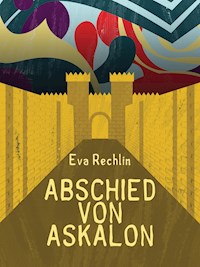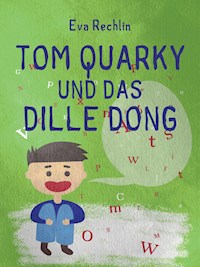Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Christof und Johanna kennen sich schon seit der Kindheit, während der die beiden glücklich miteinander gespielt hatten. Nachdem sie zusammen aufgewachsen waren, musste Christof mit 14 jedoch in eine andere Stadt ziehen. Kontakt hielten die beiden über Briefe und Postkarten, doch erst vier Jahre sehen sie sich in Person wieder. Obwohl sich beide verändert haben, sind sie mehr als glücklich sich wieder zu sehen. Doch fühlen sie nach all den Jahren möglicherweise mehr füreinander als nur Freundschaft?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Rechlin
Christof und Johanna
Saga egmont
Christof und Johanna
Copyright © 1957, 2017 Eva Rechlin og Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711754412
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Zuerst feierte Christof das Wiedersehen mit der Stadt. Vor dem Bahnhof setzte er die Koffer nieder, atmete tief, als er sich wieder aufrichtete und lächelte der vor ihm liegenden Straße zu, lächelte über ihre tausend Meter Länge hinweg dem fernen, in der Sonne wie Kiefernrinde glühenden Backsteintor zu, in das die Straße wie in einen roten Schlund einmündete. Keine zwanzig Schritt vor ihm stieß von links und rechts der Stadtwall an das Straßenpflaster, mit säulengleichen Eichen, die das Trottoir beschatteten; Teppiche von Scharbockskraut fielen sanft nieder bis an den Saum der Straße, grün und gelb ausgebreitet vor den blaßvioletten, mürben Feldsteinmauern, die den Wall begleiteten; zu beiden Seiten hinter dem Wall erstreckte sich die graue Flucht der Häuserfronten, bisweilen unterbrochen durch die sonnigen Buchten der abzweigenden Gassen, bis hin zum Tor. Rechts vor dem Wall stand ein dunkelbronzener, hoher Friedensengel, der in der erhobenen Hand einen Palmzweig hielt. Ihm gegenüber, auch in Bronze, saß überlebensgroß Fritz Reuter in einem Lehnstuhl und lächelte behaglich auf farbensprühende Blumenbeete nieder, ganz und gar „Fritzing“, wie die Stadtbewohner das Denkmal zärtlich hießen.
Vier Jahre lang hatte sich Christof nach der Stadt gesehnt, in der er geboren und aufgewachsen war – zusammen mit Johanna. Er hatte ihr den Zeitpunkt seiner Ankunft nicht geschrieben, er hatte allein ankommen wollen. Nun ging er langsam durch die lange Straße, die Last seiner Koffer nicht beachtend, immer auf das Tor an ihrem Ende zu. Mehr und mehr nahmen die weißen, pyramidengleich mit den Stufen des Treppengiebels aufsteigenden Striche Gestalt an: Elf schmale gotische Engel hielten ihre Hände zum Himmel erhoben.
Christof ging nicht bis unmittelbar an das Tor heran, hundert Meter davor etwa blieb er an der Abzweigung zur Pfaffenstraße stehen. Hier lag das städtische Krankenhaus, in dem Johannas Vater Arzt war. Die Familie wohnte gleich daneben in einem hellblau gekalkten hohen Haus mit rostrotem Fachwerkgebälk. An den Fenstern im Erdgeschoß waren zum Teil noch bleigefaßte, bunte Butzenscheiben, und man konnte das Haus unmittelbar vom Kopfsteinpflaster der Straße aus, nur über eine ausgebeulte Holzschwelle hinweg betreten. Cristof öffnete leise den rechten Flügel der breiten alten Tür und betrat den Flur. Er empfand den Eintritt in das Haus, als ginge er in eine andere Stunde des Tages, als ginge er vom überhellen Vormittag zurück in die frühe Dämmerung des Tages, in eine sanft besonnte Dämmerung, die apfelsinenrot, blaßgrün und violett durch die Butzenscheiben glomm.
Christof stellte die Koffer nieder und sah sich um. Die moosgrüne Rupfenbespannung an den Wänden gab dem rechteckigen Flur eine anheimelnde Wärme. In das obere Stockwerk führte eine weiße, mit Kokosläufern belegte Holztreppe. Hier hatte Christof mit Johanna gespielt, dreizehn Jahre lang, Tag für Tag. Sie hatten miteinander laufen und sprechen gelernt, er mit allem Können dem Mädchen meistens um das eine Jahr voraus, das er älter war. Von hier hatte er sie zu ihrem ersten Schulweg abgeholt, von hier waren sie ausgezogen, um gemeinsam schwimmen zu lernen und Indianer zu spielen, sie war Winnetou gewesen und er Old Shatterhand: deutlicher konnten sie ihre Verbundenheit nicht ausdrücken. Erst als Christof vierzehn war, hatte er seinen Eltern in eine andere Stadt folgen müssen. Aber nichts war ausgelöscht von allem, was er hier empfunden hatte – etwa die Ungeduld, mit der er so oft auf der Treppe gesessen und auf Johanna gewartet hatte, bis sie unhörbar von oben herabgeschlichen kam und ihm einen Schubs gab, daß er vornüber und aus allen Gedanken purzelte, in die er mittlerweile versunken war. Hier war fast immer der Ausgangspunkt zu ihren gemeinsamen Unternehmungen gewesen. Er erinnerte sich deutlich an die großartige Erregung vor ihren abenteuerlichen Spielen, dieses Gefühl, mit dem sich junge Vögel wieder und wieder aus ihren Nestern in den Himmel stürzen mögen. Mit der Freude auf solches Wiederfinden war er nun für ein paar Ferienwochen zurückgekehrt.
Oben wurde eine Tür geöffnet, er hörte die Stimmen von Johannas Brüdern, hörte Johannas Stimme; sie sagte: „Nein, ich weiß es wirklich nicht!”, sie sagte es mit einer Spur von Eigensinn und ging dann über den oberen Flur zur Treppe. Sie trug ein braunes Kleid mit hellen Tupfen, es erinnerte an Pfefferkuchen. Sie sah hoch und schmal aus, wie sie die Treppe herabstieg; die beiden langen Zöpfe waren weg, abgeschnitten. Oberhaupt war alles anders geworden an Johanna.
Christof blieb regungslos und stumm stehen, bis sie ihn endlich bemerkte. Sie war schon bei den unteren Stufen angelangt.
„Christof!“ rief sie erschrocken. Gleich darauf lächelte sie, freudig und verlegen, zögerte noch zwei, drei Sekunden und ging rasch auf ihn zu. Während er ihre Hand hielt, blickte er noch verwirrt auf ihr kurzgeschnittenes Haar, dann in ihre Augen und hinab bis zu ihren Füßen und wieder in ihre Augen.
„Kennst du mich nicht wieder?“ fragte sie.
„Doch. Ich hatte dich nur ganz anders in Erinnerung.“
„Ich habe dir doch zu Weihnachten ein Foto geschickt!“
„Trotzdem. Aber ich bin nicht enttäuscht“, sagte er, „ganz bestimmt nicht.“
Sie senkte den Blick und fragte: „Hast du die beiden Koffer allein hergeschleppt?“
„Ja. Was ist denn schon dabei!“
„Warum hast du auch nicht geschrieben, wann du kommst! Wir hätten dich mit dem Leiterwägelchen abholen können.“
„Nein“, sagte er, „nein. Es war sehr schön so. Und es ist auch schön, daß ich dich als erste begrüßen durfte.“
„Ja?“ Sie lachte. Er fand, daß sogar ihr Lachen anders war als früher. Auf der Herreise hatte er versucht, sich nach ihrem Foto und ihren ausführlichen Briefen ein Bild von der siebzehnjährigen Johanna zu machen. Es war ihm nicht gelungen; immer war vor seinen Augen die eigenwillige, pummelige Dreizehnjährige erstanden, wie er sie das letzte Mal gesehen hatte. Er versuchte sich insgeheim damit zu trösten, daß ihm offenbar die Zeit von vier Jahren zwischen die beiden Bilder geraten war, und er glaubte, in den vier vor ihm liegenden Wochen leicht eine Brücke von seiner Erinnerung an Johanna zu der Wiederbegegnung mit Johanna schlagen zu können, obwohl ihn im Augenblick noch das Gefühl quälte, sie durch eine gläserne Wand begrüßt zu haben. –
Am Abend desselben Tages noch ging Christof mit Johanna auf den Wallwegen um die Innenstadt. Zwar hatten die Brüder die beiden begleiten wollen, aber Johanna hatte sie abgewiesen: „Früher habt ihr unsere Gesellschaft ja auch oft genug verschmäht. Schließlich ist Christof mein ganz persönlicher Gast, und wir haben uns viel zu erzählen. Ihr habt ihm ja auch nie geschrieben, aber ich fast jede Woche.“
In der Pfaffenstraße brannten schon die drei kümmerlichen Laternen – am Eingang, in der Mitte und am Ende –, als sie das Haus verließen. Bis zum Wallweg gingen sie stumm nebeneinander her. Christof blickte an den einzelnen Häusern empor, damit Johanna sähe, daß er damit beschäftigt war, auch hier sein Wiedersehen zu feiern. Da und dort lagen in offenen Fenstern, mit den Unterarmen auf die Fensterbank gestützt, Frauen. Sie waren meistens rundlich und schienen einander zu ähneln wie ihre Fenster und ihre Häuser. Die Häuser sahen jetzt alle grau aus, die Türen wie große Mäuler, die Giebel wie spitze Stirnen. Christof wußte, daß die Frauen ihm und Johanna neugierig nachblickten; er war ganz sicher, daß sie ihn nicht für einen der Brüder hielten. Johanna balancierte mit gesenktem Kopf auf dem Kantstein des Trottoirs. Das, ja das hatte sie schon immer getan – allerdings mit erhobenem Kopf und manchmal sogar mit geschlossenen Augen, um zu beweisen, wie gut sie sich auf das Tastvermögen ihrer Füße und auf ihre Körperbeherrschung verlassen konnte. Er sah dann und wann zu ihr hin, aber sie blickte nicht auf.
Als sie den Wallweg erreichten, fragte sie: „Kennst du dich noch aus?“
„Natürlich.“
Der Weg lag wie ein aus Zweigen geflochtener Tunnel vor ihnen. Erst als der Mond höher und höher stieg, sahen sie durch die Kronen der Eichen den matt erhellten Himmel, und der Weg sah aus wie ein langer, aus Schattenornamenten und Lichtflecken gewebter Teppich. Sie gingen langsam nebeneinander her. Früher hatten sie um diese Stunde schon geschlafen.
„Wie fühlst du dich nun als soeben von der Schule Entlassener?“ fragte Johanna.
„Wie ich mich fühle? Hm – eigentlich habe ich das Bewußtsein noch nicht sehr gekostet, es ist ja noch so frisch. Vielleicht ist mir ein bißchen so, als sei ich aus dem Zuschauerraum auf die Bühne gelangt, aber bei geschlossenem Vorhang.“
„Ist das nun ein besseres Lebensgefühl?“
„Ich weiß noch nicht“, sann er laut, „ich habe mich auch noch nicht sehr dafür interessiert. Ich habe eigentlich die ganze letzte Zeit nur an diese Reise gedacht.“
„Hast du dich darauf gefreut?“
„Ja, sehr. Das habe ich dir ja auch geschrieben.“ „Ja, stimmt.“
Er dachte die ganze Zeit daran, daß sie zu den Brüdern gesagt hatte: „Wir haben uns viel zu erzählen.“
Mit derselben Vorstellung hatte er zwölf Stunden lang in der Bahn gesessen. Er erinnerte sich an alles, was er Johanna hatte erzählen wollen, wie an ein dickes Bilderbuch. Johanna hatte das vorhin nicht nur so dahingesagt; er spürte, daß sie ihn mit einem ähnlichen Bilderbuch erwartet hatte. Aber jetzt wußte weder er noch sie etwas zu erzählen. Und merkwürdig: In Christofs Bilderbuch jedenfalls waren auf einmal alle Seiten leer. Er bemühte sich sehr darum, sich wieder auf alles zu besinnen, aber ihm fiel kein Wort ein, das ihm als Wegweiser hätte dienen können. Er wußte nur noch, daß es genug gewesen war, um ein Buch damit zu füllen. Aber sonst wußte er nichts mehr, keine Zeile, kein Bild und keinen Anfang. Er dachte krampfhaft nach, woran es liegen könne und hoffte die ganze Zeit auf ein Losungswort von Johanna. Vielleicht würde alles wieder da sein, wenn sie zu sprechen begann. Aber sie schwieg auch, sie schien genau so hilflos zu sein wie er, und nicht einmal darüber konnten sie sprechen.
Endlich deutete Johanna auf eine Bank am Wegrand, und er folgte ihrer stummen Aufforderung und setzte sich neben sie. Sie saßen der Stadtmauer zugewandt, über die in dichtem Aneinander Dächer und Kamine lugten und die spitzen Türme zweier Kirchen schwarz vor glanzgesäumten Sommerwolken aufragten.
„Ich hatte alles viel größer in Erinnerung“, sagte Christof, „jetzt kommt es mir vor wie eine stehengebliebene Baukastenspielerei.“
„Das ist schön, Christof. Ich kann das natürlich nicht mit solchen Augen sehen, weil ich ja immer hier geblieben bin. Aber vielleicht bringst du es noch fertig, es mich mit neuen Augen sehen zu lehren.“ „Lieber nicht!“ sagte er schnell, „ich wäre womöglich glücklicher, wenn alles beim Alten geblieben wäre.“
„Aber es ist ja alles beim Alten geblieben! Oder nicht? Oder nicht, Christof?“
Ihre Stimme klang beinahe beschwörend.
„Sicher, Johanna. Es muß ja alles beim Alten geblieben sein.“ Er wünschte, er könnte selbst glauben, was er sagte. Johanna saß vornübergebeugt und er sah auf den Umriß ihres Nachens und ihrer Schultern; diese Linien waren ihm ungewohnt, und er versuchte, Vertrautes daran zu entdecken.
„Während der Reise“, sagte er, „habe ich mir eingebildet, ich führe heim, nach Hause – oder jedenfalls dahin, wohin ich gehöre.“
„Du gehörst doch auch hierher, Christof. Du bist hier geboren und aufgewachsen. Fühlst du dich nicht wie zu Hause?“
Er wollte sagen: „Ich hätte nicht gedacht, daß Wiedersehen und Heimkehr zweierlei sein können.“ Aber er sagte: „Es wird schon noch kommem “
Er wollte sich nicht enttäuscht fühlen, dagegen vor allem wehrte er sich; denn er wußte, daß es im Grunde trotz all des Neuartigen nichts gab, was eine Enttäuschung gerechtfertigt hätte. Womöglich lag es an ihm selbst, daß die alten Gefühle nicht wiederkehrten – lag es daran, daß er das Vertraute mit anderen Augen sah. Das Mädchen neben ihm war immer noch Johanna, sie konnte nichts anderes geworden sein, – genau so wenig, wie er etwas anderes geworden war. Aber früher hatte ihre Gemeinsamkeit ihn immer beruhigt und – diese Empfindung kam ihm erst jetzt zum Bewußtsein gewärmt, ja gewärmt, wie sich eine Hundemeute nachts aneinander wärmt. Er vermißte diese Wärme schmerzlich, jetzt ganz deutlich, und es machte ihn unglücklich zu spüren, daß es Johanna nicht anders erging, – daß sie wohl neben ihm saß, aber allein blieb wie er selbst, daß sie beide unfähig waren, den andern aus seiner Einsamkeit zu befreien, sei es nur mit einem Wort, mit einer Geste. Jeder war allein, und es war die peinigendste Art von Einsamkeit, weil sie gerade damit am wenigsten gerechnet hatten. Christof versuchte verzweifelt, jenes Wärmegefühl in sich heraufzubeschwören. Da stand Johanna auf und sagte fröstelnd: „Ich denke, wir gehen jetzt nach Hause. Es wird kühl, und du mußt auch endlich von der Reise ausschlafen.“
Er dachte nicht daran, zu schlafen. Als sie wieder zu Hause waren, schloß er sich in das ihm zugewiesene Zimmer ein und kramte Johannas Briefe, die ihm so lieb waren, aus seinem Koffer. Er griff nach dem, den sie ihm zuletzt geschrieben hatte:
Lieber Christof,
vielen Dank für Deinen letzten Brief. Zum bestandenen Examen gratuliere ich Dir nicht nur herzlich, sondern auch hochachtungsvoll. Ich werde froh sein, wenn ich das auch hinter mir habe. Ich bilde mir ein, daß mir meine sämtlichen Lehrer dann schlagartig sympathisch sein werden. Der Gedanke daran macht mich jetzt schon ganz sentimental. Denke Dir: sie haben sich so viele Jahre lang redlich mit mir abgemüht, sie haben dir sozusagen den Fußboden des Lebens gezimmert, und du hast sie dafür nur geärgert, verlacht, mißverstanden. Du hast dich nie als ihr Partner gefühlt, nie. Ich meine, als ihr Arbeitspartner. Dann wäre sicher manches besser gegangen. Das ist vielleicht mehr dein Verschulden als du weißt, weil du dir eingeredet hast – von Anfang an-, sie seien Folterknechte oder wollten dich bloß hereinlegen. So ist jedenfalls meine Einstellung … gewesen? Und nun entlassen sie dich endlich auf diesen Fußboden und du kannst darauf tun und lassen was du willst tanzen oder marschieren, ihn pflegen oder verkommen lassen, Reichtümer darauf ausbreiten oder dich selbst. Sie werden es nicht mehr sehen, nicht mehr verfolgen können. Sie zimmern schon wieder neue Fußböden. Das ist alles ein bißchen traurig. Ich vermute, ich werde zum Abschluß eine Zähre der Reue vergießen. Und in diesem Augenblick, wo ich mir das alles überlege, beschließe ich ernsthaft, sie das letzte Jahr noch ein wenig liebenswürdiger zu behandeln, – aber wer weiß, vielleicht habe ich meine guten Vorsätze morgen in der Mathematikstunde bereits wieder vergessen, wenn die Qualen wieder vorherrschen.
Ich muß dir berichten, daß Markus und Ulrich es nun tatsächlich fertig gebracht haben, sich das Geld für Fahrräder zusammenzusparen. Vater hat ihnen wohlwollend auf die Schultern geklopft, und ich sehe der Zukunft meiner Brüder zum ersten Mal mit etwas mehr Optimismus entgegen. Erinnerst Du Dich noch, wie sie anfingen, dafür zu sparen? Das war, als sie zu ihrem elften Geburtstag von Tante Jenny fünf Mark bekamen. Ich weiß noch genau, wie sie den heldenhaften Entschluß faßten, diese fünf Mark einmal nicht zu verjubeln, sondern mit ihnen den Grundstock zu einer besseren Zukunft zu legen. Diese bessere Zukunft rast nun Tag für Tag auf Rädern durch die Pfaffenstraße, und Vater hat heute beim Mittagessen sehr beziehungsvoll gesagt, er sehe zum ersten Mal voraus, wer seine beiden nächsten Patienten mit Knochenbrüchen sein würden.
Christof, ich freue mich so sehr auf Deinen Besuch. Bringe mir alle Deine Gesammelten Werke mit, von denen Du mir geschrieben hast, damit Du sie mir vorlesen kannst – oder ich sie Dir. Ich denke mir, daß man seine eigenen Gedanken und Phantasien kritischer betrachten kann, wenn man sie aus einem anderen Mund hört. Sicher schreibst Du doch alles immer stumm hin, und so wird es vielleicht ganz interessant für Dich sein, wenn es einmal ausgesprochen, wenn es hörbar, wenn es laut wird. Glaubst Du nicht?
Wenn ich an Deine Schrift denke, wird mir allerdings angst und bange. Du solltest für eine Schreibmaschine sparen. Ich habe Deine jetzige Schrift dieser Tage neben Deine von vor drei Jahren gehalten. Das war interessant. Deine jetzige Schrift ist immer noch Christof und doch nicht Christof. Ich war richtig traurig, als ich sah, daß Du früher Tintenkleckse gemacht hast und heute nicht mehr. Bist Du etwa ein braves, seriöses Bleichgesicht geworden? Früher war mehr Gestrüpp in Deiner Schrift und heute ist mehr Spalier darin. Ist das nun ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich weiß es selbst nicht. Ich bin nur sicher, daß Du selbst Dich nicht geändert haben kannst, und trotzdem bin ich neugierig auf Dich …
Christof faltete den Brief wieder und steckte ihn in das Kuvert zurück. Die Johanna dieser Briefe war dieselbe wie vor vier Jahren. Die Johanna aber, die er heute wiedergesehen hatte, erschien ihm ganz anders. Und doch hatte sie diesen Brief erst vor acht Tagen geschrieben.
*
Beim Frühstück offenbarte ihm Johanna, ohne es direkt auszusprechen, daß sie in der vergangenen Nacht in derselben Weise wie er über dieses Wiedersehen nachgedacht haben mußte. Sie allerdings schien sich nicht darin verloren zu haben, sehnsüchtig Erinnerungen heraufzubeschwören und dann hilflos zwischen ihnen und der Gegenwart stehenzubleiben. Sie hatte eine Brücke gesucht und gefunden.
„Weißt du was, Christof?“ begann sie, „wie wäre es, wenn wir unsere alte Prärie mal wieder besuchten? Ich war schon fast ein Jahr lang nicht mehr dort.“
„Und da hat sie sich“, behauptete Markus, „in die Ruine eures alten Wigwams gesetzt und ihrer Apatschen-Vergangenheit bittere Tränen nachgeweint.“
„Tu doch nicht so, als wärest du darüber erhaben!“ fuhr Johanna ihn an. „Wenn es nach mir ginge, würden wir auch heute wieder Indianer spielen.“
„Das wäre eine Idee!“ rief Ulrich.
„Ihr seid doch noch immer dieselben Rangen“, meinte Johannas Mutter und betrachtete die vier jungen Menschen mit einem etwas wehmütigen Lächeln, als zweifelte sie selbst an ihren Worten.