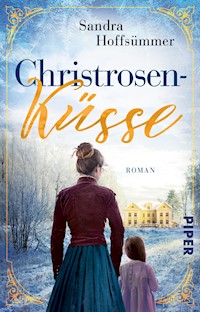
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Historischer Liebesroman mit winterlichem Flair für Leser:innen von Julia Quinn und Jane Austen »›Was macht Euch zu dem geeignetsten Kandidaten, mir die höfischen Etikette nahezubringen?‹, fragte ich. ›Ihr rebelliert dagegen.‹« England, 1853: Der Winter bricht über das Herrenhaus der Familie Roychester herein, was für das Hausmädchen Florence jede Menge Arbeit bedeutet. Ein seltsames Tagebuch, das pikante Geheimnisse der Bewohner enthält, passt da gar nicht in ihren Zeitplan. Zudem kostet sie die Sorge um ihre kleine Schwester fast die Anstellung. Als wäre das nicht genug, verdreht ihr auch noch der attraktive Adlige Elijah den Kopf, dem sie als Mitglied der Unterschicht niemals näherkommen darf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Christrosenküsse« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Ulla Mothes
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Umschlaggestaltung und Motiv: www.bookcoverstore.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1. Kapitel
Liebes Tagebuch …
2. Kapitel
Liebes Tagebuch …
3. Kapitel
Liebes Tagebuch …
4. Kapitel
Liebes Tagebuch …
5. Kapitel
Liebes Tagebuch …
6. Kapitel
Liebes Tagebuch …
7. Kapitel
Liebes Tagebuch …
8. Kapitel
Liebes Tagebuch …
9. Kapitel
Liebes Tagebuch …
10. Kapitel
Liebes Tagebuch …
11. Kapitel
Liebes Tagebuch …
12. Kapitel
Liebes Tagebuch …
13. Kapitel
Liebes Tagebuch …
14. Kapitel
Liebes Tagebuch …
15. Kapitel
Liebes Tagebuch …
16. Kapitel
Liebes Tagebuch …
17. Kapitel
Liebes Tagebuch …
18. Kapitel
Liebes Tagebuch …
19. Kapitel
Liebes Tagebuch …
20. Kapitel
Liebes Tagebuch …
21. Kapitel
Liebes Tagebuch …
22. Kapitel
Liebes Tagebuch …
23. Kapitel
Liebes Tagebuch …
24. Kapitel
Liebes Tagebuch …
25. Kapitel
Liebes Tagebuch …
26. Kapitel
Liebes Tagebuch …
27. Kapitel
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1. Kapitel
Was tat man nicht alles für die Familie? Was tat man nicht alles, um jene zu schützen, die man liebte? In meinem Fall war es Tag für Tag die Zähne zusammenzubeißen, den Kopf einzuziehen und die eigenen Wünsche hintanzustellen.
Denn Träume und Wünsche, ja, die hatte ich. Eine eigene kleine Familie – eine, die über meine kleine Schwester hinausging. Eigene Kinder vielleicht. Meinen Prinzen auf dem weißen Pferd.
Leider schien all dies so weit entfernt wie jedes Ende meiner Arbeitstage, wenn ich mich noch müde vom letzten Tag morgens von meinem harten Lager erhob. Wenigstens kam ich nicht ins Grübeln. Mir blieb schlichtweg keine Zeit nachzudenken, und auch jetzt beeilte ich mich, den schweren Korb Wäsche aufzunehmen und die schmale Stiege in den zweiten Stock zu erklimmen, um dort das Bett für den Viscount und seine Frau frisch zu beziehen. Mrs Webster würde schimpfen, wenn die Herrschaften ankämen und noch nicht alles nach ihren Wünschen wäre.
Auf leisen Sohlen huschte ich also durch die Dienstbotentür, nicht ohne vorher sicherzustellen, dass der Flur dahinter leer war. Das war unser oberstes Gebot und meiner Schwester und mir noch vor unserer Anstellung eingetrichtert worden. Ich konnte die strenge Haushälterin hören, als stünde sie neben mir: »Die Herrschaften wünschen Diskretion. Vermeidet es, ihnen aufzufallen und alles ist gut. Höre ich Beschwerden –« Den Rest des Satzes hatte sie in der Luft hängen lassen, allerdings hatte ihr Blick auf meine Schwester vollkommen genügt. Hörte sie Beschwerden, würden wir erneut auf der Straße landen und wären in den schützenden Wänden des Calcott Hauses nicht länger willkommen. Und diese Anstellung zu finden war bereits pures Glück gewesen.
Das Zimmer des Viscounts war wie erwartet leer und ich beeilte mich, die Vorhänge aufzuziehen und die abgestandene Luft aus den Fenstern hinaus auf die Ländereien zu entlassen. Kälte drang herein, trug den Geruch von Schnee mit sich, der sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Hier draußen, außerhalb der schmutzigen Straßen Londons, brach der Winter früher an.
Ich riss meinen Blick von den Wiesen und Feldern los und wandte mich mit einem Seufzen meiner Arbeit zu. Die Möbel waren bereits von Staub befreit, der dicke Teppich auf dem Fußboden ausgeklopft. Nur das Bettzeug fehlte noch. Nach wie vor ein wenig ungeschickt – denn die Handgriffe waren mir bei den schweren Decken noch zu fremd – schlug ich das Oberbett über dem Sims aus, ehe ich es bezog. Den Kissen ließ ich die gleiche Behandlung zukommen, strich Falten glatt und besah mir mein Werk mit kritischem Blick. Mrs Webster selbst würde meine Arbeit zwar nicht beurteilen, aber Mrs Beaton, die nächste in der Hierarchie der Dienerschaft, konnte im Zweifel über mein Schicksal entscheiden. Und wenn ich eins in den wenigen Wochen, die ich jetzt hier arbeitete, über die oberste Hausdame gelernt hatte, dann wie perfektionistisch sie war. Der kleine Edward Davis hatte schon für einen harmlosen Fleck auf den frisch polierten Schuhen der Lady sein Frühstück verwehrt bekommen. Niemand hatte es gewagt, ihm etwas abzugeben.
Ich zupfte eine verirrte Feder vom Bett, kniff die Augen noch ein letztes Mal zusammen und befand, dass Mrs Beaton sicherlich nichts auszusetzen haben würde.
Ebenso leise wie zuvor huschte ich kurz darauf mit meinem nun leeren Wäschekorb den Flur hinunter und durch die unscheinbare Tür zurück in das Treppenhaus, das nur für uns Angestellte bestimmt war. Der Luftzug meines Rocks brachte die kleine Flamme der Kerze in der Halterung an der Wand zum Flackern und hastig hielt ich eine Hand davor, um sie vor dem Erlöschen zu retten. Ohne sie wäre es auf der Stiege finster wie zur Geisterstunde, wenn der Mond von Wolken verdeckt am Himmel stand. Und der Dunkelheit war ich nie besonders zugeneigt gewesen.
Vermutlich wäre ich in jener auch kurz darauf zu Tode erschrocken. Ein Rumpeln, dann wurde einige Stufen über mir eine Tür aufgerissen und das Licht aus dem Raum dahinter beleuchtete für den Bruchteil einer Sekunde eine Gestalt. Ich konnte einen leisen Schrei nicht verhindern, mit dem meine Hand ans Herz flog. Wer auch immer es war, trug einen Mantel und hatte die Kapuze tief in die Stirn gezogen. Kurz überlegte ich noch, ob es sich um einen der Kammerdiener handeln könnte, die ich nur alle Jubeljahre einmal sah.
Doch weder würde einer von ihnen sich vermummen noch rücksichtslos an mir vorbeidrängen, sodass mein Wäschekorb einige Stufen hinabpolterte und dort umgekehrt liegen blieb. Das gezischte »Aus dem Weg« hallte in meinen Ohren nach.
Nach einer Schrecksekunde rappelte ich mich stirnrunzelnd auf, ohne dem Korb zunächst weitere Beachtung zu schenken. Die Herrschaften sollten unten im Salon beim Frühstück sitzen, eine Mahlzeit, die dank Lady Calcotts resoluter Art weder ihr Mann noch eines ihrer Kinder für gewöhnlich ausließ. Sie bestand auf diese Zusammenkünfte und forderte selbst die Anwesenheit ihres jüngsten Sohns, der sich aufgrund seines zarten Alters stets unter der Aufsicht seiner Gouvernante befand. Wie wahrscheinlich war es also, dass einer von ihnen sich in der Bibliothek aufgehalten hatte? Denn ich war mir fast sicher, dass die Gestalt aus dieser gekommen war – so ganz verinnerlicht hatte ich den Grundriss des Anwesens leider noch nicht.
Mein nächster Gedanke galt Dieben. Einige Ausläufer des Waldes grenzten draußen an die Koppeln und durch die Stallungen käme man mühelos ins Haus. Der Earl of Calcott war nicht unvermögend, um es vorsichtig auszudrücken. Einige der Schriften in der Bibliothek würden den ein oder anderen Mann der Wissenschaft vor Neid erblassen lassen – hatte zumindest Lizzy, eines der Küchenmädchen, mit aufmerksamkeitsheischender Stimme in einem ihrer Anfälle von Besserwisserei erzählt. Dass sie weder die Fähigkeiten zu lesen noch zu schreiben besaß und darüber hinaus nicht mit der Raffinesse ihres Geistes brillieren konnte, hielt sie selten davon ab, so zu agieren, als wäre sie uns anderen überlegen.
Unweigerlich sah ich der Gestalt hinterher, wenngleich sie natürlich längst verschwunden war. Sonderlich groß war sie nicht gewesen, doch anders, als ich mir Delinquenten vorstellte, hatte ihr kein Geruch nach menschlichen Ausdünstungen angehaftet. Stattdessen hatte die Person eine flüchtige Note von Orangenblüten und Jasmin verströmt. Ein exquisiter Damenduft. Doch welch Frevel sollte eine Frau dazu treiben, über die Dienstbotentreppe die Flucht zu suchen?
Sollte ich nachsehen?
Vermutlich. Wenn etwas zerstört worden war, musste ich den Schaden melden. Außerdem war das Poltern recht laut gewesen. Was, wenn jemand verletzt war? Ich konnte nicht einfach so tun, als sei nichts gewesen.
Schicksalsergeben sammelte ich den Korb ein, dann stieg ich die paar Stufen zu der Tür hinauf, durch die der Eindringling gekommen war. Wie immer legte ich erst mein Ohr dagegen, dann öffnete ich sie einen Spalt, doch als ich niemanden erspähen konnte, trat ich zögerlich hindurch.
Ich befand mich in der Tat in der Bibliothek des Hauses. Der Dienstboteneingang lag hinter einem Regal voller Bücher. Da ich bezweifelte, den Mechanismus zum Öffnen so einfach wiederzufinden, stellte ich vorsichtshalber den Weidenkorb dazwischen, um mir im Zweifel meinen Fluchtweg zu sichern.
Auf den ersten Blick war keine Zerstörung zu erkennen. Zaghaft spähte ich in die angrenzenden Flure, doch auch dort hielt sich niemand auf. Keine gestürzte Person, der man zur Hilfe hätte eilen müssen. Also konzentrierte ich mich auf meine nähere Umgebung. Staunend sah ich mich um, betrachtete die zahllosen Werke, von denen in der Tat so ziemlich jedes einzelne wertvoll genug aussah, um meine Schwester und mich über den Winter zu bringen.
Natürlich kannte ich mich nicht aus.
Als ich noch klein gewesen war, hatte mein Vater mir zwar das Lesen beigebracht, aber meine Lektüre hatte sich auf zwei einzelne, abgegriffene Bücher beschränkt, deren Seiten am seidenen Faden hingen. Es waren gesammelte Märchen gewesen, die ich irgendwann auswendig gekannt hatte, womit sich der Lernerfolg beim Lesen zusehends reduziert hatte.
Hier reihte sich Shakespeare an Keats und Defoe, nach einer Ordnung, die sich mir nicht erschloss. Ich bewunderte sie für die Arbeit, welche sie offensichtlich in die Niederschrift ihrer Gedanken gesteckt hatten. Es juckte mich in den Fingern, eins der Bücher von seinem Platz zu nehmen und an einem der Lesepulte aufzuschlagen, um die Seiten bis spät in die Nacht hinein zu studieren. Irgendwann würde ich eine neue Kerze benötigen, doch auch diese könnte ich mir holen.
Mit aufeinandergepressten Lippen wandte ich mich ab, verabschiedete mich von dem Traum, der ja doch nicht in Erfüllung gehen würde. Stundenlanges Lesen blieb den Geistlichen und dem Adel vorbehalten, die sich den Lohn für Menschen wie mich leisten konnten, damit ihnen Zeit für Kunst und Kultur blieb.
Eiligen Schrittes lief ich an der Wand entlang, hinter der sich die Dienstbotentreppe befand. Was auch immer ich gehört hatte, konnte nicht allzu weit entfernt gewesen sein. Und tatsächlich entdeckte ich vor dem offenen Kamin eine umgestürzte Leiter. Sehr zu meiner Erleichterung war sie unversehrt. Wieso auch immer sie hier gestanden hatte und nicht drüben an den Regalen, wo sie zweckdienlich hingehörte. Obwohl sie etwas unhandlich war, richtete ich sie mühelos auf und schaute mich nach weiteren Missgeschicken um.
Gerade als ich mich abwenden wollte, fiel mir seitlich neben dem Rost der Feuerstelle ein roter Fleck ins Auge. Unbehaglich sah ich über meine Schulter, um mich zu versichern, dass ich nach wie vor allein war. Bis auf einen ausgestopften Fuchs im Regal war ich unbeobachtet. Er hatte den Kopf auf die Pfoten gelegt und starrte mich aus seinen Glasaugen an. Nur das leise Knacken des Feuers drang an meine Ohren.
Also raffte ich meine Röcke zusammen und bückte mich. Ich musste aufpassen, mich nicht zu verbrennen, als ich mit spitzen Fingern nach dem Objekt angelte. Es war ein Buch. Mit gerunzelter Stirn wischte ich den Einband am Stoff meiner Schürze ab. Es stand kein Titel darauf. Kein Autor. Aber das Aussehen des Büchleins ließ darauf schließen, dass es viel angefasst und dabei nicht unbedingt immer pfleglich behandelt wurde. Schon der Ort, an dem es gelegen hatte, erweckte den Eindruck, als habe man es in höchster Hast dort hineingestopft. Es hätte verbrennen können. Ein Funken des Feuers hätte genügt.
Oder vielleicht war genau dies beabsichtigt?
Aufregung erfasste mich. Mein Herz begann wild zu pochen. »Welches Wissen verbirgst du?«, murmelte ich und zuckte beim Klang meiner eigenen Stimme zusammen. Es war gedankenlos, hier mit mir selbst zu sprechen und so eventuell auf mich aufmerksam zu machen. Ich wurde fürs Arbeiten bezahlt, nicht fürs Herumhocken.
Verstohlen kontrollierte ich meine nähere Umgebung. Niemand in Hör- oder Sichtweite. Mein Glück. Die Neugierde siegte. Ich sank auf die Knie und klappte den Buchdeckel auf.
Die verschmierte Zeichnung eines Schlittens mit vierbeinigen Kreaturen als Zugtiere begrüßte mich. Sie trugen unförmige Geweihe, und ohne die Erzählungen meines Vaters hätte ich wohl nicht geahnt, dass es sich bei ihnen um Rentiere handeln sollte. Dennoch waren sie liebevoll gezeichnet, wenngleich dem Urheber jedwedes künstlerische Talent abging.
Ich verkniff mir ein Schmunzeln, fuhr mit dem Zeigefinger über die dunklen Linien und ließ mich etwas bequemer auf dem Boden nieder, ehe ich zur nächsten Seite umblätterte. Hier fand ich endlich Text. Handschriftlich mit Kohle verfasst, die Buchstaben mal klein, mal groß. Es kostete mich einige Sekunden, bis ich den Anfang entziffert hatte. »Liebes Tagebuch«, las ich mir die Worte im Flüsterton vor. »Am Hof des Winterkönigs gibt es unzählige Zimmer. Eines schöner als das andere. Feen und Zwerge wandeln auf seinen Fluren, arbeiten unter dem strengen Blick der Elfenoberin.«
Feen und Zwerge? Ich wurde ganz aufgeregt und fasste unwillkürlich die nähere Umgebung ins Auge. So lange war ich noch nicht hier. Dieses Haus war alt. Der Boden, obwohl stetig und gründlich durch Bedienstete wie mich poliert, krumm und abgelaufen. Ich kannte die Geschichten, hatte immer geglaubt, dass hinter meinen gesammelten Märchen ein Körnchen Wahrheit stecken musste. Konnte es sein, dass es eine Fee gewesen war, mit der ich eben auf der Treppe zusammengestoßen war?
Ich dachte an das diffuse Knarren, das mich in den ersten Nächten wachgehalten hatte. Konnte es von jenen Wesen verursacht werden, von denen auf diesen Seiten die Rede war? Erklärte sich durch sie das rätselhafte Verschwinden von Strümpfen oder wenn Gegenstände an anderen Orten auftauchten, als man sie zurückgelassen hatte?
Stirnrunzelnd lenkte ich meine Aufmerksamkeit zurück auf die Seite, suchte die Stelle, an der ich zuletzt gewesen war, und las weiter. Sie erlauben sich keine Fehler. Ich selbst –
Ein Knarren hinter mir ließ mich zusammenfahren. Mein Herz setzte einen Schlag aus, ehe es im Eiltempo zu galoppieren begann. Schweiß brach mir aus, als ich das Buch mit zittrigen Fingern und ohne Rücksicht auf Verluste an seinen Platz zurückstopfte. Ich biss die Zähne zusammen, weil ich in meiner Hast gegen das heiße Eisen stieß und mir die Fingerkuppe versengte.
Ohne das brennende Pochen weiter zu beachten, rappelte ich mich auf. Ich hatte in meinem Leben weit schlimmere Verletzungen davongetragen. Diese war nicht die erste und würde sicherlich auch nicht die letzte bleiben. Gerade zählte für mich nur, dass ich hier fortkam. Vergessen waren alle Gedanken an übernatürliche Wesen. Mrs Websters warnende Worte klangen mir in den Ohren, sobald ich das Knarren in der Tat als Schritte identifizierte. Sie waren langsam und bedächtig. Ein anderer Bediensteter würde niemals die Ruhe dafür aufbringen, wir waren alle im Stress. Jeder von uns hatte seine Aufgaben, und im Regelfall – mich in diesem Falle einmal ausgenommen – nahmen wir uns selten die Zeit für persönliche Minuten.
Im besten Fall war es ein Zwerg, der mich entdeckte. Im schlimmsten Fall gehörten die Schritte zu jemandem, der unmittelbaren Einfluss auf meine Anstellung besaß.
Ich versenkte die Hände im Stoff meiner Röcke, beeilte mich, zurück zum Dienstboteneingang zu kommen. Leider war mir das Glück am heutigen Tage nicht gewogen. Denn als ich innehielt und vorsichtshalber lauschte, damit ich der Person nicht direkt vor die Füße stolperte, meinte ich, ihr näher gekommen zu sein. Ein undefinierbares Geräusch drang an meine Ohren. War es ein Schluchzen?
Gar nicht gut.
Niemand mochte es, wenn man ihn in einem schwachen Augenblick erwischte. Ich selbst hasste es. Einzig Betty, meiner kleinen Schwester, konnte ich nicht böse sein, wenn sie sich in solchen Momenten zu mir schlich.
Ich befeuchtete meine Lippen mit der Zungenspitze, warf einen sehnsüchtigen Blick dorthin, wo ich hereingekommen war. Wohl oder übel musste ich mich damit abfinden, nicht einfach dort verschwinden zu können. Daher entschied ich mich für die einzige Alternative, die mir blieb.
Am liebsten hätte ich mir für den Weg über die polierten Dielen die Schuhe ausgezogen. Die Sohlen quietschten beim Laufen, ein Geräusch, das mir in der Stille der Bibliothek ohrenbetäubend vorkam. Mein Puls raste mir in den Ohren. Es war ein Wunder, dass Mrs Webster sich darüber Gehör verschaffen konnte. »Die Herrschaften wünschen Diskretion.«
Die Panik, die mir bei dem Gedanken durch die Glieder fuhr, wer auch immer dort war, könnte um die Ecke treten, schnürte mir die Kehle zu. Unweigerlich würde er mich entdecken und sich vermutlich gestört fühlen. Die Vorstellung hielt mich derartig gefangen, dass ich der Schönheit um mich herum keine weitere Aufmerksamkeit schenkte. Buchregal um Buchregal zog an mir vorbei, bis ich endlich vor der Tür stand, die mich am anderen Ende aus der Bibliothek hinausführen würde.
Vor Erleichterung traten mir Tränen in die Augen, und erst als mir die Luft in einem langen Atemzug entwich, merkte ich, dass ich sie angehalten hatte. Nach wie vor so leise wie möglich drückte ich die Klinke hinab und schlüpfte durch den schmalen Spalt hinaus auf den Flur.
Wo ich erst so richtig ins Schlamassel geriet.
Liebes Tagebuch …
Hoffentlich fängt es bald an zu schneien. Ich liebe Schnee. Man kann die Flocken mit den Händen fangen. Wenn sie richtig kalt sind, behalten sie ihre Form lange genug, damit man sie betrachten kann.
Der Schneemann hat meinen Wunsch leider nicht gehört. Vielleicht ist er auch einfach zu früh aus seiner Heimat aufgebrochen, um ihn zu erfüllen. Doch dort, wo er herkommt, muss es viel Schnee geben. Ich habe es gesehen. Seine Mütze war ganz pudrig. Zu gern würde ich sein Land einmal sehen. Doch ich weiß, dass das nicht möglich ist.
Er hat einen Freund mitgebracht. Sie sind gemeinsam vom Schlitten mit den Rentieren gestiegen. Der andere wirkte sehr freundlich. Er hat einem der Rentiere über den Hals gestrichen und dabei gelacht. Natürlich habe ich mich versteckt. Sie dürfen meiner nicht gewahr werden. Das haben sie mir eingeschärft. Die Feen und Zwerge müssen sich vor ihnen verborgen halten, die Gnomen und Wichtel müssen sich unsichtbar machen.
Aber das beherrsche ich.
Seitdem die Elfenoberin mir meine Aufgabe gezeigt hat, hat sich niemand an mir gestört. So soll es bleiben. Ich will die Zuckerfee nicht enttäuschen.
2. Kapitel
Ausweichen oder Verstecken war nicht mehr möglich. Es sei denn, ich sprang hinter die opulente Blumenvase neben mir. Da ich jedoch leider bezweifelte, spontan schrumpfen zu können und ich die Konsequenz – verschüttetes Wasser quer über die Dielen, weil ich nicht in den Spalt passte – leider selbst würde bereinigen dürfen, verscheuchte ich diesen Einfall.
Die beiden Herren befanden sich nahe dem Fenster. In einen erkannte ich sofort den ältesten Sprössling meines Dienstherrn. William Henry Roychester, der Viscount Feyrton. Er war unverkennbar. Sein rotblondes, ordentlich gescheiteltes Haar verriet ihn. Die Fliege um seinen Hals war gelockert. Er lehnte halb am Fenstersturz, die Beine überschlagen und musterte mich mit einem Anflug von Überraschung. »… dass du mir unbedingt alles über diesen neuen Dozenten berichten musst«, beendete er seinen Satz. Dabei blieb eine fragende Stille zurück.
Ich sollte wohl aus Ermangelung irgendwelcher Alternativen sofort den Blick senken. Mich abwenden. Mich der abwegigen Hoffnung hingeben, der Boden würde sich auftun und mir Obhut gewähren.
Doch wie war das mit dem Reiz des Verbotenen? Mit dem Kind, dem man eine Dose Plätzchen vor die Nase stellte, die es nicht essen durfte? Betty war das perfekte Beispiel dafür. Wann immer ich versucht hatte, ihr Herumstreunen zu ihrem eigenen Wohl zu unterbinden, war es nur schlimmer geworden.
Gerade in diesem Augenblick verstand ich sie. Wie hätte ich dem zweiten Mann meine Aufmerksamkeit versagen können, wo er keine drei Schritte von mir entfernt war? Da ich seinen Blick doch so überdeutlich auf mir spürte?
Er saß auf dem Fenstersims, seine Füße baumelten herab. Kräftige Arme ragten unter hochgekrempelten Hemdsärmeln hervor, die Weste darüber trug er offen. Das Halstuch musste er sich kürzlich abgebunden haben, denn er hielt es in Händen. Stechend intelligente Augen fingen meinen Blick, hielten ihn, obwohl alles in mir schrie, dass ich endlich aufhören musste, mich wie eine Närrin zu verhalten.
Sonnenlicht fing sich in seinem dunklen Haar und ließ es glänzen. Es musste fast so schwarz sein wie mein eigenes. Eine Narbe teilte seine rechte Braue. Sie sah aus wie eine verheilte Schnittverletzung.
Verdammt Florence, das hier könnte dich deine Stellung kosten!
Der Gedanke katapultierte mich unsanft zurück in die Gegenwart. Ich biss mir auf die Innenseite meiner Wange, um mich zu sammeln. Wie musste ich mich jetzt verhalten? Was war angemessen? Musste ich etwas sagen? Sollte ich mich entschuldigen?
Ich entschied mich dagegen. In erster Linie, weil ich meiner Stimme nicht weit genug über den Weg traute, dass sie nicht brechen würde. Im schlimmsten Fall würde mir gar kein Ton über die Lippen kommen. Kurzentschlossen knickste ich, zog den Kopf ein und wollte mich gerade abwenden, als –
»Ich würde meinen, wir wurden uns bislang nicht vorgestellt.«
Mir wurde flau im Magen. Ich presste mir eine Hand gegen den Bauch. Das enge Korsett schnürte mir die Luft ab. »Verzeihung, Sir?« Natürlich musste ich mich räuspern. Und natürlich klangen diese zwei Wörter wie die Laute einer Maus.
»Dein Name. Ich würde gern deinen Namen erfahren.«
Sein Tonfall ließ nicht erahnen, welches Interesse er mit der Frage verfolgte. Der tiefe Bariton ging mir durch und durch und löste ein Gefühl in mir aus, das ich noch nie zuvor wahrgenommen hatte. Mein schlimmster Albtraum wurde wahr. Ich senkte den Kopf noch etwas weiter, um die aufquellenden Tränen zu verbergen, die sich durch ein stetiges Kribbeln in der Nase ankündigten.
»Mein Name … mein Name ist Flo.« Dabei klammerte ich die Finger fest in den Stoff meines Rocks. Am liebsten hätte ich die Arme um mich geschlungen. Was tat ich jetzt? Würden sie Betty erlauben zu bleiben? Es kam mir schäbig vor, aber ohne sie würde ich es schneller zurück nach London schaffen, und vielleicht würde es mir gelingen, für ein paar Pence bei den Waschfrauen anzuheuern. Oder ich musste in eins der Arbeitshäuser. Allein die Vorstellung dessen ließ mich erzittern.
»Flo. Ist dies dein vollständiger Name?« Das abrupte Geräusch von Schuhen, die auf Parkett landeten. Es musste der Freund des Viscounts sein, der gerade von der Fensterbank gesprungen war. »Es klingt wie eine Abkürzung.«
»Das ist richtig, Sir.« Ich schluckte angestrengt und beschloss, dass sowieso bereits Hopfen und Malz verloren waren. Dieses Gespräch dürfte überhaupt nicht stattfinden. Ich hätte die Bibliothek gar nicht erst betreten dürfen, hätte einfach den Wäschekorb nehmen und zurück an die Arbeit gehen sollen. Jetzt sollte ich meinen Rauswurf wenigstens mit Würde akzeptieren. Also hob ich den Kopf, erwiderte den Blick mit einer Ruhe und Standfestigkeit, die ich eigentlich nicht verspürte. »Es ist eine Abkürzung von Florence.«
Der Dunkelhaarige nickte und sah über die Schulter hinweg zu Lord Feyrton. Der kurze Augenblick, in dem er mich aus seinem Fokus entließ, bescherte mir eine Atempause. Sie dauerte genau so lange an, bis er das Wort ergriff. Was beinahe sofort war. »Mir hat sich noch nie erschlossen, wieso die Namen der Diener durch Abkürzungen verunstaltet werden.«
Der Viscount zuckte die Achseln. Seine Miene offenbarte einen Ausdruck der Langeweile, als er sich einen nicht existenten Fussel von der karierten Hose strich. Sobald er den Mund öffnete, ahnte ich, dass er etwas Herablassendes sagen würde.
Leider war meine Zunge schneller als mein Verstand. »Weil es einfacher ist, Sir.« Kaum war mir der Satz entschlüpft, hätte ich mir am liebsten die Hand vor den Mund geschlagen. Wenn ich dachte, es ging nicht schlimmer, kam von irgendwo mein lockeres Mundwerk daher. Die Frage war nicht an mich gerichtet gewesen und somit hätte es nicht an mir sein dürfen, sie zu beantworten. Das wusste ich. Rasch schob ich eine Entschuldigung hinterher. »Es tut mir leid, Sir. Ich wollte Euch nicht ins Wort fallen.«
Schweigen antwortete mir.
Mir wurde bang, und der Wunsch, mich einfach umzudrehen und zu verschwinden, wuchs und wuchs. Weitere Entschuldigungen lagen mir auf der Zunge. Ich sprach keine davon aus. Dass die Miene des Dunkelhaarigen undeutbar blieb, trug wahrlich nicht zu meiner Beruhigung bei.
Wer er wohl war? Es bestand durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zum Earl of Calcott, stellte ich fest. Besonders der Zug um seine Lippen und das Grübchen an seinem Kinn. Ich konnte nicht ausschließen, dass er des Viscounts Bruder war. Immerhin arbeitete ich längst nicht lange genug hier, um alle Familienmitglieder zu kennen.
Zu meiner großen Erleichterung beschlossen die beiden Männer nach einigen schweigsamen Sekunden, über meinen Einwurf hinwegzusehen. Der Viscount sprach zuerst und beantwortete damit meine unausgesprochene Frage: »Pass auf, dass du Mutter gegenüber keine dieser Allüren äußerst, Elijah. Sie könnte recht –«
»Wenig erbaut sein, ich weiß.« Ein düsteres Lächeln legte sich über Elijahs Züge, und er wandte den Blick mir zu, als könne er es nicht ertragen, den anderen Mann länger anzusehen. »Nun, Florence, ich bin sehr erfreut darüber, deine Bekanntschaft gemacht zu haben.« Er streckte eine Hand aus und unweigerlich spannte ich mich an. Meine Augen weiteten sich. Unmöglich konnte er –
Ob er meinen Schrecken nun bemerkt und richtig interpretiert hatte oder nicht, er überlegte es sich anders. Die Hand mit dem silbernen Ring daran sank herab, zur Faust geballt.
»Sicher halten wir dich von der Arbeit ab.« Ein nachlässiges Wedeln mit der Hand und ich war entlassen. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
Hastig, ehe er es sich anders überlegen konnte, knickste ich und wandte mich ab. Meinen Rock hob ich ein wenig vom Boden, damit ich nicht über den Saum stolperte. Das fehlte mir gerade noch – ein Sturz vor ihren Augen. Sie würden mich für ungeschickt halten und die Milde, die sie trotz meiner wiederholten Verstöße gegen die Etikette hatten walten lassen, wäre dahin. Denn wer wollte ein Dienstmädchen, in dessen Reichweite sämtliche Gegenstände Gefahr liefen, zu Bruch zu gehen?
»Manchmal glaube ich, dir bekommt das Studentenleben nicht besonders, Bruderherz«, hörte ich den Viscount noch sagen, kurz bevor ich um die Ecke bog. Falls Elijah antwortete, tat er es so leise, dass es nicht bis zu mir drang.
Es fiel mir schwer, nach diesem Zwischenfall wieder an meine Arbeit zurückzukehren. Meine Konzentration wollte mir immer wieder entgleiten und nachlässig, wie ich war, hätte es mich nicht gewundert, wenn ich am Ende des Tages mindestens eins der teuren Trinkgläser aus der Vitrine im Salon auf dem Gewissen gehabt hätte. Doch wie durch ein Wunder blieb jedes einzelne davon heil und fand entstaubt und poliert den Weg zurück an seinen angestammten Platz.
Margaret, genannt Peggy und das zweite Hausmädchen im Calcott’schen Haus, in deren Gesellschaft ich den gesamten Nachmittag verbrachte, entging meine Zerstreutheit völlig. Sie plapperte munter vor sich hin, während wir nach dem Abendessen das Geschirr im Esszimmer einsammelten, und war vollkommen zufrieden mit meinen nur gelegentlich eingestreuten Lauten der Zustimmung.
Lediglich die Information, dass Lady Alice, die einzige Tochter des Earls of Calcott, beim Frühstück mit Abwesenheit geglänzt hatte, ließ mich kurz aufhorchen. Vermutlich war sie es also gewesen, um deren unfreiwillige Bekanntschaft ich knapp herumgekommen war, nur um dann den beiden ältesten Söhnen in die Arme zu stolpern. Peggys beiläufigem Kommentar nach zu schließen, war Lady Calcott über das Fehlen ihrer Tochter nicht erfreut gewesen, habe es jedoch mit stoischer Miene ertragen und kein Wort darüber verloren.
Blieb die Frage, wem ich im Flur begegnet war. Wirklich einer Fee? Oder konnte es sich um den kleinen Edward Davis gehandelt haben? Hatte er ebenso wie ich Reißaus genommen, weil er Lady Alice’ Schluchzen vernommen hatte?
»Hach, was würde ich dafür geben, einen Tag lang wie sie zu sein«, sagte Peggy, als auch der letzte Teller ordentlich gestapelt im Speiselift stand, und riss mich damit aus meiner ziellosen Grübelei. Achtsam strich ich die letzten Falten der cremefarbenen Tischdecke glatt, die wir soeben gegen die alte getauscht hatten. Ich musste nicht fragen, wen sie mit sie meinte. Mir war klar, dass Peggy auf unsere Lohngeber anspielte. Sie drehte sich um die eigene Achse und umfasste in einer Geste mit weit ausgestreckten Armen den gesamten Salon mit seinen Stuckverzierungen, edlen Teppichen und Gemälden. »Dann würde ich den ganzen Tag nur herumsitzen und tun und lassen, was ich für richtig erachte.«
Ich lächelte verhalten. »Sie würden dich als alte Jungfer betiteln.«
»Das tun sie doch auch so.« Peggy wandte sich zu mir um. Ihre Wangen hatten einen Hauch Farbe bekommen, doch ich kannte sie bereits gut genug, um es nicht als Verlegenheit oder Ärger ob meiner Anspielung auf ihr Alter fehlzudeuten. Vielmehr war es dieser Ausdruck, den sie immer bekam, wenn jemand auf ihre Frivolität anspielte. Das Hausmädchen war zehn Jahre älter als ich und betonte immer wieder, wie wenig sie von gesellschaftlichen Normen und Konventionen hielt. Für sie bedeutete ihre Arbeitsstelle im Calcott’schen Haus eine unvergleichbare Freiheit, die sie nicht wie so viele vor ihr durch eine Heirat aufgeben würde. »Aber schau –« Theatralisch wedelte sie mit der Hand, streckte den Rücken durch und reckte das Kinn. Dabei tat sie einige tänzelnde Schritte durch den Raum. »Wenn ich eine von ihnen wäre, würde ich mich jetzt hier hinsetzen, um meine schmerzenden Beine von mir zu strecken.«
»Deine Beine würden kaum schmerzen«, kommentierte ich und wackelte selbst ein wenig auf der Stelle herum. Ich wusste, von welchem Schmerz sie sprach. In meinen ersten Tagen hier hatte ich mich in den frühen Morgenstunden kaum rühren können, zu sehr ziepten meine Glieder und protestierten gegen jede Bewegung. Im Laufe der Zeit war es besser geworden, und doch würde ich mir nachher die Füße massieren müssen, um morgen nicht das Gefühl zu haben, in Nagelschuhen zu laufen. Eigentlich ein Grund mehr, uns mit der Arbeit ranzuhalten. Bevor wir zu Bett gingen, mussten wir noch eine Handvoll Aufgaben erfüllen, die uns sicher mindestens zwei Stunden in Atem halten würden.
Doch Peggy machte keine Anstalten, ihr kleines Schauspiel zu beenden. Stattdessen ließ sie ihren Worten von zuvor Taten folgen, indem sie sich auf den Platz der Lady Calcott niederließ. Sie tat es anmutig und voller Eleganz. »Ich würde mit diesem Glöckchen hier klingeln.« Eine Hand gehoben, schüttelte sie es imaginär und tat, als lausche sie seinem Klang hinterher. »Und alle würden kommen, um mir jeden Wunsch von den Augen abzulesen.«
»Du solltest das nicht tun.« Unbehaglich warf ich einen Blick zur Tür, die lediglich angelehnt war und durch die jederzeit jemand hereinkommen konnte. Bei meiner heutigen Glückssträhne wäre es garantiert wieder der Viscount, um auch ja sicherzugehen, dass er sich dieses Mal wirklich gestört fühlte. Oder der andere. Elijah. Um das Schaudern, das mich beim Gedanken an den Vormittag überlief, zu überspielen, sagte ich: »Wir sollten hinunter in die Küche gehen.«
»Das sollten wir«, verkündete Peggy mit einem Seufzen, lehnte sich konträr dazu jedoch in ihrem Stuhl zurück. Dabei löste sie ihr Häubchen so weit, dass es ihr auf die Schultern rutschte und ihr Haar mit den einzelnen grauen Strähnen enthüllte. »Du bist immer so ernst, Flo.«
»Manchmal ist es mir ein Rätsel, wie du deine Stelle so lange behalten konntest«, murmelte ich trocken und verharrte steif an meiner Position nahe der Tür. Wie war das? Wir hatten selten Zeit für uns? Nun, Peggy demonstrierte gerade das Gegenteil.
Sie lachte. »Tränen, Schweiß und viel harte Arbeit.« Dann zupfte sie an einer der grauen Strähnen. »Die hier habe ich nicht grundlos. Aber Mrs Beaton mag mich und schätzt meine Qualitäten. Sie weiß, dass wir auch nur Menschen sind.«
Das wagte ich ernsthaft zu bezweifeln. Denn war es nicht eine elementare Eigenschaft des Menschseins, Fehler zu machen? Eben jene Fehler, von denen jeder der Angestellten fürchtete, sie zu begehen?
Meine Zweifel standen mir offenbar ins Gesicht geschrieben, denn Peggy zuckte unbekümmert die Schultern. »Schau, sie hat ein weiches Herz. Oder wieso glaubst du, wurde deine Schwester mit dir eingestellt?«
»Diese Entscheidung obliegt allein Mrs Webster, was hat Mrs Beaton damit zu tun?«, schoss ich zurück und kämpfte darum, mir ihren lockeren Tonfall nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ich mochte es nicht, wenn jemand auf diese Art über Betty sprach, als hätte sie es nicht genauso verdient wie wir, hier zu arbeiten. Als könnte sie weniger leisten.
»Mrs Beaton teilt die Aufgaben auf, Flo«, erklärte Peggy geduldig, und ich hasste die Nachsicht, die darin mitschwang. »Deine Schwester –«
»Meine Schwester«, fiel ich ihr eisig ins Wort, »sorgt hier genau wie alle anderen für ihren Lebensunterhalt und arbeitet hart dafür. Sie verdient es nicht, wenn man von oben auf sie herabschaut.«
Liebes Tagebuch …
Dieses Haus ist mein Freund geworden. Es beschützt mich. Manchmal zeigt es mir neue Ecken und Verstecke. In denen kann ich mich zusammenkauern. Da findet mich niemand.
Und von dort aus höre ich viel.
Mein Freund teilt seine Geheimnisse mit mir. Geheimnisse, die der Winterkönig und seine Familie den Wänden anvertrauen. So habe ich heute die Frostprinzessin weinen gehört. Sie fühlt sich einsam. Dabei war ich doch da!
Ich habe die Steine berührt, hinter denen sie lag und dabei ganz fest an sie gedacht.
Trauer ist etwas Eigentümliches.
Das Wort habe ich von dem Kochelf. Ich mag es. Es hat etwas Geheimnisvolles. Er nutzt es immer, wenn er von Dingen spricht, die er nicht versteht.
Dabei müsste er nur zuhören. Das würde ihnen allen helfen. Es gäbe viel weniger Missverständnisse.
3. Kapitel
Mein Temperament brodelte noch immer, als ich endlich die Tür meines kleinen Zimmers unter dem Dach hinter mir ins Schloss drückte. Abgestandene Luft schlug mir entgegen und ich eilte zu der kleinen Dachluke hinüber, um sie mit dem rostigen Haken aufzuklappen. Dadurch, dass das Haus dieser Tage nach Kräften gegen die Kälte geheizt wurde, war es auch hier oben warm genug, um die klare Nachtluft mit einem tiefen Atemzug willkommen zu heißen.
Peggy hatte versucht, ihre Worte wiedergutzumachen, hatte mir sogar angeboten, die letzte Runde durchs Haus allein zu übernehmen, damit ich zu Bett gehen konnte.
Ich hatte abgelehnt. Nachtragend war ich nicht, aber es widerstrebte mir, sie etwas tun zu lassen, wofür ich nachher in ihrer Schuld stand. Meine Arbeit verrichtete ich selbst, immerhin erhielt ich Lohn dafür, ein Dach über dem Kopf und warme Mahlzeiten. So gesehen, hätten wir es wirklich schlechter treffen können.
Es war ein Glücksfall gewesen, der mir in der zunehmend klirrend werdenden Kälte vor vier Wochen das Rad meines Karrens hatte brechen lassen, mit dem ich Pferdemist von den Straßen gesammelt hatte, um mir ein paar Pence zusätzlich zu verdienen. Es war reine Knochenarbeit, für die ich mich unter anderen Umständen nicht gemeldet hätte. Doch Not schuf Bereitschaft und beides war in den vergangenen Wochen unaufhaltsam gewachsen.
Der Zwischenfall mit dem Karren war nur einer aus einer Reihe unglücklicher Umstände, die mir in den vorangegangenen Tagen den Lohn verwehrt hatten. Bettys Magenknurren hatte an diesem Morgen neue Ausmaße erreicht und ihr Zittern war selbst dann nicht abgeklungen, als ich sie dicht an meine Seite gezogen und in meinen fadenscheinigen Umhang gewickelt hatte. Ihre Schuhe waren längst durchgelaufen und ihre Strümpfe genau wie meine löchrig, was denkbar schlechte Bedingungen für den anstehenden Winter waren. So hatte ich die nächstbeste Arbeit aufgenommen, die sich mir bot. In diesem Moment vor dem umgestürzten Karren zu stehen, trieb mir vor Verzweiflung die Tränen in die Augen.
Ich wechselte hilflose Blicke mit dem jungen Mann, mit dem ich an diesem Tag zusammenarbeitete. Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben und ich brauchte keinen Spiegel, um zu wissen, dass sie auch in meiner Miene zu lesen war. Ein gebrochenes Rad bedeutete für uns im schlimmsten Fall Schulden und diese, dass wir die Kosten des Karrens in den nächsten Tagen würden abarbeiten müssten. Was wiederum hieß, Betty würde weiterhin hungern. Dabei wäre die Kälte mit warmem Brei im Magen wesentlich besser zu ertragen.
»Was machen wir jetzt?«, formte er mit den Lippen und sah sich nach allen Seiten um. Die meisten Menschen beachteten uns überhaupt nicht. Dreckig und verschwitzt, wie wir trotz der eisigen Temperaturen nach den Stunden der harten Arbeit waren, fielen wir kaum auf.
»Schaufeln?«, schlug ich niedergeschlagen vor und griff bereits nach meinem Arbeitsgerät, das ich achtlos hatte fallen lassen, um den Schaden zu untersuchen. Pferdeäpfel hatten sich dampfend aus dem Karren quer über den Gehweg ergossen. Wenn wir uns beeilten, würden wir vielleicht nicht ganz so viel Ärger bekommen. Und besser, der Mist lag auf der Straße, statt den Passanten den Weg zu versperren.
Während Edward oder Edgar – wir hatten die meiste Zeit über schweigend nebeneinander gearbeitet, weshalb ich mir seinen Namen nicht gemerkt hatte – unschlüssig verharrte, stieg ich über den Haufen hinweg und begann mit der mühseligen Arbeit. Meinen Rock hatte ich mir hochgebunden, denn ich stand knöcheltief in Pferdemist. Ich war längst zu erschöpft, um mich noch darum zu kümmern, zumal davon wenigstens etwas Wärme ausging.
Dafür hörte ich zufällig das Gespräch zweier Damen mit, die etwas entfernt von uns in einem Hauseingang standen. Wie ich später erfahren sollte, war die Fülligere von ihnen Mrs Webster. Es waren ihre Worte, die über das Rattern der Kutschräder und das Geräusch von Pferdehufen bis an meine Ohren drangen, die mich aufhorchen ließen. »Es wird immer schwieriger, anständige Hausmädchen zu finden«, hatte sie gesagt und dabei seufzend das Gewicht eines Korbs vom einen auf den anderen Arm verlagert. »Den meisten fehlt es an Diskretion und dem Gespür für Feinheiten. Sie machen, was man ihnen sagt, denken dabei aber keinen Inch weit.«
Ich hatte innegehalten, und selbst jetzt, in meiner stickigen Dachkammer, sah ich die beiden Frauen noch vor mir. Es hatte noch ein Weilchen gedauert, bis ich genug Mut zusammengenommen hatte, um zu ihnen hinüberzugehen. »Gib mir zwei Minuten«, hatte ich zu Ebert oder Edgar gesagt und ihm meine Schaufel in die Hand gedrückt. Dabei wartete ich seine Antwort nicht ab, sondern wischte mir lediglich die steifgefrorenen, schmutzigen Hände an meinem Rock ab.
Mit einer beiläufigen Bewegung löste ich den Knoten an meiner Hüfte, woraufhin mein Kleid wieder auf eine angemessene Länge hinabfiel und meine Füße und Knöchel verdeckte. Die Strähnen, die sich aus meiner Frisur gelöst hatten, steckte ich notdürftig zurück unter das Häubchen. Dann atmete ich tief durch und ging mit gesenktem Kopf zu den beiden hinüber.
Die Sekunden, die sie brauchten, um mich wahrzunehmen, kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Mein Herz pochte wie wild in meiner Brust und ließ mir den Puls in den Ohren rauschen, sodass mir die Frage, welche Mrs Webster mir stellte, beinahe entging. Gerade rechtzeitig erinnerte ich mich daran, vor ihr zu knicksen. »Verzeiht mir, Madam. Durch Zufall wurde ich Eures Gesprächs gewahr. Daraus entnahm ich, dass Ihr ein Hausmädchen sucht.«
Ich spürte ihre Musterung auf mir und wusste, was sie sah. Ein abgetragener Rock, der trotz all meiner Vorsichtsmaßnahmen am Saum nass und verklebt war. Zwar hatte ich meine Hände tief in den Falten des groben Stoffs vergraben, doch im Nachhinein schien es mir unmöglich, dass Mrs Webster meine dreckverkrusteten Finger entgangen sein sollten. Und in der Spiegelung des Wasserbottichs am Brunnen wenig später hatte ich zu allem Überfluss einen langen Streifen Dreck auf meiner Wange entdeckt. Gott sei Dank war ich mir dessen im Augenblick des Gesprächs nicht bewusst gewesen. Das Unbehagen, das ich verspürt hatte, ließ mich selbst Wochen später noch erschauern. Nein, ich hatte fürwahr nicht so ausgesehen, als könnte ich ihren hohen Ansprüchen genügen.
»Und dir fiele jemand ein?«, gab die Haushälterin mir trotzdem eine Chance, die ich dankbar mit einem resoluten Nicken ergriffen hatte.
Es war tollkühn von mir gewesen, meinem Mundwerk freien Lauf zu lassen. Doch ich war mir mit einem Blick zurück auf den umgestürzten Karren mit der Zunge über die ausgetrockneten Lippen gefahren und hatte mein Widerstreben, mich selbst anzupreisen, hinuntergeschluckt. Im Schnelldurchlauf zählte ich meine bisherigen Erfahrungen auf und endete mit der Aussage: »Ich könnte gleich anfangen, wenn Ihr mir noch ein paar Minuten gebt, um meine Arbeit dort drüben abzuschließen.« Dabei hatte ich zu dem Berg Mist gedeutet.
Vielleicht war es das gewesen, was mir ihr Wohlwollen eingebracht hatte. Die Tatsache, dass ich eine Arbeit nicht einfach stehen und liegen ließ, wenn sich mir eine bessere Möglichkeit bot. Ihre buschigen Brauen hatten sich gehoben und unter ihrem abwägenden Blick hatte ich eilig wieder den Kopf gesenkt.
»Gib ihr eine Chance, Stance!«, schaltete sich überraschend die zweite Dame ein und wurde mir damit schlagartig sympathisch. »Das Mädchen hat den ganzen Tag geschuftet, während ihr Freund dort drüben nicht viel mehr getan hat, als den Karren zu verrücken.«
»Du musst dem Earl of Calcott ja auch nicht Rede und Antwort stehen«, knurrte Mrs Webster zurück. Dann seufzte sie tief und packte mein Kinn mit ihren behandschuhten Fingern. Ich war so überrumpelt, dass ich meinen Kopf klaglos in ihrem Griff hin und her drehen ließ. Ihre blassblauen Augen durchbohrten mich so streng, dass ich erst später auf dem Weg zu meinem neuen Arbeitsplatz darüber nachdenken konnte, wer mein neuer Lohngeber sein würde. »Sei pünktlich zum sechsten Glockenschlag an der Poststation. Wir werden sehen, wie du dich schlägst.«
»Flo?«
Die piepsige Stimme ließ mich zusammenfahren und riss mich schlagartig zurück in die Gegenwart. Ich konnte nicht mehr zählen, wie oft mir mein Herz seit heute Morgen beinahe aus der Brust gehüpft wäre. Eine Hand darüber gepresst, versuchte ich den trommelnden Schlag zu beruhigen. »Du hast mich erschreckt, Betty!«, tadelte ich meine Schwester milde, die sich im Halbschatten unter der dünnen Decke meines Bettes regte. »Du solltest eigentlich unten sein, schon vergessen?« Unten bei den Küchenmädchen, die ihr auf mein inständiges Flehen hin ein Lager nahe dem Kamin überließen, damit sie nicht in einer der klammen Kammern unterm Dach schlafen musste. Dieses Zugeständnis hatte mich einiges an Verhandlungsgeschick sowie die eine oder andere Fleischration gekostet, die sie im Gegenzug einforderten. Nur bevorzugte Betty den Platz an meiner Seite, was mich eigentlich nicht wundern dürfte.
»Du bist traurig!«, stellte sie fest und ihr blonder Lockenkopf tauchte auf. »Wieso?«
Erschöpft fuhr ich mir mit der Hand über das Gesicht und legte erst mein Häubchen und dann das Tuch um meine Schultern herum ab, ehe ich anfing, die Nadeln aus meinem Haar zu ziehen. Eine Strähne nach der anderen löste sich und fiel locker herab. Ich schindete Zeit. Das wusste ich nur allzu gut. Aber ich wollte meine kleine Schwester nicht mit meinen Sorgen belasten, von denen ich fürchtete, wenn ich sie einmal zu erzählen begann, würden sie ein Eigenleben entwickeln.
»Flo!« Zehen schoben sich unter der Decke hervor, als Betty zu mir herüberrobbte. Sie streckte die Hände nach mir aus. »Haare.«
»Nicht heute, Schatz«, murmelte ich und stellte meinen Fuß auf den einzelnen hölzernen Stuhl, um meine Stiefel aufzuschnüren. Neben meinem Bett, dem kleinen schiefen Nachtschränkchen und der Kommode mit der Waschschüssel darauf, bildete er das einzige Mobiliar in dem kleinen Raum. Darüber hinaus gab es nur noch einen Nachttopf, der gegenwärtig jedoch leer war.
Meine Finger zitterten, weil ich es mit einem Mal so eilig hatte, meine Kleidung loszuwerden. Plötzlich schien es mir, als ließen mir meine Schuhe zu wenig Platz und auch das Korsett, in dem ich steckte, machte Anstalten, sich um mich herum zuzuziehen. Ich hörte auf, mit den Schnüren an meinen Beinen zu kämpfen. Mühevoll unterdrückte ich mein panisches Luftschnappen, weil ich Betty nicht beunruhigen wollte, und nestelte fahrig an dem obersten Knopf an meinem Hals herum. Als ich ihn offen hatte, ging es mir schon etwas besser. Das Gefühl, gefangen zu sein, ließ etwas nach.
»Haare!«, wiederholte Betty da, dieses Mal fordernder. Es machte deutlich, dass sie sehr wohl bemerkt hatte, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ihr rundes, kindliches Gesicht drückte allen Ernst aus, den sie aufzubringen vermochte, und als sie den Unterkiefer vorschob, verkniff ich mir ein Lächeln.
Insbesondere weil ich mein Gesicht in ihrem wiedererkannte. Wir hatte die gleiche krumme Nase von unserem Vater geerbt und unsere Augen waren beide von einem intensiven Grün. Waldgrün hatte Papa es immer genannt und dann gesagt, wir müssten Feen sein, denen man die Flügel gestutzt hatte. Ich erinnerte mich daran, wie er nach dieser Aussage jedes Mal den Finger an die Lippen legte und uns zuflüsterte: »Aber sagt es niemandem, ja? Das bleibt unser kleines Geheimnis.«
Betty gab einen missmutigen Laut von sich und es hätte mich nicht gewundert, wenn sie verärgert die Hände in die Hüften gestemmt hätte. Immerhin verbrachte sie tagsüber genug Zeit in Gesellschaft der Köchin, weshalb es nur natürlich gewesen wäre, wenn sie deren Lieblingsgeste übernommen hätte. Sie beschränkte sich auf eine undefinierbar gestikulierende Bewegung, die ich als Aufforderung nahm, mich vor dem Bett auf den Boden zu setzen. Während sich ihre Finger in meinem Haar versenkten, konnte ich mich in aller Ruhe, die ich aufzubringen vermochte, meinen Stiefeln widmen. Es tat gut, endlich zu sitzen, und kaum waren meine Füße befreit, streckte ich meine Zehen von mir, um mit ihnen zu wackeln.
Wäre Papa jetzt doch hier, dachte ich sehnsüchtig und erlaubte mir einen kostbaren Moment lang, mich an sein beinahe zahnloses Grinsen zu erinnern. Er war Tischler gewesen und so lange er an der Werkbank stand, hatte er noch für jedes meiner Probleme einen Rat gewusst. Was er wohl sagen würde, wenn ich ihm von meinen unzähligen Fehltritten heute berichtete? Mit jedem einzelnen von ihnen riskierte ich immerhin leichtfertig, mit Betty erneut auf der Straße zu landen. Da half auch das Wissen nicht, dass mir im Endeffekt keine Wahl geblieben war. Immerhin hatte ich nicht ahnen können, dass sich im Flur jemand aufhielt. Rational gesehen war ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass im Vergleich zu einer schluchzenden Lady Alice der Viscount und sein vermeintlicher Bruder das kleinere Übel waren. Und Letzterer war ausnehmend höflich gewesen. Wenn mich nicht alles täuschte, hatte er mir einen Handkuss geben wollen. Als wäre ich seinesgleichen.
»Wie war dein Tag?«, fragte ich in die Stille hinein, die nur von dem Geräusch des Windes, der pfeifend über die Dachschindeln strich, unterbrochen wurde. Der Klang meiner eigenen Stimme schaffte es sogar kurz, den tiefen Bariton aus meinem Kopf zu vertreiben. »Hast du etwas Spannendes erlebt?«
Das Leben als Hausmädchen bot in der Regel nicht viel Abwechslung. Gerade nicht für sie, deren Hauptaufgabe darin bestand, die Feuerstellen im Haus mit Holz zu versehen, damit die Flammen die Kälte außerhalb des alten Gemäuers hielten. Manchmal erfand sie aus diesem Grund Geschichten, die sie mir dann auf ihre ganz eigene, abgehackte Art zu erzählen wusste. Von Abenteuern und Geistern, die sie durchs Calcott’sche Haus begleiteten und ihr wilde Dinge aus ihren eigenen Leben berichteten. Zugegeben, meist ergänzte ich ihre Ideen und führte sie zu Ende, worüber sie irgendwann in einen friedlichen Schlaf fiel.
Heute jedoch schien ihr nicht der Sinn nach einer Märchenstunde zu stehen. »Nein!«, sagte sie. Indessen flochten sich ihre Finger durch mein Haar. Wie jedes Mal war ich überrascht, wie geschickt sie sich dabei anstellte. Wenn ich sie frisierte, beklagte sie sich meistens mit finsteren Blicken über mein mangelndes Talent und Feingefühl. »Traurig. Wieso?«
Mir entrang sich ein tiefer Seufzer. Ich würde ihr nichts von meiner Begegnung mit den beiden Adligen erzählen und ich konnte ihr auch nicht davon berichten, was Peggy gesagt hatte. Meine kleine Schwester würde es nie zeigen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ihr die Art, wie manche unserer Mitmenschen mit ihr umsprangen, recht nahe ging. Sie verstand nicht, warum sie manche Menschen mit Skepsis, wenn nicht sogar Angst beäugten. Auch Mrs Webster war nicht gerade erfreut gewesen, als ich mit Betty im Schlepptau an dem vereinbarten Treffpunkt angelangt war, und das, obwohl man ihr äußerlich nichts von ihrer Besonderheit ansah. Zwar war sie etwas klein geraten für ihr Alter, aber ich war der felsenfesten Überzeugung, sie würde früher oder später in der Größe aufholen. Dennoch hatte ich ihr im Vorfeld eingeschärft, bestmöglich nicht zu sprechen, und innerlich gebetet, niemand würde eine direkte Frage an sie richten.
Mrs Beaton nahm uns am Dienstboteneingang in Empfang, und nach einem kurzen Gespräch mit ihrer Vorgesetzten wandte sie sich an uns. Natürlich richtete sie dabei auch das Wort an meine Schwester, die sich halb hinter mir versteckt hatte. Im Gegensatz zu dem harschen, strengen Ton, den sie mir gegenüber anschlug, überraschte mich ihre Freundlichkeit Betty gegenüber. »Und wie gedenkst du, dich nützlich zu machen?«
Mir rutschte das Herz in die Kniekehlen und ich war kurz davor, für Betty zu sprechen, als sie mich auf ganzer Linie stolz machte. Als sei ihr bewusst, wie wichtig dieser erste Eindruck war, trat sie neben mich. Ihre Hand schob sie in die meine, ehe sie langsam und bedächtig sagte: »Ich bin klein. Und flink. Ich kann Botengänge machen.« Sie überlegte ein Weilchen, ehe sie anfügte: »Feuerstellen säubern.«
Jetzt, auf dem Boden hockend, griff ich nach hinten und umfasste ihre Finger. Sie waren eisig. »Himmel!«, entfuhr es mir und ich drehte mich zu ihr herum. Dass meine Knie bei dem Kontakt mit dem harten Holzboden schmerzhaft protestierten, ignorierte ich. »Du solltest wieder unter die Decke!«
Sie schenkte mir ein Grinsen, wobei mir eine Zahnlücke auffiel, von der ich hätte wetten können, dass sie heute Morgen noch nicht dagewesen war. »Du!«
»Ja, ich komme auch gleich ins Bett«, bestätigte ich und hob die Decke an, damit sie darunterhuschen konnte. Es musste bereits unheimlich spät sein und ich ahnte, dass ich jede weitere wache Minute morgen schmerzlich bereuen würde. »Aber vorher muss ich aus diesem Kleid raus.«
»Gedanken«, meinte sie und zog das zerknautschte Kissen heran, um ihre Wange darauf zu betten.
Ich lächelte, erleichtert, dass ich ihr zumindest diesbezüglich die Wahrheit sagen konnte. Sie schien meine Bedrücktheit vergessen zu haben. »Ich habe an unsere Ankunft hier gedacht und welches Glück wir hatten, diese Anstellung zu finden«, sagte ich und rollte mir derweil die Strümpfe von den Beinen. Feinsäuberlich hängte ich sie über die Stuhllehne, ehe ich meine Röcke abstreifte und ebenso ordentlich gefaltet auf der Sitzfläche platzierte. Nur noch in meinem Unterkleid tapste ich schließlich zum Dachfenster hinüber, um es zu schließen. Der Griff war kalt. »Ich habe mich an Papa erinnert.«
»Papa?«
»Ja.« Im Gegensatz zu mir konnte sich Betty kaum an den Mann erinnern, der uns aufgezogen hatte. Ihre Augen funkelten vor Neugierde, aber ehe sie fragen konnte, musste sie gähnen. Ich gab ihr einen Kuss auf die Stirn, um meinen nachdenklichen Blick vor ihr zu verbergen, und war insgeheim froh, das Thema heute nicht weiter vertiefen zu müssen. »Schlaf jetzt. Ich hab dich lieb.«
Dann strich ich mir meine Haare hinters Ohr, um mich nach der einzelnen Kerze zu recken, deren flackerndes Licht den Raum erhellte. Sachte pustete ich sie aus.
Liebes Tagebuch …
Wie viel lernt man durch Beobachten?
Ich erzählte dir vom Zuhören. Nur einer von fünf Sinnen. Jeder Einzelne ist nützlich. Man braucht sie, um sich in dieser Welt zurechtzufinden.
Ganz besonders wenn einer von ihnen weniger stark vorhanden ist.
Eine Sache sehe ich oft. Weder die Feen und Zwerge noch die Familie des Winterkönigs sind sich dessen bewusst. Sie sehen nicht, was ich sehe. Sie schauen aneinander vorbei.
Keiner von ihnen bemerkt die Trauer der Frostprinzessin. Der Eisprinz plaudert mit dem Schneemann. Keiner von beiden beachtet die Prinzessin, dabei sitzt sie ihnen doch direkt gegenüber.
Auch der Winterkönig bemerkt nicht, wie sie ihn ansieht. Als wünschte sie, er würde sich an seinem Essen verschlucken. Er sieht überhaupt nicht aus wie in meiner Vorstellung. Die Zuckerfee beschrieb ihn immer als gut gelaunt. Als freundlich.
Ich habe ihn mir mit Bart vorgestellt. Lang und weiß. Passend zur Farbe der Jahreszeit, über die er herrscht. Er jedoch trägt keinen. Und auch auf dem Kopf hat er keine Krone. Nur sein fehlendes Haar erweckt den Eindruck, als fehlte ihm das Licht zum Wachsen. Wie bei einer Pflanze.
4. Kapitel
Ich hätte auf meinen Körper hören sollen, dachte ich, als ich am nächsten Morgen mit müden Augen den oberen Flur wischte. Natürlich bereute ich es, dass Betty mir gestern noch bis spät in die Nacht das Haar gebürstet hatte. Das hieß, wirklich von Reue konnte nicht die Rede sein, dennoch wünschte ich mir, die paar Minuten lieber für Schlaf genutzt zu haben.
Mein Kopf pochte wild und hielt das muntere Geplauder von Peggy kaum aus, die mir meine ablehnende Reaktion auf ihren Kommentar zu Betty nicht länger übel zu nehmen schien. Ihr Plappern erinnerte an das Rauschen des kleinen Bachs, der mitten durch das Dorf führte, in dem ich aufgewachsen war. Wort für Wort hüpfte Wassertropfen gleich von Thema zu Thema, die in meiner Vorstellung die Steine darstellten. Sie erzählte mir von Rick, der eigentlich Frederick hieß. In ihren Augen war er ein Schwerenöter, vor dem kein Rock sicher war. Diese Schlussfolgerung zog sie daraus, dass er ihr neulich beim Tragen eines schweren Wasserbottichs geholfen hatte und ihr Danke lediglich mit einem Nicken quittiert hatte. »Glaub mir«, sagte sie, während sie den Lappen auswrang, mit dem sie gerade das Geländer des Treppenabsatzes reinigte. Sie sah mich dabei mit gewichtiger Miene an. »Ich kenne die Männer. Sie lügen, wenn sie behaupten, dass sie keine Gegenleistung erwarten. Immer.« Auf diese Warnung vor dem Diener folgte eine Reihe weiterer Anekdoten, von denen ich einige für schlichtweg erstunken und erlogen hielt. Denn mir eine Mrs Johnson, die Köchin des Anwesens, trunken vor Vernarrtheit in der Küche vorzustellen, wie sie eine versalzene Suppe nach der anderen ins Speisezimmer schickte, was sich über mehrere Wochen gezogen haben soll, fiel mir beileibe schwer. Über so lange Zeit hätte es sie ihre Stellung gekostet.
Als Peggy schließlich verstummte, hatte ich bereits eine ganze Weile weggehört, weshalb es mir zuerst überhaupt nicht auffiel. Wir waren an der Treppe angelangt, und ich bückte mich gerade, um den Bereich hinter der opulenten Vase zu erreichen. Erst da bemerkte ich die plötzlich eingetretene Stille.
Ich schluckte. »Peggy?« Es kam lediglich als Krächzen heraus. Dutzende Szenarien liefen wie ein Theaterstück vor meinen Augen ab, eins schlimmer als das andere. Denn ich hatte es bisher noch nie geschafft, das Hausmädchen mit Stummheit zu schlagen. Egal, was ich ausprobiert hatte. Ganz oben auf meiner Liste an Albträumen stand ein weiteres Zusammentreffen mit dem Viscount und seinem Bruder. Weil ich mich offensichtlich noch nicht genug blamiert hatte. Mit meinem Allerwertesten hoch in der Luft am Boden hockend, müsste ich den Knicks gar nicht erst versuchen.
»Flo!« O nein. Das war nicht der warme Bariton. Ich kannte die strenge Stimme, wenngleich ich die Frau, zu der sie gehörte, seit jenem Tag in den Straßen Londons nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Was ich für ein gutes Zeichen erachtet hatte. Immerhin hieß es, dass ich mein hochtrabendes Versprechen, ihren Ansprüchen zu genügen, bislang erfüllte.
Ich korrigierte: Erfüllt hatte.
Als ich mich aufrichtete, stand die Haushälterin vor mir. Sichtlich aufgewühlt. Ihr Häubchen war verrutscht, das Tuch um ihren Hals ebenfalls. Zudem standen ihr hektische rote Flecken im Gesicht.
Meine Gedanken begannen fieberhaft zu rasen, während ich eilig in einem Knicks versank und den Moment dazu nutzte, um mir die feuchten Finger an meinem Rock abzuwischen. Sie sah zornig aus, und da sie Margaret vollkommen links liegen ließ und mich aus ihren blauen Augen in Grund und Boden starrte, war die logische Konsequenz, dass ich der Quell ihres Ärgers war. Nur leider war ich mir keiner Schuld bewusst.
Es sei denn –
So schnell wie er gekommen war, verbannte ich den Einfall wieder. In mir sträubte sich etwas gegen die Befürchtung, die beiden Adligen könnten sich über mich beschwert haben. Denn eigentlich hatte ich gehofft, ihre milde Art, mich zurück an die Arbeit zu schicken, bedeutete, sie maßen meinem Fauxpas keine zu große Bedeutung bei.
»Mitkommen!« Bei Mrs Websters schneidendem Tonfall krampfte sich alles in mir zusammen. Ich fühlte mich wie auf dem Gang zum Schafott, als ich mit hängenden Schultern den Lappen in den Holzbottich legte und mich an die Fersen der Haushälterin heftete. Der fragende und gleichzeitig mitleidige Blick, den Peggy mir schenkte, machte es nicht besser.
Erst recht, weil mir siedend heiß der Wäschekorb einfiel, den ich im Eingang zur Dienstbotentreppe in der Bibliothek zurückgelassen hatte. Ihn hatte ich vollkommen vergessen. »Wenn es um –«, versuchte ich es anzusprechen, brach jedoch ab, weil Mrs Webster ein ungehaltenes Zischen ausstieß.
»Schweig still.«
Ende der Leseprobe





























