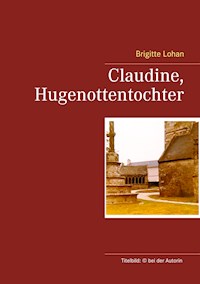
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leonard hatte große Mühe, die Augen zu öffnen. Zunächst fürchtete er, blind geworden zu sein, denn es war stockfinster um ihn, als er aufwachte. Lag er hierauf einer Canvasplane oder Campingmatratze? .... Der Geruch nach modrigem, langsam verrottendem Holz und feuchter Erde stach ihm penetrant in die Nase, die Zunge klebte am Gaumen, er spürte unerträglichen Durst und sein Zeitgefühl stand auf Null. War er nicht gerade noch mit Daniel hinter den Kotten gegangen, um Holz für das Lagerfeuer zu holen? Auf der Seite liegend, die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, versuchte er vergeblich, sich aufzusetzen, denn seine Füße waren ebenfalls gefesselt. Mit zunächst krächzender, zunehmend lauter werdender Stimme rief er um Hilfe. Grabesstille.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden, jedoch an wahren Begebenheiten orientiert.
Für meine Kinder
Maike-Jasmin, Arne-Alexander und Katrin-Solveig
Zur Erinnerung an ihren geliebten Papa.
Standort
Immer wieder suche ich
nach einem Standort,
passend für mich.
Ein Standort ist ein Wert
den doch jeder für sich begehrt.
oder muss man erstmal sterben
um einen solchen zu erwerben?
Wie die Wahl eines Partners fürs Leben
ist auch das Recht auf den Standort gegeben.
Oder sind Menschen die niemals ruh`n
die einzig freien im Denken und Tun?
Inhaltsverzeichnis
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreissig
Einunddreissig
Zweiunddreissig
Dreiunddreissig
Vierunddreissig
Fünfunddreissig
Sechsunddreissig
Siebenunddreissig
Achtunddreissig
Neununddreissig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
EINS
Mitte Juli. Ende des Sommersemesters an der Universität. Die Diplomfeier war beendet, die Gäste hatten sich von den Klappsitzen erhoben, grüßten und winkten wie nach einer Theatervorstellung. Umgeben vom Raunen gedämpfter Gespräche drängte Claudine inmitten ihrer Kommilitonen und Gäste aus dem Auditorium Maximum in die sommerlich aufgeheizte Universitätshalle, hielt Ausschau nach ihren Eltern und entdeckte ihre Mutter am Eingang zur Mensa, im Gespräch mit einem unbekannten Herrn.
„Wo bleibt denn Papa? Oder ist er schon vorgefahren?“
Enttäuscht darüber, ihren Vater nicht anzutreffen, wich das Hochgefühl, das sie eben noch verspürt hatte.
„Ja, ist er”, war die knappe Antwort ihrer Mutter, die sie liebevoll in die Arme schloss und einen Blick auf die Diplomurkunde warf: „Wunderbar hast du das gemacht. Ich freue mich so für dich, mein Schatz.” Mit einer Geste zur Seite deutete sie auf den Herrn neben sich.
„Daniel Dubois kennst du, oder?” Dieser streckte Claudine seine schmale Hand entgegen: „Meinen herzlichen Glückwunsch zum Diplom, Claudine. Ich darf Sie doch so nennen?”
„Danke, aber ich weiß gerade gar nicht”, sie unterbrach mitten im Satz und sah ihn prüfend an.
„Ich war das eine oder andere Mal bei den Sauvegardes in Dinard zu Besuch, zur gleichen Zeit wie Sie und Ihre Eltern”, erklärte er, wandte dabei den Kopf geschmeidig hin und her. Er war nur wenig größer als Claudine, die Haare graumeliert und glatt an den Kopf frisiert, durchmaß er mit stahlblauen Augen unstet die Umgebung.
„Bedaure, ich kann mich wirklich nicht erinnern”, gestand sie und schaute irritiert zu ihrer Mutter hinüber. Die hatte spontan mit einem Griff zwei der mit Sekt gefüllten Gläser vom Buffet genommen und eines davon ihrer Tochter gereicht.
„Oha, du glühst ja richtig. Komm, lass uns auf dein Wohl anstoßen.” Gläserklingen und Nippen am Sekt.
Dubois hatte sein leeres Glas zurückgestellt und wandte sich an Claudine: „Bevor ich am Dienstag nach Genf zurückreise, würde ich mich gern mit Ihnen unterhalten.”
„Worum gehts?”, sie blieb reserviert.
„Ach, das führt zu weit, wenn ich Ihnen das jetzt erkläre. Überlegen Sie es sich einfach und melden Sie sich, wenn es Ihnen passt.” Mit diesen Worten reichte er ihr seine Visitenkarte, die sie betont nachlässig in ihre Tasche gleiten ließ.
Claudines harmoniesüchtige Mutter hatte deren Abneigung gegen Dubois bemerkt. Auf die Einladung: „Daniel, wir fahren gleich zum Louisenhof, wo Leonard sein besonderes Diplom-Menü serviert und feiern danach weiter. Vielleicht hast du Lust, auch zu kommen”, hatte er höflich gelächelt und mit seinem leichten französischen Akzent geantwortet: „Merci beaucoup, Marie. Ja dann, salut!” Gab Küsschen an ihre Wangen, warf Claudine einen vielsagenden Blick zu und verschwand eilig durch den nächsten Seitenausgang der Universitätshalle.
Kurz darauf waren Timo und Max bei ihnen und bedankten sich für die Einladung.
„Unser Kotten in der Senne ist etwas abgelegen und nicht so leicht zu finden. Fahrt am besten hinter uns her”, dirigierte Claudine ihre Freunde.
Sie hatten die Autos vorn an der asphaltierten Straße geparkt. Eingehüllt in den Duft der Kiefern, von der Nachmittagssonne begleitet, die ihre Licht- und Schattenspiele tupfenweise tanzend aufführte, wanderten sie nun über den Waldweg auf dunkelbraunem, samtweichem Sand und erreichten nach ungefähr fünfhundert Metern den Kotten der Lorants, liebevoll Louisenhof genannt. Neben dem Weg floss ein klarer Bach, ließ jedes Blatt und Zweiglein wie durch eine Lupe sichtbar werden. Das alte Gebäude war am Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und originalgetreu renoviert worden, karminrot gestrichene Eichenbalken und das Fachwerk frisch getüncht. Sobald Claudine in die Diele trat, fühlte sie sich in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Das ist nichts für feine Nasen, dachte sie, als sie den einzigartigen, feucht-modrigen Geruch wahrnahm, der typisch ist für alte Bauernhäuser.
Timo hingegen war einfach nur begeistert: „Richtig urig hier! So wird`s vor zweihundert Jahren im Feuerschein des Kamins gewesen sein.” Er musste wegen seiner Größe den Kopf beugen, sonst hätte er sich an dem niedrigen Türrahmen zum Kaminzimmer gestoßen. Den beiden coolen Nerds gefiel es hier; sie fühlten sich sichtlich heimelig. Noch am Vormittag waren sie in dem funktionalen, nüchternen Universitätsgebäude gewesen, wo der Tumult nach der Abschlussfeier an das Treiben auf einem Flughafen erinnerte, und jetzt hier, an diesem verwunschenen Ort.
Sie hatten auf der Bank an dem mit blau-weißem Bunzlauer Geschirr gedeckten Esstisch Platz genommen und Claudines Vater Leonard servierte wenig später sein Diplom-Menü: Pot-au-feu, dazu Baguette, diverse französische Käsesorten, Mousse au Chocolat zum Dessert, Obst, Rotwein und Mineralwasser.
„Freut mich sehr, wenn es euch geschmeckt hat. Ein Hoch auf die frisch gebackenen Diplomanden.” Er hatte sein Rotweinglas erhoben, man prostete sich zu.
„Mein liebster Papa, danke für das köstliche Essen. Auf dein Wohl”, Claudine strahlte ihren Vater an. Er war ein wahrer Kochkünstler und Liebhaber der französischen Küche.
Anschließend blieben sie stundenlang am Tisch sitzen, redeten und fühlten sich wie Gott in Frankreich.
„Möchte jemand Kaffee? Espresso vielleicht?“ fragte Claudine zwischendurch in die Runde. Alle wollten. Bald erfüllte Kaffeeduft den Raum.
„Wer möchte, kann sich oben im Haus umziehen, will ja wohl niemand im Festtagsanzug am Lagerfeuer sitzen”, bot Claudine ihren Freunden an. Sie war froh, endlich den feinen, dunkelblauen Hosenanzug gegen Jeans und T-Shirt tauschen zu können und in ihre Sneakers zu schlüpfen. Nachdem alle umgezogen waren, gingen sie hinaus auf ihr Grundstück, eine Waldlichtung, wo das gut abgelagerte Holz kunstvoll für ein Lagerfeuer aufgeschichtet war.
Inzwischen waren auch die anderen eingeladenen Kommilitonen und Freunde nach und nach eingetrudelt. In der Dämmerung, bevor die mondlose Nacht begann, vollführten Fledermäuse ihren Akrobaten-Auftritt, schwirrten über die Köpfe der jungen Leute. Sie saßen in dem noch tagwarmen Sand um das Feuer, unterhielten sich lautstark über die Uni, bedienten sich von den bereitgestellten Getränken, genossen den Abend ausgiebig und waren erleichtert, den Prüfungsstress hinter sich zu haben.
Die Abendluft frischte auf und Claudine wollte sich den Rücken nicht verkühlen. Sie erhob sich von dem Baumstumpf, der ihr als Sitz gedient hatte, klopfte den dunklen Sand von den Jeans und ging ihren Pullover holen. Die Dunkelheit und Stille des Waldes rings um das Grundstück wirkte geheimnisvoll. Auf dem Weg zurück zum Feuer stand plötzlich jemand unter der Eingangslampe des Kottens, im Lichtkegel über ihm taumelten die Nachtfalter. Erstaunt ging sie auf ihn zu: „Oh, Herr Dubois, haben Sie doch noch hergefunden.”
„Ist ja schon etwas spät, aber ich dachte, es würde sich noch lohnen”, antwortete er und schaute dabei auf seine Digitaluhr. „Ich wollte eigentlich Ihre Eltern treffen.”
In dem Moment trat Claudines Vater Leonard aus dem Haus und erblickte den späten Gast: „Hallo Daniel, schön, dass du es geschafft hast. Marie hat mir schon von eurer Begegnung in der Uni berichtet.” Sie umarmten sich wie zwei alte Freunde. „Darf ich dir ein Glas Roten anbieten?”, lud er seinen Freund ein.
Claudine nutzte die Gelegenheit, um zurück zum Feuer zu gehen. Ihre Mutter gesellte sich zu den Männern. Die drei unterhielten sich angeregt, beobachteten die vergnügte Stimmung am Lagerfeuer aus einiger Entfernung und nippten ab und zu an ihren Gläsern. Es war noch nicht Mitternacht, da war das Feuer weit heruntergebrannt. Leonard unterbrach das Gespräch mit Frau und Freund: „Ich hole kurz ein paar Scheite vom Holzstapel, bin gleich zurück.“ Schnellen Schrittes eilte er hinter den Kotten, gefolgt von Dubois, der lebhaft auf ihn einredete und seit seinem Eintreffen nicht von der Seite seiner Gastgeber gewichen war.
„Ich hab` doch richtig gehört, oder? Mein Vater wollte Holz besorgen, sonst brennt da bald nichts mehr. Ich guck mal, wo er bleibt.” Claudine sprang auf, nahm sich eine Taschenlampe und lief hinter den Kotten.
Die Plane, die den Holzstapel gewöhnlich zum Schutz gegen Regen abdeckte, hing halb herab. Beinahe wäre sie über die auf der Erde umherliegenden Holzscheite gestolpert.
Sie leuchtete in die Dunkelheit und es beschlich sie eine böse Ahnung: „Papa, wo bleibt das Feuerholz?“ Keine Antwort, nichts zu hören, nichts zu sehen. Oder doch? Etwas blinkte vor ihren Füßen im Sand: „Großer Gott! Das ist doch Papas Taschenuhr!”, stieß sie erschrocken aus. Gewöhnlich war die Uhr samt Metall-Etui mithilfe der Uhrkette an seinem Jackett befestigt. Claudine nahm die Uhr schnell an sich, pustete den Sand weg und ließ sie in ihre Hosentasche gleiten. Von Panik ergriffen horchte sie in die Dunkelheit: Da ist was passiert. Ohne triftigen Grund gibt Papa seine heiß geliebte Taschenuhr niemals aus der Hand, geschweige denn, dass er sie verliert.
Seltsame Geräusche. Hatten da Äste geknackt? Sie rief noch einmal: „Hallo Papa!” Keine Antwort, nur die Stimmen, vereinzeltes Gelächter der Gäste, sonst Stille. Doch dann: Irrtum oder Hoffnungsschimmer? Von der Wallhecke, die das Grundstück zum Wald hin begrenzte, war ein schwaches Stöhnen zu hören.
Sie leuchtete in die Richtung: „Sind Sie das, Herr Dubois? Wie sind Sie denn hierher gekommen?“
Der Mann war offenbar nicht in der Lage zu antworten, hielt den Kopf mit beiden Händen, lehnte rücklings an der dicht gewachsenen Hainbuchenhecke und hatte große Mühe, aufrecht sitzen zu bleiben. Claudine beugte sich zu ihm hinunter und erkannte eine Platzwunde an seinem Hinterkopf und deutliche Blutspuren in den verklebten Haaren.
„Wissen Sie wo mein Vater sein kann?” Claudine begann zu zittern, versuchte krampfhaft, die Gedanken an Schlimmeres zu unterdrücken. Sie leuchtete die Umgebung aus, ohne Ergebnis, sodass dieses eklige Gefühl der Panik sich von Minute zu Minute steigerte.
Dubois griff sich zum wiederholten Male an den Kopf, versuchte ein Stöhnen zu unterdrücken und stieß mühsam hervor: „Was ist passiert? Mein Kopf ist ganz leer. Wollten wir nicht Holz besorgen, Leonard und ich? Wo ist er denn jetzt?“
„Ich sehe ihn auch nicht!”, schrie Claudine in heller Aufregung und rannte in Richtung Lagerfeuer: „Hilfe! Kommt schnell! Dubois liegt verletzt dahinten bei der Hecke! Und ich kann meinen Vater nirgends finden! Wir müssen ihn sofort suchen!“
In alle Himmelsrichtungen stoben die Gäste auseinander, begannen zu suchen und zu rufen, im Haus und auf dem großen Grundstück, auf dem Waldweg und am Waldesrand. Einige der jungen Leute liefen an Claudine vorbei, um Dubois zur Hilfe zu kommen. Sie selber war kurz stehen geblieben, konzentriete sich: „Ich muss die Polizei anrufen”, murmelte sie und wählte die 110 auf ihrem Handy.
Vorsichtig führten Timo und Max den verletzten Dubois in die Diele des Kottens und ließen ihn auf einem Stuhl Platz nehmen. Aus dem Erste-Hilfe-Kasten legten sie ihm einen Kopfverband an. Nach einer kurzen Erholung stand Dubois mühsam vom Stuhl auf und wankte in die Küche zu Marie, die vor Schreck beinah den Topf, den sie gerade abtrocknete, fallen ließ.
„Daniel! Mein Gott! Was ist passiert?”
„Quelqu`un - Irgendjemand hat mich ko geschlagen. Und sie suchen nach Leonard.” Er sackte haltlos in die Knie. Sie wollte ihm gerade zur Hilfe eilen, da hörte sie das Tatütata eines Rettungswagens näherkommen.
ZWEI
Gleichzeitig mit dem Rettungswagen traf Polizeikommissarin Sophia Ahrens und ihr Kollege Erich Bruchköbel am Lorantschen Kotten ein. Sie hatten Nachtdienst auf der Polizeidienststelle XVI und die dringende Meldung erhalten, es sei eine Person plötzlich verschwunden und des Weiteren habe es einen Verletzten gegeben. Daraufhin hatte die Kommissarin den Rettungswagen geordert.
„Sorgen Sie dafür, dass alle Gäste vor Ort bleiben, damit wir sie befragen und die Personalien aufnehmen können”, hatte sie zu Claudine gesagt. Von der Idee, mitten in der Nacht in diese einsame Gegend zu fahren, war sie nicht begeistert gewesen.
Zunächst versuchte sie, Mutter und Tochter Lorant zu beruhigen und forderte anschließend die Partygäste auf: „Gehen Sie bitte alle ins Haus und geben Sie meinem Kollegen Ihre Personalien an.”
Dann wandte die Kommissarin sich an die Sanitäter, die dabei waren Dubois auf einer Trage in den Krankenwagen zu schieben. „Kann ich den Verletzten noch befragen?”
„Ja, aber machen Sie es kurz.”
Sie stieg in den Wagen um zu testen, wie weit der Verletzte ansprechbar war: „Wie heißen Sie?”
„Daniel Dubois”
„Nun, Herr Dubois, erinnern Sie sich an irgendetwas Ungewöhnliches, bevor man Sie so zugerichtet hat?”
„Nein, Leonard, ich meine Herr Lorant und ich waren beim Holzstapel hinter dem Gebäude, da habe ich einen Schlag auf den Kopf bekommen und schwarz gesehen. Hm, und dann hat Mademoiselle Claudine mich gefunden. Zum Glück”, erklärte er schleppend. Er war ziemlich blass im Gesicht, seine Bewegungen fahrig.
„Sie sollten sich jetzt schonen.”
Das Rettungsfahrzeug fuhr los über die lange Ausfahrt und die Kommissarin wandte sich an Claudine: „Also, Frau Lorant”, dabei zog sie ihre dunkelblaue Uniformjacke zurecht, behielt die blaue Polizeimütze in der Hand: „Sie haben Herrn Dubois gefunden. Dann geben Sie mir bitte zu Protokoll, wie und wo Sie ihn gefunden haben.”
„Kommen Sie, ich führe Sie hin.”
Sie gingen hinüber zu der Stelle, wo Claudine auf den verletzten Dubois getroffen war und ließen die Taschenlampe aufleuchten, suchten nach Spuren.
„Das muss hier gewesen sein.”
„Und haben Sie eine Ahnung, wie Herr Dubois dorthin gekommen sein könnte? Ist doch einige Meter von dem Holzstapel entfernt.” Zu ihrem Kollegen sagte sie: „Bruchköbel, ich hoffe, Sie haben alles notiert. Ist schon sehr merkwürdig, dass Herr Lorant unauffindbar bleibt.”
Sofort mischte sich Claudines Mutter ein: „Wann fangen Sie endlich an, nach meinem Mann zu suchen! Sie denken ja wohl nicht im Ernst, mein Mann hätte Herrn Dubois etwas angetan! Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft.”
Die Kommissarin ließ sich nicht beirren: „Leider ist es bei der Dunkelheit und in dieser unwegsamen Umgebung schwierig, jetzt gleich eine große Suche zu starten. Ich werde morgen früh bei Tageslicht noch einmal mit einem Suchtrupp die Gegend durchforsten. Sollte sich Ihr Mann allerdings im Laufe der Nacht bei Ihnen melden, geben Sie mir bitte sofort Bescheid.”
Vor dem Eingang des Kottens harrten die müden Gäste aus, die, nachdem sie ihre Personalien angegeben hatten, unverzüglich nach Hause wollten.
Sophia Ahrens entließ sie gegen 1 Uhr 30. „Kommen Sie alle gut heim und fahren Sie vorsichtig. Auf Wiedersehen.” Und zu Bruchköbel gewandt sagte sie: „Haben Sie alles für unsere weiteren Ermittlungen? Dann lassen Sie uns jetzt fahren.” Sie setzte Bruchköbel bei seiner Wohnung ab und verbrachte selber den Rest der Nacht im Büro der Polizeidienststelle, denn ihre Nachtschicht dauerte noch an. Schnell war sie auf dem unbequemen Bürosofa unter der dünnen Wolldecke eingeschlafen, aber schon am Morgen gegen 7 Uhr wieder aufgewacht. Was für ein Glück, dass sie durchtrainiert war, sonst hätte sie diese Arbeitszeiten im Schichtdienst nicht so locker verkraftet. Sie stellte die stark benutzte Kaffeemaschine an, blickte in den Spiegel über dem Waschbecken, der ein müdes Gesicht und gerötete Augen zeigte. Lieber wäre sie jetzt zu Hause neben ihrem Schatz aufgewacht, hätte mit ihm gefrühstückt und Pläne für das Wochenende geschmiedet. Oh, das vermisste sie gerade. Aber es gab berufliche Pflichten, die das nicht erlaubten und die ihr wichtig waren. Sophia Ahrens verließ das Büro und eilte durch die samstäglich leeren Gänge der Polizeidienststelle zur Sporthalle, wo sie regelmäßig Aikido betrieb. Die erfrischende Dusche hatte sie belebt. Dann entnahm sie ihrem persönlichen Spind ihre hellblaue Jeans und ein weißes T-Shirt, zog die taillenkurze, schwarze Lederjacke darüber und beigefarbene Sneakers an die Füße. Beim Verlassen des Umkleideraumes blickte sie zufrieden in den großen Wandspiegel. Sie hatte keine Zeit, sich zu schminken, war ohnehin äußerst attraktiv mit der roten Mähne, den zahlreichen Sommersprossen auf der Nase und den jadegrünen Augen. Erst vor kurzem war sie von der Mordkommission in die Vermisstenabteilung der Polizei gewechselt und hatte gehofft, es mit weniger Mord und Totschlag zu tun zu haben. Aber weit gefehlt! Am Ende lief es auch hier oft genug auf eine abscheuliche Bluttat oder einen einsamen Tod hinaus.
Um kurz vor 8 Uhr war sie bereit für den Tag und rief als Erstes auf Claudines Handy an, die verzweifelt mitteilte, ihr Vater sei bisher nicht nach Hause gekommen.
DREI
Die Polizei war weg, die letzten Gäste hatten sich verabschiedet, während Claudine und ihre Mutter Marie draußen standen und das Geschehene noch immer nicht begreifen wollten. Marie hatte das dunkelblaue Baumwolljackett ihres Mannes um die Schultern gelegt. Seine Brieftasche steckte in der Innentasche. Er hatte das Sakko wegen der Hitze in der Küche ausgezogen und über eine Stuhllehne gehängt.
„Ich denke, es hat keinen Sinn, noch länger zu warten, ich schließe mal ab”, sagte sie nach einer Weile ergeben.
„Ja, lass uns fahren, ich bin todmüde”, Claudine gähnte unentwegt. Auf der Rückfahrt schlug sie vor: „Mama, wenn du nichts dagegen hast, komme ich lieber mit zu dir.” In ihrem Studenten-Appartment unerfreuliche Nachrichten zu bekommen, das hätte sie jetzt auf gar keinen Fall ertragen. Der elterliche Bungalow, gebaut in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, lag an einer verkehrsberuhigten Straße in einem bevorzugten Vorort der Stadt, wo die Grundstücke durchweg von Hecken begrenzt waren. Buchsbäumchen standen Spalier rechts und links des gepflasterten Weges zum Hauseingang.
Nach dem langen, in jeder Hinsicht ereignisreichen Tag bis zu seinem dramatischen Ende, war Claudine sehr erschöpft. Sie drückte ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange: „Gute Nacht Mama, sei bitte nicht böse. Ich kann einfach nicht mehr, ich verschwinde ins Bett. Weck mich bitte auf jeden Fall, wenn Papa nach Hause kommt.”
Sie stieg im Hausflur die geschwungene Holztreppe hinauf zu ihrem ehemaligen Kinderzimmer, das durch die Dachschrägen anheimelnd wirkte und bis heute in seiner Einrichtung unverändert war. Vollständig bekleidet ließ sie sich auf das Bett fallen und nahm den Hauch von Eau de la Séranne, den Geruch ihrer Kinderzeit wahr, konserviert in den Möbeln und Vorhängen; der Duft aus einer Zeit des Wohlbefindens, des Beschützt- und Behütet-Seins, des Geschichten-Vorlesens.
Wenigstens ihre Jeans und den Pullover sollte sie ausziehen, bevor sie endgültig in tiefsten Schlaf fallen würde. Und da hatte sie sie wieder in der Hand, die Taschenuhr, stehen geblieben um 11 Uhr 50. Sie legte das wertvolle Stück sorgfältig in die Nachttisch-Schublade und sank zurück in die Kissen. Während der verbleibenden kurzen Nacht schreckte sie immer wieder auf, weil sie glaubte, etwas gehört zu haben. Nachdem sie dann um kurz vor 8 Uhr durch den Anruf von Sophia Ahrens geweckt wurde, hielt sie es keine Sekunde länger im Bett aus, lief hektisch die Treppe hinunter ins Wohnzimmer und fand ihre Mutter vollständig bekleidet unruhig schlafend auf dem Sofa vor. Das hellbraune Plaid war auf den Fußboden gerutscht, das Telefon stand in Reichweite. Als die Kaffeemaschine lief, wachte ihre Mutter in überreizter Verfassung auf, schaute verstört um sich und wollte wissen: „Was ist denn los?”
„Gar nichts ist los, Mama. Leider. Kein Lebenszeichen von Papa. Das hält man ja nicht aus. Die Kommissarin hat mich eben angerufen und sich nach dem Stand der Dinge erkundigt. Sie gehen gleich in der Senne auf die Suche. Und ich werde später auch nochmal rausfahren”, sagte sie in einem Zug und stellte eine Tasse heißen Kaffees vor ihre Mutter auf den Couchtisch.
Sie selber trank eine Tasse, stark und schwarz. „Bis später”, rief sie abfahrbereit und sah, dass ihre Mutter den Kaffee nicht angerührt hatte und im Sitzen wieder eingeschlafen war.
Die beiden Männer vor dem Eingang zum Louisenhof hätten unterschiedlicher nicht sein können. Heinrich Großhaus, zuständig für die Instandhaltung und Pflege von Gebäude und Grundstück, groß gewachsen und ansehnlich gebaut, beugte sich ein ums andere Mal zu dem schmächtig wirkenden Dubois hinunter. Der hatte weder eine Kompresse noch einen Kopfverband, lediglich ein größeres Pflaster am Hinterkopf. Claudine strebte zügig auf die beiden Männer zu, die anscheinend in ein ernstes Gespräch vertieft waren.
„Guten Morgen die Herren. Geht es Ihnen besser, Herr Dubois?“
„Merci bien, mir gehts soweit gut. Die Platzwunde wurde genäht und weitere Untersuchungen haben nichts ergeben. Wie Sie sehen, bin ich schon wieder auf den Beinen.”
„Ja dann. Ich will unbedingt nochmal nach meinem Vater suchen. Habe gestern nur seine Taschenuhr gefunden und in Verwahrung genommen.”
„Soso, Leonards Taschenuhr. Also, ich kann mir das alles nicht erklären, aber wenn es etwas gibt, das ich tun kann.” Das war vermutlich seine Art, sich verbindlich zu zeigen, wobei er gleichzeitig einen seltsam unbeteiligten Eindruck machte. Urplötzlich bekam sein Tonfall nämlich eine offizielle Note: „Aber das trifft sich ja ausgezeichnet, dass Sie nochmal hergekommen sind, Claudine. Dann könnten wir jetzt unser Gespräch führen.” Dabei achtete er gar nicht auf ihr Zögern, sondern bestimmte einfach: „Schließ doch bitte auf, Heinrich.”
Dubois ließ Claudine den Vortritt und blieb dicht hinter ihr, bis in das Kaminzimmer. Widerstrebend setzte sie sich an den Tisch und konnte von hier aus durch das halbrunde Fenster auf die in warmes, helles Sonnenlicht getauchte Lichtung schauen, darauf das restliche Häufchen Asche vom gestrigen Lagerfeuer.
Dubois begann: „Claudine, ich darf doch davon ausgehen, dass Ihnen die Mitgliedschaft Ihrer Eltern in unserer Neuen Hugenottengesellschaft bekannt ist.”
Oha! Das war mal ein Einstieg! Sie hatte die Augen gesenkt und ihre Abneigung Dubois anzusehen verstärkte sich. Sie presste die Lippen aufeinander und blickte vor sich auf den Tisch. Es war ihr äußerst unangenehm, dass er ihre offensichtliche Irritation bemerkte.
Und tatsächlich fragte er: „Oder mag es sein, dass Ihr Vater Sie über seine Zugehörigkeit zu seiner hugenottischen Familienlinie im Unklaren gelassen hat?” Dubois wollte offenbar zwingend sein Vorhaben erledigen: „Aber zur Sache. Da Sie nun Ihr Studium abgeschlossen haben, lässt unser französisches Vorstandsmitglied Jean-Paul Sauvegarde aus Versailles fragen, obwohl Sie mit Ihren dreiundzwanzig Jahren noch nicht im passenden Alter sind vorzeitig Mitglied zu werden. Die Gesellschaft besteht inzwischen seit dreißig Jahren. Handwerk und Kaufmannschaft sind bei uns in einer einmaligen Gemeinschaft verbunden. Wir verfügen über einen großen Wissensbestand, darüber habe ich gestern Abend auch mit Ihrem Vater gesprochen.“
Nun wollte Claudine nicht eine Sekunde länger geduldig oder höflich sein. „Das ist wohl nicht Ihr Ernst, Herr Dubois! Anstatt mir bei der Suche nach meinem Vater zu helfen, erzählen Sie mir was von einer Neuen Hugenottengesellschaft! Oder hat Ihre ominöse Gesellschaft mit seinem Verschwinden zu tun?”, provozierte sie.
Verständnislos starrte Dubois sie an. Claudine griff nach ihrem Lederrucksack, erhob sich und wandte sich zur Tür. Im Weggehen fiel ihr ein: „Ach, noch etwas, Herr Dubois, sind Sie und Herr Großhaus alte Bekannte und gehört er zufällig auch zu Ihrer Gesellschaft?“
Offensichtlich enttäuscht über den vergeblichen Versuch, das Gespräch mit Claudine zu führen, antwortete Dubois, auf arrogante Art jede einzelne Silbe betonend: „Heinrich Großhaus weiß selbstverständlich Bescheid und unterstützt unsere Gesellschaft in allen Belangen. Er ist ebenso besorgt wegen Ihres Vaters wie ich. Ehe ich nach Genf zurückreise, melde ich mich aber noch einmal bei Ihnen. Vielleicht ist Ihr Vater bis dahin schon wieder aufgetaucht.“
Claudine eilte hinaus, rannte kreuz und quer über das Grundstück, suchte an der Wallhecke, lief den Waldweg in beide Richtungen und die abzweigenden kleinen von Moosteppichen bedeckten Pfade des Kiefern- und Tannenwaldes entlang, ohne auch nur die geringste Spur von ihrem Vater zu finden. Unglücklich stieg sie schließlich ins Auto. Sie geriet mehr und mehr aus der Fassung, schimpfte und tobte laut: „Die Fahrt hätte ich mir sparen können!”
VIER
Bis zu Claudines Rückkehr vom Louisenhof hatte ihre Mutter Marie wie betäubt auf dem Sofa gesessen, unfähig, sich vom Fleck zu rühren. Sie wirkte ziemlich derangiert, alles an ihr war irgendwie zerknittert, die dunkelbraunen Haare unfrisiert, das Make-up verwischt.
„Oje, wie spät ist es denn?” Sie schaute ihre Tochter an, als wäre die soeben von einem anderen Planeten gelandet.
„Mittagszeit, Mama”, antwortete Claudine traurig.
„Und?”
„Nichts, ich habe nicht den Hauch einer Idee, wo Papa sein kann.” Dann holte sie Luft und platzte heraus: „Aber du wirst es nicht glauben, wen ich getroffen habe: Vor unserem Kotten unterhielten sich Dubois und Großhaus höchst vertraut miteinander. Die beiden kennen sich wohl nicht erst seit gestern, oder?” Claudine ließ ihre Mutter nicht zu Wort kommen, redete ohne Pause weiter: „Mir kommt es so vor, als ob ihr alle möglichen Geheimnisse miteinander teilt, und wegen eurer seltsamen Heimlichtuereien kannte Dubois zwar mich; ich dagegen konnte mich nicht im Geringsten an ihn erinnern. Wie peinlich ist das denn?”
Der vorwurfsvolle Ton ihrer Tochter hatte Marie endlich wachgerüttelt. Sie überwandt ihre Lethargie: „Ich geh` kurz ins Bad und zieh` mich an. Dann reden wir.”
Unterdessen räumte Claudine das Frühstücksgeschirr in die Küche und holte die Taschenuhr aus der Nachttischschublade. Ihre Mutter saß wieder auf dem Sofa, die Tageszeitung vor sich auf dem Tisch. Doch bevor sie dazu kam, die Zeitung wegen der Todesanzeigen von hinten her zu lesen, stellte Claudine eine weitere Frage, eine Frage, die es in sich hatte, die ihre Mutter endgültig aus der Ruhe brachte: „Mama, muss ich Schlimmes dabei denken, wenn ich Papas Taschenuhr gefunden habe?”
Erschrocken fuhr Marie auf: „Was hast du?” Sie musste plötzlich gegen einen heftigen Hustenanfall kämpfen, hatte sich mit dem Kaffee verschluckt, rang nach Luft.
Claudine sagte: „Ja, gestern Nacht, als ich Papa gesucht habe, lag sie vor dem Holzstapel, halb im Sand vergraben. Hab mich nicht mehr getraut, dir das noch zu sagen. Warte Mama, ich helfe dir”, Claudine war aufgesprungen und hatte ihrer Mutter sanft und beruhigend den Rücken geklopft.





























