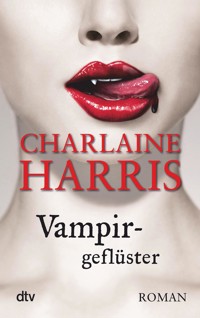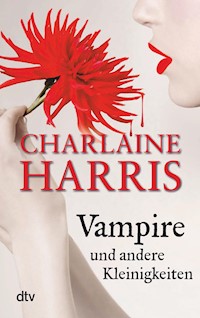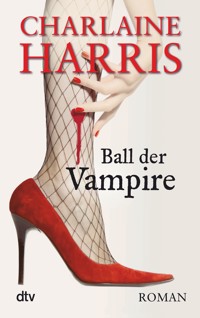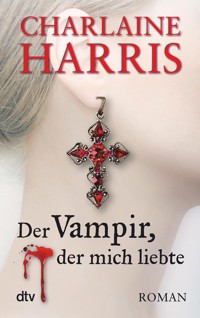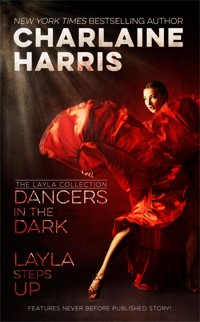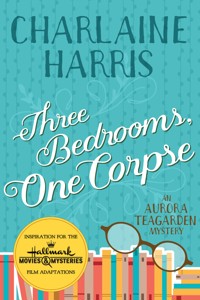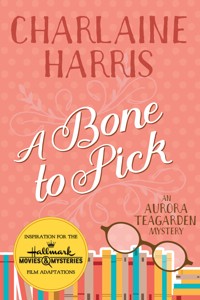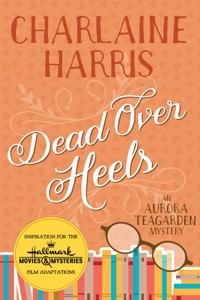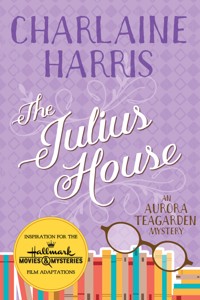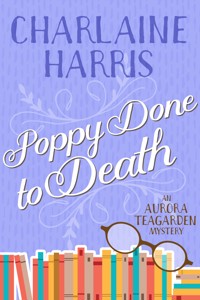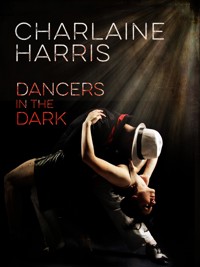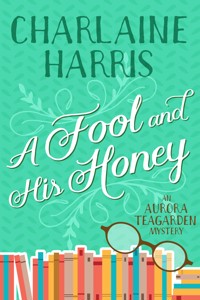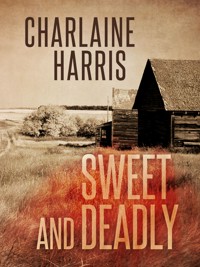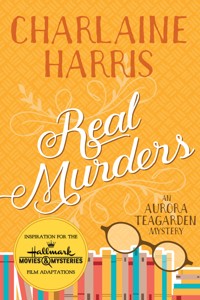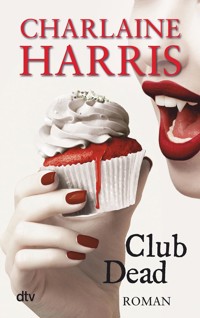
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sookie Stackhouse
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach ihrem Freund, dem Vampir Bill, begibt Sookie sich auf einen gefährlichen Roadtrip ... Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, weiß nicht recht, was sie davon halten soll, dass ihr Freund Bill (der einzige Vampir, mit dem sie freiwillig Umgang hat) in letzter Zeit so distanziert ist. Im wahrsten Sinne des Wortes: Er ist weit weg in einem anderen Staat. Sein Chef, der unheimliche, aber attraktive Eric, hat eine Idee, wo Bill sein könnte. Und ehe sie es sich versieht, ist Sookie auf dem Weg nach Jackson, Mississippi, um sich dort im Club Dead umzusehen. Es ist ein gefährlicher kleiner Laden, in dem die Vampir-Elite abhängt, um sich in Ruhe einen Schluck True Blood Null negativ zu Gemüte zu führen. Schließlich findet Sookie Bill – und zwar unter Umständen, dass sie nicht sicher ist, ob sie ihn retten oder lieber einen Pflock anspitzen soll …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sookie Stackhouse, die gedankenlesende Kellnerin, weiß nicht recht, was sie davon halten soll, dass ihr Freund Bill (der einzige Vampir, mit dem sie freiwillig Umgang hat) in letzter Zeit so distanziert ist. Im wahrsten Sinne des Wortes: Er ist weit weg in einem anderen Staat. Sein Chef, der unheimliche, aber attraktive Eric, hat eine Idee, wo Bill sein könnte. Und ehe sie es sich versieht, ist Sookie auf dem Weg nach Jackson, Mississippi, um sich dort im Club Dead umzusehen. Es ist ein gefährlicher kleiner Laden, in dem die Vampir-Elite abhängt, um sich in Ruhe einen Schluck True Blood Null negativ zu Gemüte zu führen. Schließlich findet Sookie Bill – und zwar unter Umständen, dass sie nicht sicher ist, ob sie ihn retten oder lieber einen Pflock anspitzen soll …
Charlaine Harris
Club Dead
Sookie Stackhouse Band 3
Roman
Deutsch von Dorothee Danzmann
Ich widme dieses Buch Timothy Schulz, dem mittleren meiner drei Kinder, der mir klipp und klar gesagt hat, er wünsche sich ein Buch nur für sich allein.
Kapitel 1
Bill hockte über den Computer gebeugt, als ich die Tür zu seinem Haus aufschloss und eintrat. Leider war mir dieser Anblick in den letzten Monaten nur allzu vertraut geworden. Anfangs hatte sich mein Liebster noch von der Arbeit losgerissen, sobald ich nach Hause kam, seit ein paar Wochen jedoch konnte davon keine Rede mehr sein. Anscheinend übte die Tastatur seines Rechners auf ihn eine weit stärkere Anziehungskraft aus als ich.
„Hallo Schatz“, sagte mein Vampir geistesabwesend, den Blick unverwandt auf den Schirm gerichtet. Auf dem Schreibtisch neben der Tastatur thronte eine leere Flasche TrueBlood O. Das Essen hatte er also wenigstens nicht vergessen.
Bill ist kein Typ für Jeans und T-Shirts. An diesem Abend trug er eine Khakihose und dazu ein Karohemd in gedämpften Grün- und Blautönen. Seine Haut schimmerte, sein dichtes schwarzes Haar roch nach Kräuteressenzen. Bei seinem Anblick wäre jede Frau von einem heftigen Hormonschub heimgesucht worden! Ich küsste seinen Nacken – er reagierte nicht. Ich leckte zart sein Ohr – wieder nichts.
Ich hatte gerade eine Sechsstundenschicht im Merlottes hinter mir. Sechs Stunden kellnern, immer auf den Beinen, und jedes Mal, wenn ein Gast zu wenig Trinkgeld hinterlassen oder irgendein Idiot versucht hatte, mir den Po zu tätscheln, hatte ich mir gesagt, dass ich ja bald bei meinem Liebsten sein würde, um unglaublichen Sex genießen und mich in seiner Aufmerksamkeit sonnen zu können.
So wie es aussah, hatte ich da vollkommen falsche Vorstellungen gehegt.
Ganz langsam und ganz gleichmäßig holte ich tief Luft, in den Anblick von Bills Rücken vertieft. Was für ein wundervoller Rücken mit solch breiten Schultern – wie fest ich damit gerechnet hatte, diesen Rücken bald unbekleidet vor mir zu sehen, meine Fingernägel in Ekstase darin vergraben zu können. Immer noch langsam und gleichmäßig atmete ich wieder aus.
„Bin gleich so weit!“, verkündete Bill, ohne sich umzudrehen. Auf dem Bildschirm war das Konterfei eines distinguierten älteren Herrn mit silbergrauen Schläfen und tief gebräunter Haut zu sehen. Er wirkte auf diese gewisse Anthony-Quinn-Art sexy. Gleichzeitig sah er aus, als verfüge er über nicht unerhebliche Macht. Unter dem Bild stand außer dem Namen des Herrn noch etwas Text. „1756 in Sizilien geboren“, las ich. Gerade wollte ich den Mund öffnen, um meinem Erstaunen darüber Ausdruck zu verleihen, dass Vampire entgegen der landläufigen Meinung ja durchaus auf Fotografien sichtbar seien, da wandte Bill sich zu mir um und bemerkte, dass ich ihm über die Schulter geschaut hatte.
Woraufhin er auf eine Taste drückte und der Bildschirm mit einem Mal leer war.
Sprachlos starrte ich meinen Freund an. Ich mochte nicht recht glauben, was er da eben getan hatte.
„Sookie!“, sagte Bill, bevor er sich an einem Lächeln versuchte. Seine Fangzähne waren kaum zu sehen; er war also ganz und gar nicht in der Stimmung, in der ich ihn anzutreffen gehofft hatte. Fleischeslust überwältigte Bill bei meinem Anblick jedenfalls nicht. Wie bei allen anderen Vampiren sind bei Bill die Fangzähne nur voll ausgefahren, wenn irgendeine Lust ihn umtreibt: die Lust auf Sex oder die Lust, sich zu nähren und zu morden. Manchmal sind diese Begierden bei Vampiren sehr eng miteinander verwoben; dann erwischt es den einen oder anderen Fangbanger, und der ist dann tot. Wenn Sie mich fragen, so ist es genau dieser Kitzel, diese immerwährende leise Bedrohung, die Fangbanger mehr als alles andere anzieht. Auch wenn mir in der Vergangenheit schon mehrmals der Vorwurf gemacht wurde, selbst eine dieser jämmerlichen Gestalten zu sein, die sich in der Nähe von Vampiren herumtreiben, weil sie hoffen, irgendwann werde ihnen einmal einer Beachtung schenken: Ich persönlich war (jedenfalls wenn es nach mir ging) mit einem einzigen Vampir liiert, und zwar mit dem, der da vor mir saß. Mit dem, der Geheimnisse vor mir hatte. Der so überhaupt nicht froh war, mich zu sehen.
„Bill“, erwiderte ich kühl. Irgendetwas war los hier – aber Bills Libido war es nun wirklich nicht. (Das Wort Libido hatte gerade an diesem Tag auf meinem Abreißkalender gestanden, mit dessen Hilfe man jeden Tag ein neues Wort lernen kann.)
„Das da eben hast du nicht gesehen“, fuhr mein Liebster fort, die dunklen Augen, ohne auch nur ein einziges Mal mit der Wimper zu zucken, ruhig und unverwandt auf mein Gesicht gerichtet.
„Wenn du meinst“, erwiderte ich vielleicht eine Spur sarkastisch. „Was führst du denn im Schilde?“
„Ich habe einen Geheimauftrag.“
Da wusste ich nicht, ob ich nun lachen oder beleidigt davonstolzieren sollte, weswegen ich lediglich fragend die Brauen hob und wartete, ob noch mehr käme. Bill war der Ermittler für den fünften Bezirk, einen der Bezirke, in die die Vampire Louisiana aufgeteilt haben. Bisher hatte Eric, der Leiter des fünften Bezirks, meinem Liebsten noch nie einen Auftrag erteilt, den dieser hatte vor mir ‚geheim halten’ müssen. Im Gegenteil: Wenn Bill ermittelte, dann war ich in der Regel integraler Bestandteil des Teams, ob ich das nun wollte oder nicht.
„Eric darf nichts davon erfahren. Kein Vampir aus dem fünften Bezirk darf etwas wissen“, fuhr Bill fort.
Da wurde mir mulmig zumute. „Aber wenn du nicht für Eric arbeitest – für wen denn dann?“ Die Füße taten mir weh, weswegen ich mich auf die Knie sinken ließ und meinen Kopf an Bills Knie lehnte.
„Für die Königin von Louisiana“, erklärte mein Liebster so leise, dass man schon fast hätte sagen können, er flüstere.
Da Bill bei seinen Worten eine ganz feierliche Miene machte, bemühte auch ich mich, ernst zu bleiben, was mir allerdings nicht gelingen wollte. Ich musste kichern – leise, aber unüberhörbar.
„Das hast du ernst gemeint?“, fragte ich dann vorsichtshalber nach, auch wenn mir schon klar war, dass Bill bestimmt nicht gescherzt hatte. Er ist nämlich ein ernsthafter Typ und selten zu Späßen aufgelegt. Ich vergrub das Gesicht in seinem Oberschenkel; Bill sollte nicht mitbekommen, wie sehr ich mich amüsierte. Dann warf ich von unten her einen vorsichtigen, abschätzenden Blick auf sein Gesicht. Mein Vampir wirkte reichlich angesäuert.
„Todernst“, sagte Bill so eisig, dass ich aufrichtige Anstrengungen unternahm, die ganze Sache ebenfalls nüchtern zu sehen.
„Nur um sicherzugehen, dass ich dich richtig verstanden habe“, sagte ich halbwegs gefasst, wobei ich mich im Schneidersitz auf den Boden hockte und beide Hände auf die Knie legte. „Du arbeitest für Eric, der der Leiter des fünften Bezirks ist, aber eine Königin gibt es auch noch? Eine Königin von Louisiana?“
Bill nickte.
„Louisiana ist also in Bezirke aufgeteilt, und da Eric seinen Betrieb in Shreveport im fünften Bezirk hat, ist diese Königin seine direkte Vorgesetzte?“
Als Bill daraufhin einfach nur erneut nickte, legte ich mir die Hand vor die Augen und schüttelte den Kopf. „Wo wohnt sie? In Baton Rouge?“ Baton Rouge war unsere Landeshauptstadt; das schien mir der logische Wohnsitz für eine Königin.
„Nein! In New Orleans natürlich!“
Natürlich! In der Vampirzentrale! Man konnte ja heute im Big Easy nirgendwo mehr einen Stein werfen, ohne einen Untoten zu treffen – wenn man den Zeitungen Glauben schenken wollte (was wohl nur ein Narr täte). In New Orleans boomte der Tourismus, aber anders als früher. Die trinkfesten, lärmenden Horden, die früher in die Stadt geströmt waren, um nach Herzenslust zu feiern, kamen nun weniger. Die neuen Touristen waren solche, die die Untoten der Stadt möglichst hautnah erleben wollten und deren Besichtigungsprogramm darin bestand, in einer Vampirbar zu trinken, zu einer Vampirprostituierten zu gehen und eine Sexshow von Vampiren für Vampire zu besuchen.
Das hatte ich zumindest gehört: Ich selbst war zuletzt als Kleinkind in New Orleans gewesen. Meine Eltern hatten meinen Bruder Jason und mich dorthin mitgenommen. Das musste gewesen sein, ehe ich sieben wurde, denn meine Eltern waren kurz nach meinem siebten Geburtstag gestorben.
Als die Vampire sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorstellten, um die Tatsache kundzutun, dass sie wahr- und wahrhaftig unter uns weilten, waren Mama und Papa bereits zwanzig Jahre tot gewesen. Dieser öffentlichen Ankündigung war die Entwicklung synthetischen Blutes durch japanische Vampire vorangegangen: Mit Hilfe dieses Blutes konnte ein Vampir sich nun ernähren, ohne sich dabei unbedingt eines Menschen bedienen zu müssen.
Die Vampirgemeinde der Vereinigten Staaten hatte die japanischen Vampirklans als Erste an die Öffentlichkeit gehen lassen. In fast allen anderen Nationen der Welt, in denen es Fernsehen gab (und wo gibt es das heutzutage nicht?), waren die weiteren Ankündigungen dann zeitgleich gelaufen, durch hunderte sorgfältig ausgesuchter Vampire mit besonders angenehmem Äußeren, in hunderten verschiedener Sprachen.
Wir normalen, altmodisch sterblichen Menschen hatten in jener Nacht, die nun bereits zweieinhalb Jahre zurücklag, erfahren müssen, dass wir immer schon mit Monstern zusammengelebt hatten.
Die Quintessenz dieser weltweiten Ankündigung war gewesen, dass wir vor diesen Monstern keine Angst mehr zu haben brauchten. „Nun können wir endlich aus den Schatten treten“, hatte man uns verkündet, „denn ihr habt nichts mehr von uns zu befürchten. Wir können harmonisch mit euch zusammenzuleben. Wir müssen nicht mehr von euch trinken, um zu überleben.“
Sie können sich sicher lebhaft vorstellen, wie hoch in jener Nacht die Einschaltquoten waren und welch ein Aufschrei danach um die Welt ging. Die Reaktionen auf das Coming-out variierten beträchtlich, je nach Situation in den jeweiligen Nationen.
Am schlechtesten erging es den Vampiren in den mehrheitlich islamischen Nationen. Was mit dem Sprecher der Vampire in Syrien geschah, will ich Ihnen lieber gar nicht erzählen, auch wenn der weibliche Vamp, der in Afghanistan vor die Kameras getreten war, einen vielleicht noch schrecklicheren – und endgültigen – Tod starb. (Was hatten die sich eigentlich dabei gedacht? Ausgerechnet in Afghanistan eine Frau für diesen Job abzustellen. Vampire können so clever sein, aber was die Welt von heute angeht, scheint es manchmal, als könnten sie nicht bis drei zählen!)
Manche Nationen – hier möchte ich besonders Frankreich, Deutschland und Italien nennen – weigerten sich, die Vampire als gleichberechtigte Bürger anzuerkennen. Andere Nationen – unter anderem Bosnien-Herzegowina, Argentinien und ein Großteil der afrikanischen Länder – verweigerten den Vampiren überhaupt jeglichen Status und gaben sie als Beute für jeden Kopfgeldjäger frei. Aber Amerika, England, Mexiko, Kanada, Japan, die Schweiz und die skandinavischen Länder entschieden sich für eine tolerante Haltung.
Es lässt sich schwer sagen, ob die Vampire mit einer solchen Reaktion gerechnet hatten oder nicht. Sie haben nach wie vor damit zu kämpfen, unter den Lebenden wirklich Fuß zu fassen, weswegen sie um alles, was ihre Selbstorganisation und ihre Verwaltungsstrukturen betrifft, immer noch ein großes Geheimnis machen. Einzelheiten wie die, die Bill mir eben genannt hatte, hatte ich in einer solchen Fülle noch nie zu hören bekommen.
„Du arbeitest also im Auftrag der Königin von Louisiana an einem geheimen Projekt“, sagte ich langsam, wobei ich mich bemühte, möglichst neutral zu klingen. „Deswegen verbringst du seit ein paar Wochen jede wache Minute ausschließlich an deinem Computer.“
„Ja“, sagte Bill. Er setzte die Flasche TrueBlood an die Lippen, konnte ihr aber nur ein paar letzte Tropfen entlocken, weswegen er sich den Flur hinab in den kleinen Küchenbereich seines Hauses begab (als Bill das alte Haus seiner Familie hatte umbauen lassen, hatte er auf eine Küche weitgehend verzichtet, denn er benötigte ja keine), um sich eine weitere Flasche aus dem Kühlschrank zu nehmen. Ich hörte, wie er die Flasche öffnete und in die Mikrowelle schob – also wusste ich auch, wo er sich gerade aufhielt. Jetzt klingelte die Mikrowelle; Bill kam zu mir ins Wohnzimmer zurück, wobei er die offene Flasche, den Daumen oben auf der Öffnung, kräftig durchschüttelte, um alles gut zu mischen.
„Wie lange wirst du denn noch mit dieser Sache befasst sein?“, wollte ich wissen, keine unangemessene Frage, wie mir schien.
„So lange ich dazu brauche“, entgegnete Bill, und das war als Antwort schon weitaus unangemessener. Wenn ich es genau nahm, waren seine Worte sogar eindeutig dazu angetan, mich wütend zu machen.
Hmmm … waren unsere Flitterwochen etwa schon vorbei? Wörtlich meine ich das nicht mit den Flitterwochen, denn da Bill Vampir ist, dürfen wir nach dem Gesetz gar nicht heiraten; praktisch nirgendwo auf der Welt.
Nicht, dass Bill je um meine Hand angehalten hätte!
„Wenn dein Vorhaben dich so sehr beschäftigt“, sagte ich langsam und vorsichtig, „dann bleibe ich vielleicht lieber weg, solange du damit befasst bist.“
„Das wäre vielleicht wirklich das Beste“, erwiderte Bill nach einer merklichen Pause, und mir war, als hätte er mir einen Schlag in die Magengrube verpasst. Blitzschnell stand ich auf und zog meinen Mantel über die Uniform, die ich als Kellnerin trug, wenn es Winter war: lange schwarze Hosen und dazu ein langärmliges weißes T-Shirt mit geradem Ausschnitt und dem aufgestickten Schriftzug „Merlottes“ über der linken Brust. Rasch wandte ich Bill den Rücken zu. Mein Gesicht sollte er jetzt nicht sehen dürfen!
Ich wollte auf gar keinen Fall weinen – also drehte ich mich auch dann nicht zu meinem Liebsten um, als ich dessen Hand auf meiner Schulter spürte.
„Ich muss dir etwas sagen“, sagte Bill mit seiner kalten, glatten Stimme.
Ich hatte gerade begonnen, mir die Handschuhe überzustreifen, eine Tätigkeit, die ich nun einstellte, auch wenn ich Bill immer noch nicht ansah. Ich wusste nicht, ob ich seinen Anblick ertragen hätte. Was er zu sagen hatte, würde er meiner Rückansicht mitteilen müssen.
„Wenn mir irgendetwas zustößt“, fuhr er fort (und da hätte ich eigentlich stutzig werden müssen, da hätte ich anfangen müssen, mir Sorgen zu machen), „wenn mir etwas zustößt, dann musst du das Versteck aufsuchen, das ich mir in deinem Haus eingerichtet habe. Eigentlich solltest du da meinen Computer sowie einige Disketten vorfinden. Sag niemandem etwas davon. Sollte der Rechner nicht im Versteck sein, dann sieh bitte hier im Haus nach, ob er hier ist. Komm tagsüber. Komm bewaffnet. Nimm den Computer und alle Disketten, die du finden kannst, und verstecke sie in der Fluchthöhle, wie du mein Versteck ja immer nennst.“
Ich nickte. Das konnte Bill auch von hinten unmöglich übersehen. Meiner Stimme mochte ich einfach nicht trauen.
„Falls ich in – falls ich, sagen wir mal, in acht Wochen noch nicht zurück bin und du auch nichts von mir gehört hast, dann gehst du zu Eric, erzählst ihm alles, was ich dir heute gesagt habe, und stellst dich unter seinen Schutz.“
Ich sagte gar nichts. Noch war ich zu erschüttert, zu traurig, um wütend zu werden, aber lange würde es nicht mehr dauern, bis bei mir die Sicherung durchbrannte. Mit einem heftigen Nicken, bei dem mir mein Pferdeschwanz mehrmals den Nacken streifte, nahm ich Bills Worte zur Kenntnis.
„Ich werde bald schon nach … Seattle aufbrechen“, fuhr Bill fort. Seine kalten Lippen streiften die Stelle in meinem Nacken, gegen die zuvor mein Pferdeschwanz geschlagen war.
Er log.
„Wir reden, wenn ich wieder da bin.“
Nach einer berauschenden Perspektive hörte sich das nicht an. Im Gegenteil: Es klang unheilvoll.
Ich neigte erneut den Kopf; sprechen konnte ich nach wie vor nicht, denn inzwischen kullerten bei mir auch die Tränen. Eher wollte ich sterben, als Bill sehen lassen, dass ich weinte!
So verließ ich ihn – in jener kalten Dezembernacht.
* * *
Am nächsten Tag fuhr ich auf dem Weg zur Arbeit einen Umweg, was keine gute Idee war. Ich war in einer Stimmung, die einen dazu bringt, extra Dinge zu tun, die einem beweisen, dass das Leben ein Jammertal ist. Ich hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan und fühlte mich eigentlich schon schlecht genug; trotzdem beharrte eine innere Stimme darauf, dass sich die Dinge problemlos auch noch schlimmer machen ließen; ich brauchte lediglich die Magnolia Creek Road entlangzufahren. Natürlich tat ich das dann auch.
Belle Rive, das uralte Anwesen der Bellefleurs, glich einem Ameisenhaufen: Selbst an diesem kalten, unwirtlichen Tag wurde überall geschäftig gearbeitet. In der Auffahrt dieses noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg stammenden prächtigen Hauses parkten der Wagen einer Schädlingsbekämpfungsfirma, der Firmenwagen eines Kücheneinrichters und der Lastwagen einer Tischlerei. Für Caroline Holliday Bellefleur, die uralte Dame, die seit gut achtzig Jahren über Belle Rive herrschte (und zu einem Gutteil noch dazu über ganz Bon Temps), war das Leben derzeit eitel Freude und Betriebsamkeit. Ich fragte mich, was ihre Enkel, die Anwältin Portia und der Polizist Andy, von all den Veränderungen halten mochten, die in Belle Rive vonstatten gingen. Die beiden hatten ihr gesamtes Leben als Erwachsene im Haus ihrer Großmutter verbracht (genau wie ich). Wahrscheinlich freuten sie sich zumindest darüber, dass die alte Dame an der Renovierung ihres alten Prachtbaus so viel Freude hatte.
Meine eigene Großmutter war wenige Monate zuvor umgebracht worden.
Womit die Bellefleurs natürlich nicht das Geringste zu tun gehabt hatten. Noch dazu hatten weder Andy noch Portia Grund, ihre Freude am neu gewonnenen Reichtum ihrer Familie mit mir zu teilen. Im Gegenteil; beide mieden mich wie die Pest. Sie standen tief in meiner Schuld, was sie auf den Tod nicht ausstehen konnten. Dabei ahnten sie nicht einmal, wie viel sie mir schuldeten!
Den Bellefleurs war eine mysteriöse Erbschaft in den Schoß gefallen. Irgendwo in Europa war ein Verwandter von ihnen auf „geheimnisvolle Weise“ ums Leben gekommen – so hatte Andy das einem befreundeten Polizisten erklärt, mit dem er manchmal im Merlottes zusammenhockte. Als dann Maxine Fortenberry eines Tages Lose für eine Benefizveranstaltung der Frauenvereinigung der Gethsemane Baptist Church bei uns vorbeibrachte, wusste sie zu berichten, dass Caroline Bellefleur sämtliche Familiendokumente, derer sie irgend hatte habhaft werden können, genau, aber vergeblich studiert hatte, um den Wohltäter zu identifizieren: Das Glück, das ihrer Familie widerfahren war, schien der alten Dame immer noch völlig unerklärlich.
Das hinderte die Matriarchin jedoch nicht daran, das Geld mit vollen Händen auszugeben.
Selbst Terry Bellefleur, ein Vetter Andys und Portias, besaß seit kurzem einen funkelnagelneuen Pick-up, der die ungepflasterte Auffahrt zu seinem extrabreiten Wohnwagen zierte. Terry, einen Vietnamveteranen mit zahlreichen inneren und äußeren Narben, der nicht viele Freunde hatte und im Merlottes als Koch und Barmann aushalf, hatte ich sehr gern. Seinen neuen fahrbaren Untersatz neidete ich ihm ganz ehrlich nicht.
Aber irgendwie musste ich an die Auspuffanlage denken, die ich unlängst bei meinem alten Auto hatte ersetzen müssen. Die Rechnung dafür hatte ich umgehend und vollständig beglichen, auch wenn ich versucht gewesen war, Jim Downey zu bitten, sich erst einmal mit der Hälfte als Anzahlung zu begnügen und mir zu gestatten, den Rest in zwei Monatsraten abzustottern. Jim hatte jedoch Frau und drei Kinder, da mochte ich ihn nicht fragen. Erst an diesem Morgen hatte ich mir vorgenommen, meinen Chef, Sam Merlotte, anzusprechen: Er sollte mich für mehr Schichten als bisher eintragen. Wenn Sam mich gebrauchen konnte, sprach wahrlich nichts dagegen, mein Leben mehr oder weniger im Merlottes zu verbringen, nun, wo Bill nach „Seattle“ gereist war. Das Geld konnte ich jedenfalls gut gebrauchen.
Ich ließ Belle Rive hinter mir, bemüht, nicht allzu bittere Gedanken zu hegen. Dann verließ ich unsere Stadt in südlicher Richtung und bog auf dem Weg ins Merlottes nach links in die Hummingbird Road ein. Ich versuchte mir einzureden, alles sei in Ordnung: Bestimmt würde Bill nach seiner Rückkehr aus Seattle (oder wo immer er sein mochte) wieder mein leidenschaftlicher Liebhaber werden; bestimmt würde er mich anbeten wie früher, würde dafür sorgen, dass ich mich geliebt und wertgeschätzt fühlte. Dass ich wieder das Gefühl hätte, zu jemandem zu gehören, und nicht einsam und allein in der Welt zu stehen.
Natürlich hatte ich immer noch meinen Bruder Jason. Der aber, musste ich mir fairerweise eingestehen, zählte nicht wirklich, wenn es um Intimität und Kameradschaft ging.
Tief in mir jedoch spürte ich unverkennbar den Schmerz darüber, zurückgewiesen worden zu sein. Diesen Schmerz kannte ich so gut, dass er sich anfühlte wie eine zweite Haut.
Wie sehr es mir doch zuwider war, erneut in diese Haut schlüpfen zu müssen!
Kapitel 2
Ich hatte gerade noch einmal die Türklinke heruntergedrückt, um zu überprüfen, ob die Haustür auch wirklich abgeschlossen war, und wandte mich zum Gehen – da sah ich aus den Augenwinkeln heraus auf der Hollywoodschaukel, die meine Vorderveranda ziert, eine Gestalt hocken. Mit Mühe unterdrückte ich einen Schrei, sah genauer hin und erkannte, wer dort saß.
Ich trug an dem Abend einen schweren Wintermantel, mein Besucher ein kurzärmliges T-Shirt. Aber das wunderte mich nicht.
„El …“, setzte ich an, unterbrach mich dann aber selbst. Das war ja gerade noch einmal gut gegangen! „Bubba!“, fuhr ich fort, ganz beiläufig, ganz sorglos, „Wie geht’s denn so?“ Ich bemühte mich zumindest, gelassen und sorglos zu klingen, aber es gelang mir nicht wirklich. Bubba ist aber nicht der Hellste und bekam gar nicht mit, wie mir zumute war. Die Vampire geben zu, dass es ein Fehler war, ihn damals zu zeugen, als er bis zum Stehkragen mit Drogen vollgepumpt an der Schwelle des Todes stand. In der Nacht, in der man ihn ins Leichenschauhaus eingeliefert hatte, war einer der dort diensthabenden Angestellten zufällig ein Untoter gewesen; noch dazu ein begeisterter Fan. Dieser hatte in aller Eile einen nicht gerade wohldurchdachten, ziemlich komplizierten Plan entwickelt, zu dessen Durchführung auch der ein oder andere Mord notwendig gewesen war. Mit Hilfe dieses Plans war der illustre Mann gezeugt – zum Vampir gemacht – worden. Aber leider, müssen Sie wissen, läuft das nicht immer glatt. Seit damals wird er herumgereicht wie das Mitglied einer königlichen Familie, das nicht alle Tassen im Schrank hat. Im letzten Jahr war Louisiana für seine Unterbringung zuständig gewesen.
„Miss Sookie, wie geht’s, wie steht’s?“ Immer noch klang seine Aussprache breit und nuschelnd, immer noch war sein Gesicht auf pummelige Art sehr attraktiv. Eine Locke des dichten, schwarzen Haars fiel ihm scheinbar zufällig in die Stirn, eine Frisur, die achtlos schien, in Wirklichkeit aber harte Arbeit erforderte. Die dicken Koteletten waren gebürstet. Irgendein untoter Fan hatte dafür gesorgt, dass Bubba an diesem Abend geschniegelt und gebügelt unter die Leute kam.
„Mir geht es gut, vielen Dank“, sagte ich höflich und strahlte über das ganze Gesicht. Ich strahle immer, wenn ich nervös bin. „Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit“, fügte ich hinzu, während ich mich fragte, ob es mir eventuell möglich sein würde, einfach in mein Auto zu klettern und davonzufahren, aber bereits ahnte, dass das wohl eher nicht der Fall sein dürfte.
„Miss Sookie, man hat mich hierher geschickt, um auf Sie aufzupassen.“
„Ach ja? Wer hat dich denn geschickt?“
„Eric!“, erwiderte Bubba stolz. „Ich war der Einzige im Büro, als der Anruf kam. Eric hat gesagt, ich soll meinen Arsch hierher schaffen.“
„Warum denn? Welche Gefahr droht mir denn?“ Ängstlich spähte ich in den Wald, der mein Haus umstand. Bubbas Worte hatten mich unruhig gemacht.
„Das weiß ich nicht. Eric sagte nur, ich soll auf Sie aufpassen, bis einer von denen aus dem Fangtasia hier sein kann. Eric oder Chow oder Miss Pam oder vielleicht sogar Clancy. Wenn Sie zur Arbeit wollen, dann fahre ich mit Ihnen und kümmere mich um jeden, der Sie belästigt.“
Jegliche weitere Befragung wäre fruchtlos gewesen. Ich hätte Bubbas armes Spatzenhirn nur sinnlos gequält. Damit hätte ich ihn lediglich verärgert, und ein ärgerlicher Bubba, glauben Sie mir, ist kein angenehmer Anblick. Von daher musste man auch stets peinlich darauf bedacht sein, nie seinen alten Namen zu nennen – selbst wenn er sang, was von Zeit zu Zeit vorkam und einen unweigerlich an den erinnerte, der er einstmals gewesen war.
„Mit in die Bar kannst du aber nicht kommen“, teilte ich dem Vampir unumwunden mit. Das wäre das reinste Desaster! Die Gäste im Merlottes sind durchaus daran gewöhnt, von Zeit zu Zeit einen Vampir hereinschneien zu sehen, das ja, aber ich konnte schließlich nicht vorher jeden einzelnen Besucher warnen und alle bitten, nur ja nicht den bewussten Namen in den Mund zu nehmen. Eric war wohl mit seinem Latein ziemlich am Ende gewesen; in der Regel sorgte die Vampirgemeinde dafür, dass Fehler wie Bubba sich nicht in der Öffentlichkeit herumtrieben. Manchmal gelang es Bubba, sich davonzustehlen und eigene Wege zu gehen. Dann wurde „ER“ gesehen, und die Regenbogenpresse geriet regelmäßig schier aus dem Häuschen.
„Könntest du nicht im Wagen sitzen bleiben, während ich arbeite?“, schlug ich vor. Die Kälte würde Bubba ja nichts ausmachen.
„Das ist zu weit weg, ich muss näher dran sein“, erwiderte mein Wächter, und das hörte sich nicht so an, als wolle er darüber diskutieren.
„Was hältst du vom Büro meines Chefs? Das befindet sich direkt neben der Bar. Dort kannst du mich hören, wenn ich um Hilfe rufe.“
Das schien Bubba nicht wirklich zufriedenzustellen, letztlich aber nickte er zustimmend. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich die Luft angehalten hatte: Erleichtert atmete ich aus. Am einfachsten wäre die Sache für mich gewesen, wenn ich gleich zu Hause bleiben und mich bei Sam telefonisch hätte krank melden können. Aber mein Chef rechnete fest damit, dass ich auftauchte, und was noch wichtiger war: Ich brauchte den Lohn.
Mit Bubba auf dem Beifahrersitz neben mir kam mir mein Auto sehr klein vor. Holpernd fuhren wir vom Grundstück, und ich nahm mir fest vor, die Leute vom Kieswerk zu benachrichtigen und sie zu bitten, auf meiner Auffahrt, die sich unendlich lang durch den Wald schlängelte, neuen Kies aufzuschütten. Den Auftrag strich ich im Geiste aber gleich wieder. Momentan konnte ich mir das nicht leisten. Es würde bis zum nächsten Frühjahr warten müssen – oder gar bis zum Sommer.
Von meiner Auffahrt bogen wir nach rechts auf die Landstraße ein, um die paar Kilometer bis zum Merlottes zurückzulegen. Im Merlottes arbeite ich als Kellnerin, wenn ich nicht gerade schwer geheimnisvolle Dinge für die Vampire erledige. Wir hatten die halbe Strecke bereits zurückgelegt, als mir bewusst wurde, dass ich einen Wagen, mit dem Bubba hätte zu mir herausgefahren sein können, gar nicht gesehen hatte. Ob er geflogen war? Manche Vampire konnten das. Bubba war zwar der unbegabteste Vampir, den ich bislang zu Gesicht bekommen hatte, aber es mochte ja durchaus sein, dass er für diese eine Sache ein besonderes Händchen hatte.
Noch vor einem Jahr hätte ich mich bei meinem Fahrgast danach erkundigt. Jetzt stelle ich solche Fragen nicht mehr. Mittlerweile bin ich es gewöhnt, mit Untoten zusammen zu sein. Obwohl ich mitnichten selbst Vampirin bin! Ich bin Telepathin. Mein Leben war die Hölle auf Erden, bis ich einen Mann kennenlernte, dessen Gedanken ich nicht lesen konnte. Leider konnte ich dessen Gedanken nur deswegen nicht lesen, weil er bereits tot war. Trotzdem waren Bill und ich nun einige Monate lang ein Paar gewesen, und bis vor kurzem hatte ich unsere Beziehung als wunderbar erlebt. Die anderen Vampire brauchen mich. Ich bin also sicher bei ihnen – bis zu einem gewissen Grad. Meist. Manchmal.
Im Merlottes schien, als ich dort ankam, nicht viel los zu sein: Der Parkplatz wirkte halbleer. Sam hatte das Lokal etwa fünf Jahre zuvor erworben. Die Geschäfte waren damals nicht besonders gut gelaufen, was daran liegen mochte, dass die Bar draußen vor der Stadt lag, mitten in einem dichten Wald, der etwas bedrohlich die Ränder des Parkplatzes bestand. Vielleicht war es dem Vorbesitzer auch einfach nie gelungen, die richtige Mischung hinzubekommen: die richtigen Drinks, das richtige Essen, die richtige Bedienung.
Sam hatte es irgendwie geschafft, das Ruder herumzureißen und das Lokal in ein gutgehendes Etablissement umzuwandeln, nachdem er es umbenannt und gründlich renoviert hatte. Mittlerweile konnte mein Chef gut davon leben. Aber dieser Tag war ein Montag; montags pflegt man bei uns in der Gegend, im nördlichen Louisiana, nicht auszugehen, um etwas zu trinken. Ich bog in den Parkplatz für Angestellte ein, direkt vor Sams Wohnwagen, der wiederum im rechten Winkel direkt neben dem Lieferanteneingang des Lokals steht. Rasch sprang ich vom Fahrersitz, eilte durch unseren Lagerraum und spähte dann durch das Glasfenster der Tür zum Durchgangsflur, von dem wiederum die Türen zu den Klos und zu Sams Büro abgehen. Der Flur war leer. Gut. Als ich an Sams Tür klopfte, saß mein Chef gerade am Schreibtisch. Das war noch besser.
Sam ist kein besonders großer Mann, aber er ist sehr muskulös und kräftig. Er hat rötlich blondes Haar, blaue Augen und ist ungefähr drei Jahre älter als ich. Ich bin sechsundzwanzig. Ich arbeite nun wohl etwa drei Jahre für Sam. Ich mag meinen Chef, der sogar in ein paar meiner Lieblingsphantasien eine wichtige Rolle zu spielen pflegte, bis er vor ein paar Monaten eine Zeitlang mit einem wunderschönen, aber leider sehr mordlüsternen Wesen liiert war. Damals war meine Begeisterung für meinen Chef ein wenig verblasst. Aber er ist und bleibt mein Freund, daran kann kein Zweifel bestehen.
„’tschuldigung, Sam?“, sagte ich, wobei ich grinste wie ein idiotisches Honigkuchenpferd.
„Was gibt’s?“ Sam schlug den Katalog des Gaststättenausstatters zu, in dem er geblättert hatte.
„Ich muss hier drin eine Weile jemanden unterbringen.“
Sam wirkte nicht erbaut. „Wen denn? Ist Bill wieder da?“
„Nein, der ist noch auf Reisen.“ Mein Lächeln wurde noch strahlender. „Aber die haben einen anderen Vampir geschickt, der auf mich aufpassen soll. Ich muss den hier abstellen, während ich arbeite, wenn du nichts dagegen hast.“
„Wozu brauchst du denn einen Aufpasser, und warum kann er sich nicht einfach zu den anderen Gästen setzen? Genug TrueBlood ist da.“ Die synthetische Blutmarke TrueBlood hatte langsam, aber sicher den rivalisierenden Markenprodukten den Rang abgelaufen und stand nun als Nummer eins auf dem Markt für Ersatzblut da. „Fast so gut wie der Stoff, aus dem das Leben ist“ – das war der Slogan der ersten Werbekampagne der Firma gewesen, die ganz offensichtlich bei den Vampiren sehr gut angekommen war.
Ich hörte einen leisen Laut hinter mir und seufzte. Offenbar wurde Bubba bereits ungeduldig.
„Ich hatte dich doch gebeten …“ Ich wollte mich tadelnd zu meinem Begleiter umwenden, aber dazu kam ich gar nicht mehr. Eine Hand packte mich unsanft bei der Schulter, riss mich herum, und dann fand ich mich einem Mann gegenüber, den ich vorher noch nie zu Gesicht bekommen hatte und der gerade die Faust ballte, um mir einen kräftigen Schlag mitten ins Gesicht zu versetzen.
Die Wirkung des Vampirbluts, das ich vor einigen Wochen zu mir genommen hatte (um mein Leben zu retten, das möchte ich gleich klarstellen!), ließ zwar bereits nach – ich schimmere wirklich kaum noch im Dunkeln –, aber ich war immer noch schneller als die meisten Menschen. Ich ließ mich zu Boden fallen und rollte wie eine Kugel gegen die Beine meines Gegners. Der geriet ins Stolpern, wodurch es wiederum Bubba leichter fiel, sich den Mann zu schnappen und ihm den Hals umzudrehen.
Mühsam rappelte ich mich wieder auf die Beine. Sam kam aus dem Büro gestürzt. Sam und ich starrten einander an; dann starrten wir auf Bubba, dann auf den toten Mann.
Na, da saßen wir ja ganz schön in der Patsche!
„Ich habe ihn umgebracht!“, verkündete Bubba stolz. „Ich habe Sie gerettet, Miss Sookie!“
Wenn der Mann aus Memphis plötzlich bei einem in der Kneipe auftaucht, wenn man dann feststellen muss, dass er Vampir geworden ist und kurz darauf zusehen darf, wie er einen Möchtegernangreifer ganz einfach umbringt – dann ist das ziemlich viel auf einmal. Selbst für Sam, der ja selbst mehr ist, als es nach außen hin den Anschein hat.
„Das hast du wirklich getan“, lobte Sam Bubba mit sanfter, beruhigender Stimme. „Weißt du denn auch, wen du da umgebracht hast?“
Ehe ich Bill kennenlernte (der selbst rein technisch gesehen tot ist), kannte ich Tote (tote Menschen, meine ich) nur aus dem Bestattungsinstitut, schön zurechtgemacht, damit Freunde und Verwandte von ihnen Abschied nehmen konnten.
Jetzt scheine ich ziemlich häufig einfach so irgendwelche Leichen zu Gesicht zu bekommen. Gut, dass ich nicht zimperlich bin!
Diese spezielle Leiche mochte etwa vierzig Jahre alt sein – vierzig Jahre, von denen offenbar kein einziges leicht gewesen war. Die Arme des Mannes waren über und über mit meist sehr primitiven Tätowierungen von der Art, die man sich im Knast von Mithäftlingen anfertigen lassen kann, bedeckt. Noch dazu fehlten der Leiche ein paar Zähne. Sie trug die Kluft, bei der ich stets an Rocker denken muss: speckige Jeans und eine Lederweste über einem T-Shirt mit obszönem Aufdruck.
„Was steht hinten auf der Weste?“, wollte Sam wissen, als sei das für ihn von großer Bedeutung.
Gehorsam hockte Bubba sich hin und drehte den Mann auf die Seite. Der Anblick einer lose am Handgelenk baumelnden Hand, der sich mir bei dieser Gelegenheit bot, brachte meinen Magen leicht in Aufruhr. Trotzdem zwang ich mich, mir die Weste aufmerksam anzusehen. Ein Wolfskopf im Profil zierte sie, die Schnauze gehoben, heulend. Das Ganze als Silhouette vor einem weißen Kreis, der wohl – so nahm ich an – den Mond darstellen sollte. Sam wirkte beim Anblick dieser Embleme womöglich noch besorgter als zuvor schon. „Werwolf“, sagte er, und sein Tonfall klang angespannt. Werwolf – das erklärte einiges.
Es war viel zu kalt, um nur mit einer Weste bekleidet herumzulaufen – es sei denn, man war Vampir. Zwar ist die Körpertemperatur beim Werwolf höher als beim Menschen, aber die meisten Werwölfe sind trotzdem peinlich darauf bedacht, bei kaltem Wetter einen Mantel zu tragen. Ihre Gemeinschaft lebt noch im Geheimen. Das Gros der Menschen (mit Ausnahme einiger Glückspilze, zu denen außer mir wohl noch ein paar hundert zählten) hatte keine Ahnung von ihrer Existenz. Ich fragte mich, ob der Tote wohl einen Mantel im Gastraum hängen hatte, an der Garderobe gleich neben dem Eingang. Das hätte bedeutet, dass er sich hier im hinteren Bereich bei den Herrentoiletten versteckt gehalten hatte, um mein Auftauchen abzuwarten. Vielleicht war er auch dicht hinter mir durch den Hintereingang hereingekommen, was hieße, dass sich sein Mantel wohl in seinem Wagen befand.
„Hast du ihn hereinkommen sehen?“, fragte ich Bubba, wobei ich mir eingestehen musste, dass mir vielleicht doch ein wenig schwummrig war.
„Ja, Ma’am. Er muss auf dem großen Parkplatz auf Sie gewartet haben. Er ist um die Ecke gebogen, aus seinem Auto gestiegen und ist nach hinten gegangen, etwa eine Minute nach Ihnen. Sie sind durch die Tür hier, er ist hinter Ihnen her, und ich bin ihm gefolgt. Sie hatten schwer Glück, dass Sie mich dabeihatten.“
„Vielen Dank. Du hast recht: Ich hatte Glück, dich dabeizuhaben. Was der Mann wohl mit mir vorhatte?“ Sobald ich darüber nachdachte, beschlich mich ein ganz kaltes Gefühl. War er einfach auf der Suche nach einer Frau gewesen, die er sich schnappen konnte, weil sie allein unterwegs war? Oder hatte er es speziell auf mich abgesehen gehabt? Diese Überlegungen, wurde mir rasch bewusst, waren ziemlich müßig: Da Eric beunruhigt genug gewesen war, mir einen Leibwächter zukommen zu lassen, musste er gewusst haben, dass irgendeine Bedrohung auf mich lauerte. Das schloss wohl aus, dass ich zufällig Opfer dieses Übergriffs geworden war.
Bubba stolzierte kommentarlos zur Tür hinaus, kehrte aber gleich darauf zurück.
„Vorn in seinem Auto hatte er Pflaster und Knebel“, wusste er zu berichten. „Da liegt auch sein Mantel. Den habe ich mitgebracht, wir sollten ihm lieber was unter den Kopf legen.“ Mit diesen Worten bückte er sich und schlang einen schweren Militärmantel um Kopf und Hals des Toten. Das war eine ziemlich gute Idee: Der Mann tropfte ein wenig. Sobald Bubba die Arbeit beendet hatte, leckte er sich genüsslich die Finger.
Mittlerweile zitterte ich wie Espenlaub. Sam legte den Arm um mich.
„Aber merkwürdig ist sie schon, diese Sache …“ Ich kam nicht dazu, meinen Satz zu beenden, denn nun sah ich, wie die Tür zwischen Flur und Gastraum langsam aufging, wobei ich einen Blick auf das Gesicht Kevin Pryors erhaschte. Kevin ist ein netter Kerl, aber er ist auch Bulle, und ein Polizist war das Letzte, was wir im Moment brauchen konnten.
„Die Toilette ist leider verstopft!“, verkündete ich rasch und schlug die Tür vor Kevins schmalem, bass erstaunten Gesicht zu. „Hört mal, Jungs“, wandte ich mich dann hastig an Sam und Bubba, „ich halte die Tür zu, und ihr schafft den Kerl in sein Auto, ja? Dann können wir uns später in aller Ruhe überlegen, was wir mit ihm tun wollen.“ Den Fußboden im Flur würde ich gründlich schrubben müssen. Als ich mich nun mit der Verbindungstür zum Gastraum befasste, konnte ich feststellen, dass diese sich verschließen ließ. Das war mir zuvor nie aufgefallen.
Sam wirkte nicht besonders glücklich. „Findest du nicht, wir sollten lieber die Polizei rufen, Sookie?“, wollte er wissen.
Noch vor einem Jahr hätte ich selbst schon die Hand am Hörer gehabt, um den Notruf zu verständigen, noch ehe die Leiche überhaupt den Boden berührt hatte! Aber das letzte Jahr war für mich ein einziger langer Lernprozess gewesen. Nun fing ich Sams Blick auf und deutete mit dem Kinn auf Bubba. „Wie soll der mit Knast fertig werden?“, murmelte ich ganz leise. Bubba summte gerade die ersten Takte von „Blue Christmas“. „Von uns beiden ist keiner stark genug, um eine solche Tat begehen zu können.“ Ich deutete auf die Leiche.
Einen Moment lang schien Sam zu schwanken; dann schickte er sich in das Unvermeidliche und nickte widerstrebend. „Okay, Bubba, dann wollen wir beide den Typen hier mal raus zu seinem Auto schaffen.“
Ich rannte los, um einen Putzlappen zu holen, während die beiden Männer – na ja: der Vampir und der Gestaltwandler – den Rockerknaben zur Hintertür hinaustrugen. Als Sam und Bubba zurückkehrten – mit ihnen ein Hauch kalter Winterluft –, hatte ich den Fußboden im Flur und in der Männertoilette bereits gewischt, so wie ich es auch getan hätte, wäre die Toilette wirklich verstopft gewesen und übergelaufen. Im Flur hatte ich noch dazu ein wenig Raumspray versprüht, um insgesamt die Luftqualität zu verbessern.
Nur gut, dass wir so schnell gewesen waren: Kaum hatte ich die Tür zur Bar entriegelt, da stieß Kevin sie auch schon auf.
„Hier hinten alles so weit in Ordnung?“, wollte er wissen. Kevins Sport ist Laufen, von daher hat er kein Gramm Fett am Leibe. Besonders groß ist er auch nicht. Noch dazu ähnelt er ein wenig einem Schaf und lebt immer noch im Haus seiner Mutter. Aber ganz gleich, wie er rein äußerlich wirken mag: Dumm ist Kevin gewiss nicht. Früher hatte ich ihm manchmal beim Denken zugehört; seine Überlegungen hatten sich immer entweder um Polizeiarbeit gedreht oder um Kenia Jones, die schwarze Amazone, seine Streifenwagen-Partnerin. Momentan jedoch, musste ich feststellen, drehten sich seine Gedanken eher um uns hier im Flur und unser Verhalten, das ihm verdächtig vorkam.
„Ich glaube, wir haben es reparieren können“, antwortete Sam. „Pass aber auf, ja? Der Boden ist nass, wir haben gerade gewischt. Nicht, dass du mich womöglich noch verklagst!“ Bei diesen Worten warf er Kevin ein strahlendes Lächeln zu.
„Ist jemand bei dir im Büro?“, fragte Kevin und wies mit dem Kinn auf Sams geschlossene Bürotür.
„Einer von Sookies Freunden“, antwortete Sam.
„Na, ich geh mal lieber an die Arbeit – bisschen Alkohol unter die Leute bringen“, verkündete ich munter und grinste die beiden Männer an, während ich mit einer Hand oben auf meinem Kopf überprüfte, ob mein Pferdeschwanz noch richtig saß. Dann suchte ich das Weite, so schnell mich meine Reeboks trugen. Der Gastraum war fast leer, und die Kollegin, die ich ablösen sollte (Charlsie Tooten), wirkte bei meinem Anblick ziemlich erleichtert.
„Nichts los hier heute“, murmelte sie. „Die Typen an Tisch sechs halten sich jetzt schon über eine Stunde an einem einzigen Krug Bier fest, und Jane Bodehouse hat wirklich jeden Mann angebaggert, der reingekommen ist. Kevin kritzelt schon den ganzen Abend irgendwas in ein Notizbuch.“
Rasch warf ich einen Blick hinüber zum einzigen weiblichen Gast des Abends, bemüht, mir nicht anmerken zu lassen, wie zuwider mir der Anblick war. Wo Alkohol ausgeschenkt wird, da sammeln sich unweigerlich auch Trinker, jede Kneipe kriegt ihr Quantum davon ab. Sie kommen, sobald man aufmacht, und gehen erst, wenn man schließt. Jane Bodehouse war eine unserer Alkis. Für gewöhnlich trank Jane zu Hause, aber alle zwei Wochen etwa kam es ihr in den Sinn, uns heimzusuchen und vielleicht einen Mann aufzugabeln. Das Aufgabeln gestaltete sich immer schwieriger. Jane war mittlerweile nicht nur weit über fünfzig, noch dazu merkte man ihr inzwischen die gut zehn Jahre an, in denen sie wenig geschlafen und sich schlecht ernährt hatte.
In jener Nacht sah ich gleich, dass Jane beim Schminken völlig danebengelegen hatte, was die tatsächlichen Umrisse ihres Mundes und ihrer Augen betraf. Das Resultat war bizarr und bedenklich. Wir würden wohl bald ihren Sohn anrufen und ihn bitten müssen, seine Mutter abzuholen. Dass Jane nicht mehr fahren konnte, hatte ich mit einem einzigen Blick festgestellt.
Ich dankte Charlsie mit einem Kopfnicken und winkte dann Arlene, meiner anderen Kollegin, die an einem der Tische mit ihrer neuen Flamme Buck Foley zusammenhockte, zu. Wenn Arlene sich einmal hingesetzt hatte, dann war wirklich Totentanz angesagt! Meine Kollegin winkte zurück, wobei die roten Locken fröhlich um ihr Gesicht tanzten.
„Wie geht’s den Kurzen?“, rief ich, während ich mich daranmachte, ein paar der Gläser wegzustellen, die Charlsie aus der Spülmaschine geräumt hatte. Eigentlich kam ich mir ganz normal vor – bis ich dann feststellte, dass meine Hände zitterten wie Espenlaub.
„Prima! Coby hat ein reines Einserzeugnis nach Hause gebracht, und Lisa war Siegerin im Buchstabierwettbewerb!“, gab meine Kollegin mit einem stolzen Lächeln zurück. Jeder, der mir weismachen wollte, eine vierfach geschiedene Frau könne unmöglich eine gute Mutter sein, wurde von mir an Arlene verwiesen. Weil ich meine Kollegin gernhabe, warf ich auch Buck an ihrer Seite ein Lächeln zu. Buck ist der perfekte Repräsentant für die Art von Mann, mit der Arlene sich gern einlässt: Sie sind allesamt nicht gut genug für sie.
„Ach wunderbar!“, erwiderte ich auf die schulischen Leistungen ihrer Kinder bezogen. „Die beiden schlagen ganz nach der Mama: kluge Köpfchen eben.“
„Hör mal, hat dieser Typ dich gefunden?“
„Was für ein Typ?“, fragte ich, obwohl ich das dumpfe Gefühl hatte, die Antwort bereits zu kennen.
„Der Rocker. Er fragte mich, ob ich die Kellnerin sei, die mit Bill geht. Für die hätte er nämlich was abzugeben.“
„Meinen Namen kannte er nicht?“
„Nein. Komisch, nicht? Oh Gott! Sookie! Wenn er deinen Namen nicht kannte, kann er unmöglich von Bill geschickt worden sein!“
Wenn Arlene so lange gebraucht hatte, sich das zurechtzulegen, dann hatte Coby seinen Grips ja vielleicht doch vom Vater. Egal: Ich liebe Arlene, weil sie so ist, wie sie ist, nicht ihres Verstandes wegen.
„Ja und? Was hast du ihm gesagt?“ Ich strahlte Arlene an, und zwar mit meinem nervösen Lächeln, nicht mit dem echten. Wenn ich mein nervöses Lächeln aufgelegt habe, dann bekomme ich das manchmal noch nicht einmal richtig mit.
„Ich sagte, mir sind Männer lieber, wenn sie noch warm sind und atmen.“ Arlene lachte. Manchmal konnte sie unglaublich taktlos sein. Ich nahm mir vor, demnächst einmal gründlich darüber nachzudenken, warum ich Arlene als Freundin betrachtete. „Nein, Dummchen, das habe ich doch nicht wirklich gesagt! Ich habe ihm lediglich mitgeteilt, dass du die Blondine bist, die um neun Uhr zur Schicht kommt.“
Herzlichen Dank, Arlene! Der Angreifer hatte also gewusst, wer ich war, weil meine beste Freundin mich ihm gegenüber identifiziert hatte. Er hatte weder meinen Namen gekannt noch gewusst, wo ich wohne. Ihm war lediglich bekannt gewesen, dass ich im Merlottes arbeitete und mit Bill Compton zusammen war. Ein klein wenig beruhigend fand ich das schon, aber nicht übermäßig.
Die nächsten drei Stunden schleppten sich träge dahin. Zwischendurch kam Sam aus dem Büro, um mir zuzuflüstern, er habe Bubba mit einer Zeitschrift und einer Flasche Life Support versehen, damit dieser etwas zum Lesen und zum Nippen hätte. Dann fing Sam an, hinter dem Tresen herumzuspuken. „Warum war der Typ wohl mit dem Auto unterwegs und nicht mit dem Motorrad?“, murmelte er leise vor sich hin. „Warum hat das Auto ein Nummernschild aus Mississippi?“ Sam verstummte, als Kevin an den Tresen trat. Der Polizist wollte wissen, ob wir nicht bald mal Janes Sohn Marvin benachrichtigen wollten, damit er seine Mutter abholte. Sam erledigte diesen Anruf gleich, in Kevins Beisein, und berichtete, Marvin werde innerhalb der nächsten zwanzig Minuten auftauchen. Daraufhin machte sich Kevin auf den Heimweg, das Notizbuch unter den Arm geklemmt. Neugierig fragte ich mich, ob der junge Mann wohl drauf und dran war, ein Dichter zu werden, oder ob er lediglich seinen Lebenslauf verfasste.
Die vier Männer, die lange versucht hatten, Jane zu ignorieren und dabei ihr Bier mit der Langsamkeit von vier Schildkröten zu trinken, hatten den Krug irgendwann einmal doch noch geleert und brachen auf, wobei jeder von ihnen einen Dollar auf dem Tisch liegen ließ. Das sollte wohl Trinkgeld sein. Die hatten ja wirklich die Spendierhosen an! Wenn ich nur solche Kunden hätte, dann würde ich nie genug Geld zusammenbekommen, um meine Auffahrt richten zu lassen.
Bis zur Sperrstunde verblieb uns noch eine halbe Stunde. Arlene hatte schon alle Arbeiten erledigt, die sie gewöhnlich zum Schichtende übernahm, und bat, mit Buck ein wenig früher gehen zu dürfen. Die Kinder waren noch bei Arlenes Mutter – das Paar würde Arlenes Wohnwagen eine kleine Weile für sich allein haben.
„Kommt Bill bald heim?“, fragte meine Kollegin, während sie ihren Mantel anzog. Buck redete derweil mit Sam über Fußball.
Ich zuckte die Achseln. Drei Nächte zuvor hatte Bill angerufen, um mir mitzuteilen, er sei gut in „Seattle“ eingetroffen und werde sich nun – mit wem auch immer – treffen. Woher der Anruf wirklich gekommen war, hatte ich nicht feststellen können: Die Rufnummer des Anrufers ließe sich nicht feststellen, teilte mir mein Telefon mit. Meiner Meinung nach sagte das viel darüber aus, wie die Dinge im Moment zwischen mir und Bill standen. Ich nahm die Rufnummernunterdrückung als ganz schlechtes Omen.
„Fehlt er dir?“ Arlene klang verschmitzt.
„Was denkst du denn?“, gab ich zurück. Ein leises Lächeln umspielte meine Mundwinkel – ein echtes diesmal. „Geh du bloß nach Hause und lass es dir gut gehen.“
„Buck ist der perfekte Partner für schöne Stunden!“ Arlene klang regelrecht lüstern!
„Wie schön für dich.“
Als Pam dann kam, war Jane Bodehouse der einzige noch verbliebene Gast im Merlottes, und Jane zählte kaum: Sie war ziemlich hinüber.
Pam ist Vampirin und Mitbesitzerin des Fangtasia, einer vorwiegend von Touristen frequentierten Bar in Shreveport. Sie ist Erics Stellvertreterin, blond, wahrscheinlich über 200 Jahre alt und verfügt wahrhaftig über Sinn für Humor, was man nun wirklich nicht von allen Vampiren behaupten kann. Soweit man überhaupt mit einem Vampir befreundet sein kann, ist sie die engste Vampirfreundin, die ich habe.
Sie saß auf einem Barhocker und sah mich über die schimmernde Holzfläche des Tresens hinweg an.
Das war ein ganz schlechtes Omen! Außerhalb des Fangtasia hatte ich Pam noch nie gesehen. „Was ist los?“, fragte ich zur Begrüßung. Dabei lächelte ich, verspannt bis in die Zehenspitzen.
„Wo ist Bubba?“, fragte sie in dem präzisen Tonfall, der ihr eigen ist. Dabei spähte sie mir über die rechte Schulter, als hoffte sie, den Vampir hinter mir stehen zu sehen. „Wenn Bubba den Weg hierher nicht gefunden hat, rastet Eric aus.“ Zum ersten Mal hörte ich den leichten Akzent, mit dem Pam sprach. Was für ein Akzent das war, hätte ich nicht sagen können. Vielleicht handelte es sich auch nur um Überreste eines altertümlichen Englisch.
„Hinten, in Sams Büro“, antwortete ich, den Blick unverwandt auf Pams Gesicht gerichtet. Ich wünschte mir, das Fallbeil würde rasch niedersausen. Ich wollte sofort wissen, was Sache war. Sam trat neben mich; ich stellte die beiden einander vor. Pam begrüßte meinen Chef interessierter, als sie jeden normalen Menschen begrüßt hätte (andere Menschen hätte sie unter Umständen gar nicht beachtet), denn Sam war Gestaltwandler. Beinahe erwartete ich, bei meiner Freundin auch sexuelles Interesse aufflackern zu sehen. Pam war Allesfresserin, was Sex betraf, und Sam ein höchst attraktives übernatürliches Wesen. Aber es funkte nicht. In den Gesichtern von Vampiren lässt sich schwer lesen. Dennoch gewann ich den Eindruck, Pam wirke eindeutig unglücklich.
„Komm schon, was ist?“, wiederholte ich meine Frage, nachdem wir alle drei eine Weile geschwiegen hatten.
Pam erwiderte meinen Blick. Wir sind beide blond und blauäugig – aber damit hört die Ähnlichkeit auch schon auf. Als würde man Hunde miteinander vergleichen: Alle gehören ein und derselben Tierart an, aber zwischen den einzelnen Rassen gibt es erhebliche Unterschiede. Pams Haar war glatt und hell, ihre Augen dunkel – und sie ruhten an diesem Abend voller Besorgnis auf mir. Sie warf Sam einen bedeutungsvollen Blick zu, woraufhin mein Chef sich, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, zu Jane und ihrem Sohn gesellte, um Marvin, einem ausgelaugt wirkenden Mann Mitte dreißig, behilflich zu sein, seine Mutter hinaus auf den Parkplatz zu manövrieren.
„Bill ist verschwunden“, sagte Pam dann unumwunden – ein Schuss aus der Hüfte sozusagen, was unsere Unterhaltung betraf.
„Er ist in Seattle“, widersprach ich heftig. Ich tat absichtlich so, als sei ich etwas begriffsstutzig. „Begriffsstutzig“ – auch dieses Wort stammte von meinem Vokabular-Kalender. An diesem Morgen gerade erst entdeckt, und schon konnte ich es anwenden.
„Er hat dich angelogen.“
Dazu sagte ich erst einmal gar nichts. Ich bat Pam mit einer Handbewegung, fortzufahren und sich näher zu erklären.
„Er war die ganze Zeit über in Mississippi. Er war nach Jackson gefahren.“
Ich starrte auf den Tresen mit seinen vielen, vielen Lackschichten. Dass Bill mich angelogen hatte, das hatte ich mir ja mehr oder weniger bereits allein zusammengereimt; dennoch tat es weh, entsetzlich weh, es nun so direkt ausgesprochen zu hören. Erst hatte er mich angelogen, und nun war er verschwunden.
„Na und? Was habt ihr jetzt vor? Wie wollt ihr ihn finden?“, fragte ich und war mir selbst zuwider, weil meine Stimme so schrecklich dünn klang.
„Wir suchen nach ihm. Wir tun, was wir können“, sagte Pam. „Aber die, die Bill haben – wer immer das sein mag –, könnten auch hinter dir her sein, Sookie. Deswegen hat Eric dir Bubba geschickt.“
Darauf konnte ich nichts erwidern, denn inzwischen rang ich mühsam darum, ein Mindestmaß an Fassung zu wahren und nicht zusammenzubrechen.
Sam war inzwischen zurückgekehrt – wahrscheinlich hatte er mir von Weitem schon angesehen, wie verwirrt ich war. Er trat dicht hinter mich und sagte: „Jemand hat heute Nacht versucht, Sookie auf dem Weg zur Arbeit zu entführen. Bubba hat sie gerettet. Die Leiche ist hinter dem Haus. Wir hatten vor, sie fortzuschaffen, sobald wir die Kneipe dichtgemacht haben.“
„Das geht ja schnell“, sagte Pam, wobei sie womöglich noch unglücklicher klang, als sie zuvor schon geklungen hatte. Sie musterte Sam mit einem abschätzenden Blick und nickte dann. Auch Sam war schließlich ein übernatürliches Wesen – das war fast so gut, als sei er ein Vampir; natürlich nur fast. „Ich werde mir den Wagen von dem Typen mal näher anschauen“, sagte sie dann. „Vielleicht kann ich ja irgendetwas herausfinden.“ Pam ging ganz selbstverständlich davon aus, dass wir uns eigenständig, ohne etwas Offizielles zu veranlassen, der Leiche entledigen wollten. Es fällt Vampiren schwer, die Autorität von Gesetzeshütern anzuerkennen und einzusehen, dass man notwendigerweise die Polizei verständigt, wenn ein Problem auftaucht. Zwar dürfen Vampire nicht zum Militär, Polizisten können sie aber werden, und diese Arbeit macht ihnen sogar höllischen Spaß. Untote Polizisten sind jedoch für alle anderen Vampire oft eher so etwas wie Angehörige einer niederen Kaste.
Wie gern hätte ich jetzt über die Rolle der untoten Polizisten bei der Polizei nachgedacht, statt mich damit zu beschäftigen, was Pam mir gerade mitgeteilt hatte.
„Seit wann ist Bill denn verschwunden?“, fragte Sam. Er schaffte es, seiner Stimme nichts anmerken zu lassen, aber ganz dicht unter der ruhigen Oberfläche, die er nach außen zur Schau stellte, brodelte Grimm.
„Eigentlich hätte er letzte Nacht nach Hause kommen sollen“, erklärte Pam. Ich fuhr auf: Das hatte ich nicht gewusst. Warum hatte Bill mir nicht gesagt, dass er nach Hause kommen wollte? „Geplant war, dass er nach Bon Temps fahren und uns im Fangtasia Bescheid geben würde, sobald er sicher dort eingetroffen war. Heute wollten wir uns dann mit ihm treffen.“ Für einen Vampir stellte das, was Pam da eben am Stück gesagt hatte, eine lange Rede dar – man hätte meine Vampirfreundin fast schon als schwatzhaft bezeichnen können. Pam zückte ihr Handy und gab eine Nummer ein; ich konnte die leisen Pieptöne hören, kurz darauf ihre Unterhaltung mit Eric. Nachdem Pam Eric alles Notwendige gesagt hatte, fügte sie noch hinzu: „Sie sitzt hier. Sie sagt nichts.“
Dann gab sie mir das Telefon. Ganz automatisch hielt ich es mir ans Ohr.
„Sookie, hörst du zu?“ Ich wusste, Eric konnte hören, wie mein Haar über die Sprechmuschel glitt, konnte meinen Atem hören, der als Flüstern an sein Ohr drang.
„Ich weiß, du hörst zu“, sagte er dann auch. „Hör gut zu und tu, was ich dir sage. Erzähle noch niemandem, was geschehen ist. Verhalte dich ganz normal, verbringe deine Tage so, wie du es für gewöhnlich tust. Einer von uns hat dich ständig im Auge, ob du es mitbekommst oder nicht. Wir werden selbst tagsüber einen Weg finden, dich zu bewachen. Bill werden wir rächen, und dich werden wir beschützen.“
Bill rächen? Also ging Eric davon aus, dass Bill tot war. Nun, nicht tot – nicht mehr existent.
„Ich wusste gar nicht, dass er letzte Nacht hätte nach Hause kommen sollen“, sagte ich, als sei das das Wichtigste von allem, was ich gerade erfahren hatte.
„Er hatte – schlechte Nachrichten, die er dir mitteilen wollte“, warf Pam plötzlich ein.
Eric hatte das mitbekommen und gab ein unzufriedenes Geräusch von sich. „Sag Pam, sie soll die Klappe halten“, befahl er, wobei er sich das erste Mal, seit ich ihn kannte, wütend anhörte. Ich fand es nicht notwendig, den Befehl weiterzugeben, da ich davon ausging, dass Pam Eric ebenfalls verstanden hatte. Die meisten Vampire hören außergewöhnlich gut.
„Ihr kanntet also die schlechten Nachrichten und wusstet, dass er zurückkommen wollte“, sagte ich. Nicht nur war Bill verschwunden und möglicherweise tot – für immer tot –, er hatte mich noch dazu belogen. Er hatte mir weder gesagt, wohin er in Wirklichkeit fahren wollte, noch, was er dort vorhatte, und hatte mir ein wichtiges Geheimnis vorenthalten, eines, das auch mich betraf. Der Schmerz über diesen Verrat ging so tief, dass ich die dazugehörige Wunde noch nicht einmal spüren konnte. Das jedoch – so wusste ich aus Erfahrung – würde sich nur zu rasch ändern.
Ich reichte das Telefon an Pam zurück, machte auf dem Absatz kehrt und verließ die Bar.
Draußen zögerte ich kurz, ehe ich in mein Auto stieg. Eigentlich hätte ich noch bleiben sollen, um zu helfen, die Leiche fortzuschaffen. Sam war kein Vampir und war überhaupt nur meinetwegen in die Sache hineingeraten. Es war ihm gegenüber nicht fair, einfach so zu verschwinden.
Aber letztlich zögerte ich höchstens eine Sekunde, dann fuhr ich los. Bubba konnte Sam helfen, und Pam – Pam, die alles wusste, während ich nichts wusste.
Eric behielt recht: Als ich zu Hause vorfuhr, erhaschte ich einen kurzen Blick auf ein Gesicht, das weiß zwischen den Bäumen schimmerte. Fast hätte ich meinem Beschützer einen Gruß zugerufen, denn ich hätte den Vampir gern gebeten, die Nacht über auf meiner Wohnzimmercouch Platz zu nehmen, aber dann dachte ich: nein! Ich musste ganz einfach allein sein. Nichts von dem, was hier geschah, hatte mit mir das Geringste zu tun. Es gab nichts, was ich unternehmen konnte; ich war verdammt dazu, untätig und passiv herumzuhängen, und dabei hatte ich nicht von mir aus bestimmt, dass ich unwissend bleiben wollte.
Ich war so verletzt und wütend, wie ich überhaupt nur sein konnte. Zumindest kam es mir so vor – später jedoch würde sich herausstellen, dass meine Einschätzung falsch gewesen war. Ich stürmte ins Haus und verriegelte hinter mir die Tür. Ein Schloss würde zwar keinen Vampir aufhalten – dafür aber die Tatsache, dass ich ihn nicht gebeten hatte einzutreten. Bis zum Morgengrauen würde der Vampir vor der Tür auch dafür sorgen, dass kein Mensch sich ins Haus wagte.
Ich zog mir meinen alten, langärmligen hellblauen Nylonbademantel an und setzte mich an meinen Küchentisch, um stumm und starr auf meine Hände zu starren. Wo Bill jetzt nur sein mochte? Wandelte er überhaupt noch auf Erden oder war er ein Häufchen Asche auf irgendeinem Holzkohlegrill? Ich dachte an sein dunkelbraunes Haar und daran, wie dicht und glatt es sich unter meinen Händen angefühlt hatte. Natürlich zerbrach ich mir den Kopf darüber, warum er seine geplante Rückkehr wohl vor mir geheim gehalten haben mochte. So vergingen meinem Eindruck nach ein paar Minuten. Als ich dann aber auf die Uhr über dem Herd sah, musste ich feststellen, dass ich bereits eine geschlagene Stunde so dagesessen und blind in die Luft gestarrt hatte.
Nun hätte ich wohl eigentlich zu Bett gehen sollen. Es war spät, es war kalt – schlafen gehen wäre jetzt das Normalste von der Welt gewesen. Aber Normalität würde es wohl für mich nie wieder geben. Moment mal, das stimmte doch gar nicht – ohne Bill wäre meine Zukunft doch überhaupt erst total normal!
Kein Bill. Keine Vampire. Kein Eric, keine Pam, kein Bubba.
Keine übernatürlichen Wesen: keine Werwölfe oder Gestaltwandler, keine Mänaden. Auf keinen von denen wäre ich je gestoßen, wenn ich mich nicht mit Bill eingelassen hätte. Wäre er nie ins Merlottes gekommen, dann hätte ich weiter einfach dort gekellnert, mir ohne es zu wollen all die Gedanken angehört, die um mich herum gedacht wurden, den kleinlichen Geiz, die Begierde, die Enttäuschungen, die Hoffnungen und die Phantasien. Die verrückte Sookie, Dorftelepathin von Bon Temps, Louisiana.
Bis Bill kam, war ich Jungfrau gewesen. Nun blieb mir nur noch der Sex mit JB du Rone. JB ist so schön, dass man glatt vergessen kann, dass er dumm ist wie Bohnenstroh. Er hatte so wenige Gedanken im Kopf, dass mir seine Gegenwart fast schon angenehm und erträglich war. JB konnte ich sogar berühren, ohne unangenehme Bilder zu empfangen. Aber Bill – ohne dass ich es mitbekommen hatte, hatte ich die rechte Hand zur Faust geballt, und mit dieser Faust donnerte ich jetzt so nachdrücklich auf den Küchentisch, dass es höllisch wehtat.
Bill hatte mir gesagt, wenn ihm irgendetwas zustieße, sollte ich zu Eric „gehen“. Ich war mir nie sicher gewesen, was genau er damit gemeint hatte: Sollte Eric dafür sorgen, dass mir ein Erbe ausgezahlt wurde, das Bill mir womöglich hinterlassen hatte? Sollte mich Eric vor anderen Vampiren schützen? Oder sollte ich zu Eric … nun, sollte ich zu Eric eine ähnliche Beziehung aufnehmen, wie ich sie mit Bill gehabt hatte? Ich hatte Bill deutlich zu verstehen gegeben, dass man mich nicht herumreichen konnte wie einen Weihnachtskuchen.
Aber Eric war bereits zu mir gekommen, also hatte ich noch nicht einmal mehr die Wahl, frei zu entscheiden, ob ich Bills letzten Rat befolgen wollte oder nicht.
Langsam verlor ich den roten Faden bei meiner Grübelei. Sehr klar war der mir allerdings die ganze Zeit nicht gewesen.
Ach Bill, wo bist du nur! Verzweifelt vergrub ich das Gesicht in den Händen.
Inzwischen war ich so erschöpft, dass mir der Kopf dröhnte. Auch war es zu dieser frühen Stunde selbst in meiner Küche kalt. Also stand ich auf, um ins Bett zu gehen, auch wenn ich genau wusste, dass ich nicht würde schlafen können. Mein Verlangen nach Bill war von einer so klaren, stechenden Intensität, dass ich mich fragte, ob es nicht vielleicht sogar unnatürlich war, ob mich irgendeine übernatürliche Macht verzaubert hatte.