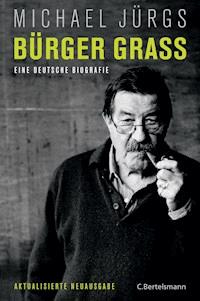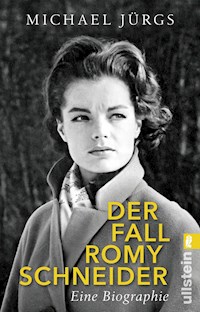9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Das abenteuerliche Leben einer tapferen Frau
Sie wurde 98 Jahre alt und in Nachrufen weltweit als eine außergewöhnliche Frau gewürdigt: Nancy Wake. Geboren in Neuseeland, begann ihr abenteuerliches Leben in New York, London, Paris: »Ich war eine Art Playgirl.« Sie heiratete einen reichen Franzosen, begann in Marseille als Fluchthelferin und Kurierin für den Widerstand gegen die Nazis zu arbeiten. Als sie von der Gestapo unter dem Decknamen »Weiße Maus« gejagt wird, flieht sie nach England, lässt sich dort vom Geheimdienst als Agentin ausbilden und 1944 über dem besetzten Frankreich absetzen. Eine schöne Frau, sagt einer ihrer Mitstreiter, aber wenn es in den Kampf ging, so tapfer wie fünf Männer. Sie liebte das Leben, hasste die Nazis und kämpfte für die Freiheit der Franzosen. Michael Jürgs folgte ihren Spuren in ganz Europa. Seine Geschichte ihres Lebens ist die Biografie einer starken Frau – und auch eine Chronik von Helden und Verrätern, Mördern und Kollaborateuren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Ähnliche
MICHAEL JÜRGS
Codename Hélène
Churchills Geheimagentin Nancy Wake und ihr Kampf gegen die Gestapo in Frankreich
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2012 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: R·M·E Rosemarie Kreuzer
Bildredaktion: Dietlinde Orendi
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-08884-2V002
www.cbertelsmann.de
INHALT
PROLOG
KAPITEL 1
»Ich war eine Art Playgirl«13
Einsam in Sydney – Trinkfest in New York – Verliebt in Paris – Tangonächte an der Côte d’Azur – Der Antrag des Schrotthändlers – Stukas gegen Ambulanzen
KAPITEL 2
»Setzt Europa in Flammen«
Die »Hunnen« erobern Frankreich – Die Gefangenen der Zitadelle – Die Fridolins im Grandhotel – Das Elend der Heimatlosen – Ein Arzt für alle Fälle – Morde ohne Spuren – Stukas gegen Ambulanzen
KAPITEL 3
Die Flucht der »Weißen Maus«
Albtraum der Gestapo – Ein Schwein im Koffer – Flirt mit dem Todfeind – Der falsche Abschiedsbrief für Henri – Ein lebensrettender Bluff – Küsse am Bahnsteig – Ein Abenteuer in den Pyrenäen
KAPITEL 4
Drei Kondome zum Frühstück
Most Wanted: Junge, hübsche, tapfere Frauen – Verhör im Hinterzimmer – In Uniform am Suppentopf – Agentin im Nahkampf – Dynamit in toten Ratten – Die zehn Gebote des Safeknackers – Nachtflug ins Feindesland
KAPITEL 5
Frei sein oder sterben
Mordkomplott am Küchentisch – Die Schlachten am Mont Mouchet – Vier Panzerfäuste für ein Halleluja – Ein schwuler Funker im Baum – Die Peilkommandos der Gestapo – Tour de France in 72 Stunden – Das Ende einer Spionin
KAPITEL 6
Die lautlose Killerin
Der Code des toten Dichters – Tage des Zorns, Wochen der Rache – Dreierbanden in Sachen Sabotage – Das Kampflied der Partisanen – Festgelage unter Bäumen – Ein Pferd im Badezimmer – SS-Verbrechen in Tulle und Oradour – Genickbruch als Seelenlast
KAPITEL 7
Vive la France
Das verlassene Schloss – Ein Salut für Hélène – Schreckensnachricht im Siegesrausch – Henri Fioccas langes Sterben – Ein Kellner trifft auf Nancys Faust – Das leere Bankschließfach – Wahlkampf in Australien – Unsterblich in den Tod
EPILOG
Zeittafel
Quellen
Personenregister
Orts- und Sachregister
Bildnachweis
PROLOG
Kennst du diese Frau?«, hatte mein Freund Erich auf die Kopie eines Artikels aus dem britischen Wochenmagazin The Economist vom 13. August 2011 geschrieben und hinzugefügt: »What a life – was für ein Leben!« Am Sonntag zuvor, am 7. August, war in den Londoner Royal Star & Garter Homes das Leben jener Frau erloschen. Für die Economist-Redaktion ein Ereignis von internationaler Bedeutung, denn im aktuellen Heft erwies sie der Toten mit einem ganzseitigen Nachruf die ihr offenbar gebührende letzte Ehre: Nancy Wake, verstorben im Alter von 98 Jahren, sei eine der »gefürchtetsten Agentinnen« des britischen Geheimdienstes gewesen, erfolgreich im Zweiten Weltkrieg als Fluchthelferin abgeschossener britischer Piloten, furchtlos bei Sabotageakten und Attentaten gegen die Deutschen während der Besetzung Frankreichs zwischen 1940 und 1944, mutig in vorderster Reihe bei den Kämpfen der Résistance und des Maquis gegen die SS, nach der Befreiung deshalb ausgezeichnet mit vielen hohen Orden für ihre außergewöhnliche Tapferkeit.
Von der Frau, deren Leben hier in knappen Sätzen beschrieben wurde, hatte ich noch nie etwas gehört. Erste Annäherungen per Eingabe ihres Namens in Suchmaschinen des Internet schienen die Würdigung zu bestätigen: ein erfülltes Leben sogar dann, falls nur die Hälfte von dem stimmte, was weltweit in Nachrufen über sie jetzt gedruckt wurde: nicht nur in England und Irland, sondern auch in den USA, in Australien, in Frankreich, in Neuseeland usw.
Manches mutete allerdings an, als hätte ein mit Fantasie begabter Autor alle bekannten und im kollektiven Bewusstsein archivierten Berichte über Spione und Krieg, Gestapo und Résistance, Verrat und Courage, Völkermord und Vergeltung zu einer modernen Heldensaga verdichtet. Und diese, frei nach dem zynischen Motto des ja nicht nur online real existierenden Journalismus, wonach Tote keine Gegendarstellungen mehr schicken, im Netz über die Welt verteilt. Dankbar schrieben davon viele ab, die nicht über eigene Quellen oder Erkenntnisse verfügten.
Da Nancy Wake kurz vor ihrem 99. Geburtstag gestorben war, musste sie 1912 geboren sein. So viel immerhin stand fest. Also war sie 27 gewesen, als 1940 ihr geheimes Leben im Schatten begann, das jetzt nach ihrem Tod in den Nachrufen noch ein letztes Mal erhellt wurde. Nachdem ich Fotos von ihr aus jener Zeit gesehen hatte, gab es außerdem keine Zweifel am Wahrheitsgehalt der Beschreibungen ihrer Schönheit und ihrer Ausstrahlung. Nancy Wake war in der Tat eine schöne Frau.
Aus solchen Stoffen werden Legenden gewoben oder Blockbuster für die große Leinwand gestrickt. Nicht wirklich überraschend deshalb, dass ihre Geschichte angeblich längst verfilmt worden war, wie das Internet mir suggerierte. Die Liebe der Charlotte Gray hieß der Film, und der hatte bereits 2001 Premiere in den Kinos. In der britisch-australischen Produktion (Regie: Gilian Armstrong) spielte Cate Blanchett die Titelfigur der Engländerin Charlotte Gray, die Sebastian Faulks für seinen gleichnamigen Roman erdacht hatte, auf dem das Drehbuch beruht. Doch vieles, was im Film zu sehen ist, würde der Biografie von Nancy Wake entsprechen.
Laut Drehbuch lässt sich Cate Blanchett alias Charlotte Gray aus Schmerz über ihren vermissten und wahrscheinlich mit seinem Flugzeug über Feindesland abgeschossenen Royal-Air-Force-Geliebten vom britischen Geheimdienst anheuern und zur Agentin ausbilden. Sie will seinen Tod rächen. In einer Mondnacht springt sie per Fallschirm über Frankreich ab, schließt sich der Untergrundarmee des Maquis gegen die deutschen Besatzer an, erlebt auf dem Land die Verfolgung der Juden durch die SS und deren willige Helfer von der faschistischen französischen Miliz, kämpft als einzige Frau unter Männern und verliebt sich in einen der jungen Widerstandskämpfer.
Liebe in Zeiten des Krieges aber hat keine Überlebenschancen. Das Paar muss sich trennen. Er wird weiter bis zum Sieg oder seinem bitteren Ende gegen die Deutschen kämpfen, sie flieht mithilfe einer Spezialeinheit zurück nach London, wo sie, weil das Leben im Kino nun mal spielend eingesetzt werden kann, dann doch wieder ihren einstigen Geliebten trifft. Er hat nicht nur den Abschuss überlebt, es war ihm auch gelungen, sich über Spanien nach England durchzuschlagen. Aber diese frühe, für alle Abenteuer ausschlaggebende Liebe ist inzwischen kälter als der Tod. Als der Krieg vorbei ist, die Nazis besiegt und Europa befreit, kehrt Charlotte Gray auf der Suche nach ihrer eigentlichen Sehnsucht zurück nach Frankreich und findet den geliebten Schattenkrieger in seinem Bauernhof in der Provence. In einer Umarmung endet der Film.
Wie sich herausstellte, verbindet die erfundene Geschichte der Charlotte Gray mit der wahren Biografie der Untergrundkämpferin Nancy Wake immerhin so viel: Auch sie ist mit dem Fallschirm über Frankreich abgesprungen, auch sie hat die Deutschen bekämpft, auch sie hat den Krieg überlebt. Da allerdings enden bereits die Ähnlichkeiten. Die wahre Geschichte der Frau, die ein lebenslustiges Playgirl war, wie sie selbst sich bezeichnete, die in der mondänen Welt von Paris und der Côte d’Azur umschwärmt wurde, die aus Hass gegen die Nazis in den Untergrund ging und als Fluchthelferin wirkte, bis sie selbst fliehen musste, die in England eine Spezialausbildung als Geheimagentin Seiner Majestät erhielt, die in einer Mondnacht über Frankreich absprang und die dann bis zur Befreiung in der Schattenarmee ihren Mann stand – diese wahre Geschichte ist viel spannender als die ausgedachte.
Nancy Wakes Leben nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte zwar länger als das zuvor, 66 Jahre, doch aufregend war nur das andere. Ihren 1985 veröffentlichten Erinnerungen gab sie deshalb mit auf den Weg: »Freiheit ist das Einzige, wofür sich zu leben lohnt. Während ich meine Pflicht erfüllte beim Maquis, dachte ich oft: Macht nichts, wenn du getötet wirst, denn ohne Freiheit wäre es nicht wert zu leben.« Julia Gillard, Premierministerin von Australien, dem Land, wo Nancy ihre Kindheit verbrachte, sah das in ihrem Nachruf ebenso: »Sie war eine Frau von außergewöhnlichem Mut und Einfallsreichtum, deren waghalsige Heldentaten Hunderten von alliierten Soldaten das Leben retteten, und half, die Nazi-Besetzung Frankreichs zu beenden.«
Viele Geschichten aus jener Zeit, die post mortem gedruckt über die gebürtige Neuseeländerin verbreitet wurden, scheinen zu gut, um wahr zu sein. Manchmal war trotz aller Recherchen nicht endgültig zwischen Fiktion und Fakten zu unterscheiden und zu bestimmen, was nur gut war und was gut und außerdem wahr. Dass Nancy Wake beispielsweise an der Côte d’Azur Kaviar am Morgen, Champagner am Vormittag und Liebe am Nachmittag bevorzugte, mag ja stimmen, denn sie war jung und hatte eine besondere erotische Ausstrahlung, wie einer ihrer Verehrer aus der Résistance notierte. Das liest sich zweifellos verlockend gut. Aber ist es auch wahr? Freunde von Nancy oder Mitstreiter aus dieser Zeit gibt es keine mehr, Nancy Wake hat sie alle überlebt.
Sowohl in einer englischen als auch in einer australischen Biografie über Nancy Wake werden auf vielen Seiten sogar Dialoge abgedruckt – angeblich wörtlich so gesprochen bei der Planung von Attentaten oder in einer Gefechtspause in der Auvergne oder bei Verhören der Gestapo oder auf der Flucht über die Pyrenäen. Die dürften aber eher frei erfunden worden sein von den Autoren, denn logischerweise lief im Untergrund nie ein Tonband mit, um für die Nachwelt aufzuzeichnen, was gesprochen wurde.
Die Suche nach belegbaren Spuren im Leben von Nancy Wake, geboren 1912, gestorben 2011, brachte jedoch zutage, dass es viele gute Geschichten gibt, die wirklich wahr sind: Wie sie als junge Journalistin 1938 in Wien erlebt, dass unter hämischer Zustimmung ihrer Nachbarn jüdische Bürger vom Pöbel durch die Straßen gejagt werden. Wie sie nach der Kapitulation und der Aufteilung Frankreichs in den unter deutscher Militärverwaltung stehenden besetzten Norden des Landes und den von französischen Rechtskonservativen regierten unbesetzten Süden als Ambulanzfahrerin und Fluchthelferin und Kurierin der Résistance aktiv wird. Wie sie über die verschneiten Pyrenäen ins neutrale Spanien flüchtet, als die Gestapo sie zu jagen beginnt. Wie sie von Gibraltar aus unter stetiger Bedrohung durch deutsche U-Boote nach England verschifft wird. Wie sie in einem Trainingscamp als Agentin für den britischen Geheimdienst ausgebildet wird. Wie ihr die da antrainierte Nahkampftechnik des silent killing das Leben rettet, weil sie deshalb in Frankreich einem SS-Mann per Karateschlag das Genick brechen kann, bevor der zu seiner Waffe greift. Wie sie im Juni 1944 kurz vor dem Frühstück eine Frau erschießen lässt, die für die Deutschen spionierte, und danach in aller Ruhe ihren noch heißen Kaffee austrinkt. Wie sie, einzige Frau unter Männern, ein Gestapo-Hauptquartier in Montluçon in die Luft jagt. Wie sie, ausgerechnet während der bejubelten und gefeierten Befreiung Frankreichs, vom Tod ihres Manns erfährt, der gefoltert und hingerichtet wurde, weil er sie nicht verraten wollte. Wie sie im September 1944 im britischen Offiziersklub in Paris kurzerhand einen Kellner k.o. schlägt, der sich lobend über das Benehmen der ehemaligen Besatzer geäußert und nicht geahnt hatte, dass diese Britin am Tisch jedes Wort verstand.
Nach dem Krieg wurde Nancy Wake für ihren Einsatz mit den höchsten militärischen Auszeichnungen Großbritanniens, Frankreichs, der USA und Australiens geehrt, doch unsentimental pragmatisch, wie sie stets war, verkaufte sie alle Orden für 60000 Pfund an einen Militariasammler, als sie Geld brauchte. Ihre Rechnungen in der Bar des Hotels Stafford sollen diskret Prinz Charles und einige Unterstützer beglichen haben. Zwar starb sie in England, doch in ihrem Testament verfügte sie, dass ihre Asche in der Auvergne verstreut werden soll, wo sie einst auf dem Mont Mouchet in einer legendären Schlacht aufseiten des Maquis gegen die SS kämpfte.
What a life – was für ein Leben!
Bei meinen Reisen in ihre Vergangenheit, auf der Suche nach Akten und Dokumenten oder während Besuchen bei denen, die sie als alte Frau in London noch erlebt haben, musste ich zwangsläufig in die Vergangenheit jener reisen, die sie bekämpft hatte. Die Biografie der Nancy Wake, von der Gestapo zur Fahndung als »Weiße Maus« ausgeschrieben, auf deren Ergreifen, tot oder lebendig, fünf Millionen Francs Kopfgeld ausgesetzt waren, ist nicht nur die einer leidenschaftlichen, schönen Frau und die einer kaltblütigen Schattenkriegerin im Namen der Freiheit.
Sondern auch eine deutsche Geschichte.
KAPITEL 1
»Ich war eine Art Playgirl«
Es riecht nach Fisch, und es duftet nach Safran. So muss es sein. Safran gehört wie seine Schwestern Thymian und Lorbeer zu den wichtigsten Zutaten der Suppe aus verschiedenen Fischsorten und Krustentieren, für die Marseille berühmt ist. Die zu kochen erfordert allerdings keine große Kunst. Im Viertel um den Alten Hafen gibt es Bouillabaisse Marseillaise in jedem Restaurant. Wovon Urlauber schwärmen, ist für Einheimische Hausmannskost.
Eine junge Frau geht vom Kai, wo Dutzende Pferdekutschen auf Touristen warten, über den Quai Fraternité, setzt sich unter die Markise auf der Veranda des »Basso«, bestellt als Aperitif einen Pastis und zum Essen, wie alle Gäste auf der Terrasse, die Bouillabaisse des Hauses. Sie macht aber nicht Urlaub hier, sondern hat in Marseille einen Termin, für den sie zu einer bestimmten Uhrzeit in der Canebière sein muss, der kilometerlangen Prachtstraße, die vom Hafen zur Saint-Vincent-de-Paul-Kirche führt. Bis dahin bleibt ihr jedoch genügend Zeit. Also genießt sie die Sonne, trinkt zur Fischsuppe ein paar Gläser Rosé aus Tavel, leert nach und nach sogar die ganze Flasche.
Nancy Wake heißt sie, ist 22 Jahre alt und am vorherigen Abend mit dem Train Bleu aus Paris eingetroffen. Dort herrschten bereits nasskühle Temperaturen. Im Süden Frankreichs bleibt es aber selbst dann noch sommerlich warm, wenn anderswo im Land längst der Herbst regiert.
Auch heute, an diesem 9. Oktober 1934.
Pastis und Rosé haben ihre Wahrnehmung nicht getrübt. Sie verträgt so einiges an Alkohol, auch härtere Getränke als Wein, was Nancy Wake zeitlebens im Kreise trinkfester Männer Respekt einbringt, insbesondere bei denen, die ihr in den kommenden zehn Jahren nahe sein werden. Nachdem sie ihre Rechnung bezahlt hat, macht sie sich durch schmale Gassen auf zur Canebière. Sie ist freie Mitarbeiterin des International News Service (INS), der zum amerikanischen Zeitungskonzern von William Hearst gehört, und nach Marseille gekommen, um über den Staatsbesuch des jugoslawischen Königs Alexander I. in Frankreich zu berichten, der an diesem Nachmittag beginnt. Das Schiff, mit dem er angereist ist, hat sie bereits im Hafen liegen sehen. Gleich würde er es verlassen.
Seit einem Jahr verdient sie sich ihren Lebensunterhalt als Journalistin, hat das Handwerk zwar nie so richtig gelernt, aber immer dann, wenn sie bisher nicht weiterwusste, haben ihr professionelle Kollegen geholfen. Entweder die in London, wo sie im Jahr zuvor ein paar Monate lang gewohnt hat und dessen bevorzugte Pubs in dieser Zeit auch ihre liebsten Tränken wurden, oder die in Paris, wo sie jetzt lebt und beste Beziehungen zu Korrespondenten der großen Zeitungen unterhält. Heute ist sie auf sich gestellt, ist allein. Der Auftrag scheint aber auch für eine Anfängerin keine allzu große Herausforderung zu sein. Sie muss nur aufschreiben, was sie sieht. Tausende stehen am Straßenrand, um den König zu begrüßen. Nancy Wake drängt sich zwischen den Menschen hindurch in die vorderste Reihe.
Ein paar Tage vorher hatte der französische Nachrichtendienst vor der Gefahr eines Attentats gewarnt, geplant von bereits im Land versteckten Mordkommandos der kroatischen Ustascha-Bewegung. Angeblich drohten die, in Marseille zuzuschlagen. Mehr noch: Der italienische Geheimdienst soll bei der Planung eines Anschlags geholfen haben. Profis also. Der Verdacht ist begründet und liegt sozusagen nahe, denn Italiens Diktator Benito Mussolini würde von einem Machtvakuum beim Nachbarn jenseits der Adria profitieren. Aber Alexander I., selbst durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen und über Serben, Kroaten, Slowenen als »Königsdiktator« herrschend, also kein unbedingt lupenreiner Demokrat, ließ sich nicht dazu überreden, in einem geschlossenen, sicheren Wagen ins Rathaus zu fahren. Er wollte das Bad in der Menge und bestand darauf, in einem Landaulet, einer Limousine mit aufklappbarem Cabrioletverdeck im Bereich der Fondsitze, chauffiert zu werden.
In dem sitzt er jetzt, neben dem französischen Außenminister Louis Barthou, der ihn unten an der Gangway des Kreuzers »Dubrovnik« mit allen Ehren empfangen hatte. Vor und hinter der Staatskarosse reitet eine Ehrengarde der Armee. Hurra-Rufe links und rechts vom Straßenrand. Es ist kurz nach 16 Uhr an diesem 9. Oktober 1934, kaum hundert Meter sind zurückgelegt auf der Canebière, als passiert, wovor gewarnt worden war: das Attentat.
Und Nancy Wake erlebt es live: Ein Mann stürzt auf das Auto zu, Revolver in der Hand, schießt auf die Insassen. Der Chauffeur lässt das Steuer los, packt ihn an den Haaren, reißt ihn zurück. Ein Offizier reitet heran mit erhobenem Säbel und schlägt auf den Schützen ein, aber es ist schon zu spät. Der König und der Minister sind beide getroffen, der Attentäter, bereits schwer verwundet, wird von den Leibwächtern des Monarchen bewusstlos geprügelt. Er stirbt drei Stunden später. Alexander I. verblutet noch vor Ort. Barthou wird zwar ins Krankenhaus geschafft, doch auch für ihn kommt jede ärztliche Hilfe zu spät.
Die junge Reporterin rennt, so schnell sie es auf ihren hochhackigen Schuhen schafft, durch die in Panik fliehende Menge, zurück in ihr Hotel. Es ist das »du Louvre et de la Paix«, gilt als das beste Quartier der Stadt und liegt etwa auf halber Wegstrecke zwischen Bahnhof und Altem Hafen an der Canebière. In Nancy Wakes Leben wird es noch oft eine Rolle spielen. Architektonisch gehört das Grandhotel zu den fünf, sechs schönsten Gebäuden Marseilles. Vier überdimensionale Figuren verkörpern am Eingang symbolisch die Weltläufigkeit der Hafenstadt. Die Sphinx steht für Amerika, der Elefant für Asien, das Kamel für Afrika und der Fisch für Europa. Sie gibt telefonisch nach Paris durch, was sie gerade erlebt hat, beschreibt als Augenzeugin jenes Attentat, das am folgenden Tag die Schlagzeilen der Weltpresse bestimmen wird. Der Name des bulgarischen Terroristen, Wlado Georgiew Tschernosemski, unterwegs mit einem gefälschten Pass auf den Namen Peter Kelemen, der bei seiner Attacke von einem Kamerateam gefilmt worden war, wurde erst am Tag danach bekannt gegeben. Da saß Nancy Wake schon wieder in Paris mit ihren journalistischen Freunden zusammen in einer Brasserie und ließ sich bei ein paar Flaschen Wein für ihren Scoop feiern. Ein Fest, wie sie es liebte.
Paris war nicht nur an diesem besonderen Abend, sondern Tag für Tag ihr Fest fürs Leben. Nancy Wake bewegte sich zwar stets am Rande des Existenzminimums, near the breadline, aber das bereitete ihr keine schlaflosen Nächte – solche Zustände war sie gewöhnt von Kindheit an. Sie wohnte in einer billigen kleinen Mansarde unterm Dach, nahe des Louvre, in der Rue Sainte-Anne. Die Miete musste, wie allgemein üblich damals, zweimal jährlich jeweils für sechs Monate im Voraus bezahlt werden. Kurz vor diesen Terminen hatte sie dann doch »ein paar schlaflose Nächte«, weil stets noch ein paar Francs fehlten an der nötigen Summe, aber danach, wenn alles gut gegangen war, lebte sie wieder sorglos in jeden neuen Tag hinein.
Ein Bad gab es nicht, sie durfte das der Concierge unten im Haus benutzen, mit der sie sich anfreundete. Als sie vor ihrer Heirat 1939 die geliebte Wohnung aufgab und damit ihr bisheriges leichtfüßiges Leben zu Ende war, weinten beide beim Abschied und versprachen, sich regelmäßig zu schreiben. Erst nach dem Krieg erfuhr Nancy Wake, dass die Concierge von der Rue Sainte-Anne ausgerechnet bei einem Bombenangriff der Alliierten auf eine von Deutschen besetzte Stadt ums Leben gekommen war, weil sie inzwischen aus Paris in die Provinz gezogen war und die Explosion auch ihr Haus zerstört hatte.
Die insgesamt knapp sechs Jahre, die Nancy Wake in Paris verbrachte, waren bestimmt einerseits von der Notwendigkeit, genügend Geld zu verdienen für die halbjährliche Miete und die im Alltag anfallenden Kosten für Lebensmittel, Kleidung, Kosmetik. Andererseits vom Wunsch, möglichst viel davon hautnah mitzubekommen, was die Stadt der Liebe so unwiderstehlich machte. »Ich war«, bekannte sie in ihrer Autobiografie, ohne näher darauf einzugehen, »eine Art von Playgirl«, und überließ, was konkret damit gemeint sein könnte, der Fantasie des Lesers. Ähnlich vage beschrieb sie, was sie wo oder mit wem eigentlich erlebt hatte, bevor sie, aufgebrochen 1932 im fernen Australien, in Frankreich gelandet war. Verriet nur so viel, dass Städte wie New York, London und vor allem eben Paris schon als Kind in Sydney ihr Fernweh geweckt und ihre Träume beflügelt hatten.
Herkunft und Lebenslauf lassen sich anhand ihrer Personalakte nachvollziehen, die in The National Archives in London ruht. Was sie im – damals für alle künftigen Agenten obligatorischen – history sheet angab, als sie ein britischer Geheimdienst-Gentleman rekrutierte, musste schon deshalb stimmen, weil sie wusste, dass alle Angaben überprüft werden konnten. Falls sie bei einer Lüge ertappt würde, wäre eine Karriere im Dienste Seiner Majestät beendet gewesen, bevor sie begonnen hätte. Also blieb sie bei der Wahrheit.
Als Nancy Grace Augusta Wake am 30. August 1912 in Wellington, Neuseeland, zur Welt kam, gehörte die frühere Kolonie noch zum Vereinigten Königreich. Nancy war deshalb qua Geburt britische Staatsangehörige. Ihr Vater Charles Augustus Wake arbeitete mal als Anwalt, mal als Reporter eines Wochenblattes, mal gar nicht. Ihre Mutter Ella kümmerte sich um Haushalt und Familie. Nancy war ihr jüngstes Kind. Die beiden Brüder und die beiden Schwestern hießen Stanley und Charles, Gladys und Ruby. In allen Nachrufen auf sie ist die Rede von fünf Geschwistern, aber in ihrem Lebenslauf sind nur diese vier erwähnt und auch, dass ihr ältester Bruder Stanley im Ersten Weltkrieg auf der Seite Englands kämpfte und verwundet wurde.
Im Frühjahr 1914 wanderte die Familie aus nach Australien. Anfangs lebten sie in Sydney in einem großen Haus. Als der Vater nicht mehr von einer Reise zurückkehrte und sich fortan nicht mehr darum kümmerte, wie die Zurückgelassenen ohne sein Einkommen zurechtkamen, musste Ella Wake in eine kleine Wohnung ziehen und die Familie alleine durchbringen. Sie lebten ab dann immer am Rande der Armut. Deshalb machte es Nancy Wake später, egal, ob in London oder in Paris, auch nichts aus, mit wenig auskommen zu müssen. Schon als Kind war sie oft auf sich selbst gestellt und allein. Die beiden Schwestern hatten andere Interessen als die Kleine und zogen außerdem so bald wie möglich zu Hause aus, um zu heiraten.
Früh aber hatte das Kind bestimmte Vorstellungen vom Leben, die so gar nicht passten zu den streng religiösen seiner Mutter oder zu deren Ansichten, welche Rolle für eine Frau in der Gesellschaft angemessen war und welche nicht. Auf die Idee, dass es zwischen Mann und Frau Gleichberechtigung geben muss, wäre sie nie gekommen. So etwas passte nicht in ihr Weltbild. Nancy sah das schon früh anders. Sie riss als Teenager zweimal aus, galt als schwer erziehbar und rebellisch, bewunderte insgeheim den fernen Vater, der die Familie verlassen hatte. Die Mutter, die arbeiten musste, weil er sich nie mehr hatte blicken lassen, nannte ihn einen Bastard. Darin immerhin stimmte ihr Nancy zu.
Aber bei ihr bekam »Bastard« einen leicht wehmütigen, fast sehnsüchtigen Ton. Klang nach ungebundenen, freien Straßenkötern. Die haben es zwar schwerer im Leben, weil sie selten gefüttert und getätschelt werden, aber sie hängen an keiner Leine, niemand kann sie dahin ziehen, wohin sie nicht freiwillig gehen wollen. So eine Art von Straßenköter im besten Sinne war Nancy Wake offenbar zeitlebens. In Sydney besuchte sie die North Sydney Household School, die sie verließ, sobald sie sechzehn wurde. Was damals niemanden interessierte. Heute ist ihr Name auf der Ehrentafel der berühmten ehemaligen Schüler verzeichnet, darunter auch der Filmschauspieler Peter Finch.
Um dem nach wie vor strengen Regiment der Mutter zu entkommen, um nicht von ihren Regeln abhängig zu sein, um eigenes Geld zu verdienen, nahm Nancy Gelegenheitsjobs an. Arbeitete als Kindermädchen oder als Pflegerin in einer Nervenheilanstalt, wozu sie keine besondere Ausbildung brauchte. 1932 konnte sie alles hinter sich lassen, sich auf die Reise dahin begeben, wo sie Abenteuer erwarten würden statt Vorschriften und wo sie vor allem eines haben würde: Spaß. Abenteuer zu erleben und möglichst viel Spaß zu haben waren ihr bis ins hohe Alter stets wichtiger als geordnete Verhältnisse. Insgesamt müsse festgestellt werden, steht in der Beurteilung des britischen Geheimdienstes, dass Nancy Wake das Leben als einen einzigen großen Spaß betrachte – »seems to take life as a big joke« –, allerdings sehr viel vernünftiger sei, als das auf den ersten Blick den Anschein habe.
Weil ihr eine Tante aus Neuseeland 200 Pfund vermacht hatte, konnte Nancy Wake die beengten Verhältnisse, die sie auch tatsächlich einengten, endlich verlassen. Die Erbschaft war so viel wert, dass es bei ihren bescheidenen Ansprüchen für die Ausgaben eines Jahres reichen musste. Sie verließ Sydney. In ihren eigenen verklärenden Worten: »An einem sonnigen Dezembertag 1932 stand ich auf dem Deck eines Schiffes, das von Sydney nach Vancouver fuhr, schaute aufs Meer und war gespannt, was die Zukunft mir bringen würde.«
Von Kanada aus, wo sie drei Monate blieb, zog sie nach New York. Wie sie dort lebte, beschrieb sie, sobald es um Privates ging, ganz allgemein so, dass es eine aufregende Zeit gewesen sei. Von einem Job berichtete sie nichts. Noch herrschte Prohibition in den USA, war es verboten, Alkohol frei auszuschenken oder zu verkaufen. Was automatisch die Kreativität der Durstigen weckte, die den eigenen Schnaps zu Hause in Badewannen brannten und ihre Freunde zum Probetrinken einluden. Vor allem aber war es ein ideales Geschäftsmodell von gut organisierten Gangsterbanden, die quer übers Land mit der verbotenen Ware handelten und sich steuerfrei gewaltigen Mehrwert verschafften.
In den illegal betriebenen finsteren Speakeasy-Kneipen von New York hatten nur Mitglieder Zutritt. Nancy Wake dürfte deshalb bei ihren nächtlichen Ausflügen in Begleitung gewesen sein. Jedenfalls hat sie in jener Zeit »so viel Alkohol konsumiert wie nie mehr in meinem ganzen Leben. Doch ich war jung und meine Leber in einem guten Zustand.« Das blieb die offensichtlich, denn auch als über Neunzigjährige vertrug sie im Londoner Stafford Hotel, wo sie bis 2003 wohnte, locker ihre sechs Gin Tonics über den Tag verteilt und stand immer noch, wenn auch von einem Stock gestützt, fest auf den Beinen. Dafür gibt es nüchterne, glaubwürdige Zeugen.
Über ihren Aufenthalt in New York ist außer den besonderen Erfahrungen von der Widerstandsfähigkeit ihrer Leber nichts weiter bekannt. Im Frühsommer 1933 hatte sie offenbar genug von New York geschluckt und kaufte sich ein Ticket für die Schiffspassage übers weite Meer Richtung Europa. Erste Station nach der Ankunft in Liverpool war London, wo sie ein billiges Zimmer in einem Boarding House mietete und sich zudem an einem College einschrieb, das versprach, in wenigen Monaten die Grundzüge des Journalismus zu vermitteln. Ein merkwürdig anmutender Entschluss. Wie kam sie darauf? Ihre Erklärung war schlicht naiv: Sie ging davon aus, dass man in dem Beruf viel reisen durfte, in ferne Länder. Und das entsprach ihrer Abenteuerlust. In welchen Pubs sich die echten Journalisten trafen, fand die Amateurin durch ein paar Eigenrecherchen schnell heraus. Dort war sie möglichst oft. So viel wie die Männer vertrug sie allemal. Was die so bewunderten wie ihre Schönheit.
Als die verblüht schien, so etwa in den 1970er-Jahren, beeindruckte sie immer noch mit ihrer verbliebenen Trinkfestigkeit. Nach einer Pressekonferenz in Hollywood, bei der Pläne vorgestellt wurden, ihr Leben zu verfilmen – woraus dann nichts werden sollte –, saßen sie und einige Journalisten noch in der Bar des Beverly Wilshire Hotel in Los Angeles. Kein Abstinenzler in der Runde. Nancy hatte bereits einige Whiskys getrunken, aber das merkte man ihr wie üblich nicht an. Einer der Reporter schien weniger an der Résistance und ihrem Leben im Untergrund interessiert zu sein. Sondern eher daran, ob jenes Gerücht stimmen würde, dass sie mehr vertragen könne als ein trinkfester Mann, ohne je die Contenance zu verlieren. Er forderte sie heraus. Wer würde mehr Tequila vertragen, sie oder er? Unter seinen Kollegen galt er als standfester Trinker.
Nancy Wake, damals immerhin schon sechzig Jahre alt, wenn auch nicht die klassische Verkörperung einer würdigen alten Dame, nahm die Herausforderung an. Nach zwei geleerten Schnapsflaschen stand sie auf, dankte höflich für die Drinks und verließ die Bar auf eigenen Beinen. Ihr Gegner rührte sich da schon nicht mehr. Zwar hatte sie am nächsten Morgen einen gewaltigen Kater, doch ihr Herausforderer war, wie sie voller Genugtuung hörte, erst um die Mittagszeit aus einer tiefen Bewusstlosigkeit erwacht.
Sechs Monate hielt sie es 1933 in der britischen Hauptstadt aus, aber als sich die landesüblichen Novembernebel aufs Gemüt senkten, floh sie in die Stadt des Lichts, weil die symbolisierte, was sie eigentlich suchte: Abenteuer, Spaß, Glamour. Freunde für ein solches Leben zu finden fiel ihr nicht schwer. Nancy war jung und attraktiv, 1,76 Meter groß, trug liebend gern High Heels und auffällige große Hüte, hatte leuchtend blaue Augen, dunkelbraunes Haar und unendlich lange Beine. Gelernt hatte sie so richtig nichts, außer dem wenigen, was sie am College in London mitbekommen hatte. Im history sheet war als Beruf eingetragen: Nil, also keiner, und was da steht, entspricht auch ihren Aussagen.
In Paris gab die attraktive junge Frau als Beruf »Journalistin« an. Ältere, nicht so attraktive Journalisten, die über gute Verbindungen verfügten, nahmen sie in ihre Kreise auf und liebend gern mit bei Erkundungen des Nachtlebens. Bei nächstbester Gelegenheit verschafften sie ihr einen Termin beim International News Service. Sie stellte sich vor, und sie muss überzeugend gewesen sein, denn Nancy Wake wurde auf Probe engagiert und fortan nach Zeilenhonorar bezahlt. Davon musste sie leben, denn das Erbe der Tante war aufgezehrt. Zwar konnte sie für Hearst und die amerikanischen Zeitungen in englischer Sprache schreiben, doch von Monat zu Monat sprach sie auch besser Französisch. Sie fand bald den richtigen Ton in der ihr fremden Sprache. Nur ein leiser englischer Akzent sei noch festzustellen, bemerkte einer ihrer Ausbilder 1943 in England, hielt das aber nicht für weiter störend, weil ein Deutscher bei etwaigen Kontrollen bestimmt nichts merken würde.
Weltpolitische Ereignisse, kommentiert als mögliche Zeichen eines drohenden Kriegs, standen in den Leitartikeln der seriösen Presse, aber da war Nancy Wake nicht zu Hause. Natürlich hatte sie mitbekommen, was in Europa passierte, alles über die politischen Zustände in Deutschland gelesen und wusste, was die überwiegende Mehrheit der Deutschen als Glück empfand, Franzosen jedoch mit Sorge verfolgten, denn mit den Nachbarn diesseits des Rheins hatten sie in zwei Kriegen schlimme Erfahrungen gemacht. Nicht alle lehnten die Ideologie des Erbfeindes ab, wie sich herausstellen sollte, als der in Frankreich einmarschierte, nicht alle. Viele Franzosen aus dem konservativ-katholischen Bürgertum, zu viele, teilten den im Dritten Reich per Gesetz zur Staatsdoktrin erhobenen Antisemitismus, lehnten ebenso alle ab, die nicht in ihr autoritäres Weltbild passten – Freimaurer, Kommunisten, Zigeuner. Ihr reaktionäres Frauenideal – Küche, Kinder, Kirche – entsprach weitgehend dem der Nazis, mit Ausnahme der Verwurzelung im Katholizismus.
Zu den abendlichen Runden von Nancy Wakes Freunden in Paris stießen liberale jüdische Journalisten, die aus Deutschland ins Exil nach Frankreich geflohen waren, nachdem Meinungsfreiheit durch gesteuerte Propaganda ersetzt worden war und sie nicht nur ihren Beruf aufgeben mussten, sondern als Staatsfeinde galten. Nancy war klug genug zu wissen, dass sie ihnen intellektuell nicht gewachsen sein würde, sie hörte lieber zu. Sie wurde nicht nur akzeptiert, weil sie attraktiv war, sondern weil die »merkten, dass ich ebenso wie sie an die Ideale von Freiheit glaubte«. Die war im Deutschen Reich unter Todesstrafe gestellt worden. Bücher brannten auf Scheiterhaufen, Oppositionelle wurden in Konzentrationslagern eingesperrt, aus dem Land ihrer Väter vertrieben oder ermordet. Aufgrund der Nürnberger Gesetze wurden deutschen Juden die Bürgerrechte aberkannt, Beziehungen zwischen ihnen und Ariern als »Rassenschande« unter Strafe gestellt. Die braune Diktatur machte Demokraten Angst, aber noch glaubten viele daran, dass Hitler halten würde, was er lügend versprach, den Frieden.
Der Schoß, aus dem dann jenes Gewürm kroch, das Europa verschlingen würde, war fruchtbar nicht nur diesseits, sondern auch jenseits des Rheins, in Frankreich, Antisemitismus in intellektuellen und bürgerlichen und katholischen Milieus gesellschafts-, faschistische Blut-und-Boden-Parolen und Fremdenhass im Volk mehrheitsfähig. Die Action Français und die rechtsradikalen Mitglieder der Croix de Feu (Feuerkreuzler) hatten 1934 in Paris versucht, das Parlament zu stürmen und die Regierung zu stürzen. Erst nach einer heftigen Straßenschlacht mit einem Dutzend Toten ergaben sie sich. Aber sie gaben nicht auf, woran sie fanatisch glaubten, sondern warteten auf für sie bessere Zeiten. Ihr blindwütiger Hass auf die ab 1936 regierende Volksfront unter Léon Blum, der Croix de Feux verboten hatte, wurde von vielen geteilt, wenn auch verbrämt mit vornehmer klingenden Formulierungen. Aus Angst vor dem Bolschewismus, der unter Stalin in Moskau ähnlich blutig wütete wie die Nazis unter Hitler, fanden Faschisten zunächst klammheimliche, dann aber immer mehr sich öffentlich bekennende Unterstützer im konservativen Bürgertum oder bei reaktionären Würdenträgern der katholischen Kirche.
Ein Jude an der Spitze des Staats, schrieben Leitartikler der auflagenstarken rechtskonservativen Zeitungen, sei so etwas wie der Untergang der Grande Nation. Erfolgsschriftsteller Céline alias Louis-Ferdinand Destouches hetzte gegen Juden, Kommunisten, Freimaurer und gegen die demokratisch gewählte Regierung: »Lieber ein Dutzend Hitler als einen allzu mächtigen Blum.« Ein anderer führender Antisemit, der Schriftsteller Marcel Jouhandeau, schrieb unter großer Zustimmung der Rechten über die »jüdische Gefahr«, weil dieser Jude Blum »keiner von uns ist«. Die kommunistische Alternative, gleichfalls stark vertreten in Frankreich, verkündet von ebenfalls wortgewaltigen Schreibern, wurde unterstützt aus Moskau, die rechtsradikalen Antisemiten aus Berlin und Rom.
Frankreich war keine Ausnahme, auch in anderen Ländern Europas machten die Extremisten mobil. In Großbritannien gründete Oswald Mosley die Union der Faschisten, die sich auf ihre Blackshirts genannten Kampfverbände stützten und Andersdenkende niederknüppelten nach dem Vorbild der SA und der Mussolini-Schwarzhemden in Italien. Im Mutterland der Demokratie hatten die Radikalen jedoch keine Chance auf Mehrheiten, sie schafften es nicht einmal ins britische Unterhaus. Im Königreich Italien gab es keine freien Wahlen mehr, oppositionelle Parteien hatte der »Duce« verboten. In Österreich demonstrierten Schlägertrupps der Heim-ins-Reich-Bewegung ihre Stärke, denn die eingeborenen Faschisten waren ihnen nicht radikal genug. Regierungschef Engelbert Dollfuß, selbst Austrofaschist und liberalen Gedankenguts unverdächtig, wurde von einem Nazi-Aktivisten im Bundeskanzleramt ermordet – aber immerhin der Attentäter dann zum Tode verurteilt und hingerichtet. In Portugal regierte der Diktator Salazar, in Spanien begann 1936 der Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der Republik und den Falangisten unter General Franco. Internationale Brigaden aus vielen Ländern unterstützten die gewählte Regierung, italienische Faschisten und die Nazis mit ihrer Legion Condor halfen den Putschisten und testeten Waffen, die sie bald anderswo einzusetzen gedachten.
Die Verbrechen der Wehrmacht und der SS und der Gestapo während der Besatzungszeit sind tief verankert im kollektiven Bewusstsein der Franzosen und in der kollektiven Scham der nachgeborenen Deutschen. Dass den deutschen Verbrechern in Uniform bei ihren Schandtaten viele Franzosen begeistert halfen, ist eine Schande. Das relativiert nicht die Verbrechen der Deutschen. Aber zur Wahrheit gehört es eben auch. In Deutschland wie in Frankreich dauerte es Jahrzehnte, bis die Schuld nicht mehr verdrängt und das Totschweigen gebrochen wurde.
Nancy Wake schrieb hauptsächlich für den Boulevard. Nur auf dem konnte jemand wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen. William Hearst, Erfinder der Yellow Press – so genannt, weil er Klatsch auf gelben Zeitungsseiten veröffentlichen ließ, was auffiel und Auflage machte –, hatte damals noch Sympathien für die Nazis. Nach einem Treffen mit Hitler in Berlin druckten seine Zeitungen eine Serie über Hermann Göring. Die allerdings wurde schnell abgebrochen nach Protesten empörter Leser und Boykottdrohungen New Yorker Anzeigenkunden. Der Tycoon gab seinen prodeutschen Kurs auf, als mehr und mehr bekannt wurde über die Verfolgung und Enteignung und Ermordung jüdischer Deutscher.
Was später in gebotener britischer Distanz in Nancy Wakes Personalakte stehen wird, war in Paris ihre USP, ihre Unique Selling Proposition. Sie war attraktiv, sie war wild, sie war ungebändigt, sogar das Wort »sensationslüstern«, lurid, taucht in den Charakterisierungen auf. Heißblütig sei sie, sultry, in Gesellschaften der Mittelpunkt, um den sich die Männer scharten, sie fasste eben das Leben als einzigen großen Spaß auf. Für die Klasse von Frauen aus dem Bürgertum hatte sie nicht genügend Klasse, Bildung der bürgerlich-klassischen Art konnte sie ebenso wenig vorweisen, eine nur »durchschnittliche Intelligenz« wurde attestiert. Schließlich hatte sie im 16. Lebensjahr ohne Abschluss die Schule verlassen und sich danach in Schulen des Lebens bewährt, wo es keine Zeugnisse gibt. Nur Erfahrungswerte. Mit der berühmten weiblichen Eleganz von Pariserinnen vermochte sie nicht zu glänzen, weil sie kein Geld besaß, um teure Kleider zu kaufen, aber für Seidenstrümpfe und High Heels und verrückte Hüte reichte es.
Offen bekannte sie zwar ihre unbändige Lust auf Abenteuer, aber schwieg am Tag danach. Nancy Wake war nie ein flibbertigibbet, kein Klatschmaul. Ihre Abenteuerlust wurde deshalb vom britischen Geheimdienst als positiv vermerkt, denn wer so unerschrocken neugierig mutig war, konnte da eingesetzt werden, wo es gefährlich wurde. Die Eigenschaft der Verschwiegenheit würde außerdem im Feindesland mal überlebensnotwenig sein. Mit üblichen Kriterien wie Schulabschlüssen, Erziehung zur Bildung, angelesenem Wissen ließ sich ihr Intellekt nicht messen. Sie besaß aber das, was man allgemein einen gesunden Menschenverstand nannte, verbunden mit einem sicheren Gespür für Gefahren, einem Instinkt, dem sie vertraute. In Gefahr und Not wählte sie deshalb nie den Mittelweg, sondern entschied sich in Sekundenschnelle, was sie tun musste und was nicht. Andernfalls hätte sie im Untergrund nicht überlebt. Ob sie nie Angst gehabt habe, wurde sie als über Neunzigjährige von einem Rundfunkreporter aus Dublin gefragt. »Never ever«, antwortete sie daraufhin mit ihrer rauchigen Stimme und lachte, als hätte man ihr einen unziemlichen Antrag gemacht.
Eines Abends lernte sie bei einem ihrer Ausflüge ins Pariser Nachtleben den Schauspieler Harry Bauer kennen. Er war ein Star in Frankreich, hatte in vielen Filmen mitgewirkt, darunter den Inspektor Maigret in Julien Duviviers Thriller Poil de carotte (Karottenkopf) gespielt, war jetzt mit Mitte fünfzig auf dem Höhepunkt seiner Popularität. In Paris sollte er Theater spielen, die Hauptrolle in Maurice Rostands Dreiakter Der Prozess des Oscar Wilde, basierend auf dem Prozess gegen den Dichter, der 1895 wegen »homosexueller Unzucht«, wie die Anklage lautete, zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, nach Verbüßung seiner Haftstrafe England verlassen hatte und 1900 verarmt in Paris gestorben war. Bauer lud Nancy Wake zur Premiere ein. Sie habe während der gesamten Aufführung schluchzen müssen, schrieb sie, sogar noch beim anschließenden nächtlichen Souper im Restaurant.
Henri-Marie Baur, wie Harry Bauer eigentlich hieß, war Jude. Das wussten die wenigsten, aber das interessierte in Künstlerkreisen niemanden – noch nicht. Es wurden Rasse und Religion erst überlebenswichtig, nachdem die Deutschen in Paris einmarschiert waren. Im Gepäck die Pläne zur Vertreibung der Juden aus Frankreich. Harry Bauer war, wie viele Schauspieler, ein unpolitischer Mensch. Er arrangierte sich mit den neuen Machthabern, denn er wollte ungestört seinen Beruf ausüben, gute Rollen bekommen. Die bekam er. Auch von den Deutschen. Zum Beispiel 1942 die Hauptrolle des Komponisten Stephan Melchior im Film Symphonie des Lebens. Joseph Goebbels war begeistert und sagte das auch nach der Vorführung, fügte allerdings hinzu, er wolle dennoch die ihm übermittelten Vorwürfe der Pariser SS-Dienststelle prüfen, wonach Bauer Jude sei. Weil es ein Skandal gewesen wäre, falls tatsächlich ein Jude in einem deutschen Film hätte mitspielen dürfen. Ein paar Wochen später wurde Bauer festgenommen, erkrankte schwer im Gefängnis, starb kurz nach seiner Freilassung an den Folgen der Haft. Er wurde 1943 unter großer öffentlicher Anteilnahme bestattet. Selbst viele der Franzosen, denen die Deutschen klammheimlich willkommen gewesen sind, waren davon überzeugt, dass er nicht an einer tödlichen Krankheit litt, sondern von der Gestapo ermordet worden war.
Dass sich Nancy Wake ohne Schwierigkeiten zurechtfand in einer doppelten Existenz, war hilfreich. In Paris, der großen Welt, glänzte sie als Mittelpunkt einer das Leben genießenden Bohème von Journalisten und Schauspielern, doch sobald sie im Auftrag von Hearst in der Provinz unterwegs war, schlüpfte sie über Nacht in die Rolle des braven Mädchens vom Land, das bei denen, die in einer anderen, einer kleinen Welt lebten, instinktiv den richtigen Ton fand. Sprach im Dialekt des französischen Südens, baute Slangwörter aus der Halbwelt in ihre Sätze ein, die sie in Paris nie gebraucht hätte. Diese Fähigkeit zur Anpassung an die jeweilige Situation war im künftigen Beruf als Agentin nützlich, weil sie in beiden Rollen überzeugend auftrat: als mondäne Frau, die sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst war, auch auf deutsche, und sich gegebenenfalls flirtend aus kritischen Situationen befreite. Oder als biedere Landfrau, die per Fahrrad unterwegs war mit dem Einkaufskorb wie während der Besatzungszeit viele Französinnen, in dem aber oft unter Gemüse und Eiern ein Revolver versteckt war.
Sie schrieb über Zigarettenschmuggler ebenso wie über die wilden Pferde der Camargue, über Stierkämpfe in Nîmes und Arles ebenso wie über das berühmte Fest der Zigeuner in Saintes-Maries-de-la-Mer. Von Widerständen und Schwierigkeiten ließ sie sich nicht entmutigen, erreichte eben, wenn nötig, über Umwege das Ziel und kam mit dem aus, was es auf diesem Weg gab. Sie lernte dabei fürs Leben.
Jener Trip nach Marseille im Oktober 1934 wegen des Staatsbesuchs eines Königs schien nur ein paar Zeilen wert zu sein. Deshalb wurde sie hingeschickt, keiner der erfahrenen Kollegen. Auf der Rückfahrt von dem Abenteuer, das sich dann direkt vor ihren Augen abspielte, sitzt ihr eine junge Frau gegenüber, die sie am vorherigen Tag schon in der Hotelbar gesehen hatte. Sie heißt Stephanie und stammt aus Jugoslawien, aber dass sie ausgerechnet in Marseille war, als der jugoslawische König Alexander I. ermordet wurde, ist Zufall. Sie war, erzählt sie, mit ihrem Mann im Hôtel du Louvre et de la Paix abgestiegen, hatte ihm aber, kaum angekommen, nach einem heftigen Streit, bei dem Eiskübel und Gläser durch die Luft flogen, empfohlen, sich zum Teufel zu scheren.
Nancy konnte die Szene beobachten, weil sie in der Nähe saß und gerade einen Drink zu sich nahm. Stephanies Begleiter, angeblich ja ihr Ehemann, machte sich nach dem Streit, den Polizisten schlichten mussten, tatsächlich aus dem Staub, und Stephanie nahm den nächsten Zug Richtung Paris. Da kannte sie niemand. Nancy bietet ihr spontan an, dass sie bei ihr in der Rue Sainte-Anne wohnen kann, bis sie eine eigene Wohnung gefunden hat. Fortan sind sie abends zu viert, wenn sie zum Essen gehen oder in einen Nightclub. »Ich war immer verliebt«, schrieb Nancy Wake, aber sie fügte hinzu: »Ins Leben. Und ganz besonders in Paris.«
Das, was ringsum in Europa wirklich passierte, lässt ihr Leben in Paris erscheinen wie einen letzten Tanz auf dem Vulkan kurz vor dessen Ausbruch. Das liest sich wie ein gängiges journalistisches Klischee und klingt eher nach einem hinkenden Vergleich. Doch diese Parallelwelt gab es tatsächlich noch. Die Zeitungen berichteten über die andere Wirklichkeit. Im Spanischen Bürgerkrieg verloren die Anhänger der Republik ihre Hochburgen und Stützpunkte. Guernica war 1937 von deutschen Bombern dem Erdboden gleichgemacht worden Die mit modernen Waffen bestens ausgerüsteten Truppen der Falangisten wüteten nach ihren Siegen im Blutrausch. Viele Spanier flohen vor Verfolgung und Mord über die Grenze nach Frankreich. Dort hatten eh schon Hunderttausende zuvor Zuflucht gesucht.
Sie vergrößerten die Schar der Exilanten aus Deutschland und Österreich. Auch in Wien waren inzwischen, nach dem begeistert begrüßten »Anschluss« ans Deutsche Reich 1938, die Nazis an der Macht. Im Süden Frankreichs und besonders in der Hafenstadt Marseille, wo sie auf ein Visum hofften, mit dem sie per Schiff in die Vereinigten Staaten von Amerika ausreisen durften, hatten sich vor allem viele deutschsprachige Intellektuelle niedergelassen. Insgesamt lebten in dieser Zeit vor dem bald beginnenden Krieg fast 400000 Flüchtlinge in Frankreich, 150000 aus Spanien, rund 40000 aus Deutschland und Österreich. Hitler hatte nach dem Münchner Abkommen 1938, wo sich ein letztes Mal die Westmächte Frankreich und Großbritannien, im Sinne der vom britischen Premier Neville Chamberlain vertretenen Appeasement-Politik, um des lieben Friedens willen von ihm hatten erpressen lassen, das Sudetenland ertrotzt, was faktisch das Ende der Tschechoslowakei bedeutete. Österreich gehörte ja bereits freiwillig zum Deutschen Reich.
Im Frühling 1938 war Nancy Wake deshalb zusammen mit einigen ihrer Journalistenfreunde nach Wien gereist. Alle wollten für ihre jeweiligen Arbeitgeber schreiben, was sich sichtbar geändert hatte, seit der »Führer«, gefeiert und umjubelt von hunderttausendfachem »Heil«-Gebrüll, seine Heimat heim ins Reich geholt hatte. Die bisher Unpolitische erlebte hautnah, dass jüdische Bürger gezwungen wurden, kniend per Zahnbürste die Trottoirs zu reinigen, oder von der Polizei aus ihren Häusern geprügelt wurden. Das vergaß sie nie mehr. Immer dann, wenn sie nach dem Krieg gefragt wurde, was der Auslöser gewesen sei für ihren persönlichen Schattenkrieg gegen die Nazis, erwähnte sie stets diese Erlebnisse. Nach ihrem ersten Besuch 1934 war ihr Wien so reizvoll in Erinnerung geblieben wie das Leben in Paris. Die Leichtigkeit des Seins schien auch an der Donau heimisch zu sein. Umso größer, nachhaltiger der Schock nur vier Jahre später. Es kam ihr vor, erinnerte sie sich, als wäre plötzlich ein Spalt zur Hölle aufgebrochen. Das Bild, das sie für ihre Gefühle fand, ist passend gewählt. Die Teufel, die so herrschten, hatten von nun an einen Namen: Nazis.
Noch ging in Frankreich das Leben für sie weiter wie bisher. Den Sommer verbrachte sie mit einem amerikanischen Freund in Juan-Les-Pins. Er war »ein fantastischer Tänzer«, musste aber wegen anderer Verpflichtungen zurück nach Paris. Sie blieb und hoffte auf ein paar Klatschgeschichten von der Côte d’Azur, die sie bei Hearst auf den gelben Seiten loswerden konnte. Abend für Abend ging sie deshalb aus. Dabei fiel ihr in einem Nightclub ein gut aussehender Mann auf, der sie bewundernd anstarrte. Dass Männer auf sie so reagierten, war sie jedoch gewöhnt und erschien ihr nicht als besonders aufregend. Der Mann trat an ihren Tisch und stellte sich vor: Henri Fiocca. Beide tanzten. Sie fand ihn zwar »charmant, sexy und amüsant«, hielt ihn aber dennoch nur für einen der leichtlebigen Playboys, von denen es an der Côte d’Azur viele gab. Leichtlebig war sie schließlich selbst. Doch dieser eine Mann war nicht wie andere Männer. Der scheinbare Lebemann wurde, auch wenn sein Leben mit ihr nicht lange dauern sollte, ihr Lebensmann.
Beim Abschied, er wieder zurück zur Arbeit nach Marseille, sie zu ihrer nach Paris, tauschten sie Adressen aus. Er hatte ihr erzählt, dass er zwar in der Hafenstadt lebte und dort seine Geschäfte als Schrotthändler führte, oft jedoch reisen musste zu Kunden und außerdem genügend Geld besaß, jederzeit an jeden Ort zu fahren, um sie zu treffen. War es schon eine große Liebe? Ein coup de foudre? Hat sie sein so selbstverständlich und nebenbei erwähnter Reichtum beeindruckt, weil er es gar nicht nötig hatte, zu protzen wie andere, die sie umschwärmten?
In den nächsten Monaten jedenfalls suchte die Journalistin Nancy Wake verstärkt nach Themen, die im Süden Frankreichs angesiedelt waren. Den Spott ihrer Freunde hielt sie aus. Traf dabei regelmäßig und nie zufällig Henri Fiocca. Aus einem unverbindlichen Flirt, wie sie ihn eigentlich zu schätzen liebte, wurde mehr. Anfang 1939 machte er ihr einen Heiratsantrag. Sie bat um Bedenkzeit. Denn die Vorstellung, aus ihrem unbeschwerten Alltag in Paris nach Marseille zu ziehen als Ehefrau eines reichen Kaufmanns, ihren Beruf und die weinselig fröhlichen Runden mit Freunden aufgeben zu müssen, erschien ihr nicht so verlockend. Hatten sie und Henri nicht auch ohne feste Bindung wunderbare Zeiten zu zweit? Warum sollte man die durch eine Ehe gefährden?
Bei einem Diner im Restaurant Verduns in Marseille wollte sie ihn davon überzeugen, alles zu belassen, wie es war, aber sie kam gar nicht erst zu Wort. Henri Fiocca erklärte ihr, dass er den Gedanken an das Leben, das sie ohne ihn in Paris führte, nicht ertragen würde. Ja, gab er zu, er sei eifersüchtig. Zwar war er dreizehn Jahre älter als sie, im Vergleich mit ihren jungen Freunden in Paris, besonders mit jenem Amerikaner, mit dem eng Tango tanzend er sie zum ersten Mal gesehen hatte in Juan-Les-Pins, mit seinen vierzig Jahren sogar ein alter Mann, aber er liebe sie und werde für sie sorgen. Sie müsse nur Ja sagen.
Man könnte Vermutungen anstellen, warum sie daraufhin seinen Antrag annahm und ihr freies Leben aufgab. Ob es vielleicht daran lag, dass sie bisher stets auf sich allein gestellt war, verbunden mit allen Risiken des Lebens, und unbewusst festen Halt bei einer Vaterfigur suchte? Doch bereits der Versuch einer derartigen Interpretation muss scheitern, weil es keine Hinweise in ihren Aufzeichnungen gibt. Sein Bekenntnis, eifersüchtig zu sein, notierte sie, habe sie davon überzeugt, dass er es ernst meinte. Denn eifersüchtig sei ja nur jemand, der liebt. Und vergaß nicht zu erwähnen, wie gerührt der Restaurantbesitzer Joseph war und zur Feier des Moments eine Flasche Champagner der Marke Krug öffnen ließ.
Die einzige Konstante in Nancy Wakes bisherigem Lebenslauf war die Abwechslung gewesen, die unstillbare Neugier auf das Abenteuer, das hinter der nächsten Ecke womöglich auf sie wartete. Dem Mädchen, das von sich selbst sagte, eine Art Playgirl zu sein, erschien vielleicht die Ehe eine spannende Alternative zu ihrem bisherigen Leben. Ein Abenteuer der mal ganz anderen Art. Aber schon das ist reine Spekulation. Ein Termin für die Hochzeit war schnell festgelegt, aber zuvor fuhr sie noch nach London, um Freunde zu besuchen. Die Rückfahrt stand an für den 3. September 1939. Sie war rechtzeitig im Bahnhof Waterloo.
Aber der Zug nach Dover fiel aus. Genau am Tag ihrer Abreise hatten Großbritannien und Frankreich dem Dritten Reich nach dessen Überfall auf Polen den Krieg erklärt. Fahrpläne, die bis gestern gegolten hatten, waren außer Kraft und Nancy Wakes Rückkehr nach Frankreich gefährdet, weil es für Reisen aufs Festland, erst per Zug und dann mit der Fähre über den Kanal, jetzt neue Bestimmungen unter strengen Auflagen gab. Ein gültiger Pass allein reichte nicht mehr. Hunderte wollten zurück. Sie brauchte zusätzliche Dokumente, zum Beispiel eine schriftliche Garantie, in Frankreich dringend erwünscht zu sein. Es dauerte zehn Tage, bis die von Henri Fiocca in London eintraf.
Als endlich die künftige Madame Fiocca Marseille erreichte, ging ihr Kampf mit der Bürokratie in die nächste Runde. Diesmal mit der französischen. Ihr Ausweis als Bürgerin eines mit Frankreich verbündeten Landes und ihre Geburtsurkunde aus Neuseeland genügten dem Standesbeamten nicht. Er verlangte eine neue beglaubigte Übersetzung. Sie reagierte typisch für Nancy Wake, machte ihm unmissverständlich klar – und in einem Französisch, das in Marseille nicht unbedingt in besseren Kreisen gepflegt wurde –, wohin er sich seine Papiere stecken könne. Nein, die Haare waren es nicht. Dann rief sie Henri an, der sie im Hôtel du Louvre et de la Paix untergebracht hatte, und erklärte ihm, was sie betreffen würde, sei die Hochzeit hiermit geplatzt. Drei Stunden später gab ein Bote die Genehmigungen bei der Rezeption ab. Ihr künftiger Mann, erkannte sie, schien über beste Verbindungen in der Stadt zu verfügen.
Henri Fioccas Familie, konservativ katholisch, war entsetzt über die Wahl ihres Sohnes. Die Braut kam nicht aus ihren Kreisen, wie sie unschwer feststellten nach der ersten Begegnung, womit sie ja auch recht hatten. Eine kirchliche Trauung in Saint-Vincent-de-Paul fiel aus, weil Nancy Wake der Church of England angehörte und nicht bereit war, zu konvertieren. Sie machte sich zwar kaum was aus ihrer Religion, aber wie immer, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlte, reagierte sie störrisch. Auch der landesüblichen Sitte, wonach die Eltern der Braut die Hochzeitsfeier bezahlten, konnte sie nicht folgen, weil ihre Mutter Ella Wake kein Geld besaß und ihr Vater Charles Wake unbekannt verzogen war. Von ihrer Familie aus dem fernen Australien würde zur Hochzeit niemand kommen. Henri Fiocca löste diskret das Problem. Er übernahm alle Kosten für das Fest, bat sie aber, seinem Vater nichts davon zu sagen.
Am 30. November 1939 heirateten Nancy Wake und Henri Fiocca im Rathaus von Marseille, danach richtete das Ehepaar einen Empfang im Hôtel du Louvre et de la Paix aus – es wurde ein fröhliches, ein lautes, ein glückseliges Fest, und vor allem die aus Paris angereisten Freunde der Braut trugen mit ihren nicht immer jugendfreien Gesängen zum Gelingen bei. Selbstverständlich gab es genug Champagner, aber auch die wenigen Gäste, Verwandte von Henri, die auf frisch gepresstem Orangensaft bestanden, gerieten in Stimmung. Nancy hatte Barkeeper und Kellner angewiesen, die Säfte mit Brandy oder Grand Marnier anzureichern. Ihr Schwiegervater war vor allem deshalb glücklich und zufrieden, weil ihn dieser wunderbare Abend keinen Centime gekostet hatte. Außerdem musste er zugeben, dass sein Sohn eine ausgesprochen schöne Frau gewählt hatte.
Das junge Paar zieht nach der Hochzeitsreise in eine luxuriöse Wohnung in die Rue Edouard Stephan, mit Blick über Marseille und den Hafen. Nancy Fiocca, geborene Wake, muss sich nun nicht mehr darum kümmern, wovon sie die Miete bezahlt oder ob sie genügend zum Leben verdient. Sie passt sich dem an, was von Frauen jener Klasse, zu der sie durch Einheirat jetzt gehört, erwartet wird. Gibt Partys, geht einkaufen, empfängt abends ihren Mann nach der Arbeit und macht hauptsächlich einen guten Eindruck. Sie lernt sogar, eine Bouillabaisse zu kochen. Der Maître des »Basso« bringt es ihr bei. Als ihr Schwiegervater mal den berühmten Maurice Chevalier zu Gast hat, ist es Nancy, die sie zubereitet, und alle loben ihre Künste. Ein angenehmes Leben, so scheint es.
Vom Krieg, den Frankreich zwar erklärt hat, der aber bisher noch wie eine Art Stillstandkrieg aussah, war im öffentlichen Leben Marseilles kaum etwas zu bemerken. Hamsterkäufe soll es jedoch bereits gegeben haben, wie die Zeitung berichtete. Auch die Fioccas hatten sich eingedeckt. Vor allem mit Brandy, Wein, Kaffee und Zigaretten. Was jedoch in der Öffentlichkeit auffiel, waren die Schlangen vor dem amerikanischen Konsulat. Wer Verwandte oder solvente Bürgen in den Vereinigten Staaten von Amerika vorweisen konnte, wartete täglich auf die erlösende Nachricht, ins Land der Freien einreisen zu dürfen. Unter ihnen viele deutsche Juden. Denn für die ging es jetzt, da die Nazis, vor denen sie geflohen waren, an der Grenze standen, um Leben oder Tod. Auf dem Nachhauseweg vom US-Konsulat, wo sie wegen ihres Visums nachgefragt hatten und erneut vertröstet worden waren, machten jene Emigranten, die es sich leisten konnten, Station im Hôtel du Louvre et de la Paix, tauschten die neuesten Gerüchte aus und tranken einen Pastis oder ein Glas Wein. Mit ihren Frauen oder, wie Lion Feuchtwanger, mit der aktuellen Geliebten. Das konnten sich aber nur die Wohlhabenden unter den Flüchtlingen leisten.
Zu denen gehörte der Emigrant Walter Benjamin schon lange nicht mehr. Das war mal anders gewesen, als es ihm noch gut ging und Frankreich nur eine Urlaubsreise wert. Marseille kannte er aus diesen Zeiten. Im Sommer 1926 hatte er hier sogar für ein Experiment Station gemacht. Für einen Selbstversuch mit Drogen: »Um sieben Uhr abends nach langem Zögern Haschisch genommen. […] So liege ich auf dem Bett, las und rauchte. Mir gegenüber immer dieser Blick in den ventre von Marseille«, notiert er in seinem dann Haschisch in Marseille betitelten Aufsatz, wo er auch die Bar im Restaurant »Basso« am Alten Hafen beschrieb:
»Und auf dem Hintergrunde dieser immensen Dimensionen des inneren Erlebens, der absoluten Dauer und der unermeßlichen Raumwelt, verweilt nun ein wundervoller, seliger Humor desto lieber bei den Kontingenzen der Raum- und Zeitwelt. Ich empfinde diesen Humor unendlich, wenn ich im Restaurant Basso erfahre, die warme Küche würde gleich geschlossen, während ich mich eben niedergelassen habe, um mich in die Ewigkeit hineinzutafeln. Nachher nichtsdestoweniger das Gefühl, daß ja dies alles hell, besucht, belebt ist und auch bleiben wird. […] Aber das Essen war später. Erst die kleine Bar am Hafen. […] Auf dem Wege zum vieux port schon diese wundervolle Leichtigkeit und Bestimmtheit im Schritt, die den steinigen, unartikulierten Erdboden des großen Platzes, über den ich ging, mir zum Boden einer Landstraße machte, über die ich, rüstiger Wanderer, bei Nacht dahinzog. […] In jener kleinen Hafenbar begann dann das Haschisch seinen eigentlich kanonischen Zauber mit einer primitiven Schärfe spielen zu lassen, mit der ich ihn vordem wohl noch kaum erlebte. Nämlich er machte mich zum Physiognomiker, zumindest zum Betrachter von Physiognomien, und ich erlebte etwas in meiner Erfahrung ganz Einziges: ich verbiß mich förmlich in die Gesichter, die ich da um mich hatte und die zum Teil von remarkabler Roheit oder Häßlichkeit waren. Gesichter, die ich gemeinhin aus einem doppelten Grunde gemieden hätte: weder hätte ich gewünscht, ihre Blicke auf mich zu ziehen, noch hätte ich ihre Brutalität ertragen.«
Jetzt war Marseille seine letzte Hoffnung, den Uniformierten mit den brutalen Gesichtern, die mittlerweile in Wirklichkeit auftraten und nicht mehr nur in seinen Albträumen, zu entkommen. Das wird er schaffen. Aber als ihn die Kraft, der Mut, die Hoffnung auf bessere Zeiten im spanischen Portbou verließen, nahm er sich, obwohl er doch ein Visum für die USA besaß, den Jägern der Gestapo entkommen war, am 26. September 1940 lieber selbst das Leben, bevor es die ihm doch noch hätten nehmen können. So zumindest die gängige Annahme bis vor wenigen Jahren. Inzwischen gibt es Zweifel an Benjamins Freitod. War es vielleicht doch ein natürlicher Tod? Oder gar Mord? Denn der Brief an Theodor W. Adorno, in dem er angekündigt hatte, sich umzubringen, ist verschollen.
Die Propaganda der Nazis hatte schon Wirkung gezeigt, bevor die Deutschen einmarschierten. Bereits am 14. September 1939, kurz nach der Kriegserklärung Frankreichs als Konsequenz auf den deutschen Überfall auf Polen und Monate, bevor der Krieg tatsächlich begann, wurde von der Regierung in Paris angeordnet, dass alle Männer zwischen achtzehn und fünfundfünfzig, die den »feindlichen Nationen« angehörten, in camps de concentration, Sammellagern, interniert werden sollten. Widerspruch in der veröffentlichten Meinung war kaum vernehmbar. Die Aufforderung, sich in Internierungslagern zu melden, ganz egal, ob Jude oder nicht, richtete sich an alle als feindlich bezeichneten Ausländer, selbst wenn die, wie etwa deutsche Juden, vor ihren Feinden in der eigenen Nation nach Frankreich geflüchtet waren.