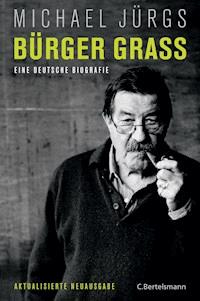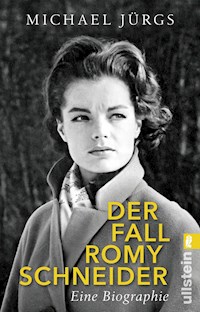2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Deutschlandreise zu den bedeutendsten Orten
deutscher Geschichte
Michael Jürgs hat sich auf eine Deutschlandreise begeben und an berühmten Orten nach den Spuren deutscher Geschichte gesucht. Mitunter begleiten ihn Prominente aus Politik und Kultur, Sport und Wirtschaft und erzählen ihm ihre persönlichen Erinnerungen – u. a. Volker Schlöndorff , Lothar de Maizière, Michael Naumann, Katja Kraus, Rainer Eppelmann, Matthias Platzeck. Gemeinsam suchen sie Antworten auf Fragen wie: Wen haben die Steinmetze in der Spitze des Kölner Doms verewigt? Wer pilgert heute noch zu Bismarcks Grab in Friedrichsruh? Wofür hielt sich die SS im KZ Buchenwald einen Zoo mit Wildtieren? Wieso gehört Rahns linker Fußballstiefel in ein Museum? Was hat ein CDU-Politiker mit Nathan dem Weisen gemein? Wie schützt Johann Sebastian Bach die Th omanerchorknaben gegen Heimweh? In fünfundzwanzig Reportagen beschreibt Michael Jürgs, wie und an welchen historischen Schauplätzen wir heute unsere Geschichte erleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Michael Jürgs
WER WIR WAREN, WER WIR SIND
Wie Deutsche ihre Geschichte erleben
C. Bertelsmann
2. Auflage
© 2015 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: buxdesign München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15913-9
www.cbertelsmann.de
Jeder Ort hat seine Zeit …
… und jede Zeit hat ihren Ort. Das klingt einleuchtend. Damit ein Schauplatz, auf den eine solch simple Behauptung denn auch tatsächlich zutrifft, ein Ort also, der nicht nur einst Größe erlebt hat, sondern der heute noch erlebt werden kann als Zeitzeuge der Vergangenheit, für mich in die nähere Auswahl kam, musste er bei der Vorbereitung meiner Reisen logistisch wie historisch einige Bedingungen erfüllen.
Erstens müsste es, belegbar mit Dokumenten und Daten, ein Ort sein, der wesentlich war in der deutschen Geschichte und in der jeweils zu bestimmten Zeiten herrschenden Gesellschaftsordnung.
Zweitens sollte der Schauplatz für Deutsche so viel Anziehungskraft ausstrahlen, dass sie als Touristen dorthin reisen, um vor Ort ihre Geschichte zu erleben. Sobald die Recherchen ergaben, dass beide Bedingungen erfüllt werden, machte ich mich auf die Reise, um erleben und beschreiben zu können, wer wir waren und wer wir sind.
Die Loreley zum Beispiel erfüllte diese Voraussetzungen nicht. Über die langhaarige blonde Nixe auf dem Schieferfelsen im Rheintal, deren Gesang die Männer zum Opfer fielen, weil sie von ihr gebannt nicht auf die Tücken des Stromes achteten, gibt es zwar viele sagenhafte Geschichten. Darunter wunderbare Balladen großer deutscher Dichter wie Clemens Brentano oder Heinrich Heine, die den Deutschen viel bedeuten, obwohl viele nicht wissen, was es bedeuten soll.
Aber es existiert keine nachprüfbare, keine mit handfesten Fakten zu belegende wahre Geschichte. Auch Frau Holle ist auf den ersten Blick wie die Loreley nichts weiter als eine sagenhafte Märchengestalt, aber in den Wäldern, in denen sie einst segensreich gewirkt haben soll, finden sich tatsächlich Spuren, finden sich tatsächlich Geschichten, die mehr sind als nur Legenden aus uralten Zeiten.
Andere Orte wiederum wie beispielsweise der Stechlinsee sind dank Theodor Fontane zwar Schauplatz großer deutscher Romane. Aber eine historisch belegbare Bedeutung außer der Anekdote, dass bei einem Erdbeben in beispielsweise Lissabon aus der Tiefe des Stechlinsees eine Fontäne hochschießt, fernab vom Geschehen ausgerechnet in der stillen Mark Brandenburg, hat der See eben nicht, weshalb dort keine Geschichten zu erleben sind, die wesentlich wären für die deutsche Geschichte.
Drittens ist meine Auswahl zusätzlich noch subjektiv und sicher auch unvollständig und naturgemäß deshalb angreifbar. Immer wieder stieß ich auf Spuren der dunkelsten deutschen Historie, sogar an Orten hoch oben am Himmel, wo ich es nun wirklich nicht vermutet hätte. So unterschiedlich die Schauplätze auch sind, so unterschiedlich ihre Geschichte auch ist – diese Erblast lastet auf vielen.
Andere in die Zeiten Reisende werden andere deutsche Orte für wesentlich halten als jene, die mir wesentlich scheinen. Deshalb ist Wer wir waren – Wer wir sind auch nur ein Geschichtsbuch voller eigenartiger Geschichten geworden, eigen für meine Art, Geschichte zu erzählen.
Keine langen Vorworte mehr.
Die Reise soll beginnen.
Dies sind die Stationen:
Wer wir waren, wer wir sind
1. Haus der Geschichte, Bonn
Bismarck allein im Wald
2. Friedrichsruh
Dich singe ich, Schwarz-Rot-Gold
3. Hambacher Fest
Preußens Grauen, Preußens Gloria
4. Potsdam
Wir sind Fußball
5. DFB-Museum, Dortmund
Frau Holle und die Wandervögel
6. Hoher Meißner
Die DNA der BRD
7. Herrenchiemsee
Das Schloss der Ruhrbarone
8. Villa Hügel
Das Dorf der Maler
9. Worpswede
Kriege und Frieden
10. Militärhistorisches Museum, Dresden
Die Welt als Bühne
11. Hoftheater Meiningen
Wunder in der Isar
12. Deutsches Museum, München
Unsterbliche Tote
13. Dorotheenstädtischer Friedhof, Berlin
Käfer unter Wölfen
14. Autostadt Wolfsburg
Mörder unter uns
15. Haus der Wannsee-Konferenz. Holocaust-Mahnmal
Gott und Teufel
16. Wartburg
In die Gänge kommen
17. Lübeck
Vom Leben der anderen
18. Stasigefängnis Berlin-Hohenschönhausen
Der lachende Richter
19. Wackersdorf
Die Traumfabrik
20. UFA-Studio Babelsberg
In Form vollendet
21. Wörlitzer Park. Bauhaus Dessau
Wir da oben, ihr da unten
22. Buchenwald. Weimar
Dem Himmel so nah
23. Kölner Dom
Sein Leipzig lob ich mir
24. Thomanerchor
Die Insel der Sehnsucht
25. Sylt
Reiselektüre
Wer wir waren, wer wir sind
1. Haus der Geschichte, Bonn
Jener Sommerabend im Kaukasus. Um einen runden Eichenblock sitzen auf zurechtgehackten Baumstümpfen drei Männer. Links Hans-Dietrich Genscher in Anzug und Krawatte. Ihm gegenüber Helmut Kohl im offenen Hemd und in halbbauchig geknöpfter Strickjacke. Zwischen Genscher und Kohl, Arme über dem hochgeschlossenen Pullover verschränkt, Michail Gorbatschow. Im Halbrund hinter ihnen stehen in gleichfalls heiterer Gemütslage die Augenzeugen dieser historischen Szene. Unter ihnen UdSSR-Außenminister Eduard Schewardnadse, Gorbatschows Frau Raissa, Kohls Sprecher Hans »Johnny« Klein – alle mittlerweile beheimatet in einer anderen Welt – und Finanzminister Theo Waigel.
Ein merkwürdiger Platz: Dort, auf Gorbatschows Datscha bei Archys, haben am 19. Juli 1990 der sowjetische Staatschef und der deutsche Bundeskanzler Geschichte ausgesessen. Dort im Kaukasus, auf einer Meereshöhe von 1400 Metern, entwarfen vor fünfundzwanzig Jahren die beiden Männer eine Roadmap zur deutschen Einheit, an deren Ende das Ziel Wiedervereinigung stand. Über ihr ungewöhnliches Outfit, in Strickjacke der eine, im Pullover der andere, geschuldet den mitunter am Fluss Selentschuk aufkommenden feuchtkühlen Abendwinden, oder über die aus Baumstämmen gesägten Hocker, auf denen sie saßen, ist seitdem mehr berichtet worden als über manchen Minister oder Parteisekretär.
Deshalb ruhen Wolle und Holz, die unter anderen Umständen in anderen Zeiten eben nur Holz und Wolle gewesen wären, im Haus der Geschichte zu Bonn hinter Glas. Ausgestellt als ansehnliche Wegbegleiter zum großen Ziel geeintes Deutschland. Wie dabei wieder zusammenwuchs, was lange getrennt war, ist zwar eine sagenhaft gute Geschichte, die alle Jubeljahre wieder erzählt wird, weil es eher selten passiert, dass Wunder geschehen und Märchen wahr werden. Doch diese Geschichte setze ich als bekannt voraus, will sie nicht mit Geschichten weiter verdichten und erfülle deshalb im folgenden Text am Beispiel von Daten wie dem 9. November 1989 oder dem 3. Oktober 1990 nur noch meine Chronistenpflicht.
Gehören solche Banalitäten wie eine Strickjacke, ein Pullover, zwei Baumstümpfe aber hierher? Ja. Hier sind sie wesentlich, denn hier gehört zum wissenschaftlichen Gesamtkonzept, auch das auszustellen, was auf den ersten Blick banal wirkt. Mit Speck fängt man Mäuse, behauptet bekanntlich der als Quelle für allen möglichen Schwachsinn missbrauchte Volksmund. Was übersetzt ins wahre Leben etwa bedeutet, dass einem verlockenden Angebot niemand widerstehen könne. Eine Weisheit, die bei den Planungen für das Haus der Geschichte, die 1986 begannen, in die Tat umgesetzt worden ist. Aufgrund von Befragungen der Besucher wurde das Konzept seit der Eröffnung 1994 immer wieder den neuen technischen Möglichkeiten angepasst und entsprechend verfeinert: Dreidimensional, digital, haptisch. Stets blieben die vier Grundsäulen der Anspruch, sowohl unterhaltend als auch belehrend, sowohl berührend als auch berührbar zu sein.
Manchmal sogar tanzbar.
Tanzbare Geschichte? Habe ich mich etwa verrannt auf der Suche nach den noch nicht ausgeschlachteten Geschichten hinter all dem Sichtbaren in den Gängen und den Wänden und den Räumen und den sechzehn historischen Stationen des Museums?
Gemach. Die tanzbare Geschichte wird noch geklärt. Aber nicht schon hier und schon gar nicht jetzt. Erst mal sollen mich die Leser bei meiner Reise durchs Haus der Geschichte begleiten. Ich habe dafür sogar über jeden Verdacht leichtfertigen Umgangs mit Historie erhabene Unterstützer. Aus einer Vielzahl von Geschichten, betont Präsident Hans Walter Hütter, werde schließlich am Ende »unsere Geschichte«. Memory in history wird gestützt von real existierenden historischen Daten.
In diesem Rahmen dürfen viele der ausgestellten Objekte, darunter eben auch Strickjacke, Pullover, Baumstumpf, für sich sprechen. Statt ausschließlich anhand von Akten und Fotos und Zahlen über die Verbrechen der Nazis und der Kommunisten die Banalität des Bösen zu dokumentieren, soll deutsche Geschichte erlebbar, Schritt für Schritt begehbar gemacht werden.
Im Museum gehören deutsch-deutsche Jahrestage wie der 23. Mai 1949, als die Bundesrepublik geboren wurde, oder der 17. Juni 1953, als Arbeiter in Ostberlin gegen die Obrigkeit auf die Straße gingen, oder der 13. August 1961, der Tag des Mauerbaus, wie der 9. November 1989 und der 3. Oktober 1990 selbstverständlich zur Nachkriegsgeschichte.
Die begann am 8. Mai 1945. Mit dem Tag der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht, mit der Befreiung von KZ-Häftlingen, Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen aus vielen Ländern startet hier die Zeitreise von der Vergangenheit in die Gegenwart. Die wurde noch viel zu lange geprägt von den herrschenden Moralvorstellungen der einst Herrschenden. Wie aus der Adenauer’schen Demokratur eine kämpferische Demokratie aufbrach, ist schon ebenso oft erzählt worden wie Geschichten der deutschen Einheit. Ausgelöst wurde diese Geschichte in einer einzigen Nacht. Nachdem am 26. Oktober 1962 von der Staatsgewalt die Redaktion des Spiegel in Hamburg besetzt und außer einigen Redakteuren auch Herausgeber Rudolf Augstein verhaftet worden war, übten fortan Schüler und Studenten auf den Straßen für ihn und die Pressefreiheit demonstrierend den aufrechten Gang. Mit Erfolg. Sechs Jahre vor den je nach Weltanschauung verklärten oder verteufelten 68ern, siebzehn Jahre nach der Befreiung 1945, nahmen wir uns Schritt um Schritt die Freiheit, die wir meinten.
Die Außerparlamentarische Opposition, kurz: APO, angetreten gegen den Vietnamkrieg der verbündeten Amerikaner und gegen die Verdrängung der Schuld der Väter und Mütter, begann den langen Marsch durch die Institutionen. Vollendet schließlich 1969 durch die Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler, der versprach, mehr Demokratie zu wagen. Beim Anblick des Wasserwerfers, den die Polizei dem Museum geschenkt hatte, leider renoviert statt mit sichtbaren Beulen von einstigen Einsätzen, rief bei einem Rundgang der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder dem Kulturstaatssekretär Nevermann laut durch die Halle zu: »Knut, komm mal rüber, die Dinger haben wir damals doch oft vor uns auf der Straße gesehen!«
Seinen internationalen Ruf hat sich das Haus der Geschichte verdient. Mit ihm und in ihm kann sich Deutschland wahrhaft sehen lassen, und damit im Glanze seines Glückes stets alles strahlen kann, was in der historischen Sammlung gezeigt wird, darunter auch die Tür zur damaligen Zelle von Rudolf Augstein, stehen für Pflege und Reinigung pro Jahr vierhunderttausend Euro im Haushalt des Museums bereit.
Der Weg durchs Museum beginnt mit einem Rückblick, um Besucher in jene Zeit zu versetzen, der die meisten von ihnen dank später Geburt entronnen sind. Nach der Stunde Null, befreiend zu sehen im kurzen Filmausschnitt über die Sprengung des Hakenkreuzes auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg oder symbolisch an einem originalen US-Jeep. Denn Soldaten in Jeeps fuhren voraus in befreite zerstörte Städte, in denen im Mai 1945 wie immer im Mai, egal, ob mal wieder Frieden herrschte in Europa oder mal wieder Krieg, die Bäume blühten. Das erste Bild, das die Geschlagenen von den Siegern speicherten – Amerikaner, Russen, Engländer, Franzosen –, war das eines Jeeps. Egal, ob der mal im Osten oder im Westen produziert wurde. So anschaulich, so sichtbar nacherlebt man im Haus der Geschichte die deutsche Nachkriegszeit. Die der Besatzung in vier Zonen, die der Bundesrepublik, die der DDR.
Bilder vom Hungerwinter 1946/1947. Der Kohlenklau wurde von Gottes amtierendem Vertreter im Bonn nahen Köln, Joseph Kardinal Frings, als überlebensnotwendig in solchen Zeiten abgesegnet, den Dieben von der Kanzel herab Absolution erteilt. Die dankten es ihm und bezeichneten fortan unerlaubtes Klauen als ihnen erlaubtes »Fringsen«.
Berichte von Flüchtlingsschicksalen, nachgebaute Notunterkünfte in Baracken, hörbar, begehbar, sichtbar: Die Zahl von elf Millionen ausgebombten, vertriebenen, verschleppten, vermissten Deutschen, Menschen, die nach Kriegsende ihre Angehörigen suchen oder von denen gesucht werden, verzeichnet bereits ab April 1945 in den Karteien des Rotes-Kreuz-Suchdienstes, kann ich mir nicht vorstellen. Hier sehe ich sie in berührenden Nahaufnahmen vor mir: Kinder, kleine und größere, zwei, drei, vier Jahre alt, manche auch älter, aufgenommen von der DEFA in Potsdam-Babelsberg. Kinder, die nicht wissen, zu wem oder wohin sie gehören, weil sie auf der Großen Flucht ihre Eltern verloren haben. Viele kennen nicht mal ihren eigenen Vornamen, geschweige denn einen Familiennamen. Bis Ende 1946 liefen solche Suchfilme zwischen Wochenschau und Hauptfilm in allen Kinos.
Memory and history, Erinnerungen und Geschichte: Freie Wahlen hier, Einparteiendiktatur dort. Wirtschaftswunder hier, Planwirtschaft dort. Pressefreiheit hier, Zensur dort. Brauner Muff unter den Talaren hier, Kadertraining ab Kita dort. Die Zone Ost, die wir trotzig anschreibend gegen die Reaktionäre von der anderen Straßenseite DDR nannten und stets ohne Gänsefüßchen, war in der Tat ein Unrechtsstaat. Zu den Ruhmesblättern meiner Branche, deren berühmt-berüchtigte Titelbilder wie das des Spiegel über »Ulbricht: Des Kremls Kreatur« oder das des Stern über »Hitlers Tagebücher entdeckt« zusammen mit den verblichenen einstigen Größen wie Quick und Revue ausgestellt sind, gehören gleichermaßen die den real existierenden Sozialismus verharmlosenden Reportagen in Meinungen prägenden Wochenblättern und Magazinen über das Land da drüben wahrlich nicht.
Wenn wir, verkündeten sie dort als Staatsräson, »eine Regierung gründen, geben wir sie niemals wieder auf. Weder durch Wahlen noch durch andere Methoden.« Es stimmt, dass in der DDR nicht gar so viele Nazigrößen ungestraft davonkamen wie hierzulande, wo es zu viele Mörder gegeben hat, die schamlos dennoch Karriere machten in Verwaltung, Politik, Universitäten, Industrie. Die meisten Schreibtischtäter im Reichssicherheitshauptamt hatten bekanntlich einen Doktortitel, gehörten zur akademisch ausgebildeten Elite. Als solche führten sie sich, keiner Schuld bewusst, in der Bundesrepublik nach der Befreiung jahrzehntelang wieder auf. Oder wurden von den neuen Verbündeten im bald beginnenden Kalten Krieg, den Amerikanern, gegen die neuen Feinde, die Russen, zu Tausenden eingesetzt bei der CIA, dem FBI oder dem Bundesnachrichtendienst.
Die enthemmte Brutalität des vorgeblichen Kulturvolkes ließ sich zwar historisch belegen. »Wir klagen uns an«, heißt es, verfasst von Martin Niemöller und Gustav Heinemann, im Oktober 1945 im sogenannten Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche, »dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.« Aber im aufbrechenden Ost-West-Konflikt zählte Moral zu den nun mal unvermeidlichen Kollateralschäden der Realpolitik.
Es lässt sich nicht leugnen, dass in der Nationalen Volksarmee die Traditionen der einst gesamtdeutschen Wehrmacht überlebten, der Ungeist des Militarismus regierte, während sich in der Bundeswehr trotz aller regelmäßig veröffentlichten Skandale über Menschenschinder in Uniform die Prinzipien der inneren Führung durchsetzten. Kein Volk in den beiden ab 1949 auseinanderdriftenden deutschen Teilstaaten war, was die gemeinsame Geschichte bis 1945 betrifft, weniger schuldig gewesen als das andere.
Als im Oktober 1990, nicht mal hundert Tage nach dem Gipfeltreffen auf Holz, Freude schöner Götterfunken in den Himmel über Berlin stieg und danach Einigkeit und Recht und Freiheit für das nicht mehr geteilte Vaterland besungen wurden, waren zwar die berauschenden ersten Liebesnächte zwischen Ostlern und Westlern, die One-Night-Stands nach dem Mauerfall, bereits eine ferne Erinnerung an erlebte Leidenschaften. Denn im vereinten Deutschland blühten noch keine Landschaften Ost, und dem Westen drohte die Düngung neuer Heimaterde bald teurer zu werden als gedacht. Seitdem wird, wann und wo auch immer es Gelegenheit gibt, gejammert und geklagt. Hier wie dort.
Aber so gut wie jetzt, fünfundzwanzig Jahre danach, ging es den Deutschen in ihrer Geschichte noch nie. Den Satz lasse ich schmucklos so stehen. Freiheit ist zwar nicht das Einzige, was zählt, aber ohne Freiheit ist alles nichts. In diesem Zusammenhang kann passend besichtigt werden: der Volksaufstand 1989, der Mauerfall, die erste gelungene unblutige deutsche Revolution oder das ungeteilte Berlin als die neue alte deutsche Hauptstadt. Inzwischen als coole Metropole überlaufen von Millionen Touristen aus der ganzen Welt.
Die Idee, gegenüber dem Bundestag und dem Turm mit den Abgeordnetenbüros, nach dem ehemaligen Parlamentspräsidenten Eugen Gerstenmaier Langer Eugen genannt, in Bonn deutsche Geschichte ab 1945 zu präsentieren, ist mit rund 500000 Besuchern pro Jahr zu einem Erfolgsmodell politischer Allgemeinbildung geworden. Die meisten von ihnen – das behaupte ich jetzt einfach mal, denn beweisen kann ich es natürlich nicht – sind beim Verlassen des Hauses klüger als Stunden zuvor beim Betreten.
Was sie sehen, wird ihnen zur Vertiefung nachlesbar auch erläutert. Dass Billy Wilder mit dem Film Todesmühlen die Schrecken in den jetzt befreiten nationalsozialistischen Konzentrationslagern dokumentierte, dass John Ford die legendäre blutige Schlacht um Monte Cassino filmte, wer weiß das schon außer vorgebildeten Historikern wie zum Beispiel mein Begleiter Professor Harald Biermann, der als Lebenspartner der RTL-Chefin Anke Schäferkordt aber auch auf anderen Spielfeldern des Lebens kundig mitreden kann.
Der weltgewandte Mann, der in den USA studierte, über die Politik John F. Kennedys promovierte – dessen handschriftlich und englisch-phonetisch notierter legendärer Satz »Ish bin ein Bearleener« im Original zu besichtigen ist – und sich mit einer Arbeit über den deutschen Liberalismus nach 1848 habilitierte, wird auch eingesetzt als eine Art Sonderbotschafter Deutschlands. Zum Beispiel dann, wenn der Kronprinz von Abu Dhabi zum Staatsbesuch anreist. Die Interessen des Gastes, teilte das Auswärtige Amt mit, würden Rennpferden und Autos gelten. Mit edlen Rössern konnte Biermann im Museum nicht dienen. Aber mit Autos. Zum Beispiel mit einem, das der Prinz noch nie gesehen hatte. Dem »Rollermobil« Isetta von BMW.
Angeregt durch das, was sie sehen, sollen die Besucher mehr wissen wollen. Sich ausgehend vom großen Gesamtbild in Details vertiefen. Dann hätten die Ausstellungsmacher, dann hätten die Kuratoren, dann hätten die Historiker sich ums Vaterland verdient gemacht.
Zugegeben, das klingt ziemlich hochtrabend. Birgt aber einen tieferen Sinn. Wer mehr weiß, ist immun gegen schreckliche Vereinfacher und Geschichtsklitterer von rechts oder von links. Ich könnte es einfach mit einem meiner Lieblingssongs erklären, dem Eingangslied aus der »Sesamstraße«: Wer Wie Was Wieso Weshalb Warum/Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Das Bonner Haus der Geschichte und seine Schwester in Leipzig, das Zeitgeschichtliche Forum, in dem die schreckliche Spießigkeit des SED-Regimes in all ihren tatsächlichen alltäglichen Schrecken vorgeführt wird, sind deshalb nicht nur historische Museen, sondern erlebbare Orte der Erinnerungskultur. Wer sich der Geschichte verweigert – und jetzt folgt eine weitere notwendige Binse –, ist dazu verurteilt, sie noch einmal zu erleben. Weil sonst die Zeichen, mit denen sich mögliche finstere Zeiten andeuten, nicht erkannt werden.
Eine hochsensible Kuratorin, ein ehrenwerter Kurator suchen sich zwar liebend gern Themen, auf die noch niemand vor ihnen gekommen ist, in der Hoffnung, dies würde unter ihresgleichen eigenen Ruhm mehren. Das können sowohl Trinksitten des Bürgertums im Gegensatz zu denen des Adels im 18. Jahrhundert sein als auch die landläufige Rezeption von Sättigungsbeilagen in den HO-Gaststätten der DDR.
Das ist zwar erlaubt.
Erlaubt ist aber auch die Frage: Wen interessiert das?
Geschichte jenseits großer Zusammenhänge kann vermittelbar sein mit kleinen Geschichten. In denen lässt sich aus der Vergangenheit lernen für die Gegenwart. Es ist deshalb zulässig, mit scheinbar Nebensächlichem, Banalem wie eben einer Strickjacke oder einem Baumstumpf Neugier zu wecken auf das, was sich nicht sofort beim ersten Blick erschließt. Um die Kirche voll zu kriegen, sagt ein altes journalistisches Sprichwort aus analogen Zeiten, um Sperriges an Mann und Frau zu bringen, ist für eine Predigt die Leichtigkeit des Scheins als verlockender Einstieg in die notwendige Schwere des Seins ein bewährtes Mittel.
Für den Lauf der Welt ist zwar von geringer Bedeutung der Zettel, den Oliver Kahn seinem Erzfeind-Kollegen Jens Lehmann aufmalte, bevor der sich im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft 2006 gegen die Elfmeterschützen der Argentinier in Stellung brachte und aufgrund der aufgezeichneten Tipps zweimal den Ball und die deutsche Mannschaft damit im Wettbewerb hielt.
Aber für die Jugendlichen, die statt in den Wald nun in deutscher Geschichte durch Räume und Zeiten gehen, zählt Lehmanns Sternstunde zu den Sternstunden ihrer eigenen Geschichte. Oder in seliger Erinnerung für die Besserverdienenden unter ihren Eltern jenes Steuermodell, das laut seines Erfinders Friedrich Merz auf einen Bierdeckel passte. Beide Originale, Kahn-Zettel wie Merz-Bierdeckel, liegen vereint in einer Vitrine. Und weil die Jungen und die Alten da hängen bleiben, gehen sie anschließend neugierig durch Räume, die sie sonst möglicherweise umgangen hätten. Ins Wesen des Museums, in seine Seele.
Unter einem Glasdach, das an hellen wie dunklen Tagen, abhängig von den Lichtverhältnissen in den vier Jahreszeiten, freien Blick gestattet, denn dunkle Räume ermüden, gehören in die 4000 Quadratmeter Museumsfläche deshalb auch scheinbar unwesentliche Objekte wie eine Schleifmaschine oder eine Milchbar, Kasse und Saal eines Lichtspielhauses oder ein Moped, das Radiogerät Heinzelmann oder ein bemalter Flower-Power-Hippie-Bulli.
Am Eingang hatte ich Jungs gesehen, die sich auf ihre Handys simsten und twitterten, was sie einander auch hätten sagen können, die Mädchen mehrheitlich mit schalldichten Kopfhörern ausgestattet, weil sie offenbar andere Töne hören wollten als die Sprüche ihrer gleichaltrigen Mitschüler. Im Alltag mögen sie dem RTL-Leben aus zweiter Hand zugeneigt sein, doch im Museum werden sie Schritt um Schritt zu interessierten Zeitgenossen. Kopfhörer hängen dann unbeachtet auf den Schultern, Handys werden nicht für Selfies, sondern für Bilder des Schreckens benutzt.
Ich glaube beobachten zu können, wie sie spüren, dass dies auch ihre Geschichte ist, dass sie, wie alle Generationen vor ihnen, auf den Schultern der vorherigen stehen und dass sie sich ihr so oder so stellen müssen. Auf vorgedruckten Fragebögen, die jedem Schüler zu Beginn der Lehrstunden ausgehändigt werden, können sie ankreuzen, welche Themen aus welcher Zeit sie am meisten interessieren und worüber sie mehr wissen wollen. Ich sehe viele, die sich mit ernster Miene über ihre Zettel beugen oder sich gegenseitig befragen, wo sie ihre Kreuze gesetzt haben.
Harald Biermann weiß aus Erfahrung, dass »viele an Themen herangeführt werden, über die sie noch nie irgendetwas gehört haben, weil ihre Lehrer vorher nicht mit ihnen darüber gesprochen haben«. Das gilt auch für die Kinder eingewanderter Mitbürger. Sie erfahren, dass Migration nicht nur Angst und Schrecken verbreitendes Fremdes ist, dass Migration nicht nur selbstverständlich zur gesamten europäischen Geschichte gehört, sondern insbesondere zur deutschen. Zur Geschichte gehört nämlich auch, dass bis zum Bau der Mauer 1961 insgesamt 2,8 Millionen Deutsche-Ost rübermachten nach Deutschland-West. Ihre Heimat verließen, weil sie es dort nicht mehr aushielten oder gar ihr Leben in Gefahr war. Solche Geschichten von Flucht oder Vertreibung kommen den Migrationskindern vertraut vor.
Solche Geschichten kennen sie aus ihrer eigenen Geschichte.
Bonn war zwar einst nur als provisorischer Regierungssitz gedacht. Das rheinische Residenzstädtchen hatte die entscheidende Abstimmung gegen den Konkurrenten Frankfurt im Parlamentarischen Rat am 10. Mai 1949 mit knapper Mehrheit von 33 zu 29 Stimmen gewonnen. Eine Stimme des Bonn-Votums stammte von Konrad Adenauer, der gegenüber in Rhöndorf wohnte und schon deshalb für die Provinz und gegen Frankfurt votierte, weil er per Fähre schnell zu seinem künftigen Arbeitsplatz diesseits des Rheins kommen konnte, dem Palais Schaumburg. Sein späterer Dienstwagen, ein schwarzer Mercedes 300, auch »Adenauer-Mercedes« genannt, steht selbstverständlich da, wo er hingehört, im Bonner Haus der Geschichte.
An die kleine Stadt am Rhein hatte sich das kleine Deutschland im Laufe der folgenden Jahre gewöhnt. Niemand glaubte trotz aller politischer Sonntagsreden, trotz aller Kerzen im Fenster für die Brüder und Schwestern drüben, dass es jemals wieder anders sein könnte. »Gedenkt der Brüder, die das Schicksal unserer Trennung tragen«, ließ 1955 Bremens Bürgermeister Wilhelm Kaisen am Marktplatz in riesengroßen Lettern am Deutschen Haus anbringen. Nach der Wiedervereinigung passte die Mahnung nicht mehr in die neue Zeit, aber hier passt sie als Original gut an eine Wand.
Auch Europa liegt in Bonn gleich um die Ecke – Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich –, und auch das kann ich sehen: Ein Bus entlässt ein paar Dutzend Besucher aus Maastricht. Die Geschichte Hollands ist bekanntlich zu oft bestimmt worden von der deutschen, und das war niemals gut so. Was also wollen sie hier sehen? Bilder, Filme, Objekte. Sie erwarten kein dröges deutsches Haus der Geschichte, sondern ein Haus voller deutscher Geschichten. Erzählt an scheinbar banalen Objekten:
Die Schleifmaschine, eine Koebau Multimat, war 1946 von den russischen Siegern als Reparationsobjekt nach Moskau verschleppt worden. Befreit wurde sie von den musealen Jägern und Sammlern aus Bonn. Sie boten ihrem Besitzer eine nette Summe, aber der wollte kein Geld, der wollte seine beste Mitarbeiterin behalten. Man einigte sich schließlich auf ein Tauschgeschäft. Er bekam eine moderne spitzenlose Rundschleifmaschine der Firma Koenig & Bauer per Schiff nach Moskau geliefert und entließ im Gegenzug das historische Modell nach Bonn, wo es jetzt steht. Ähnlich problemlos, allerdings lange vor Putins Griff nach der Ukraine und den folgenden Sanktionen des Westens, ging es zu, als die Bonner ihre Kollegen vom Streitkräftemuseum in Moskau für ihre Abteilung Weltpolitik um ein Stück des einst abgeschossenen U2-Spionageflugzeugs von Gary Powers baten.
Das Mokick Zündapp Sport Combinette, Höchstgeschwindigkeit 40 km/h, Leistung 2,9PS, Listenpreis 1745 D-Mark, erhielt als Gastgeschenk am 19. September 1964 bei der Ankunft auf dem Bahnhof Köln-Deutz der einmillionste Gastarbeiter in Deutschland, ein portugiesischer Tischler namens Armando Rodrigues de Sá. Sein Moped stellte er beim nächsten Heimaturlaub zu Hause unter, 1970 kehrte er für immer nach Portugal zurück. Dort erkrankt er an einem Tumor, wird zwar behandelt, aber die Rechnungen der Ärzte und die teuren Medikamente fressen sein Erspartes auf. Dass er auch in Portugal Anspruch gehabt hätte auf Kostenerstattung durch die deutsche Krankenkasse, in die er einbezahlt hatte, weiß er nicht. Er stirbt 1979, gerade mal 53 Jahre alt.
Die Fotos von seiner Ankunft, einmal schüchtern lächelnd auf dem Moped, ein andermal eher verschreckt in die auf ihn gerichteten Kameras blickend, wurden überall in Deutschland-West gedruckt. In die Abteilung über die deutsche Wirtschaft im Umbruch ab Mitte der 60er-Jahre gehören in Bonn auch die Geschichten von Gastarbeitern – wie Arbeitsmigranten damals genannt wurden in der Erwartung, dass sie irgendwann wieder in ihre Heimatländer würden zurückkehren wollen – aus Italien, Griechenland, der Türkei, Spanien, Portugal, Marokko, Tunesien, Jugoslawien. Anfassbar begreifbar gemacht anhand des Mokicks, das Rodrigues de Sá damals geschenkt bekam. Fürs Haus der Geschichte haben seine Jäger, ausgehend von jenen bei seiner Ankunft aufgenommenen Fotos und diese Spur verfolgend bis nach Portugal, den Zweitakter von den Enkeln erworben und eingesammelt.
Den mit bunten Blumenmotiven der Jugendkultur, den Symbolen der Hippies, bemalten VW-Bus (»Bulli«) dagegen, umgeben von Bildnissen der englischen und amerikanischen Stars, die Deutschland rockten – Stones, Beatles, Deep Purple, Jimi Hendrix –, oder der Ikonen gescheiterter Revolutionen wie Che Guevara, haben sie lange suchen müssen, um schließlich fernab von Deutschland in Kalifornien fündig zu werden. Gebrauchte Modelle in Deutschland waren längst verrostet und für Ausstellungen nicht mehr geeignet. Aber wie man von Albert Hammonds berühmtem Song It Never Rains in Southern California weiß: Dort scheint meist die Sonne, dort rostet es sich nicht so leicht im Alter. Jetzt steht ein Original im Museum.
Den Kinosaal haben sie in Altena abgebaut, als das dortige Lichtspielhaus den Kampf gegen Hollywood-Blockbuster, Fernsehen total und Videos im Puschenkino aufgab. Die Heimatfilme der 50er-Jahre erfüllten das Bedürfnis der Deutschen nach heiler Welt als Folge der Schrecken des Krieges. Schwarzwaldmädel und Fischerinnen und Sennerinnen auf grüner Heide oder in ewig singenden Wäldern, wo der Wildbach rauschte und der Förster vom Silberwald am Brunnen vor dem Tore auf die Christel von der Post wartete, hatten jedoch ausgespielt, als Opas Kino von wilden Jungen für tot erklärt wurde.
Im Museum ist das Kino, originalgetreu Reihe für Reihe aufgebaut, wiedereröffnet worden. Bitte Platz nehmen: Auf der Leinwand laufen Aufnahmen historischer Ereignisse, aktuell in jener Zeit, als vor dem Hauptfilm die Wochenschau gezeigt wurde. Diese Art von Rückblick und Überblick hat sich im Zeitalter des Smartphone überlebt, in dem sich die Informationen zu jeder Zeit und an (fast) jedem Ort herbeiklicken lassen.
Und hier, ein Koffer von Erich Honecker, den er bei der Flucht nach Moskau in Berlin vergaß! Voller Fotos und Dokumente von ihm oder Frau Margot, die noch immer im Exil vom Sieg der Weltrevolution überzeugt ist. Ein sichtbares Symbol, trotz abgewetzten Leders, für eine weitere Sternstunde der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Beim Anblick des als Beispiel für den aufblühenden Konsum ausgestellten Nyltesthemdes kratze ich mich, wohl veranlasst durch eine nachempfundene Erinnerung, unwillkürlich am Hals. Zur Tanzstunde, die es heute als Pflichtveranstaltung für Heranwachsende ab Klasse 10 so wohl nicht mehr gibt, musste ich mich damals dem engen Kragen unterwerfen und mich allzu oft mit Mädchen übers Parkett schieben, die mich von oben herab betrachteten.
Die Musik jener Zeit lässt sich nebenan in der Milchbar hören. Hundert Titel bietet die Wurlitzer-Jukebox an. Rocco Granata, auch ein Gastarbeiter, singt in einem schmachtlustvollen Schlager aus dem Jahre 1959 von »Marina, du bist ja die Schönste der Welt«. Die Melodie könnte ich mitpfeifen. Auch Banales klammert sich eben im Hippocampus unauslöschlich fest.
Harald Biermann erzählt, dass die Milchbar, einst draußen in diesem unserem Lande der Jugendtreff, bevor es Diskotheken und von den Eltern genehmigten Ausgang bis Mitternacht gab, sonntagnachmittags von älteren Besuchern des Museums umfunktioniert wird zum Ort ihrer Erinnerungen. Für getanzte Geschichte drücken sie im Musikautomaten ihre Lieblingsschlager oder Peter-Kraus-Rock-Favoriten von damals und bewegen sich im Rhythmus ihrer Jugend. Womit jetzt geklärt ist, warum Geschichte mitunter sogar tanzbar sein kann.
Ich mag die Tänzer nicht verlachen. Aus einem einfachen Grund: Sie dürften etwa so alt sein wie ich.
Also forever young.
Grau ist im Laufe der Jahrzehnte, in denen ich alt wurde und grau, zu meiner Lieblingsfarbe geworden. Nicht schwarz ist die Wahrheit, nicht weiß, sondern grau, die Farbe des Zweifels. Das stimmt natürlich so apodiktisch nicht für alle Stationen der Geschichte, in denen ich haltmache. Oft gibt es nur die eine Farbe, gibt es zweifellos nur eine einzige Wahrheit.
Grau gilt nicht für die Fotos von den ausgemergelten Überlebenden der Konzentrationslager, von denen viele, darunter die in Buchenwald oder in Dachau, äußerlich unverändert nach der Befreiung quasi über Nacht umfunktioniert wurden. Die sowjetischen Besatzer sperrten dort nicht nur die Täter ein, sondern erneut Opfer der Willkür, die sich erdreisteten, anders zu denken als das nun herrschende Regime mit seinem verpflichtend zum Idol aller Werktätigen erklärten obersten Menschenfreund Josef Stalin an der Spitze. Im Lager Dachau zum Beispiel mussten bis 1947Displaced Persons hausen, von den Nazis verschleppte Zwangsarbeiter, bis sie irgendwo auf der Welt ein zweites Leben beginnen durften.
Grau gilt nicht, als ich vor dem Original eines T34-Panzers stehe, mit dem 1953 in Ostberlin der Aufstand niedergewalzt wurde. Das Wort »todesmutig« wird da begreifbar. Wer vor einem solchen Ungetüm stand und nicht weggelaufen ist, sondern Steine werfend ankämpfte, schaute dem Tod ins Auge. So drohend riesig unbesiegbar hatte ich mir bisher Panzer nie vorstellen können. Der Anblick des stillgelegten Monsters verbreitet noch immer Todesangst.
Grau gilt nicht in dem schwarz gehaltenen Raum, in dem per Endlosschleife auf einem Bildschirm die Namen ermordeter Juden ablaufen. Die Stille lässt die Mädchen verstummen, die soeben noch vor einer Vitrine mit modischen Highlights der 50er-Jahre – wie Pettycoat aus Perlon oder Nachthemd aus Nylon – kicherten. Sie scheinen schlagartig begriffen zu haben, was unbegreiflich scheint. Sechs Millionen Opfer des Holocaust sind eine schreckliche, aber auch schrecklich abstrakte Zahl. Millionen Tote sind im Wortsinn nicht vorstellbar. Der Name eines Opfers aber trifft, weil es dadurch eine Biografie bekommt.
Immer wieder, nicht nur hier, taucht dunkel die Vergangenheit aus der Gegenwart empor, berichten auf vielen digitalen Terminals Zeitzeugen, Prominente wie Normalbürger, davon, wie sie bestimmte Zeiten erlebt haben, was ihnen in denen widerfahren ist. Immer dann, wenn ich nach oben schaue, sehe ich jedoch auch Fortschritt. Solche Durchblicke gehören zum Konzept, denn es geht in der Geschichte aufwärts aus den Niederungen der Vergangenheit.
Stockwerk über Stockwerk ist sie sichtbar. Handgranaten, die zu Eierbechern umfunktioniert wurden aus Mangel an Alternativen. Das erste Kaufhaus der 50er-Jahre. Von der Baracke im Auffanglager bis zu den begehrten gleichmachenden Bungalows oder Reihenhäusern. Das Verschwinden kleiner nationaler Parteien von Bundestagswahl zu Bundestagswahl, was gut war für die wachsende Demokratie. Die aufblühenden Grünen mit Petra Kelly und Gert Bastian, mit Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit bis zu den Protagonisten namens Bahr, Rösler, Brüderle der mal stolzen und für das Land mal so wesentlichen Liberalen namens FDP.
Ich gehe durch den Rumpf eines Rosinenbombers, wie er einst 1948 zur Versorgung der Bevölkerung Westberlins eingesetzt wurde. Das Flugzeug haben die Bonner in Barcelona entdeckt, als sie nach einem passenden Symbol für die Blockade Berlins suchten. Es war dort zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt worden, um Pflanzengift auf von Insekten befallene Felder zu sprühen. Nun ist es entgiftet und steht da, wo es seiner Geschichte entsprechend hingehört.
Häufig müssen sie nicht mal bezahlen für ihre Fundsachen. Das meiste wird ihnen geschenkt. Im viergeschossigen Kellerdepot lagern rund 700000 unterschiedliche Objekte, vom Eisernen Kreuz bis zu Alltäglichem aus Haushaltsauflösungen. Auch Militaria werden genommen, selbst dann, wenn man sie bereits zu Dutzenden in Kisten liegen hat und nie ausstellen wird. Denn damit werden sie den üblichen Verdächtigen entzogen, die sich auf Flohmärkten oder im Internet auf der Suche nach Nazischrott herumtreiben.
Ein paar Reihen des Originalgestühls aus dem Bonner Bundestag konnten die Nachbarn vom Haus der Geschichte gerade noch rechtzeitig für sich retten, bevor der Rest 1988 geschreddert wurde, weil die Musik im Berliner Reichstag auf neuem Gestühl spielen würde. Auch das Rednerpult steht im Ausstellungsraum und falls einer der Schüler von dort aus eine Rede halten würde, könnten seine Klassenkameraden unten im Saal Zustimmung oder Ablehnung so laut artikulieren wie die Abgeordneten damals bei den Originalreden, indem sie die Deckel der Schreibpulte wie in der Schule heben und wieder fallen lassen. Klappern gehörte schon damals zum politischen Handwerk.
Natürlich werden hier keine aktuellen Reden gehalten, aber die berühmten aus der deutschen Nachkriegsgeschichte stehen auf Knopfdruck zur Anhörung bereit. Damals gab es ja einige Meister der Rhetorik: Helmut Schmidt, Willy Brandt, Herbert Wehner, Franz Josef Strauß, Karl Theodor Baron zu Guttenberg, Joschka Fischer, Richard von Weizsäcker.
Dunkel und totenstill wie der Raum, in dem in unendlicher Folge die Namen von ermordeten Juden auf dem Bildschirm erscheinen, so totenstill und dunkel ist die Wand, auf dem die Bildnisse der Opfer der RAF auftauchen. Kopf um Kopf, Foto um Foto – die prominenten Manager, Banker, Juristen Jürgen Ponto, Hanns-Martin Schleyer, Siegfried Buback, Detlev Rohwedder, Alfred Herrhausen, Ernst Zimmermann, Karl-Heinz Beckurts, Gerold von Braunmühl, gleichermaßen die oft vergessenen Polizisten, Leibwächter, Fahrer Norbert Schmid, Reinhold Brändle, Helmut Ulmer, Johannes Goesmann, Georg Wurster, Wolfgang Göbel, Michael Newrzella, Herbert Schoner.
Auch deren Mörder lebten unter uns.
Hier die Schreibmaschine von Andreas Baader, auf der er die Bekennerschreiben tippte, um nach blutigen Attentaten, Bombenanschlägen, Morden das Volk aufzurütteln, sich durch die Rote Armee Fraktion vom sogenannten »Schweinesystem« befreien zu lassen. Das Volk aber fühlte sich nicht unterdrückt und wollte durchs Bundeskriminalamt von solchen Befreiern befreit werden. Dort das »Flächenschussgerät« der Terroristen gegen das verhasste Symbol von Recht und Ordnung, die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Weil die Zündung versagte, missglückte der Anschlag. Die sich links nennenden Desperados, ein verlorener Haufen von Gewalttätern, flohen vor den Ermittlern ins andere Deutschland. Wurden dort von der Stasi mit falschen Namen und Legenden ausgestattet und fühlten sich in der Diktatur des Proletariats sicher. Aber von den Folgen eines warmen Sommerabends im Kaukasus wurden auch sie kalt erwischt.
Was für eine gute Geschichte.
Bismarck allein im Wald
2. Friedrichsruh
Vor der Expedition zu einem einstigen Mythos deutscher Nation musste ich zuerst einmal das Archiv auf meiner Festplatte Gehirn durchforsten.Ich hatte mir Wegzehrung angelesen und im Kopf verstaut. Über Otto von Bismarck neue Erkenntnisse zu verbreiten wäre zwar zum Scheitern verurteilt. Aber Spuren des mal unsterblich Scheinenden müssten sich noch finden lassen draußen im Sachsenwald.
Dort gab er den Geist auf. Dort liegt er begraben.
Sein Leben, das politische und das private, seine Entscheidungen für Krieg oder für Frieden sind in gefühlt tausendundeins Büchern, Magazinen, Dissertationen, Artikeln, Filmen analysiert, beleuchtet, geschildert worden. Sogar die zarten Liebesbriefe, die er an seine Frau Johanna – aber während der Ehe auch an andere Frauen – schrieb, veröffentlicht bereits zwei Jahre nach seinem Tod, gehören zu diesem Allgemeingut. Den Olivenzweig, den ihm eine Angebetete zum Abschied überreichte, bewahrte er bis zum Ende in seiner Tabaksdose auf. So viel Empfindsamkeit hätten ihm nicht mal seine alle Schwächen übersehenden Verehrer zugetraut. Sie liebten ihn blind für seine andere Seite als preußischen Bullerkopf.
Unter all jenen bekannten großen Deutschen, die bei näherer Betrachtung sämtlich nicht gar so groß erscheinen, wie sie in den Schulbüchern dargestellt werden, war er für die Generation der Groß- und Urgroßväter ein Mythos. Ein Held. Eine Kultfigur. Das Wort »Kult« im Zusammenhang mit Bismarck würden heutzutage Menschen mit einigermaßen intakten Gehirnzellen schon deshalb nicht mehr verwenden, weil inzwischen sogar irgendwelche Masseure von meist geringem Verstand darunter subsumiert werden. Bei aller berechtigter Kritik am Eisernen Kanzler wäre es gleichfalls posthumer Rufmord, würde man ihn mit Udo Walz, Klaus Wowereit oder Mario Barth in einen Kulttopf werfen.
Wahrlich, ein in preußischer Wolle gefärbter Reaktionär, das war er beileibe. Die beim Hambacher Fest bürgerliche Freiheiten fordernden Demokraten von 1832 oder gar die Revolutionäre von 1848 waren ihm ein rechtes Gräuel: »Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut.« Nach den drei siegreichen Einigungskriegen wurde der Gründer des Deutschen Reiches von der Mehrheit des Volkes vergöttert als ein Reichsschmied, der die Machtverhältnisse im Herzen Europas zugunsten Deutschlands verändert hatte und anschließend als ehrlicher Makler zwischen den Völkern den Frieden wahren konnte.
Der hielt bis 1914, bis die Schüsse in Sarajevo fielen, bis es wieder einen Politiker wie ihn gebraucht hätte statt der von Christopher Clark beschriebenen regierenden »Schlafwandler«, die in den Großen Krieg schlitterten, weil sie die Folgen ihres Tuns nicht so bedachten, wie Otto von Bismarck es bei seinen Plänen – auch bei den finsteren – stets tat.
Mein Geschichtslehrer, der Bismarck als ideale Verkörperung aller angeblich genetisch verankerten deutschen Tugenden pries, bevor wir dann erfolgreich seinen Unterricht so lange boykottierten, bis er freiwillig in den unverdienten Ruhestand ging, malte uns Schülern den Eisernen Kanzler als Lichtgestalt. Bewirkte damit aber das Gegenteil. Deutsche Sekundärtugenden wie Pflichtbewusstsein, Disziplin, Ordnungsliebe waren uns so fremd wie etwaige hehre Gefühle für eine durch Väter und Mütter, Großväter und Großmütter für immer schuldig gewordene deutsche Nation, für die wir uns, zwar schuldlos, aber kollektiv schämten. Den Kanzler des zweiten Reiches interpretierten wir als Wegbereiter des verbrecherischen dritten.
Ein anderer sogenannter großer Deutscher verkörpert leibhaftig die Kontinuität nationalen Größenwahns, der am Ende in die Nazidiktatur führte – Paul von Hindenburg. Als 19-Jähriger kämpfte er in Bismarcks Bruderkrieg gegen Österreich, als 24-Jähriger in der Schlacht von Sedan gegen Frankreich, als 67-Jähriger besiegte er 1914 bei Tannenberg die Russen. Und als greiser Staatspräsident ernannte er 1933 Hitler zum Reichskanzler. Hätte jener Oberstudienrat, der die Befreiung von den Nazis 1945 unbeirrbar als Kapitulation bezeichnete, stattdessen einen Bogen geschlagen von Bismarck zu Hitler, vom Preußentum zum Nationalsozialismus, hätte er kühlen Verstandes historische Vergleiche gezogen und dabei sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede benannt, so wäre uns Bismarck nicht einseitig suspekt erschienen als Archetyp für das deutsche Wesen.
Und damit für alles, was wir ablehnten.
Deshalb verdämmerte Bismarck für uns in der Ferne des 19. Jahrhunderts, als Schulwissen zu einigen wenigen Daten abgespeckt und abgespeichert. Die Schrecken des 20. Jahrhunderts, zwei Weltkriege, von Deutschen begangener millionenfacher Völkermord prägten das Bewusstsein. Patriotische Gefühle weckten allenfalls Fußballnationalmannschaften, sowohl die der Männer als auch später die der Frauen, kurzfristig auch 1989 die für Deutsche untypisch unblutige und endlich mal gelungene Revolution oder jener Kanzler, der 2002 den wiedervereinigten Deutschen versprach, sie aus einem bevorstehenden Krieg herauszuhalten, damit der Mehrheit aus dem Herzen sprach und die folgende Bundestagswahl gewann.
Aufgefrischt werden mussten deshalb die einst zum schulischen Pflichtstoff gehörenden Daten und Stationen, bevor ich mich auf den Weg zu ihm in den Sachsenwald mache. Dort, eine halbe Stunde Autofahrt außerhalb von Hamburg, liegt er in einem Mausoleum begraben, dort in Friedrichsruh wird er am Leben erhalten im Museum, dort erwartet mich seine Geschichte. Den Wald hat ihm nach dem Sieg über Frankreich sein Lieblingskönig geschenkt – Wilhelm I., den er zum Kaiser machte –, und den erblichen Fürstentitel gleich dazu.
Daten also: Geboren 1815, Sohn eines preußischen Landadligen, als Jurastudent bereits das, was man heute einen Kampftrinker nennen würde, bis zu 20 Mensuren soll er siegreich bestanden haben in den sich die Birnen weich schlagenden Burschenschaften, ein Rabauke, ein Rüpel, der aufgrund seiner alkoholbedingten Ausfälle oft Wochen im Karzer der Universität trockengelegt wurde. Ein Spieler. Ein Schürzenjäger. Verschuldet. Ein hoffnungsloser Fall.
Aber er wurde gerettet durch die Heirat mit der strenggläubigen Pietistin Johanna von Puttkamer. Was ihm gleichzeitig den Weg nach oben ebnete. Die in Preußen einflussreichen reaktionären Pietisten erkoren ihn zu ihrem Hoffnungsträger: Abgeordneter im Preußischen Landtag, Gesandter in Sankt Petersburg und in Paris, 1862 preußischer Ministerpräsident, fünf Jahre später Kanzler des Norddeutschen Bundes und dann ab 1871 bis zu seiner Entlassung 1890 Reichskanzler, gefürchtet und geliebt als der Eiserne. Die Karikatur aus dem britischen Punch, auf der der Lotse Bismarck das deutsche Staatsschiff verlässt, beobachtet von Kaiser Wilhelm II. an der Reling, kann wie jede gute Karikatur so oder so gedeutet werden. O Gott, was soll jetzt aus Deutschland werden? Oder aber: Endlich geht der Alte in den Ruhestand und das Schiff Deutschland auf einen neuen Kurs.
Auch ein anderes Bild ist abrufbar. Ein Gemälde, das jene berühmte Szene zeigt, da Wilhelm I. von den versammelten deutschen Fürsten zum deutschen Kaiser proklamiert wird. Otto von Bismarck steht in der Mitte und betrachtet, im bildlichen wie im sinnbildlichen Sinn, sein politisches Meisterwerk. Krönung des preußischen Königs zum deutschen Kaiser, Gründung des Deutschen Reiches, Demütigung des besiegten Frankreichs, dem er Elsass und Lothringen wegnahm. Kaiser-Hurra ausgerechnet im Herzen der Grande Nation, im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles. Andererseits auch, eigentlich Bismarcks strategischer Begabung unwürdig, eine folgenschwere Arroganz der Macht. Die kein Franzose den Deutschen vergaß oder gar verzieh.
Die Vorgeschichte zu diesem Triumph ist gleichfalls kein Ruhmesblatt aus der umfangreichen Akte Bismarck’scher Staatskunst. Oder etwa doch? Denn die Skrupellosigkeit, mit der er ein Telegramm so manipulierte, kürzte und strich, dass die Wut der düpierten Franzosen, sowohl Kaiser Napoleons als auch der Nationalversammung, zwangsläufig hochkochen musste, könnte man ebenso auch als Taktik interpretieren. Gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen, ein für alle Mal mit Eisen und Blut zu entscheiden, wer die Großmacht auf dem Kontinent sein würde, nachdem ja schon die andere, Österreich, geschlagen worden war von den Preußen, schien ihm auf lange Sicht alternativlos. Sein König zögerte. Wilhelm wäre nach der gewonnenen Schlacht 1866 bei Königgrätz lieber nach Wien durchmarschiert und hätte die Habsburger für immer erledigt. Was der je nach Gefechtslage handelnde kluge Bismarck für unklug hielt und mithilfe des Kronprinzen Friedrich verhinderte.
ENDE DER LESEPROBE