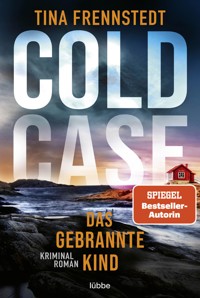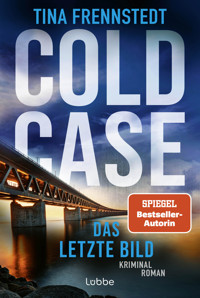9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cold Case-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nebel liegt über dem Süden Schwedens, als in Malmö eine der umstrittendsten Künstlerinnen des Landes ermordet aufgefunden wird. Zuvor war ihre Kunst mutwillig zerstört. Mit merkwürdigem Lehm, der eine gruselige Verbindung zu einem ungelösten Mordfall, einem COLD CASE, herstellt. Vor 15 Jahren war ein Mann auf brutale Weise ermordet worden. Am Opfer fand man damals das gleiche Material. Tess Hjalmarsson stürzt sich in die Ermittlungen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressum2004Dienstag, 16. April 2019Es gab nurTess drehte sichDie EhefrauDie Straßen vonMittwoch, 17. AprilMischa Lindberg schlossDonnerstag, 18. AprilDie feuchte LuftFreitag, 19. April»Dreckswasser.«Die EhefrauDienstag, 23. AprilDie Fahrstuhltür öffneteEin paar StundenDie EhefrauMittwoch, 24. AprilRiesige Flammen schlugenDie Gassen vonLundberg und MarieDie Frühlingssonne schienLundberg saß inDonnerstag, 25. AprilIm Malmöer PolizeigebäudeTess parkte vorMax’ ältere Schwester,Die EhefrauTess schaute sich2004Freitag, 26. AprilTess stellte ihreAls Tess undTess wollte geradeDer Nachmittagsverkehr aufTess und LundbergDie EhefrauSonntag, 28. AprilEs war engAls Tess amDienstag, 30. AprilDie Ehefrau»Zieh dich an,Tess und MarieLundberg saß alleinTess blinzelte in2004Mittwoch, 1. Mai»Ist das JesusIn dem traditionsreichenDonnerstag, 2. MaiMaries aggressiver FahrstilDie Sonne beleuchteteAls Carsten MorrisAls sie wiederDer Sonnenuntergang über2004Freitag, 3. MaiChilli lag aufDie EhefrauTess fuhr aufObwohl es schonTess setzte sichSamstag, 4. MaiIm Cold-Case-Büro warMontag, 6. MaiDie EhefrauEine ungewöhnliche StilleHammenhög lag inmittenUnni Holm warfLundberg schloss dieObwohl es bereits2004Dienstag, 7. MaiDie Stimmung imTess ließ denEs war stickigKurze Zeit späterAls sie anMittwoch, 8. Mai»Du erinnerst dich,Von Weitem warLundberg stieg zuDie EhefrauTess hielt amDie EhefrauDas Tal wirkte2004Mittwoch, 8. MaiTess hasste VeranstaltungenVielen Dank anÜber dieses Buch
Nebel liegt über dem Süden Schwedens, als in Malmö eine der umstrittendsten Künstlerinnen des Landes ermordet aufgefunden wird. Zuvor war ihre Kunst mutwillig zerstört. Mit merkwürdigem Lehm, der eine gruselige Verbindung zu einem ungelösten Mordfall, einem COLD CASE, herstellt. Vor 15 Jahren war ein Mann auf brutale Weise ermordet worden. Am Opfer fand man damals das gleiche Material. Tess Hjalmarsson stürzt sich in die Ermittlungen …
Über die Autorin
Tina Frennstedt ist eine der renommiertesten Kriminalreporterinnen Schwedens und gilt als Expertin für Fälle, die nie aufgeklärt wurden. Sie hat bei den Tageszeitungen »Dagens Nyheter« und »Expressen« gearbeitet. Ihre Reportagen über schwedische Kriminalfälle sind preisgekrönt und bilden den realitätsnahen Hintergrund für ihr hochspannendes Thrillerdebüt COLD CASE – Das verschwundene Mädchen.
Tina Frennstedt lebt in Stockholm und schreibt bereits an der Fortsetzung der COLD-CASE-Reihe.
TINA FRENNSTEDT
COLDCASE
DAS GEZEICHNETE OPFER
KRIMINALROMAN
Übersetzung aus dem Schwedischen vonHanna Granz
LÜBBE
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der schwedischen Originalausgabe:
»COLD CASE – Väg 9«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by Tina Frennstedt
First published by Bokförlaget Forum, Stockholm, Sweden
Published in German language by arrangement with
Bonnier Rights, Stockholm, Sweden
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Unter Verwendung von Motiven von
© shutterstock: gyn9037 | Yingna Cai | Bruno Ismael Silva Alves
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-9418-4
www.luebbe.de
www.lesejury.de
2004
Max warf einen Blick zurück, trat in die Pedale und lauschte auf das Motorgeräusch. Immer heftiger strömte der Regen herab. Solange keine Scheinwerfer zu sehen waren, war alles gut, alles in Ordnung. Sein Puls beruhigte sich.
Vielleicht waren es nur betrunkene Jugendliche gewesen, die ihm einen Schrecken einjagen wollten. Denn ansonsten waren an diesem Samstagabend ungewöhnlich wenig Autofahrer unterwegs.
Er hörte seinen eigenen Atem in der kompakten Dunkelheit. Die Pedale quietschten. Im Wald neben der Straße rauschte der Wind in den Kiefern.
Kurz vor der nächsten Kurve tauchte hinter ihm wieder das Scheinwerferlicht auf. Erneut schaute er über seine Schulter zurück. Es muss ja nicht dasselbe Auto sein, dachte er. Genau wie beim ersten Mal fuhr es dicht auf, klebte förmlich an seinem Hinterreifen, ohne Anstalten zu machen, ihn zu überholen. Vielleicht war die Sicht zu schlecht.
Eine Minute verging. Das Auto war immer noch hinter ihm, drei, vier Meter entfernt, und hatte das Fernlicht eingeschaltet. Was war das für ein Katz-und-Maus-Spiel?
Durch den Regen erblickte er ein erleuchtetes Fenster neben der Straße. Ein Haus, endlich ein Haus. Vielleicht sollte er anhalten? Er hatte es schon fast erreicht, konnte in die Küche hineinschauen. Das Auto kam jetzt so nah, dass er beinahe das Gleichgewicht verlor. Max trat schneller, spähte zum Fenster, meinte, drinnen die Silhouette einer Frau zu erkennen. Das Bild seiner Mutter Gunnel tauchte vor seinem geistigen Auge auf, er würde sie und seinen Vater am Mittwoch wiedersehen, wenn er vorspielte.
Die Straße beschrieb erneut eine Kurve. Die Müdigkeit, die er früher am Abend verspürt hatte, war verflogen. Er war hellwach.
Das Motorgeräusch wurde leiser, und als er sich umdrehte und in die Dunkelheit zurückstarrte, sah er, dass das Auto gehalten hatte. Die Scheinwerfer waren erloschen. Max bremste, stellte einen Fuß auf den Boden und betrachtete es einen Moment.
Sein langer schwarzer Wollschal war schwer vom Regen und kratzte am Hals. Er warf sich das Ende über die Schulter. Seine orangefarbene Jeans war an den Oberschenkeln bereits völlig durchnässt, und auch durch die Lederhandschuhe drang Feuchtigkeit. Nicht gut für seine Finger. Seine Hände waren steif, und er sehnte sich danach, ins Warme zu kommen und die nassen Sachen auszuziehen.
Die eisigen Regentropfen stachen ihn wie Nadeln ins Gesicht.
Etwas weiter vorn endete die Straßenbeleuchtung, doch dann war es nur noch ein kurzes Stück, bis er abbiegen und auf dem Strandweg die letzten Meter bis nach Hause fahren konnte. Er warf einen letzten Blick zum Auto zurück, sprang auf sein Fahrrad und fuhr wieder los.
Große Tropfen liefen ihm über das Gesicht, sein blondes, halblanges Haar war pitschnass, und er zitterte. Das altmodische Vorderlicht seines Fahrrads schickte einen dünnen Lichtstreifen auf den Asphalt. Der Dynamo surrte.
Wie spät es wohl sein mochte? Um kurz nach eins, als der Pub zugemacht hatte, hatte er sich auf dem Marktplatz von den anderen getrennt. Es war laut und ein wenig chaotisch gewesen. Die anderen wollten weiter, zu einem Absacker nach Malmö, in der Wohnung von einem von ihnen. Vielleicht hätte er doch lieber mitgehen sollen, statt allein im Dunkeln nach Hause zu fahren. Doch er wollte topfit sein, wenn er vorspielte, sonst wären all die Stunden, die er am Klavier verbracht hatte, vergebens gewesen.
Die Fahrradkette rasselte. Er hatte es nicht geschafft, das Rad zur Reparatur zu bringen, ohnehin wollte er sich demnächst ein neueres mit Gangschaltung kaufen.
Der Regen wurde noch stärker, und er leckte sich ein paar mit Schweiß vermischte Tropfen von der Oberlippe. Wieder hörte er das Motorengeräusch hinter sich.
Die Scheinwerfer waren auf ihn und die Bäume gerichtet. Max drehte sich um. Sein Herz klopfte wild. Das Auto kam langsam näher, hielt sich ein paar Meter hinter ihm, wie schon zuvor. Es konnte nicht dasselbe Auto sein. Nicht ein drittes Mal. Der Fahrer blendete zweimal auf, wie um ihm etwas mitzuteilen. Dann wurde es still. Das Auto war stehen geblieben, die Scheinwerfer erloschen. Max fuhr weiter, so schnell er konnte. Sein Herz pochte wie ein überdrehtes Metronom. Zwei Lichtkegel näherten sich von vorn. Endlich kam ihm jemand entgegen, ein Lastwagen. Max bremste, sprang ab, warf das Fahrrad zur Seite. Der Lastwagen kam auf der Gegenfahrbahn auf ihn zu, und er winkte mit beiden Armen, hüpfte auf und ab und rief:
»Stehen bleiben! Stehen bleiben!«
Doch der Lastwagen wurde nicht langsamer. Max winkte noch heftiger, sah der Fahrer ihn denn nicht?
»Stehen bleiben! Hallo, bitte bleiben Sie stehen!«, rief er verzweifelt.
Der Lastwagen verschwand um die Kurve, und um ihn herum wurde es wieder pechschwarz. Vor Kälte klapperten ihm die Zähne. Max schloss die Augen und hob die Arme schützend vors Gesicht, als zwei große weiße Lichtkegel ihn blendeten. Sie schienen ihn direkt anzustarren und blendeten dann erneut auf.
Er hielt den Blick fest auf die Scheinwerfer gerichtet, bereit zu fliehen, und hob sein Fahrrad auf.
Dann sprang er auf den Sattel, beugte sich tief über den Lenker und strampelte, so schnell er konnte. Der Regen beeinträchtigte die Sicht. Er spähte in die Dunkelheit, suchte nach dem Abzweig, doch um ihn herum waren nur Baumstämme und schwarzer Asphalt. Max fuhr im Stehen weiter, um mehr Kraft zu haben. Ein Fuß rutschte ab, und als er weitertrat, ging es ganz leicht, viel zu leicht.
»Oh, verdammt!«, fluchte er.
Die Kette war wieder abgesprungen. Gleichzeitig kam das Auto immer näher, in seinem Rücken blinkten die Scheinwerfer.
Würde er hier je wieder rauskommen?
Er spürte den Stoß gegen seinen Gepäckträger und wurde auf dem Sattel nach vorne gedrückt.
Erst beim zweiten Stoß stürzte er vom Fahrrad und fiel in den Straßengraben. Sein Gesicht wurde in das nasse Gras gepresst. Aus dem Augenwinkel sah er sein Vorderrad, das sich im Scheinwerferlicht drehte und drehte.
Dienstag, 16. April 2019
Es gab nur weniges, was Polizeikommissarin Tess Hjalmarsson wirklich aus der Fassung bringen konnte. Selbst im heftigsten Sturm stand sie mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Aber in einem hellen, harmonisch eingerichteten Wartezimmer zu sitzen, in dem Kerzen brannten und meditative Musik aus den Lautsprechern drang, machte sie schrecklich nervös.
Mit der Hand strich sie über das graue Schaffell auf dem Sofa. In einem Regal standen Spielzeug und Kinderbücher. Noch konnte sie einfach gehen, einfach aufstehen und durch die Tür verschwinden. Niemand würde etwas sagen, seine Meinung dazu äußern oder protestieren. Sie hatte niemandem etwas versprochen. Außer sich selbst. Und genau das war so unheimlich. Sie konnte niemanden enttäuschen, außer sich selbst.
Eine Frau trat aus einer Tür weiter hinten im Flur. Tess betrachtete sie. Sie lächelte und schien ganz versunken in ihre eigene Welt.
Tess musste an ihre Schwester Isabel denken, vielleicht hätte sie sie doch bitten sollen, sie zu begleiten. Doch Isabel wusste nicht einmal, dass sie hier war, niemand wusste es. Es war ihr wichtig gewesen, diese Entscheidung ganz allein und für sich zu treffen.
Die Frau trat an die Rezeption, vielleicht bezahlte sie. War sie die Nächste? Am anderen Ende des Flurs öffnete sich die Tür zum Ausgang. Das Licht, das von draußen hereinfiel, lockte. Tess atmete die frische Luft ein.
Wenn es sich so anfühlte, wenn sie am liebsten davonlaufen wollte, dann war es vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung? Tess streckte die Hand nach der schwarzen Lederjacke aus, die neben ihr auf dem Sofa lag.
Fünf Meter, mehr waren es nicht bis zur Tür. Sie wollte gerade aufstehen, als eine blonde Frau im weißen Kittel ihr entgegenkam.
»Therese Hjalmarsson?«
Tess zwang sich zu einem Lächeln. Zu spät, sie konnte nicht mehr entkommen.
Tess drehte sich um und blickte zu der sandfarbenen Fassade des Altbaus hinauf, in dem sich die Klinik befand.
»Das war schon alles«, sagte sie zu sich selbst und sog die frische Kopenhagener Frühlingsluft ein.
Sie folgte der Straße zum Kongens Nytorv und versuchte, nicht weiter über die seltsame Tatsache nachzudenken, dass sie jetzt die DNA eines Unbekannten in sich trug. Ein absurdes Gefühl.
In ihr brodelte eine seltsame Mischung aus Freude und Verwirrung. Sie hatte genau das getan, was sie nie hatte tun wollen. Gleichzeitig war sie stolz auf sich, weil sie ihren Kinderwunsch endlich ernst genommen und selbst die notwendigen Schritte unternommen hatte. Das Problem war nur, dass sie sich so schwer vorstellen konnte, als Schwangere herumzulaufen.
Dennoch war der Wunsch in den letzten Monaten immer stärker geworden, und irgendwann hatte sie sich dabei ertappt, wie sie einen Termin in der Kopenhagener Kinderwunschklinik vereinbarte. Sie durchlief sämtliche Tests und unterschrieb die erforderlichen Formulare, in denen sie beispielsweise auch die gewünschte Größe und Augenfarbe des Spenders angeben musste. Anschließend wartete sie, bis ihr Körper ihr sagte, dass es so weit war.
Der knapp einstündige Besuch in der Kinderwunschklinik war trotz allem ein positives Erlebnis gewesen, sie hatte sich willkommen und gut behandelt gefühlt. Der Raum, in dem die künstliche Befruchtung vorgenommen wurde, war anheimelnd eingerichtet, nichts verbreitete Krankenhausatmosphäre. Niemand hatte ihr das Gefühl gegeben, etwas an ihr wäre falsch, weil sie allein kam, ohne Partner oder Freundin.
»Wir erleben hier alle möglichen Konstellationen«, hatte die Hebamme gesagt und ihr den dampfenden Behälter mit den tiefgefrorenen Spermien gezeigt, die sie ihr einpflanzen würde.
Sie hatte Tess, die mittlerweile zweiundvierzig war, erklärt, dass mindestens zehn Inseminationen notwendig sein würden, bis es eventuell zu einer Schwangerschaft kommen würde. Nachdem sie es rasch im Kopf überschlagen hatte, kam Tess zu dem Schluss, dass sie dann wohl mit etwa fünfzigtausend Kronen rechnen musste. Beim Abschied waren sie und die Hebamme sich einig gewesen, dass es das Beste wäre, wenn sie sich gar nicht wiederzusehen bräuchten.
Es war Dienstagnachmittag, und viele Kopenhagener stimmten sich in den frisch geöffneten Außenbereichen der Cafés und Restaurants auf das bevorstehende Osterwochenende ein. Tess blickte auf Nyhavn herab und auf die Reihen von Stühlen und Tischen entlang des Kanals und der dort vertäuten Schiffe.
Jetzt würde sich alles zum Guten wenden, hatte sie beschlossen. Nachdem sie ihren letzten Fall erfolgreich gelöst hatte und Annikas Verschwinden aufgeklärt war, war es ihr nicht leichtgefallen, sich wieder für die Arbeit zu motivieren.
Das vergangene Jahr war sehr chaotisch gewesen. Ihr Chef, Per Jöns, hatte einen Herzinfarkt erlitten. Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und Lebensführung hatten ihren Tribut gefordert. Und wie in jedem Betrieb entstand sofort Unruhe innerhalb ihrer Abteilung, neue Gesichter tauchten auf und versuchten, sich einen Posten zu sichern.
Tess hatte das ungute Gefühl, dass etwas im Gange war. Sie befürchtete, dass die Neuerungen sich nicht unbedingt zu ihrem Vorteil entwickeln würden. Sie hatte ein Gespür für so etwas. Es war ein Erbe ihrer Großtante Thea und sehr verlässlich. Ein inneres Warnsystem, das einen, wenn man lernte, darauf zu hören, vor so manchem bewahren konnte. Doch in diesem Fall wusste sie nicht, wie sie diese Fähigkeit nutzen sollte.
Was sie wusste, war, dass sie Makkonen hätte Konkurrenz machen und mit ihm um den Titel des Polizeioberkommissars hätte kämpfen sollen, um ihren Verantwortungsbereich als Teamleiterin auszuweiten. Sie hätte ihre Erfolge nutzen sollen, um so ihr Gehalt aufzubessern. Das Problem war, dass sie das gar nicht interessierte, sie hatte keine Lust, in die Chefetage zu wechseln und sich ständig irgendwelchen Machtkämpfen aussetzen zu müssen. Die Speichelleckerei, die dazu notwendig war, lag ihr einfach nicht. Sie wollte echte Polizeiarbeit machen, Angehörige treffen, Ermittlungsprotokolle mit neuen Augen lesen und zu Vernehmungen rausfahren. Tief im Innern wurmte es sie dennoch, dass sie Makkonen das Feld kampflos überlassen hatte.
Privat hatte sie sich dagegen sehr bemüht, endlich weiterzukommen und die Beziehung mit Angela ein für alle Mal hinter sich zu lassen, ein neues Leben anzufangen. Erschwert wurde dies durch die unerwartete Trennung ihrer Eltern, nach der sie sich sehr intensiv um ihren Vater gekümmert hatte, der am Boden zerstört gewesen war. Auch hatte sie sich viel zu lange in ihre Arbeit geflüchtet, statt sich um sich selbst zu kümmern.
Vielleicht war dies der eigentliche Grund, weshalb sie heute in Kopenhagen in der Kinderwunschklinik war. Es war der Versuch, einen neuen Sinn zu finden, etwas anzustreben, das ihr wichtig war.
Sie kam am Hotel d’Angleterre vorbei und beschloss, sich einen Moment auf die Terrasse zu setzen. Die Frühlingssonne wärmte ihr Gesicht, sie hatte keine Eile, ins Malmöer Präsidium zurückzukehren.
Tess spürte in sich hinein, obwohl sie wusste, dass man so schnell nichts merken konnte.
Dies hier war eine der Gelegenheiten, in der sie eine Freundin hätte anrufen können, um die große Neuigkeit zu verkünden, mit der niemand mehr gerechnet hatte. Es gab genau vier Personen, denen sie sich wirklich verbunden fühlte, und eine davon sah sie inzwischen fast gar nicht mehr. Angelas Gesicht erschien vor ihrem geistigen Auge. Wahrscheinlich waren es Situationen wie diese, die einen dazu brachten, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig war.
Tess bekam ihren Tee in einer kleinen silbernen Kanne serviert, als ihr Handy in der Tasche ihrer Lederjacke surrte.
»Marie«, stand auf dem Display.
Vielleicht waren es doch eher fünf. Ihre Kollegin, Polizeikommissarin Marie Erling, gehörte wahrscheinlich mit auf die Liste der Personen, die ihr nahestanden.
»Also, so ein Blödsinn!«
Marie hielt sich niemals mit Smalltalk auf.
»Wo bist du?«, fragte Tess.
»In Möllevången, ich führe hier Vernehmungen wegen der Schießerei letzten Donnerstag durch. Ein völlig harmloser Typ wurde angeblich aus heiterem Himmel erschossen, als er zu Hause Geburtstagsgeschenke für seine Mutter einpackte.«
»Ja, klar.«
»Sein Vorstrafenregister ist so lang, dass man damit locker eine Fähre der Scandlines einwickeln könnte.«
Tess verstand Maries Frust nur zu gut. Die Schießereien in Zusammenhang mit der Bandenkriminalität in Malmö waren für sie die schlimmsten Einsätze, die sie sich vorstellen konnte. Kein Wunder: Die Chance, diese Vorfälle aufzuklären, war minimal, und inzwischen verlagerten sie sich immer mehr Richtung Zentrum, ins »schickere« Malmö. Da nutzte es wenig, dass die Verbrechen – meist Vergeltungsschläge der einzelnen Banden untereinander – den Alltag der übrigen Bevölkerung selten beeinträchtigten.
»Außerdem«, sagte Marie, »bin ich dadurch einem Team zugeordnet worden, das einen frischen Mord am Hals hat. Kannst du mich da nicht raushauen? Unter Makkonen zu arbeiten macht mich wahnsinnig!«
»Ja, ich hoffe, da tut sich bald etwas«, sagte Tess.
Marie, die eigentlich zu ihrem Cold-Case-Team gehörte, war vorübergehend für die Mitarbeit in der allgemeinen Mordkommission unter Leitung des frisch gekürten Polizeihauptkommissars Ola Makkonen freigestellt worden. Eine Art Umverteilung der Ressourcen, die zu Tess’ Ärger immer häufiger vorkam.
»Und was machst du so? Kommst du heute noch rein?«
Tess fühlte sich plötzlich wie ein kleines Mädchen, das die Schule schwänzt. Mitten in der Woche saß sie mit ihrem großen Geheimnis auf der Terrasse des Hotel d’Angleterre und genoss die Sonne.
»Vielleicht später. Ich habe heute eigentlich frei.«
»Bist du krank?«
»Nein, ich habe einfach nur frei, ich musste noch etwas erledigen.«
»Mal was anderes: Willst du wissen, wie das Date war?«
Oh nein, dachte Tess, nicht schon wieder.
Seit ihrer Scheidung war Marie zu einer der wahrscheinlich emsigsten Tinder-Daterinnen Südschwedens geworden. Bald würde sie sich die Finger verbinden lassen müssen, so abgenutzt mussten sie vom Swipen sein. Und sie hielt mit den Erfahrungen, die sie dabei machte, nicht hinterm Berg.
»Habe ich eine Wahl?«
»Nein. Aber du wirst dich freuen, ich bin nämlich gar nicht hingegangen. Die Kleine hatte Fieber, und Tomas kommt nicht mit allen dreien zurecht, wenn eins von ihnen krank ist. Aber dieser Sebbe, den ich Mittwoch getroffen habe …«
Marie lachte.
»Also, ich weiß ja, dass du dich mit so etwas nicht auskennst, aber hast du schon mal vom Nervösen-Schwanz-Phänomen gehört?«
Tess warf einen Blick zum Nachbartisch, doch Marie erwartete gar keine Antwort.
»Er war wirklich richtig süß und einfühlsam, aber es klappte einfach nicht. Jetzt habe ich mich belesen und habe gelernt, dass so etwas gerade dann vorkommen kann, wenn echte Gefühle mit im Spiel sind. Dann geht plötzlich gar nichts mehr. Seltsam, bei mir ist das anders.«
Marie redete und redete, und Tess glitt in ihre eigenen Gedanken ab. Ihr Blick fiel auf ein Paar mit Kinderwagen, das auf dem Gehweg vorbeischlenderte.
»Also zwei Nieten in einer Woche. Aber auch ein abgesagtes Date ist ein Date. So, jetzt muss ich leider auflegen. Frohe Ostern!«
Unglaublich, dachte Tess, nachdem sie aufgelegt hatten. Marie gelang es immer wieder, es so erscheinen zu lassen, als wäre Tess diejenige gewesen, die sie angerufen und um Auskunft über ihre letzten Dates gebeten hätte.
Tess zahlte, stand auf und ging Richtung Ströget und Rådhusplatsen, um von dort aus mit dem Zug nach Malmö zurückzufahren.
Die Ehefrau
Ein Milan flog über die Wiese. Das milde Aprilwetter hielt an, und die Schneewehen, die Österlen vom Rest der Welt abgeschnitten hatten, waren endlich verschwunden. Ganz anders als im letzten Jahr, als ein plötzlicher Schneesturm an Ostern eine weiße Decke über die Gegend gebreitet hatte. Hier in der Gegend erinnerten sich alle noch sehr gut daran.
Ziellos wanderte sie über die Landstraßen, sog den Duft der Wiesen und frisch gepflügten Äcker ein. Wenigstens die frische, herrliche Landluft gab es noch. Das meiste andere um sie herum hatte sich verändert.
Es war ihr viertes Frühjahr in Österlen. Jetzt brach die Zeit an, in der die entlegenen Winkel sich belebten und die Häuser im Ort sich füllten. Sie hatte gelernt, mit den Jahreszeiten zu leben und mit den Gewohnheiten, die sie prägten. Nach einem langen, harten und stürmischen Winter begann man wieder, sich zu besuchen. Erwartungsvoll und zuversichtlich blickte man auf Ostern und auf den Sommer. Kleine rot-gelbe Kugeln wiesen an den Kreuzungen den Weg zu den Häusern der Künstler und den Galerien. Jetzt pilgerten die Touristen in Strömen herbei, und Teile des Jahreseinkommens wurden gesichert.
Sie selbst fühlte sich einfach nur leer.
Ausgebrannt und eingesperrt. Ihr Leben, ihr Projekt, ihr Traum von einem ruhigeren Leben hatte sich anders entwickelt als gedacht. Völlig anders.
Es war ihr Mann gewesen, der sie gedrängt hatte, aufs Land zu ziehen, ausgerechnet nach Österlen. Und nachdem sie das Haus entdeckt hatten, ein unwiderstehliches Angebot, hatte es kein Zurück mehr gegeben. Die vielleicht einzigen einigermaßen erträglichen Kindheitserinnerungen ihres Mannes waren mit diesem Teil Schonens verbunden. Sie umfassten die kurze Zeit, in der seine Familie hier gelebt hatte, bevor sein Vater die Koffer gepackt und sie verlassen hatte, um wieder in den Norden zu ziehen. Bevor seine Mutter krank geworden war und anfing, sich selbst und ihrer Familie zu schaden, sodass sie in die Psychiatrie eingewiesen werden musste. Bevor alles so endete, wie es das in solchen Fällen immer tat: in Chaos und immer neuen Inobhutnahmen.
Sie selbst war skeptisch gewesen, ob der Umzug eine gute Idee war. Für sie war Österlen lediglich eine einsame Gegend, die einmal im Jahr für ein paar Wochen aufblühte. Ein Ort, an dem Künstler sich um die Wette bemühten, das ach so berühmte Licht einzufangen. Man hatte sie vor der Schwermut gewarnt, die im November über diesen Landstrich hereinbrach. Dann musste man sich darauf verlassen können, dass das Leben in allen Bereichen gut funktionierte.
Doch am Ende war es ihrem Mann gelungen, sie zu überzeugen, indem er ihr ein ruhigeres, erfüllteres Leben als im stressigen Malmö versprochen hatte. Naturnah, mit mehr Zeit für die Familie. Und er würde wieder Zeit zum Malen finden, könnte seinen Traum von einem kreativen Leben verwirklichen.
Wäre sie nicht so verzweifelt gewesen, hätte sie der Gedanke an ihre naiven Träume zum Lachen gebracht. Denn es war völlig anders gekommen. Das Bild, das sie vor sich gesehen hatte – wie sie beide ein altes Haus renovieren, in modischen Gummistiefeln herumlaufen und zwischen Stockrosen und malerischen Glasveranden ein ökologisch korrektes Leben führen würden – hatte sich als trügerisch erwiesen. Nie zuvor in ihrem Leben hatten sie häufiger mit dem Auto fahren müssen, und am Ende mussten sie sich sogar noch einen Zweitwagen anschaffen, um den Alltag einigermaßen geregelt zu bekommen.
Die Entfernung zu allem und jedem machte sie fertig. Egal, wohin man wollte, es dauerte mit dem Auto mindestens eine Stunde. Der öffentliche Nahverkehr war schlecht ausgebaut, sodass viel Organisationstalent gefragt war, denn die Kinder mussten zu all ihren Aktivitäten mit dem Auto gefahren werden. Hinzu kamen die Dunkelheit, die Stille und nicht zuletzt die Wildschweine, die den Garten verwüsteten.
Außerdem ging es ihnen finanziell schlechter, obwohl sie und ihr Mann öfter und mehr arbeiteten als je zuvor. Erst kürzlich war ihr klar geworden, dass er vielleicht sogar ganz froh war, sich hinter seiner Arbeit verstecken zu können. Ihre eigenen Ängste und Sorgen wuchsen dagegen ins Unermessliche. Im Herbst war sie »zusammengeklappt«, wie man das wohl nannte. Mit hohem Fieber wurde sie in die Notaufnahme in Kristianstad gebracht. Dahinter steckte kein einzelnes Ereignis, sondern die ständigen kleinen Stressfaktoren. Tief in ihrem Innern wusste sie, dass einer der Gründe die getrennten Leben waren, die sie inzwischen führten.
Sie hatte angefangen zu ahnen, dass der Umzug lediglich ein weiterer Schritt auf seiner inneren Reise zurück in die Kindheit gewesen war. Eine Art Wiedergutmachung, ein Versuch, die Erinnerungen zurückzuerobern und sie heller zu machen. Mit jedem Tag hatte sie sich mehr auf eine Requisite in seinem Lebensprojekt reduziert gefühlt. Das Einzige, worüber sie inzwischen noch nachdachte, war, wie sie da wieder herauskommen konnte. Sie würde hier keinesfalls noch einen weiteren Winter verbringen, das zumindest hatte sie sich selbst geschworen.
Die Straßen von Malmö leerten sich in Erwartung des langen Wochenendes. Durch das Taxifenster fiel Tess’ Blick auf die als Osterhexen verkleideten Kinder, die schon vorzeitig zu feiern begonnen hatten. Das Taxi hielt an einem Zebrastreifen. Über die Schulter des Fahrers sah Tess zwei Frauen, die Hand in Hand die Straße überquerten.
Es dauerte einen Moment, bevor sie begriff, um wen es sich handelte. Dann wurde ihr eiskalt.
Zum ersten Mal seit ihrer Trennung sah sie Angela mit einer anderen Frau. Als das Taxi anfuhr, drehte Tess sich um und folgte dem Paar mit dem Blick.
Eine blonde Frau ging an Angelas Seite. Tess kannte sie nicht, zumindest glaubte sie das.
Sie schloss die Augen, seufzte und lehnte sich auf dem schwarzen Ledersitz zurück. Konzentrier dich auf dein eigenes Leben, sagte sie sich selber und überlegte, wie Angela wohl reagieren würde, wenn sie wüsste, dass sie in der Kinderwunschklinik in Kopenhagen gewesen war.
Die Frühlingssonne spiegelte sich im Kanal unter der Carolibrücke, als sie in die Porslinsgatan Richtung Polizeigebäude einbogen.
»Sind Sie Polizistin?«, fragte der Taxifahrer, als er hielt.
»Ja.«
»Sie müssen da unbedingt etwas unternehmen, das geht so nicht weiter.«
»Was meinen Sie?«
»Alles. Die Gewalt. Ich traue mich schon gar nicht mehr, abends noch zu fahren. In den letzten Monaten bin ich zweimal ausgeraubt worden.«
Der Fahrer namens Yassin zeigte auf seinen Hals.
»Hier. Hier haben sie mir das Messer drangehalten. Und dann kann man nichts machen, dann gibt man ihnen das Geld. Das kann doch nicht so weitergehen!«
Tess erklärte ihm, dass sie alles täten, um die Situation zu verbessern. Was sonst sollte sie ihm auch sagen?
Yassin schüttelte skeptisch den Kopf.
»Dann hoffen wir mal, dass es hilft, denn sonst muss ich mir eine andere Arbeit suchen.«
Durch die Drehtür ging Tess in Richtung Rezeption. Inzwischen wagte sie außerhalb des Dienstgebäudes kaum noch zu sagen, was sie beruflich machte.
Vor allem in den letzten Jahren hatte sich einiges verändert. Obwohl Malmö laut einer Studie inzwischen wieder deutlich sicherer war als noch vor einiger Zeit und es weniger Gewalttaten gegen die allgemeine Bevölkerung gab, sprachen doch alle über nichts anderes mehr. Außerdem wurden Bandenrivalitäten jetzt häufig in der Nähe der »normalen Bürger« ausgetragen. Viele Malmöer hatten einfach genug und äußerten dies auch lautstark.
Tess nahm den Aufzug zur Abteilung Gewaltverbrechen, wo sie erwartete, von vorfeiertäglicher Stille empfangen zu werden. Doch zu ihrer Verwunderung eilten noch immer zahlreiche Kollegen geschäftig durch die Gänge.
An einem der Schreibtische im Cold-Case-Büro saß Rafaela Cruz, das neueste Mitglied in ihrem Team. Immer wieder ertappte Tess sich dabei, ihre Anwesenheit nicht richtig wahrzunehmen. Erst wenn Rafaela aufstand, nahm sie mit ihren eins fünfundachtzig wirklich Raum ein, ansonsten bemerkte man sie kaum. Was Tess über sie wusste, ließ sich an den Fingern einer Hand abzählen. Ihre trainierten Oberarme zeigten aber deutlich, dass sie persönliche Bestergebnisse von hundertdreißig im Bankdrücken erzielte und die Polizeimeisterschaften in dieser Kategorie gewonnen hatte. Tess, die selbst bei etwa siebzig lag und damit auch ganz zufrieden war, war jedes Mal beeindruckt, wenn sie Rafaela im hauseigenen Fitnessstudio zusah.
Ansonsten war Rafaela eine schweigsame junge Frau mit lateinamerikanischen Wurzeln, aus der Tess nicht recht klug wurde. Schwer durchschaubar, aber sehr beharrlich, sie hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um Teil des Cold-Case-Teams zu werden. Ihre Beweggründe waren Tess zunächst schleierhaft gewesen, doch dann hatte sie erfahren, dass Rafaela persönliche Erfahrungen mit unaufgeklärten Fällen hatte. Ihr älterer Bruder war in den Neunzigerjahren in einer Pizzeria in Lund erschossen worden, und niemand war für die Tat verurteilt worden. Solche privaten Erfahrungen konnten sich sowohl positiv als auch negativ auf die Arbeit auswirken – bei Rafaela war sie sich da noch nicht sicher. Aber Tess war dankbar für jede zusätzliche Kraft, die ihr zugestanden wurde.
Nachdem 2010 die Verjährungsfrist aufgehoben worden war, erhöhte sich die Anzahl abgelegter Fälle, in denen weiter ermittelt werden konnte, jedes Jahr. Allein in Schonen war man inzwischen bei über hundert Fällen, zahlreiche bandenbezogene Straftaten drohten mit der Zeit ebenfalls in dieser Kategorie zu landen. Viele würden sich wohl niemals aufklären lassen. Tess führte eine Liste von etwa zwanzig alten Fällen, bei denen man mithilfe neuer DNA-Analyseverfahren vielleicht zu neuen Erkenntnissen kommen würde. Jede Woche befassten sie sich mit mehreren dieser Fälle, wobei sie sich streng an der Liste orientierten.
Ihre persönliche Wunschliste sah allerdings noch ganz anders aus. Die befand sich in dem grünen, ledergebundenen Buch, das sie überall mit sich herumtrug, um sich jederzeit Notizen machen zu können. Unter diesen Fällen befanden sich der brutale Mord an dem Ehepaar Liedberg auf Råå, in der Nähe von Helsingborg, sowie der Fall Lena Bergholm und noch ein paar weitere.
Die technischen Möglichkeiten entwickelten sich zu ihren Gunsten. Seit dem Jahreswechsel ermöglichte ein neues Gesetz es dem Nationalen Forensischen Zentrum, NFC, in Fällen, in denen es keine Tatverdächtigen gab, anhand von DNA-Spuren Familienangehörige ausfindig zu machen.
Es war ihr nicht vergönnt gewesen, die Erste zu sein, die diese Möglichkeit erproben konnte. Die Kollegen in Göteborg waren schneller gewesen, ihnen gelang es anhand eines solchen Tests, einen alten Vergewaltigungsfall an einem jungen Mädchen aufzuklären. Tess freute sich dennoch über den Erfolg und hoffte, bald Gelegenheit zu bekommen, die neue Methode selbst zu nutzen.
Seit sie dem Team zugeteilt worden war, hatte Rafaela Cruz viel Zeit darauf verwendet, alte Ermittlungsprotokolle zu lesen. Tess war beeindruckt von ihrem Einsatz. Darüber hinaus bewies ihr Neuzugang ein gutes Gespür dafür, wie man sich den Altfällen am besten näherte, die richtigen Details und bisher unbeachteten Zusammenhänge fand.
Tess trat zu ihr.
»Wie läuft es im Liedberg-Fall? Hast du einen Anhaltspunkt gefunden?«
Überrascht blickte Rafaela auf. Sie war anscheinend so in ihre Papierberge vertieft gewesen, dass sie gar nicht bemerkt hatte, dass jemand hereingekommen war.
»Ich glaube, ich habe in einer der Zeugenbefragungen einen Hinweis auf ein Auto entdeckt, der bisher nicht beachtet wurde und vielleicht noch mal überprüft werden sollte.«
Tess schaute ihr über die Schulter. In dem Bericht wurde ein blaues Auto erwähnt.
»Ja, das hätte längst jemand machen müssen. Bravo. Schau mal im zentralen Fahrzeugregister, ob du herausfindest, wer zum entsprechenden Zeitpunkt Besitzer des Wagens war.«
Rafaela richtete sich auf.
»Mir fällt es schwer, das so liegen zu lassen. Und vom Computer zu Hause lassen sich die zeitlichen Abläufe schlecht nachverfolgen, wenn alle wichtigen Ordner hier im Büro sind. Ich werde wohl auch am Wochenende immer mal hier sein.«
Tess nickte. Noch nie hatte sie die Kollegin so lange an einem Stück reden hören.
»Das verstehe ich. Ich werde mir selbst auch einen dicken Ordner mit nach Hause nehmen.«
Rafaela verzog das Gesicht.
»Auch wenn ich aus Paraguay komme, so groß feiere ich Ostern nicht.«
Tess klemmte sich die Bergholm-Akte unter den Arm.
»Ich auch nicht, obwohl ich in Västerhamn wohne«, sagte sie und grinste.
Als sie auf dem Flur stand, sah sie, wie ihre neue Chefin, Sandra Edding, weiter hinten im Flur ihre Bürotür abschloss, ein kleiner schwarzer Reisekoffer stand neben ihr. Noch nie hatte Tess sie so gesehen, ohne Kostüm, in weißen Turnschuhen, Jeans und dickem schwarzem Pullover. Sie sah darin viel jünger aus als fünfundvierzig.
Tess fühlte sich in ihrer Gegenwart verunsichert, ein ungewohntes Gefühl für sie. Sie ahnte, dass Sandra Edding eingesetzt worden war, um durchzugreifen und umzustrukturieren. Und sie war sich nicht sicher, wie ihre Einstellung zu den alten, auf Eis gelegten Fällen war. Aber sie wusste, dass sie in ihrer vorherigen Position in Stockholm als eine Art Star gefeiert worden war und dass man sie hier ebenfalls so sah.
Als sie vor ein paar Monaten in der Abteilung für Gewaltverbrechen als die Vertretung von Per Jöns vorgestellt worden war, hatten die jüngeren Männer sich vielsagend angeschaut. Tess vermutete, dass Sandra Edding es gewohnt war, als gutaussehend betrachtet zu werden. Sie schien völlig unberührt von den Blicken, die ihr zugeworfen wurden. Tess hatte gehört, dass sie ihren Mann und ihre Tochter sowie den Sohn ihres Mannes an den meisten Wochenenden in Stockholm besuchte. Sie hatte in verschiedenen Ländern bei der Aufklärung internationaler Verbrechen mitgearbeitet, unter anderem in Frankreich. Dort, in Le Havre, hatte sie auch ihren Mann kennengelernt. Gerüchten zufolge war er entfernt mit dem Stifthersteller Edding verwandt und wahrscheinlich recht wohlhabend.
Tess nickte ihr zu. Im selben Moment tauchte Marie Erling auf.
Sie blickte Sandra hinterher, die in den Aufzug stieg.
»Treffen mit Merkel?«
Tess schüttelte den Kopf.
»Hast du mich raushauen können?«
»So schnell geht das nicht.«
»Ich fahre nicht noch mal zu einer Schießerei raus, lieber melde ich mich krank.«
Tess folgte Marie zum Aufzug.
»Gestern habe ich den ganzen Tag nicht den Mund aufgemacht. Keinen Piep habe ich gesagt. Makkonen ist beinahe ausgerastet. Ich habe behauptet, ich hätte eine Nussallergie, mein Hals sei zugeschwollen und meine Stimmbänder blockiert. Weiß gar nicht, ob es so was gibt, muss ich mal googeln.«
Tess betrachtete Marie. Die Scheidung hatte sichtbare Spuren hinterlassen. Jedes Schwangerschaftskilo nach der Geburt ihrer Tochter Tilde und noch ein paar mehr hatte sie wieder verloren. Und wenn sie früher schon launisch gewesen war, so hatte sich dieser Wesenszug im letzten halben Jahr noch verstärkt. Tess fürchtete, dass sie immer noch in der Schockphase war. All die Dates, die sie wöchentlich absolvierte, kamen ihr als Außenstehende eher wie Fluchtversuche vor.
Die Initiative für die Trennung hatte Marie selbst ergriffen, nachdem sie mehrere Jahre das Gefühl nicht losgeworden war, die Beziehung plätschere nur noch so dahin. Vielleicht hatte sie damit gerechnet, dass ihr Mann Tomas sie auf Knien anflehen würde, gemeinsam zu versuchen, die Beziehung zu retten. Stattdessen hatte er die Tür, die sich einen Spaltbreit geöffnet hatte, weit aufgerissen und war gegangen. Offenbar, und ohne je den geringsten Hinweis darauf gegeben zu haben, war er ebenfalls unzufrieden mit ihrer Beziehung gewesen. Es war alles ganz schnell gegangen, und am Ende stand Marie unversehens mit einem Alle-zwei-Wochen-Leben da, das sie zutiefst verabscheute.
Tess war drauf und dran, ihr zu erzählen, dass sie ihre Exfreundin Angela Hand in Hand mit einer anderen gesehen hatte, hielt sich aber zurück. Sie wollte nicht darüber reden.
»Was hast du Ostern vor?«, fragte sie Marie stattdessen.
»Ist es schon so weit?«
»Übermorgen. Für die meisten beginnt es mit Gründonnerstag.«
Marie hob abwehrend die Hand.
»Lass uns nicht darüber reden.«
Tess sah ihr nach, bis sie über den Gang verschwunden war.
Sie selbst hatte ebenfalls keine großartigen Pläne für das lange Wochenende. Ihre Schwester Isabel und Familie hatten zu sich eingeladen, da würde sie wahrscheinlich hingehen. Ihr Vater, mit dem sie die Feiertage im letzten Jahr begangen hatte, damit er nicht allein war, hatte sich Hals über Kopf in eine Frau namens Eva verliebt und war nun rund um die Uhr beschäftigt. Und ihre Mutter war mit Freundinnen zu einer Weinverkostung nach Südfrankreich gefahren. Die meisten anderen Menschen um sie herum waren jeweils mit ihren eigenen Familien beschäftigt, wie man das ab vierzig eben war, und eine eigene Familie hatte sie nicht. Noch nicht.
Tess überlegte, wie ihr Leben nächstes Ostern wohl aussehen würde. Leichte Panik ergriff sie. Vielleicht hatte sie dann ein Kind zu versorgen? Und ihre übliche Vorgehensweise, kurz vorher noch abzuspringen, wenn etwas nicht passte, schien in diesem Fall keine gangbare Lösung zu sein.
Mittwoch, 17. April
Mischa Lindberg schloss die Badezimmertür und ging barfuß über den kalten Steinfußboden. Sie war nervös wegen der Vernissage am Karfreitag und fand keine Ruhe. Seit Tagen schon fühlte sie sich so rastlos. Natürlich war sie gespannt, wie ihr Lebenswerk »The End« beim Publikum ankommen würde.
Doch da war noch etwas anderes. Sie fühlte sich beobachtet. Sobald sie aus dem Haus ging, sei es zum Einkaufen oder auch nur, um auf dem Hof etwas zu erledigen, kam es ihr vor, als sähe ihr jemand zu. Am Morgen, als sie im nebligen Garten gelbe Osterfedern in den Apfelbaum gehängt hatte, musste sie sich umdrehen, so fest war sie davon überzeugt gewesen, dass jemand hinter ihr stand. Doch das einzige Lebewesen in der Nähe war der kleine Star oben auf dem Dachbalken, der zu ihr herabsah.
Am Abend, als sie ihr Atelier aufgeräumt hatte, war dieses Gefühl erneut da gewesen. Es hatte sich angehört, als schlüge eine Tür auf der Rückseite der Scheune im Wind, und als sie hinging, um nachzusehen, hatte sie wieder das Gefühl gehabt, da wäre jemand.
Vielleicht lag es ja auch nur an der hohen Arbeitsbelastung und dem Druck, vor Ostern mit allem fertig werden zu müssen.
Mischa gähnte und löschte in der Küche das Licht.
Intensive Tage lagen vor ihr, und sie brauchte eine Nacht mit langem, tiefem Schlaf.
Sie ging ins Schlafzimmer, zog den schweren Samtüberwurf vom Bett und kroch unter die Decke.
Vor sich sah sie ihr Kunstwerk »The End« und verspürte plötzlich eine Art Trennungsschmerz. Nach zehn Jahren Arbeit sollte das Bild dem Publikum zugänglich gemacht werden, wenn am Karfreitag die Galerie Factory ihre Türen öffnete. Bis jetzt war es ganz allein ihr Baby gewesen, wenn auch ein zwei Meter großes, und selbst wenn niemand das Ölgemälde kaufen würde, der Zauber wäre zerstört, sobald sie es mit anderen teilte.
In gewisser Weise hatte dieser Prozess bereits begonnen. In der letzten Woche hatte sie es mehrfach in den Medien präsentiert, sowohl das Fernsehen als auch Zeitungen waren daran interessiert gewesen. Eine Künstlerin, die mit ihrem letzten Menstruationsblut malte, erregte Aufmerksamkeit. Doch das war nicht der Grund, weshalb sie es getan hatte. Wenn sie provozieren, auf Unrecht oder mangelnde Gleichberechtigung hinweisen konnte, sollte ihr das recht sein, aber ansonsten hatte sie keinerlei Interesse an öffentlicher Aufmerksamkeit. Es war einfach ihr Beitrag, wenn es darum ging, den Missstand anzuprangern, dass ein großer Teil im Leben einer Frau versteckt und unsichtbar gemacht wurde.
Ein zweigeteiltes Ölgemälde, ein hellblau schimmernder Himmel und eine gelbe Heidelandschaft, die durch eine Meereslinie, gemalt mit Blut – ihrem Blut – voneinander getrennt wurden. Vorher und nachher. Hatte sie bei ihrem Ex-Mann Andy eine gewisse Eifersucht wegen der großen Aufmerksamkeit gespürt, die sie im Rahmen der bevorstehenden Konstrundan, dem jährlich in Schonen stattfindenden Kunstfestival, erhielt? Kleine Sticheleien wegen des Medienhypes? Sie konnte es ihm nicht verdenken. Es war nicht leicht, als Künstler über die Runden zu kommen. Doch ihr Werk würde ja auch andere Kunden in seine Galerie locken. Er konnte also eigentlich zufrieden sein.
Sie nahm das oberste Buch vom Stapel auf ihrem Nachttisch. Joyce Carol Oates. In letzter Zeit war sie nicht häufig zum Lesen gekommen. Ein wenig zerstreut blätterte sie bis zum Eselsohr und begann zu lesen. Nach ein paar Sätzen fiel plötzlich weißes Licht von draußen in ihr Schlafzimmer. Sie nahm das Buch herunter und legte es auf ihrem Bauch ab. Dann schaute sie zum Fenster. Es war, als wären starke Scheinwerfer auf ihr Haus gerichtet.
Sie schlug die Decke zur Seite und setzte sich auf die Bettkante. Durch die weiß-rosa Vorhänge sah sie, wie das Licht schwächer wurde. Ein Auto, das zurücksetzte?
Seltsam, dachte sie. Ihr Hof lag am Ende der Straße, und es gab keinen Grund, hier vorbeizufahren. Vielleicht hatte sich jemand verfahren. Sie saß immer noch auf der Bettkante. Doch das Licht schien weiterhin zu ihr herein. Also stand sie auf und ging zum Fenster. Sie öffnete die Vorhänge einen kleinen Spalt und schaute zur Straße. Fünf starke Autoscheinwerfer leuchteten in ihre Richtung. Mischa stand ganz still. Das Auto musste etwa fünfzig Meter vom Haus entfernt sein.
Sie hörte leises Motorgeräusch und beschloss, sich eine Jacke überzuziehen und nachzusehen.
Als sie in der Küche Licht machte, stellte sie fest, dass auch Teile des dunklen Wohnzimmers von den Scheinwerfern erleuchtet wurden. Mischa zog sich ihre Fleecejacke und die grünen Gummistiefel an und drehte den Schlüssel um. Die Haustür knarrte, und als sie hinaustrat, schaute sie in einen weißen Nebel.
Das Auto schien sich dem Haus wieder etwas genähert zu haben.
Mischa wurde vom Licht geblendet und hielt sich die Hand vor die Augen. Die Luft war warm und feucht vom Nebel, das leise Surren des Automotors war das einzige Geräusch. Durch den Nebel erahnte sie kleine schwache Lichter vom Nachbarhof auf der anderen Seite der Wiese. Sie überlegte, ob sie zu dem Auto hingehen oder lieber auf der Treppe stehen bleiben sollte.
Bevor sie sich entscheiden konnte, erloschen die Scheinwerfer, und sie starrte ins Dunkel.
Als sie ein paar Stufen hinunterging, leuchteten sie wieder auf, blinkten zweimal kurz hintereinander.
Mischa stand auf dem Hof und schaute zu dem Auto hinüber. Was ging hier vor? Die Reifen wirbelten Kies auf, als es wendete und wieder Richtung Straße fuhr.
Sie sah zu, wie die roten Rücklichter im Dunkel verschwanden.
Donnerstag, 18. April
Die feuchte Luft von der Ostsee, über der sich die Kühle vom Baltikum und die Wärme des Aprils in Schonen mischten, hatte Österlen in dichten Nebel gehüllt, der sich über die Wiesen legte.
Mischa Lindberg fuhr im Schneckentempo zur Galerie in Bästekille.
Es war erst sechs Uhr. Sie war früh dran, wollte ihr Werk ein letztes Mal allein auf sich wirken lassen, bevor morgen die Ausstellung eröffnet wurde. Unzählige Male war sie diese Strecke zwischen ihrem Hof in Stenshuvud und der Galerie schon gefahren. Normalerweise lagen die Felder offen zu beiden Seiten der Straße. Einen Nebel wie heute hatte sie selten erlebt. Nicht im April, er gehörte in den November. Die Sicht beschränkte sich auf nur wenige Meter.
Der Schlafmangel machte sich in ihrem Kopf und ihren Gliedern bemerkbar. Nachdem das Auto gestern verschwunden war, war es ihr schwergefallen einzuschlafen. Und als sie schließlich vor lauter Erschöpfung doch einnickte, schreckte sie kurz darauf hoch und starrte zum Fenster, erwartete das grelle Scheinwerferlicht wieder in ihr Schlafzimmer fallen zu sehen.
Sie konzentrierte sich auf ihre Atmung und hoffte, die Panikattacke wieder in den Griff zu bekommen. Die Erinnerung an den Anfall letzte Woche war noch zu frisch. Dabei hatte sie gedacht, sie hätte diese Dinge endgültig hinter sich gelassen. Sie wusste, warum sie in den letzten Wochen wieder empfänglicher dafür geworden war. Er hatte sie angerufen, unter Druck gesetzt, wollte ihr Nein nach ihrem Treffen in Malmö nicht akzeptieren. Warum konnte er es nicht begreifen? Sie mochte seine aufdringliche Art nicht. Wie er etwas von ihr verlangte, das sie ihm nicht geben konnte, ihm nie hatte geben können. Die einzige Möglichkeit war gewesen, ihm ein für alle Mal zu sagen, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm haben wollte. Sie fühlte sich in die Ecke gedrängt, und genau das hatte die Angstmaschine wieder in Gang gesetzt.
Das erste Mal hatte sie so etwas vor vielen Jahren in einem kleinen Motorboot auf dem Meer vor Kivik erlebt. Eigentlich verabscheute sie sowohl Boote als auch das Meer, hatte sich aber vorgenommen, ihre Phobie in den Griff zu bekommen. Stattdessen hatte das Gefühl des Ausgeliefertseins auf dem offenen Meer voll zugeschlagen, und die kleine Gruppe, mit der sie unterwegs gewesen war, sah sich gezwungen, das Boot zu wenden, nachdem sie sich an Deck hingelegt und hyperventiliert hatte.
Sie versuchte die Gedanken daran zu verdrängen, fuhr an dem Hinweisschild zu Fridens Pizzeria vorbei und dann weiter auf der schmalen Landstraße.
Als sie sich hinter der Kurve befand, bog ein Auto von der Kreuzung hinter ihr auf die Straße ein.
Sie warf einen Blick in den Rückspiegel. Starkes Scheinwerferlicht drang durch den kompakten Nebel. Das Auto war nah, wenn sie kräftig bremste, würde es zu einem Auffahrunfall kommen.
»Dann überhol doch, wenn du willst«, sagte Mischa laut und wütend, während sie herunterschaltete, erstaunt, dass bei so einem Wetter irgendjemand überhaupt auf den Gedanken kam, zu überholen.
Doch das Auto schien ebenfalls abzubremsen, und die Scheinwerfer verschwanden wieder im Nebel.
Quietschend fuhren die Scheibenwischer über die Windschutzscheibe und entfernten die schweren nassen Tropfen. Mischa schaute abwechselnd auf die Fahrbahn und in den Rückspiegel. Endlich tauchte das graue Blechdach der umgebauten Industrieanlage auf, und sie bog auf den Parkplatz ein.
Andy hatte die Factory vor fünf Jahren eröffnet. Die Galerie mitten auf einem Feld nördlich von Kivik war inzwischen einer der Hauptanziehungspunkte des Kunstfestivals, etwa zwanzig Künstler stellten dort aus. Mischa war nur mit »The End« repräsentiert, doch es war das größte und meistbesprochene Werk der Ausstellung.
Blinkende Farbexplosionen in den verschiedensten Tönen fielen von dem surrealistischen Neonschirm über dem Eingang durch den Nebel. Mischa blieb sitzen und schaute auf den leeren Parkplatz. Es herrschte wirklich dichter Nebel, und als sie die Autotür öffnete, kam es ihr vor, als trete sie in eine Wasserwolke. Das Geräusch der zufallenden Autotür hallte dumpf über die Felder.
Sie fischte die Schlüssel aus der Tasche ihrer Latzhose. Erneut hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie blieb neben dem Auto stehen und blickte sich nach allen Seiten um. Lauschte.
Die Feuchtigkeit drang in ihr halblanges schwarzes Haar. Mit der Korbtasche über der Schulter eilte sie zum Eingang. Die rote Metalltür quietschte, als sie sie öffnete. Sie betrat die dunkle Halle, stellte die Tasche ab und ging zum Lichtschalter.
Sie hörte ein Scharren, blieb an der Kasse im Eingangsbereich stehen. Das Geräusch kam von weiter drinnen. Mischa atmete ein paarmal tief durch. Die trockene Luft hier erleichterte ihr das Atmen, und der Geruch nach Kaffee von gestern, Malerfarbe und frisch gehängter Kunst drang in ihre Nase.
Sie tastete nach dem Lichtschalter. Wieder hörte sie das Scharren. Hinter ihr fiel die Metalltür ins Schloss, und sie zuckte zusammen.
Ein mattes Halbdunkel füllte den Raum. Die hoch oben liegenden Fenster ließen die Galerie normalerweise hell und luftig erscheinen, doch der Nebel dämpfte das Licht von draußen. Mischa fuhr mit der Hand über die Wand und fand den Schalter. Sie drehte ihn, schaute zu den großen Deckenlampen hinauf, doch nichts geschah. Seltsam, dachte sie, vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt. Sie müsste Andy anrufen und ihm Bescheid sagen.
Doch ganz dunkel war es nicht. Als Mischa den Blick über die weißen Wände wandern ließ, an denen die Kunstwerke hingen, bemerkte sie einen Lichtschein ganz hinten im Raum. Sie öffnete die Außentür, um besser sehen zu können, und blockierte sie mit einem Stein, damit sie nicht wieder zufiel.
Ihre Sandalen hallten in der Galerie wider, als sie in Richtung des Lichtscheins ging. Ganz hinten im Gang verlangsamte sie den Schritt, dann bog sie um die Ecke.
Auf dem Boden neben ihrem Bild stand eine Taschenlampe, so groß wie ein Scheinwerfer. Sie folgte dem Lichtstrahl langsam vom Boden die Wand hinauf. Der Boden wankte unter ihren Füßen.
Der Streifen Blut in »The End« bildete zusammen mit einem Riss ein gigantisches Kreuz über dem gesamten Gemälde. Mischa starrte ihr zerstörtes Lebenswerk an. Sie trat einen Schritt vor und stieß ein ersticktes Nein aus.
Die Atmung verlagerte sich ein Stück höher in ihren Brustkorb, und sie wusste genau, was das bedeutete. Ihr Sichtfeld wurde an den Rändern unscharf und flimmerte schwarz.
Luft. Sie musste hier raus.
Als sie sich umdrehte, hörte sie erneut das Scharren. Sie war nicht allein. Doch wer auch immer noch hier sein mochte, sie hatte keine Lust, es herauszufinden. Sie rannte zum Ausgang, suchte in der Hosentasche nach ihrem Handy, fand es jedoch nicht. Im Gang zwischen den Bildern flatterte etwas an ihrem Kopf vorbei und berührte ihr Haar.
»Nein!«, schrie sie und riss abwehrend die Arme hoch.
Mischa blickte auf. Ein paar Schritte vor ihr flatterte eine Taube, nahm Kurs auf das Licht und flog zur Tür hinaus. Mit zitternden Beinen folgte sie ihr. Draußen blieb sie vor dem Eingang stehen, die Feuchtigkeit des Nebels hüllte sie ein. Irgendwo da draußen wurde ein Motor angelassen, doch sie erkannte nur die Umrisse des Fahrzeugs. Als sie in die grauweiße kompakte Masse starrte, sah sie einen dunklen Kombi langsam auf sich zurollen. Sie schaute zu den Weiden am Parkplatz hinüber und lief los, an ihnen vorbei und weiter auf der schmalen Landstraße. Ihre Sandalen drückten, sie hörte ihre eigenen schweren Schritte auf dem Asphalt.
Das Motorgeräusch kam näher. Scheinwerfer blendeten hinter ihr auf, und die weißen Nebelpartikel um sie herum erstrahlten in einer Lichtexplosion. Sie drehte sich um, das Auto zwinkerte ihr zu. Zweimal kurz. Genau wie gestern.
Mischa verließ die Landstraße und rannte auf das Feld, stolperte über ein Grasbüschel und landete auf den Knien. Die Nase lief, sie saß auf dem in Nebel gehüllten Feld, schniefte und lauschte auf weitere Geräusche, hörte nichts als ihr eigenes Keuchen. Doch sie ahnte, dass es da draußen jemanden gab, nur wenige Meter von ihr entfernt.
Sie hörte seine anklagende, wütende Stimme in ihrem Kopf: »Du hast es mir versprochen, aber du hast mich verraten. Dabei warst du die Einzige, der ich vertraut habe.«
Freitag, 19. April
»Dreckswasser.«
Olle Hansson schüttelte resigniert den Kopf. Er hätte längst aufgeben sollen. Doch es hatte ihm widerstrebt, mit dem Beruf Stolz und Ehre von Generationen an den Nagel zu hängen. Die Augen der Dorsche quollen wie Pingpongbälle aus den mageren Köpfen, wie Zombies lagen die Fische im Netz.
Langsam steuerte er das Boot durch die Dunkelheit und den feuchten Nebel. Ein paar Meter aufs Meer hinaus, weiter wollte und traute er sich bei so schlechter Sicht nicht. Ruhig lag das Wasser da, ungewöhnlich ruhig für April, und er hatte sein Netz »långelands« ausgelegt, parallel zur Küste.
Aus dem Radio im Steuerhaus drang wie immer der Wetterbericht, er hörte am liebsten den dänischen, das war der einzige, der verlässliche Voraussagen für diesen Teil des Landes traf. Die ruhigen, milden Winde würden demnach noch ein paar Tage andauern, kein starker Ostwind war in Sicht. Ostern würde warm und sonnig werden.
Er zog seinen orangefarbenen Anorak fester um sich und atmete die brackige, frische Ostseeluft ein. Schön, wild und gefährlich war sie, und ach, so tot.
Jedes Jahr hatte er aufs Neue gedacht: Bald wird es sich ändern. Olles Großvater, der große Aalfischer, hatte in der Hanö-Bucht gearbeitet, genau wie sein Vater und sein Onkel. Die Wahrheit war, dass es bald nicht mehr gehen würde. Fischersohn Olle würde derjenige sein, der das Fischerleben aufgeben musste. Umweltgifte und Überdüngung hatten inzwischen auch das wenige, was noch übrig war, zerstört. Letzte Woche war sein Netz voller Zombiefische gewesen, gespenstische, wurmzerfressene Dorsche mit überproportional großen Augen. Und dann die Boykotte, die es ihnen unmöglich machten, den Fisch zu verkaufen. Die Behörden, die keinerlei Anstrengungen unternahmen, ihnen zu helfen. Er trauerte mit seinen Fischerbrüdern.
Bald würde es sie in Österlen nicht mehr geben, auch Olle hatte begonnen, seine Boote und Fischereigerätschaften zu verkaufen. Für andere Träume, die er einmal für sein Leben gehabt, aber nie verwirklicht hatte, war es inzwischen viel zu spät. Aber er würde das schon hinkriegen, seit ein paar Jahren hatte er eine neue Liebste, und mit ihr waren neue Energie und neue Träume von einem anderen Leben aufgetaucht.
Es war gegen fünf Uhr früh, und der Nebel schien sich ein wenig zu lichten. Noch immer war es dunkel, die Scheinwerfer des Bootes beleuchteten das schwarze eisige Meer. Bis die Sonne die dicken Schwaden endgültig vertrieben hatte, würde es wohl noch bis in den Vormittag hinein dauern. Er sehnte sich nach den Sommermorgen, wenn über dem Horizont die Sonne aufging. Wenn man der Wärme entgegenfuhr. Gott, was hatte er auf See nicht schon gefroren!
Der Bruder seines Vaters, Erik, hatte ihm einmal gezeigt, wie man sich am besten gegen die Kälte auf dem Wasser schützte. Dann war er draußen an der Södra Midsjöbank ums Leben gekommen. Olle schauderte immer noch, wenn er daran dachte, was sein Onkel in den zehn Meter hohen Wellen durchgemacht haben musste. Als Kind hatte er oft in Kivik am Pier gesessen und sich vorgestellt, was sich draußen, über hundert Seemeilen weiter im Meer, abgespielt hatte.
Olle blickte zum grauen Himmel hinauf. Die Nebelschwaden bewegten sich auf verschiedenen Ebenen und in verschiedene Richtungen. Trotz der Hoffnungslosigkeit des Fischerlebens gab es weniges, das an dieses Gefühl heranreichte, an einem ruhigen Tag allein vorn im Bug seines Schiffs zu stehen und in die Morgendämmerung zu fahren.
Die Wellen glucksten, und er fuhr weiter die Küste entlang. Jetzt konnte er schon Teile der Hügellandschaft erkennen. Durch den Dunst erahnte er die Konturen von Stenshuvud, einer felsigen Anhöhe etwa hundert Meter über dem Meer, die aus der flachen Landschaft ins Meer hineinragte. Bald würden die Buchen ausschlagen und ihr Blätterdach eine kühle grüne Decke bilden. Auf der anderen Seite lag der Sandstrand und dahinter Knäbäckshusen, ein malerisches Dorf, das im Sommer völlig überlaufen war.
Olle dachte an den Sommer, während das Boot sich tuckernd der Küste näherte. Ein starker Lichtschein, der vom Land durch den Nebel drang, holte ihn in die Gegenwart zurück. Er stellte den Blick scharf, um herauszufinden, was das sein konnte, drosselte den Motor und nahm sein Fernglas zur Hand.
Nachdem er es justiert hatte, stellte er fest, dass das blinkende Licht von Stenhuvuds Udde kam, wo der kleine weiße Leuchtturm stand.
»Nanu«, sagte er laut zu sich selbst.
Olle hatte keine Ahnung, wie oft er diese Strecke in seinem Leben schon gefahren war. In all den Jahren war der Leuchtturm nie im Einsatz gewesen. Es war viele Jahre her, seit man ihn außer Betrieb genommen hatte.
Er legte das Fernglas beiseite und fuhr näher heran. Das Wasser war hier an die vier Meter tief, er konnte sich dem Land also recht weit nähern. Die dichtesten Nebelschwaden lockerten sich ein wenig.
Olle wischte sich die Feuchtigkeit aus dem Gesicht. Ein starker, kalter Lichtschein drang durch die grauen Massen. Je länger er starrte, desto überzeugter war er: Das Licht kam vom Leuchtturm.
Zum ersten Mal in seinem Fischerleben sah er ihn als das, wozu er gedacht war – ein leuchtendes Warnsignal an der Küste, ein grellweißer Punkt an der äußersten Spitze des Felsens, etwa zehn Meter hoch. Nachdem seine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, griff er erneut nach dem Fernglas und stellte es scharf.
»Verdammt …« Sein Puls beschleunigte sich. Ungläubig blinzelte er zu der Anhöhe und den Steinen unterhalb des Leuchtturms hinüber.
Er brachte das Boot zum Stehen, stellte den Motor aus, nahm das Fernglas herunter und ließ es um seinen Hals baumeln. Er blickte sich um, konnte jedoch keine weiteren Boote in der näheren Umgebung entdecken. Er musste sich entscheiden: Krivareboden etwas weiter entfernt ansteuern, das Boot dort vertäuen und zu Fuß zum Leuchtturm gehen oder gleich die 112 anrufen.
Direkt vor ihm lag eine Leiche. Sie war zwischen zwei Steinen eingeklemmt, doch der Oberkörper bewegte sich mit den Wellen hin und her.
Er oder sie konnte nicht mehr am Leben sein.
Olle hatte erst einmal im Leben einen Toten gesehen. Bei einem Unfall auf einer spanischen Autobahn, als er und seine damalige Freundin Sekunden nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle vorbeigefahren waren. Diese Bilder war er nie wieder losgeworden. Und er ahnte bereits, dass es ihm nach diesem Anblick ähnlich ergehen würde.
Noch einmal schaute er zu der Leiche hinüber. Das Haar breitete sich im Wasser aus. Trotz der Dunkelheit meinte er zu erkennen, dass sie ein buntes Top trug, wahrscheinlich handelte es sich also um eine Frau. Gerade hier, am Stenshuvud, trafen die Strömungen aufeinander, bei starkem Seegang konnte es schwierig werden, zu navigieren. Wie war sie hierhergekommen? War sie aus einem Boot gestürzt und von den Wellen angespült worden?
Er drehte sich um, starrte in den Nebel und auf das Meer. Seine Beine zitterten, und er fühlte sich einer Ohnmacht nahe. Er wollte weg, raus aufs Meer, in Sicherheit. Weg von der Anhöhe und dem schrecklichen Anblick der Leiche.
Ein unerwartetes Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Doch es war nur ein Vogel, der aus einem Gebüsch aufflatterte. Weiter Richtung Strand entdeckte er die Umrisse eines kleinen weißen Boots.
Der Leuchtturm warf ein seltsames Licht über den Hügel, über das Meer und den Nebel. Warum in aller Welt leuchtete er jetzt? Nach all den Jahren? Und wer war die Frau im Wasser?
Die Ehefrau
Seit ein paar Tagen leuchtete die Wiese gelb vom Löwenzahn. In weniger als zwei Monaten würde es hier noch intensiver leuchten, wenn der Raps zu blühen begann, und die Felder wogten. Sie sollte sich eigentlich freuen, sollte zuversichtlich in die Zukunft blicken, dem Frühling und vor allem dem Sommer entgegen, der vor ihnen lag. Doch es gelang ihr nicht.
Je mehr Zeit verstrich, desto mehr hatte sie das Gefühl, der Mann an ihrer Seite würde ihr fremd. Gestern, als er auf der Arbeit noch etwas erledigt hatte, was noch vor Ostern fertig werden musste, hatte sie sich mit dem Laptop hingesetzt. Ihre verschiedenen Geräte waren alle mit demselben Passwort versehen, so war es schon immer gewesen, es war nichts Seltsames daran.
Sie hatte nicht vor, nach irgendwelchen Geheimnissen zu stöbern, und hatte selbst auch nichts, wovon er nicht wissen durfte. Als sie diesmal jedoch die Dateien auf der Festplatte betrachtete, entdeckte sie einen Ordner, der ihre Neugier weckte. Ihr Mann hatte ihn erstellt, ihn mit drei Kreuzen benannt, und als sie ihn öffnete, fand sie etwa zwanzig Bilder. Alle von ihm. Ein paar Kinderfotos, unscharf, verblichen und mit düsterem Gesichtsausdruck. Auf einigen war auch sein älterer Bruder zu sehen. Sie hatten keinen engeren Kontakt, er war von zu Hause ausgezogen, sobald er konnte. Sie selbst hatte ihn nur ein einziges Mal gesehen, als er vor zwei Jahren im Sommer mit seiner Freundin vorbeigekommen war. Die Stimmung war steif und angespannt gewesen und völlig anders, als wenn sie sich mit ihrer Schwester traf.
Andere Fotos zeigten ihren Mann als Jugendlichen, sie wirkten etwas gelöster, und noch andere stammten aus seiner Zeit an der Folkhögskola Skurup, wo er seine Zulassung zum Studium erwerben wollte. Eine Party, alle hatten Bierdosen in der Hand, vor ihnen Tische voller Flaschen und Gläser.
Ein paar Gesichter erkannte sie wieder, Max Lund natürlich, und ein paar weitere. Die letzten Bilder waren ein paar Jahre später aufgenommen worden. Da waren diese tiefliegenden, geheimnisvollen Augen, in die sie sich damals verliebt hatte, als sie zusammen in einer Bar in Malmö standen. Die eine Neugier und Zärtlichkeit in ihr geweckt hatten, wie sie es nie zuvor erlebt hatte.
Sie hatte sich die Fotos angeschaut und versucht herauszufinden, was er darin gesucht haben konnte. Die Kindheit, wieder einmal, vermutete sie. Diese ständige Suche nach sich selbst.
Nachdem sie den Ordner geschlossen und den Laptop heruntergefahren hatte, fühlte sie sich unsicher und verwirrt. Mit wem lebte sie eigentlich zusammen?
Sie öffnete das Tor zum Garten hinterm Haus. Am Morgen, noch bevor sie mit dem Packen begonnen hatte, hatte sie die Maulwurfshügel auf dem Grundstück platt getreten, die aufpoppten, sobald man ihnen den Rücken zukehrte.