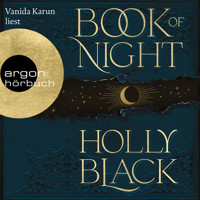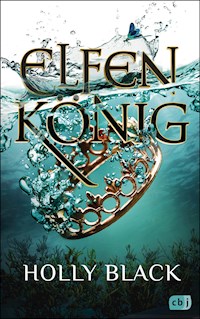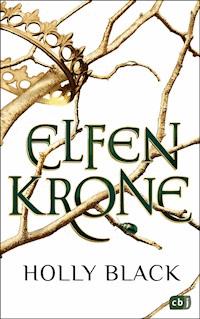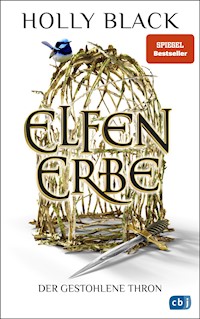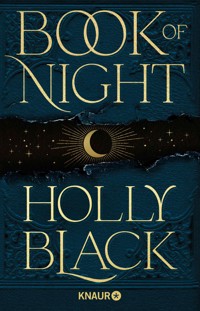6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Coldtown ist gefährlich. Ein goldener, glamouröser Käfig für die Verdammten und all jene, die mit ihnen bis in den Tod feiern ...
Tana wacht morgens nach einer Party auf und stellt fest, dass sie eine der wenigen Überlebenden in einem Haus voller Leichen ist. In einer Welt, in der Vampire ihr Unwesen treiben, ist Tana Schreckliches gewohnt, doch normalerweise halten sich Vampire in Quarantäne-Städten auf, in den sogenannten »Coldtowns«. Tanas Ex-Freund Aidan hat die Party zwar überlebt, doch er ist mit dem Vampir-Virus infiziert, und auch Tana könnte infiziert sein. Gemeinsam mit Aidan und dem einzigen anderen Überlebenden, dem geheimnisvollen Gavriel, macht sich Tana auf ins Herz der Gefahr – nach Coldtown, um sich und die anderen zu retten ...
Ein atemberaubender Vampirroman über Rache und Schuld, Tod und Liebe, von der New-York-Times-Bestsellerautorin Holly Black!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HOLLY BLACK
STADT DER UNSTERBLICHKEIT
Aus dem Englischen
von Anne Brauner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2013 by Holly Black
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
»The Coldest Girl in Coldtown«
bei Little, Brown and Company, New York.
© 2020 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Anne Brauner
Lektorat: Carola Henke
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München
unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock
(Christos Georghiou, Photosani)
he • Herstellung: UK
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-21919-2V001
www.cbj-verlag.de
Für Steve Berman,
der mich zu der Kurzgeschichte inspiriert hat,
die wiederum die Inspiration für diesen Roman war.
ERSTES KAPITEL
Uns kann nichts Schöneres zustoßen als der Tod.
– Walt Whitman
Tana erwachte in einer Badewanne. Sie hatte die Knie an die Brust gezogen und die Wange an das kalte Metall des langsam tropfenden Wasserhahns gelehnt. Der Stoff an ihrer Schulter und einige Strähnen waren nass, doch zum Glück waren ihr übriger Körper und die anderen Anziehsachen trocken geblieben. Mit steifem Hals und verspannten Schultern sah sie verschlafen zur Decke hoch und betrachtete die Schimmelflecken, die zu einem Rorschachmuster verflossen waren. Einen Augenblick lang wusste sie nicht, wo sie war. Dann stützte sie sich auf die Knie, rutschte mit der Haut über die Emaille und zog den Duschvorhang auf.
Im Waschbecken türmten sich Plastikbecher, Bierflaschen und benutzte Handtücher. Durch ein kleines Fenster über der Toilette strömte helles buttergelbes Spätsommerlicht, getüpfelt vom Schatten der schwingenden Knoblauchkette.
Eine Party, genau. Sie war auf eine Sonnenuntergangsparty gegangen.
»Bah.« Als sie die Finger um den Vorhang schloss, um die Balance zu halten, riss sie durch ihr Gewicht drei Gardinenringe von der Duschstange. Ihre Schläfen pochten.
Sie erinnerte sich daran, wie sie sich fertig gemacht hatte. Sie hatte die dünnen Armreifen, die immer noch bei jeder Bewegung klimperten, und die dunkelroten Stahlkappenstiefel angezogen, die man ewig schnüren musste und die sie eigenartigerweise nicht mehr trug. Und sie erinnerte sich daran, wie sie ihre blassen blauen Augen schimmernd schwarz geschminkt und den Spiegel geküsst hatte, damit es ihr Glück brachte. Danach war alles etwas verschwommen.
Tana stand mühsam auf und wankte zum Waschbecken, um sich Wasser ins Gesicht zu spritzen. Ihr Make-up war verschmiert, ein Streifen Lippenstift zog sich über ihre Wange und die Mascara hatte sich zu einem großen Fleck ausgebreitet. Das weiße Babydollkleid, das sie sich aus dem Schrank ihrer Mutter geborgt hatte, war am Ärmel gerissen, und ihr schwarzes Haar war so verwuschelt, dass sie mit den Fingern kaum durchkam. Sie sah aus wie ein abgewrackter Pantomime.
Ehrlich gesagt, war sie ziemlich sicher, dass sie im Badezimmer weggetreten war, nachdem sie vor ihrem Exfreund Aidan geflüchtet war. Davor hatte sie sich an einem Trinkspiel namens Dame oder Tiger beteiligt, bei dem man darauf wetten sollte, ob eine geworfene Münze mit Kopf (Dame) oder Zahl (Tiger) aufkam. Wer auf das falsche Pferd gesetzt hatte, musste einen kippen. Danach war Tanzen angesagt gewesen, wobei die Whiskeyflasche kreiste. Aidan hatte Tana bedrängt, mit seiner neuen Freundin rumzumachen, einem Mädchen mit Schmollmund, rotblonden Haaren und einem Hundehalsband, das sie am Hintereingang gefunden hatte. Er hatte gesagt, es wäre wie eine Sonnenfinsternis mit dem Mond am Himmel, die Vermählung alles Hellen und Dunklen. Du meinst eine Sonnenfinsternis mit Mond in deiner Hose, hatte Tana dazu gesagt, aber er hatte auf eine schräge, zähe Weise nicht lockergelassen.
Und da der Whiskey in ihrem Blut sang und Schweiß über ihre Haut leckte, überkam sie ein gefährlich vertrauter Übermut. Es war ihr immer schon schwergefallen, bei Aidan mit seinem bösen Engelsgesicht Nein zu sagen, und was noch schlimmer war, er wusste es.
Mit einem Seufzer öffnete Tana die Badezimmertür – die nicht einmal abgeschlossen war, sodass die ganze Nacht alle hatten hereinkommen können, während sie da drin war, hinter dem Duschvorhang, wie peinlich war das denn? – und ging langsam in den Hausflur. Es roch nach verschüttetem Bier und etwas anderem, nach Metall und süß nach Leichenhalle. Nebenan lief der Fernseher, auf dem Weg in die Küche hörte sie die leise Stimme eines Nachrichtensprechers. Da Lances Eltern nichts gegen seine Sonnenuntergangspartys einzuwenden hatten, lud er fast jedes Wochenende zu sich in das alte Farmhaus ein, schloss die Türen in der Dämmerung und verrammelte sie bis zum Morgen. Sie war schon oft dabei gewesen. Am nächsten Tag gab’s immer ein großes Durcheinander, sie redeten über den vergangenen Abend, tranken Kaffee und brutzelten ein Frühstück aus ein paar Eiern und Toastscheiben.
Dazu gehörten auch lange Schlangen vor den beiden kleinen Badezimmern und lautes Klopfen, wenn einer zu lange brauchte. Alle wollten pinkeln, duschen und sich umziehen. Das hätte sie doch wecken müssen.
Wenn sie trotz allem weitergeschlafen hatte und alle schon zum zweiten Frühstück im Diner waren, würden sie sich über sie lustig machen. Sie würden Witze darüber reißen, dass sie bewusstlos in der Badewanne gelegen hatte, und was sie in dem Badezimmer alles veranstaltet hatten, während sie schlief. Womöglich hatten sie Fotos gemacht. Sie müsste sich jede Menge Blödsinn anhören, und zwar nicht nur einmal, sobald die Schule wieder angefangen hatte. Tana konnte von Glück sagen, dass ihr keiner einen Schnurrbart aufgemalt hatte.
Wäre Pauline auf der Party gewesen, wäre das alles nicht passiert. Wenn sie genug hatten, legten sie sich unter den Esstisch, Arme und Beine übereinander wie Kätzchen im Körbchen, und kein Junge auf der ganzen Welt, nicht einmal Aidan, wagte es, sich den Zorn von Paulines spitzer Zunge zuzuziehen. Doch Pauline war in einem Theater-Camp, und Tana hatte sich so gelangweilt, dass sie allein auf die Party gegangen war.
In der Küche war niemand. Auf den Arbeitsflächen wurden Pfützen aus verschüttetem Schnaps und Orangenlimonade von Chips aufgesogen. Tana wollte sich gerade Kaffee einschenken, als sie auf der anderen Seite des schwarz-weißen Linoleums, direkt an der Tür zum Wohnzimmer, eine Hand entdeckte, die Finger wie im Schlaf gespreizt. Sie entspannte sich. Die anderen waren noch gar nicht wach – das war alles. Vielleicht war sie die Erste – obwohl die Sonne, die durch das Badezimmerfenster geschienen hatte, hoch am Himmel gestanden hatte.
Je länger sie die Hand ansah, umso bewusster wurde ihr, dass sie sonderbar blass war und die Haut an den Fingernägeln bläulich schimmerte. Tanas Herz schlug schneller, ihr Körper reagierte, bevor sie begriff, was los war. Langsam stellte sie die Kaffeekanne wieder ab und zwang sich, vorsichtig Schritt für Schritt über den Küchenboden ins Wohnzimmer zu gehen.
Dann hätte sie beinahe geschrien.
Der braune Teppichboden war hart und schwarz von getrockneten Blutstreifen und sah aus wie ein Bild von Jackson Pollock. Die Wände waren von oben bis unten blutverschmiert, die schmuddelige beigefarbene Tapete war mit Handabdrücken übersät. Und die Leichen. Dutzende von Leichen. Menschen, die sie seit dem Kindergarten täglich getroffen hatte, Menschen, mit denen sie Fangen gespielt hatte, derentwegen sie geweint, die sie geküsst hatte, lagen seltsam verdreht da, ihre Körper bleich und kalt, ihre starrenden Augen wie die von Puppen in einem Schaufenster.
Die Hand neben Tanas Fuß gehörte Imogen, einem hübschen, kräftigen Mädchen mit pinkfarbenem Haar, das im nächsten Jahr auf die Kunsthochschule gehen wollte. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, und ihr Sommerkleid mit dem blauen Ankermuster war hochgerutscht, sodass man ihre Oberschenkel sehen konnte. Anscheinend hatte es sie erwischt, als sie wegkriechen wollte, denn sie hatte einen Arm ausgestreckt und krallte sich mit der anderen Hand am Teppichboden fest.
Ottas, Ilainas und Jons Leichen lagen übereinander. Sie waren gerade erst aus dem Sommerlager zurückgekehrt und hatten kurz vor Sonnenuntergang am Anfang der Party im Hof noch Saltos vorgeführt, während die Mücken im warmen Wind flogen. Jetzt klebte verkrustetes Blut wie Rost an ihren Sachen, färbte ihr Haar und sprenkelte ihre Haut wie Sommersprossen. Ihre Augen standen offen, die Pupillen waren milchig.
Tana fand Lance auf einem Sofa, die Arme über die Schultern eines Mädchens auf seiner linken und eines Jungen auf seiner rechten Seite gelegt – alle drei Hälse waren zerbissen und zerfetzt. Ihre Bierflaschen standen neben ihnen, als wäre die Party noch im Gange. Als würden sie gleich mit ihren weißblauen Lippen Hi, Tana sagen.
Tana war schwindelig. Der Raum drehte sich. Sie sank auf den blutgetränkten Teppichboden, während das Pochen in ihrem Kopf immer lauter wurde. Im Fernsehen sprühte jemand orangefarbenes Putzmittel auf eine Arbeitsfläche aus Granit, während ein grinsendes Kind die Marmelade vom Brot lutschte.
Plötzlich merkte Tana, dass ein Fenster offen stand, weil der Vorhang flatterte. Wahrscheinlich war es auf der Party zu warm geworden, alle waren in dem kleinen Haus ins Schwitzen geraten und sehnten sich nach der kühlen Brise direkt vor ihrer Nase. Und als das Fenster erst mal offen war, hatte keiner daran gedacht, es wieder zuzumachen. Schließlich gab es ja noch den Knoblauch und das Weihwasser auf den Simsen.
So etwas kannte man aus Europa, etwa aus Belgien, wo es auf den Straßen nur so von Vampiren wimmelte und die Geschäfte erst nach Einbruch der Dunkelheit öffneten. Aber hier doch nicht. Nicht in Tanas Stadt, wo es seit über fünf Jahren keinen Überfall mehr gegeben hatte.
Und doch war es passiert. Jemand hatte nachts ein Fenster aufgelassen und ein Vampir war hereingekrochen.
Sie sollte ihr Handy holen und anrufen – irgendwen. Auf keinen Fall ihren Vater; der konnte damit nicht umgehen. Die Polizei? Oder einen Vampirjäger, zum Beispiel Hemlok, diesen riesigen Kahlkopf aus dem Fernsehen, einen ehemaligen Ringer, der immer ganz in Leder auftrat. Er wüsste, was zu tun wäre. Tanas kleine Schwester hatte ein Poster von Hemlok in ihrem Schließfach, direkt neben Bildern des goldhaarigen Lucien, ihrem Lieblingsvampir aus Coldtown. Pearl fände es total spannend, wenn Hemlok käme; dann würde sie endlich ein Autogramm von ihm ergattern.
Tana musste kichern, das war voll daneben. Sie schlug die Hände vor den Mund, um das Geräusch zu ersticken. Es war nicht richtig, vor toten Menschen zu lachen. Als ob man bei einer Beerdigung lachte.
Die starren Augen ihrer Freunde beobachteten sie.
Der Nachrichtensprecher im Fernsehen sagte diverse Schauer für die Woche voraus. Der Nasdaq war gesunken.
Als Tana noch einmal daran dachte, dass Pauline nicht zur Party gekommen war, war sie so leidenschaftlich, so egoistisch dankbar, weil Pauline lebte, obwohl alle anderen tot waren, dass sie sich nicht einmal zu einem schlechten Gewissen aufraffen konnte.
Irgendwo weit weg klingelte ein Handy in einem der Gästezimmer. Der Klingelton war ein blecherner Remix von »Tainted Love«. Es hörte wieder auf. Dann gingen beinahe gleichzeitig zwei Handys in ihrer unmittelbaren Nähe los und vereinten sich zu einem schrägen Refrain.
Nach den Nachrichten kam eine Show über drei Männer, die mit einem Witze reißenden Schädel unter einem Dach lebten. Jedes Mal wenn der Schädel sprach, wurde die Lachkonserve eingespielt. Tana wusste nicht genau, ob es die Show wirklich gab oder ob sie sich das einbildete. Sie verlor die Zeit aus dem Auge.
Dann schimpfte sie mit sich: Sie sollte gefälligst aufstehen und in das Gästezimmer gehen, in dem alle die Jacken aufs Bett geworfen hatten, und so lange suchen, bis sie ihre Handtasche, ihre Stiefel und ihren Autoschlüssel gefunden hatte. Da war auch ihr Handy. Ohne konnte sie niemanden anrufen.
Sie musste das sofort tun – Schluss mit Rumsitzen.
Ihr war klar, dass andere Handys in ihrer unmittelbaren Nähe waren, in der Hosentasche einer Leiche oder zwischen kalter toter Haut und einem Spitzen-BH. Doch die Vorstellung, die Leichen zu durchsuchen, war unerträglich.
Steh auf, befahl sie sich selbst.
Sie kam auf die Beine und ging im Slalom zur Tür, wobei sie versuchte, das Knirschen des Teppichbodens unter ihren nackten Füßen zu ignorieren und den Verwesungsgestank im Esszimmer zu verdrängen. Dann fiel ihr etwas ein, das sie in der Zehnten in Sozialwissenschaften gelernt hatte – der Lehrer hatte ihnen von der berühmten Razzia in Corpus Christi erzählt, als die Regierung von Texas versucht hatte, die staatliche Coldtown zu schließen und am helllichten Tag mit Panzern angerückt war. Alle Menschen in der Stadt, die möglicherweise infiziert waren, wurden erschossen. Sogar die Tochter des Bürgermeisters wurde getötet. Gleichzeitig wurden viele schlafende Vampire umgebracht, aus ihrem Versteck gezerrt, geköpft oder dem Sonnenlicht ausgesetzt. Als die Nacht hereinbrach, gelang es den übrig gebliebenen Vampiren, die Wachposten am Stadttor zu töten und das Weite zu suchen. Im Zuge ihrer Flucht hinterließen sie zahllose ausgesaugte Infizierte und noch heute gaben die Vampire von Corpus Christi ein beliebtes Ziel für Kopfgeldjäger im Fernsehen ab.
Für diese Unterrichtsreihe musste jeder Schüler ein anderes Projekt übernehmen. Tana hatte ein Diorama aus einem Schuhkarton und viel roter Plakatfarbe gebastelt – als Präsentationsfläche für einen Zeitungsartikel, den sie ausgeschnitten hatte. Es war ein Bericht über drei Vampire, die aus Corpus Christi geflohen und irgendwo eingebrochen waren, alle töteten und dann zwischen den Leichen auf die Abenddämmerung warteten.
Da fiel ihr ein, dass eventuell auch in diesem Haus noch ein Vampir sein könnte, der Vampir, der all ihre Freunde abgeschlachtet hatte. Und der sie irgendwie übersehen hatte, zu sehr mit Blut und Gemetzel beschäftigt, um auch noch alle Türen zu Flurschränken und Badezimmern aufzureißen – einer, der den Duschvorhang nicht zur Seite geschoben hatte. Doch jetzt würde er auch sie ermorden, wenn er hörte, wie sie sich bewegte.
Ihr Herz raste, es klopfte fest an ihren Brustkorb, und jeder Schlag fühlte sich an, als würde sie jemand auf die Brust boxen. Dumm, dumm, dumm.
Tana war schwindelig, sie atmete flach und hastig. Sie wusste, dass sie sich eigentlich wieder setzen und den Kopf zwischen die Beine legen sollte – was man so tun sollte, wenn man hyperventilierte –, doch wenn sie sich jetzt setzte, stand sie vielleicht nie wieder auf. Stattdessen zwang sie sich, tief einzuatmen und die Luft so langsam wie möglich aus ihrer Lunge wieder herauszulassen.
Am liebsten hätte sie die Haustür aufgerissen und wäre über den Rasen gerannt, um bei den Nachbarn so lange an die Tür zu hämmern, bis man sie einließ.
Doch ohne ihre Stiefel, ihr Handy und den Autoschlüssel würde sie große Probleme bekommen, wenn niemand zu Hause war. Das Farmhaus von Lances Eltern lag auf dem Land und hinter dem Haus begann direkt ein Naturschutzgebiet. Es gab kaum Nachbarn in der Nähe. Und Tana wusste genau, dass keine Macht der Erde sie dazu bringen konnte, dieses Haus noch einmal zu betreten, wenn sie erst aus der Tür war.
Sie war hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, wegzulaufen, und dem Bedürfnis, sich wie ein Mistkäfer zusammenzurollen, die Augen zu schließen, die Arme über den Kopf zu legen und »Wenn ich die Ungeheuer nicht sehen kann, können sie mich auch nicht sehen« zu spielen. Doch weder der eine noch der andere Impuls würde sie retten. Sie musste nachdenken.
Das Sonnenlicht warf durch die Blätter an den Bäumen helle Sprenkel ins Wohnzimmer – Spätnachmittagssonne, aber immerhin Sonne. Daran klammerte sie sich. Selbst wenn im Keller eine Horde Vampire hauste, würden sie nicht – könnten sie nicht – vor Einbruch der Nacht herauskommen. Es war das Beste, sich an ihren Plan zu halten: ins Gästezimmer zu gehen und ihre Stiefel, das Handy und den Autoschlüssel zu holen. Dann das Haus zu verlassen und so total wahnsinnig und grauenhaft auszuflippen wie noch nie. Sie würde sich erlauben, zu brüllen oder in Ohnmacht zu fallen, Hauptsache, sie tat es in ihrem Auto, weit weg von hier, mit hochgedrehten Fenstern und abgeschlossenen Türen.
Vorsichtig, ganz vorsichtig streifte sie jeden glänzenden Armreifen einzeln ab und legte sie auf den Teppich, damit sie nicht klimperten, wenn sie gleich zum Gästezimmer lief.
Als sie diesmal durchs Zimmer ging, hörte sie jede knarrende Diele, jeden ihrer abgerissenen Atemzüge. Sie witterte in allen Schatten Mäuler mit Reißzähnen; sie witterte kalte Hände, die durch das Linoleum in der Küche brachen und mit langen Fingernägeln ihren Knöchel aufkratzten, wenn sie in die Dunkelheit hinuntergezogen würde. Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, bis sie die Tür des leeren Gästezimmers erreicht hatte und die Klinke drückte.
Obwohl sie sich fest vorgenommen hatte, sich zusammenzureißen, schnappte sie hörbar nach Luft.
Aidan war ans Bett gefesselt. Handgelenke und Knöchel waren mit Gummiseilen an die Bettpfosten gebunden, und der Mund mit silbernem Isolierband zugeklebt, aber er lebte. Sie konnte ihn erst nur anstarren, weil der Schock nun in einer gewaltigen Welle über sie hereinbrach. Jemand hatte Müllbeutel über die Fenster geklebt und die Sonne ausgeschlossen. Und neben dem Bett, geknebelt und in Ketten, lag zwischen den Jacken, die jemand auf den Boden geworfen hatte, noch ein Junge, mit Haaren so schwarz wie verschüttete Tinte. Er blickte zu ihr hoch. Seine Augen strahlten wie Rubine und ebenso rot.
ZWEITES KAPITEL
Wir kämpfen deshalb alle gegen unsere Heilung an, weil es der Tod ist, der alle Krankheiten heilt.
– Sir Thomas Browne
Als Tana sechs gewesen war, waren Vampire Muppets, die gerne zählten, oder in einem Cartoon die Bösen in schwarzen, rot gesäumten Mänteln. Die Kinder verkleideten sich an Halloween als Vampire, trugen Kunststoffzähne, die schlecht über ihre eigenen passten, und schmierten sich süßen Sirup ins Gesicht, der wie Rinnsale kirschroten Blutes aussehen sollte.
Mit Caspar Morales wurde alles anders. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts waren Vampire in zahlreichen Büchern und Filmen romantisch verklärt worden, und es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein Vampir sich selbst in romantischem Licht sah.
Der verrückte, romantische Caspar beschloss, im Gegensatz zu den Vampiren aus alter Zeit, die sich über Jahrzehnte hinweg hatten verstecken müssen, seine Opfer nicht zu töten. Er wollte sie verführen, ein bisschen Blut saugen und dann weiterziehen, von Stadt zu Stadt. Als die alten Vampire ihn endlich eingeholt und in Stücke gerissen hatten, hatte er längst Hunderte von Menschen angesteckt. Und diese neuen Vampire, die gar keine Ahnung hatten, wie sie es hätten verhindern sollen, infizierten Tausende andere.
Der erste Ausbruch ereignete sich an Caspars Geburtsort, der Kleinstadt Springfield, Massachusetts, als Tana ungefähr sieben war. Da Springfield nur fünfzig Meilen entfernt lag, kam es zuerst in den Lokalnachrichten, bevor es landesweit bekannt wurde. Zunächst dachte man an einen Journalistenstreich. Doch dann kam es in Chicago, San Francisco und schließlich in Las Vegas zu weiteren Ausbrüchen. Ein Mädchen, das auf frischer Tat ertappt worden war, als es einen Croupier beißen wollte, ging in Flammen auf, als die Polizisten es aus dem Casino zum Streifenwagen bringen wollten. Ein Geschäftsmann wurde in seinem Penthouse-Versteck aufgespürt, umgeben von abgenagten Leichen. In einer nebligen Nacht stand ein kleines Mädchen am Fisherman’s Wharf, streckte allen Erwachsenen die Arme entgegen, die helfen wollten, ihren Vater zu finden, und rammte ihnen dann die Zähne in den Hals. Eine Varietétänzerin integrierte blutige Spielchen in ihre Show und ließ die Besucher Einverständniserklärungen unterschreiben. Wenn sie das Theater verließen, gingen sie hungrig von dannen.
Die Armee errichtete Barrikaden um die Stadtteile, in denen sich die Menschen ansteckten. So entstanden die ersten Coldtowns.
Vampirismus ist ein amerikanisches Problem, erklärte die BBC. Doch der nächste Ausbruch fand in Hongkong statt, dann in Yokohama, dann in Marseille, in Brecht und schließlich in Liverpool. Danach breitete der Vampirismus sich wie ein Flächenbrand in Europa aus.
Mit zehn Jahren sah Tana ihrer Mutter zu, die sich an ihrem Schminktisch für die Party eines Kunsthändlers schön machte, der ihrer Galerie einige Werke überlassen wollte. Sie trug einen Bleistiftrock mit einem smaragdfarbenen Seidentop und hatte ihr kurzes schwarzes Haar straff zurückgegelt. Zum Schluss legte sie noch ihre Perlenohrringe an.
»Hast du keine Angst vor Vampiren?«, hatte Tana gefragt und sich an die Beine ihrer Mutter geschmiegt, das feine Kratzen der Strumpfhose an ihrer Wange gespürt und das Parfüm ihrer Mutter geschnuppert. Normalerweise waren beide Eltern zu Hause, bevor es dunkel wurde.
Tanas Mutter hatte nur gelacht, doch sie kam krank von der Party zurück. Kalt, hieß es, was sich erst ganz harmlos anhörte, als hätte man sich erkältet. Doch das war eine andere Kälte, bei der die Körpertemperatur sank, die Sinne geschärft wurden und die Gier nach Blut ins Unermessliche wuchs.
Wenn jemand, der Kalt geworden war, Menschenblut trank, mutierte die Infektion. Sie tötete den Wirt und ließ ihn wiederauferstehen, Kälter als je zuvor. Durch und durch Kalt, bis in alle Ewigkeit.
Wenn man den Zentren für Krankheitskontrolle und Vorbeugung Glauben schenken durfte, gab es nur ein Heilmittel. Man musste das Opfer davon abhalten, Menschenblut zu trinken, bis die Infektion aus dem System geschwemmt war, was bis zu achtundachtzig Tage dauern konnte. Keine Klinik der Welt bot einen solchen Service an. Anfangs hatte man Kalte Patienten in den Krankenhäusern mit Betäubungsmitteln vollgepumpt, bis eine sehr vermögende Frau mittleren Alters aus ihrem künstlichen Koma erwachte und einen Arzt angriff. Es gelang hin und wieder, die Blutgelüste mit Schnaps oder Drogen in Schach zu halten, doch bei vielen Opfern half auch das nicht. Wenn jedoch die Polizei herausfand, dass jemand potenziell infiziert war, wurde diese Person unter Quarantäne gestellt und in eine Coldtown verbannt. Tanas Mutter hatte schreckliche Angst. Deshalb hatte sie sich nach zwei Tagen, in denen das Zittern richtig schlimm geworden und sie vor Hunger die Wände hochgegangen war, in dem einzigen Teil des Hauses einschließen lassen, aus dem sie nicht herauskommen konnte.
Tana erinnerte sich an die Schreie, die nach einer Woche aus dem Keller hochgellten, Schreie, den ganzen Tag, während ihr Vater arbeiten war, und dann die ganze Nacht, sodass ihr Vater den Fernseher so laut stellte, dass man nichts anderes mehr hörte, und sich in den Schlaf trank. Nachmittags nach der Schule rief Tanas Mutter zwischen ihren Schreianfällen ihren Namen und flehte sie an, sie herauszulassen. Sie versprach ihr nichts zu tun. Sie behauptete, es ginge ihr besser, sie wäre nicht mehr krank.
Bitte, Tana. Du weißt, ich würde dir nie etwas antun, mein hübsches kleines Mädchen. Ich liebe dich über alles in der Welt, mehr als mein Leben, das weißt du. Dein Vater versteht nicht, dass es mir besser geht. Er glaubt mir nicht und ich fürchte mich vor ihm, Tana. Er wird mich hier gefangen halten bis ans Ende meiner Tage. Der lässt mich hier nie wieder raus. Er wollte immer die Kontrolle haben, meine Unabhängigkeit hat ihm noch nie gefallen. Bitte, Tana, bitte. Es ist kalt hier unten, und es kriecht und krabbelt über mich drüber, wenn es dunkel ist, und du weißt, wie sehr ich mich vor Spinnen fürchte. Du bist mein Kind, mein süßes Kind, mein Liebling, und du musst mir helfen. Du hast Angst, aber wenn du mich rauslässt, bleiben wir für immer zusammen, Tana, du und ich und Pearl. Wir gehen in den Park und kaufen uns ein Eis und füttern die Eichhörnchen. Wir graben Würmer im Garten aus. Dann sind wir wieder glücklich. Du holst jetzt den Schlüssel, ja? Hol den Schlüssel. Bitte hol den Schlüssel. Bitte, Tana, bitte. Hol den Schlüssel. Hol den Schlüssel.
Und Tana saß dann an der Kellertür, steckte die Finger in die Ohren und heulte Rotz und Wasser. Sie weinte und weinte und weinte. Und die kleine Pearl kam angewackelt, auch sie weinte. Sie weinten, während sie ihr Müsli aßen, weinten, während sie Zeichentrickfilme sahen, und weinten sich in den Schlaf, dicht aneinandergeschmiegt in Tanas schmalem Bett. Mach was, sie soll aufhören, sagte Pearl, aber das konnte Tana nicht.
Und wenn ihr Vater abends die Handschuhe aus Stahlgeflecht anzog, wie ein Küchenchef zum Austernöffnen, und schwere Arbeiterstiefel, um ihrer Mutter etwas zu essen zu bringen, weinten sie besonders herzzerreißend. Sie hatten fürchterliche Angst, er würde sich ebenfalls anstecken, obwohl er ihnen erklärte, dass nur ein Vampir jemanden infizieren konnte und dass ihre Mutter immer noch ein Mensch war und ihre Krankheit deshalb nicht weitergeben konnte. Er erklärte, dass ihr Verlangen nach Blut nichts anderes war, als wenn jemand mit Pikazismus am liebsten Kreide oder Lehm oder Metallfeilen essen würde. Er erklärte, alles würde wieder gut werden, vorausgesetzt, dass Mom nicht bekam, was sie wollte, vorausgesetzt, dass Tana und Pearl sich ganz normal verhielten und niemandem erzählten, was sie hatte, weder den Lehrern noch ihren Freunden, und auch nicht ihren Großeltern, die das nicht verstehen würden.
Er sprach ruhig und überzeugend. Dann ging er ins Nebenzimmer und kippte eine halbe Flasche Jack Daniels. Und das Schreien hörte nicht auf.
Nach vierunddreißig Tagen konnte Tana es nicht mehr ertragen und versprach ihrer Mutter, sie freizulassen. Nach siebenunddreißig Tagen hatte sie es geschafft, den Schlüsselbund aus der Hosentasche der braunen Dockers ihres Vaters zu stehlen. Nachdem Dad zur Arbeit gegangen war, löste sie die Riegel, einen nach dem anderen.
Als sie die knarrende Holztreppe hinunterging, stieg ihr vom Keller der Geruch von Schimmel und Mineralien in die Nase. Ihre Mutter hatte sofort aufgehört zu schreien, als sie die Kellertür aufgemacht hatte. Es war sehr still, nur Tanas Schuhe quietschten auf dem Holz. Auf der letzten Stufe zögerte sie.
Dann wurde sie niedergeschlagen.
Tana wusste noch, wie es sich angefühlt hatte, dieses endlose Brennen von Zähnen auf ihrer Haut. Obwohl sie noch nicht vollständig ausgebildet waren, hatten die Fangzähne sich wie Zwillingsdorne oder die Zangen einer Riesenspinne tief in ihr Fleisch gebohrt. Sie hatte den weichen Druck eines Mundes gespürt, und es hatte wehgetan, und dann war da noch dieses Gefühl, als würde alles schnell aus ihr herausfließen.
Sie hatte sich gewehrt, hatte geschrien und geweint, mit ihren plumpen Kinderbeinen ausgetreten und mit den rosa Kindernägeln gekratzt. Das hatte nur dazu geführt, dass ihre Mutter sie noch fester an sich riss und das Fleisch an der Innenseite ihres Arms aufgeplatzt war. Das Blut spritzte wie aus einer Wasserpistole.
Seitdem waren sieben Jahre vergangen. Die Ärzte hatten ihrem Vater versichert, die Erinnerung würde verblassen wie die große wulstige Narbe an ihrem Arm, doch beides hatte sich nicht bewahrheitet.
DRITTES KAPITEL
Fällt im Tod die Blüte ab, möge die Frucht wachsen.
– Henry Ward Beecher
Aidan blickte sie entsetzt aus weit aufgerissenen Augen an. Er stemmte sich gegen die Gummiseile und versuchte, durch das Klebeband zu sprechen. Tana konnte die Worte nicht verstehen, aber durch seinen Tonfall forderte er sie deutlich genug auf, ihn loszubinden, und flehte sie an, ihn nicht allein zu lassen. Wahrscheinlich bereute er jetzt, dass er ihren Geburtstag vergessen und sie über Twitter verlassen hatte, und bedauerte mit einiger Sicherheit alles, was er am Vorabend gesagt hatte. Beinahe hätte Tana wieder gekichert. Hysterie blubberte hoch, doch sie schluckte sie herunter.
Sie schob einen Fingernagel unter den Rand des Klebebands und begann, es möglichst schonend abzuziehen. Aidan zuckte zusammen und blinzelte schnell hintereinander mit seinen karamellfarbenen Augen. Als auf der anderen Seite des Zimmers Ketten rasselten, hielt sie inne und hob den Blick.
Es war der Vampirjunge. Er zog an seinem Halsband, schüttelte den Kopf und starrte sie eindringlich an, als wollte er ihr etwas Wichtiges mitteilen. Lebendig hatte er offensichtlich gut ausgesehen, denn er war immer noch attraktiv, obwohl seine Blässe und ihr Wissen, was er war, ihn als Monster auswiesen. Sein Mund war weich, die Wangenknochen spitz wie Messerklingen und sein Kiefer geschwungen – all das verlieh ihm eine schräge Schönheit. Sein schwarzes Haar war ein irrer Wust aus schmutzigen Locken. Als sie ihn anstarrte, trat er an einen Bettpfosten, sodass das Gestell ächzte, und schüttelte wieder den Kopf.
Na klar, als ob sie Aidan hier sterben ließe, nur weil der hübsche Vampir seinen Snack behalten wollte.
»Lass das«, sagte sie vor Angst lauter als beabsichtigt. Es wäre das Beste, wenn sie über das Bett stieg und die Müllsäcke von den Fenstern riss. Dann würde er in der Sonne verbrennen und wie ein sterbender Stern schwarz werden und zu glühenden Scheiten zersplittern. Doch sie hatte so etwas noch nie mit eigenen Augen gesehen, nur auf den YouTube-Videos, wie alle anderen auch, und bei der Vorstellung, etwas zu töten, während es gefesselt und geknebelt war, und dabei auch noch zuzusehen, wurde ihr übel. Sie glaubte nicht, dass sie das schaffen würde.
Doof, doof, doof, sagte ihr Herz.
Tana wandte sich wieder Aidan zu. Ihre Hände zitterten. »Ganz ruhig bleiben, verstanden?«
Als er nickte, zog sie mit Schwung das Klebeband ab.
»Aua«, sagte Aidan. Dann warf er sich mit gebleckten Zähnen auf sie.
Tana hatte sich gerade an dem Seil an seinem Handgelenk zu schaffen gemacht. Seine unvermutete Attacke überrumpelte sie so, dass sie rückwärts taumelte, das Gleichgewicht verlor und mit einem Aufschrei auf den Jackenhaufen fiel. Seine stumpfen Fangzähne hatten ihren Arm gestreift, nah an der Narbe.
Aidan wollte sie beißen.
Aidan war infiziert.
Der Lärm, den sie gemacht hatte, würde ein wahres Nest schlafender Vampire wecken.
»Arschloch«, sagte sie. Nur ihre Wut hielt sie davon ab, in Panik zu verfallen. Sie stand auf und boxte Aidan, so fest sie konnte, in die Schulter.
Er zischte vor Schmerzen und lächelte dann sein schiefes, verlegenes Lächeln, das er immer aufsetzte, wenn er bei irgendwas erwischt wurde. »Sorry. Ich … ich habe es nicht so gemeint. Ich … also, ich liege hier nur schon seit Stunden und kann an nichts anderes denken als an Blut.«
Sie erschauerte. Sein glatter Hals zeigte keine Bisswunden, doch es gab genug andere Stellen, wo man gebissen werden konnte.
Bitte, Tana, bitte.
Sie hatte Aidan nie von ihrer Mutter erzählt, aber er wusste Bescheid. In der Schule wussten es alle. Außerdem hatte er die Narbe gesehen, eine Schweinerei aus wulstiger, glänzender Haut, bleich mit einem roten Schimmer an den Rändern. Sie hatte ihm erzählt, dass es sich manchmal anfühlte, als stecke ein Eissplitter in dem darunterliegenden Knochen.
»Wenn du mir nur ein bisschen gibst, dann …«, setzte Aidan an.
»Dann stirbst du, Blödmann. Dann würdest du ein Vampir werden.« Obwohl sie ihn am liebsten noch mal geschlagen hätte, bückte sie sich und kramte in den Jacken, bis sie ihre Handtasche mit dem Autoschlüssel gefunden hatte. »Wenn wir hier raus sind, darfst du um Gnade betteln wie noch nie in deinem Leben.«
Unter Kettengerassel trat der Vampirjunge noch mal gegen das Bett. Sie warf ihm einen Blick zu. Er sah von ihr zur Tür und zurück. Dann riss er voller Ungeduld die Augen auf.
Diesmal verstand sie ihn. Da kam etwas. Etwas, das wahrscheinlich gehört hatte, wie sie hingefallen war. Sie watete durch die verstreuten Jacken zur Kommode und schob sie vor die Tür, damit keiner hereinkommen konnte. Kalter Schweiß bildete sich zwischen ihren Schulterblättern. Ihre Beine waren bleischwer, und sie wusste nicht, wie lange sie noch durchhielt, ehe der Wunsch, sich klein zu machen und zu verkriechen, die Oberhand gewann.
Nach einem Blick auf den rotäugigen Jungen überlegte sie, ob er vielleicht vor wenigen Stunden noch zu den Feiernden gehört und Bier getrunken, getanzt und gelacht hatte. Sie erinnerte sich nicht daran, ihn gesehen zu haben, doch das hatte nichts zu sagen. Es waren einige auf der Party gewesen, die sie nicht kannte und die sie sich auch nicht gemerkt hatte, Teenager aus Conway oder Meredith. Gestern war er vielleicht noch ein Mensch gewesen. Andererseits konnte er auch seit über hundert Jahren kein Mensch mehr sein. Was spielte das für eine Rolle – jetzt war er auf jeden Fall ein Ungeheuer.
Tana nahm einen Hockeypokal von der Kommode. Er wog schwer in ihrer Hand, als sie durchs Zimmer dorthin ging, wo der Junge angekettet war. Ihr Herz schlug wie ein Fensterladen bei Gewitter. »Ich befreie dich jetzt von dem Knebel. Aber wenn du versuchst, mich zu beißen oder anzufassen, haue ich dir den hier über den Schädel, so fest und so oft ich kann, kapiert?«
Er nickte, die roten Augen ruhig.
Seine wachsweiße Haut fühlte sich kalt an, als sie seinen Hals streifte, um den Knoten des Knebels zu finden. So nah war sie einem Vampir noch nie gekommen und hatte noch nie darüber nachgedacht, wie es sein würde, jemandem so nah zu sein, der nicht atmete, der starr war wie eine Statue. Seine Brust hob sich nicht, sie senkte sich nicht. Dagegen zitterten ihre Hände wie Espenlaub.
Dann glaubte sie plötzlich, irgendwo im Haus etwas gehört zu haben, ein Knarren, als würde eine Tür geöffnet. Tana konzentrierte sich darauf, den Knoten schneller zu lösen, auch wenn es mit einer Hand schwierig war. Sie sehnte sich verzweifelt nach einem Messer und wünschte, sie wäre so schlau gewesen, aus der Küche eins mitzunehmen. Sie wünschte, sie hätte etwas Besseres als einen Silberpokal mit goldener Schrift.
»Tut mir leid wegen eben«, meldete sich Aidan vom Bett. »Ich bin total fertig, verstehst du das nicht? Aber ich tu’s nie wieder – ich würde dir nie wehtun.«
»Als ob du gut darin wärst, einer Versuchung zu widerstehen«, sagte Tana.
Er lachte leise, bis das Lachen in Husten überging. »Ich bin eher der Typ, der sich ihr in die Arme wirft, stimmt schon. Aber ganz ehrlich, mir hat das auch Angst gemacht und ich werde so etwas nicht wieder tun.«
Ständig ließen Infizierte alle Schranken fallen und griffen ihre Familien an. Solche Geschichten kamen nicht einmal mehr in die Schlagzeilen.
Doch die Experten bestanden darauf, dass nicht alle Vampire Monster waren. Rein theoretisch sind sie dieselben Menschen wie zuvor, vorausgesetzt, ihr Hunger ist gestillt. Sie haben immer noch dieselben Erinnerungen und sind weiterhin fähig zu moralischen Entscheidungen.
Theoretisch.
Endlich löste sich der Knoten in Tanas Fingern. Sie krabbelte schnell rückwärts, doch der Junge mit den roten Augen spuckte nur den Stoffknebel aus.
»Durchs Fenster«, sagte er mit einem leichten Akzent, den sie nicht deuten konnte – aber daraus schloss sie, dass er wahrscheinlich doch nicht aus der Gegend war und sich gestern angesteckt hatte. »Mach. Sie sind schnell wie Schatten. Wenn sie durch die Tür kommen, ist es aus.«
»Aber du …«
»Leg eine Decke auf mich – oder besser zwei –, dann bin ich gut verpackt, und die Sonne kann mir nichts anhaben.« Obwohl er nur wenig älter aussah als Aidan, strahlte seine ruhige Stimme viel Erfahrung aus. Tana war richtig erleichtert. Wenigstens einer, der wusste, was getan werden sollte, auch wenn sie es nicht war. Auch wenn derjenige kein Mensch war.
Da sie für ihn nicht mehr in Reichweite war, stellte sie die Hockeytrophäe wieder auf die Kommode, wohin sie gehörte, wo Lances Eltern sie wiederfinden konnten und – Tana brach hier ab, weil sie sich auf das unmögliche Hier und Jetzt konzentrieren musste. »Wieso bist du hier angekettet?«, fragte sie den Vampir.
»Ich bin in schlechte Gesellschaft geraten«, sagte er, ohne eine Miene zu verziehen. Einen Augenblick lang wusste sie nicht, ob er sich lustig machte. Die Vorstellung, er könne Humor haben, verstörte sie.
»Pass auf«, rief Aidan vom Bett. »Du weißt nicht, wozu er fähig ist.«
»Aber wir wissen alle, wozu du fähig wärst, oder?«, konterte der Vampir aalglatt.
Draußen näherte sich die Sonne sicher bereits dem Waldrand. Sie hatte keine Zeit, zu überlegen, was am besten war.
Sie musste ihr Glück versuchen.
Auf dem Bett, unter Aidan, lag eine Tagesdecke. Tana zerrte daran. »Ich gehe zum Auto«, erklärte sie allen beiden. »Ich schiebe das Fenster hoch und dann steigt ihr zusammen in den Kofferraum. Ich habe einen Montierhebel, hoffentlich kann ich damit die Kette knacken.«
Der Vampir sah sie verwirrt an. Dann sah er zur Tür und warf ihr einen verschlagenen Blick zu. »Wenn du mich befreist, kann ich sie aufhalten.«
Tana schüttelte den Kopf. Vampire waren stärker als Menschen, doch mit Eisen konnte man sie in Schach halten. »Ich glaube, es ist für uns alle das Beste, wenn du weiter in Ketten bleibst, nur eben nicht hier.«
»Bist du sicher?«, fragte Aidan. »Gavriel ist immer noch ein Vampir.«
»Er hat mich vor dir und vor ihnen gewarnt. Das hätte er nicht tun müssen. Ich werde mich kaum dadurch revanchieren, dass ich …« Sie zögerte und runzelte die Stirn. »Wie hast du ihn genannt?«
»So heißt er.« Aidan seufzte. »Gavriel. Die anderen Vampire haben das gesagt – als sie mich ans Bett gefesselt haben.«
»Oh.« Mit einem letzten Ruck riss sie die Decke los und warf sie über Gavriel.
Ihr Herz raste, doch nicht nur vor Angst, sondern auch vor Aufregung und Adrenalin. Sie würde sie retten. Das musste sie schaffen.
Auf einmal kratzte es an der Tür und der Knauf drehte sich langsam. Kreischend sprang Tana aufs Bett und über Aidan hinweg zum Fenster. Mit einem Ruck riss sie den Müllbeutel ab und ließ das goldene Licht des frühen Abends herein.
Gavriel atmete vor Schmerz scharf ein, schlang die Decke enger und versuchte, möglichst viel von seinem Körper hinter der Kommode in Sicherheit zu bringen.
»Noch volle Sonne!«, rief er zwischen zwei hastigen Atemzügen. »Kommt lieber nicht rein!«
Vor der Tür wurde es still.
»Du kannst mich nicht hierlassen«, sagte Aidan, als Tana das alte Fenster des Farmhauses hochschob, das über die Jahre vom Regen aufgequollen war. Es hakte.
Ihre Muskeln brannten, als sie noch einmal mit voller Kraft dagegen drückte. Laut ächzend ruckelte die Fensterscheibe ein Stück nach oben. Das musste reichen, um drunter durchzukriechen, hoffte sie. Der kühle süße Wind wehte den Duft von Geißblatt und frisch gemähtem Gras ins Zimmer.
Nach einem Blick auf die Tagesdecke inmitten der Jacken und Taschen, unter der Gavriel sich versteckte, holte sie tief Luft. »Ich lasse dich nicht hier«, sagte sie zu Aidan. »Versprochen.«
Heute sollte niemand mehr umgebracht werden, wenn sie es verhindern konnte. Erst recht niemand, den sie einmal geliebt hatte, auch wenn er ein Arschloch war. Auch kein toter Junge mit verdammt guten Ratschlägen. Und sie selbst hoffentlich auch nicht.
Sie beugte sich vor und steckte den Kopf unter den Fensterrahmen, ohne die verrotteten grauen Holzsplitter und die abblätternde Farbe zu beachten. Sie warf ihre Handtasche nach draußen. Dann rutschte sie langsam vorwärts, schob ihre Brüste über das Sims und verkantete ihre Hüften, sodass sie sich an der Außenwand weiter nach unten ziehen konnte, bis sie kopfüber ins Gebüsch fiel. Der Fall war heftig und schmerzhaft, das Licht zu grell und das Gras zu grün. Es dauerte, bis sie sich auf den Rücken drehen und tief Luft holen konnte.
Sie war in Sicherheit. Wolken wehten über den Himmel, auseinandergezogen wie Zuckerwatte. Sie schoben sich zu Bergen zusammen, zu eingemauerten Städten, formten sich zu aufgerissenen Mäulern mit spitzen Zahnreihen, zu Armen, die sich vom Himmel nach unten ausstreckten, zu Flammen und …
Ein plötzlicher Windstoß fuhr in die Äste, die zitternd einige leuchtend grüne Blätter abwarfen. An Tanas Schulter summte eine Fliege und erinnerte sie an die Leichen im Haus, auf denen Fliegen landeten, an die schillernden Maden, die brüteten, schlüpften, sich ohne Ende vermehrten und wie eine Entzündung ausbreiten würden, bis schwarze Fliegen den Raum in einen wogenden Teppich verwandelten. Bis man nichts mehr hören konnte außer dem Flirren ihrer durchsichtigen Flügel.
Tana zitterte jetzt wie die Äste eben, ihr ganzer Körper bebte, und eine Woge der Übelkeit überwältigte sie mit solcher Wucht, dass sie sich gerade noch umdrehen konnte, bevor sie sich im Gras erbrach.
Du hast gesagt, du dürftest ausflippen, meldete sich eine innere Stimme.
Noch nicht, noch nicht, ermahnte sie sich, obwohl allein die Tatsache, dass sie mit ihrem eigenen Verstand verhandelte, bewies, wie schlecht es um sie bestellt war. Sie rappelte sich auf und versuchte, sich zu erinnern, wo sie geparkt hatte. Dann ging sie über den abschüssigen Rasen zu den Autos und an ihnen vorbei, strich über die Motorhauben und fürchtete, jedes Mal wieder brechen zu müssen, wenn sie im Inneren etwas entdeckte – Bücher, Pullover, Perlengehänge am Rückspiegel –, kleine Andenken an das Leben der Menschen, Dinge, die sie nie wiedersehen würden.
Schließlich erreichte sie ihren Crown Vic, öffnete die quietschende Tür, stieg ein und inhalierte den schwachen, vertrauten Geruch von Benzin und Öl.
Tana hatte das Auto an ihrem siebzehnten Geburtstag für einen Tausender gekauft und die Kratzer mit hellgrünem Rostschutzmittel besprüht, sodass es wie ein demoliertes Polizeiauto aussah. Dann hatte sie den Motor mithilfe ihres Vaters wieder zusammengesetzt, als er gerade mal wieder kurz aus dem Nebel seines Unglücks aufgetaucht war und sich daran erinnert hatte, dass er zwei Töchter hatte.
Der Wagen war groß und robust und schluckte unersättlich Benzin. Als sie die Tür zuknallte, hatte sie zum ersten Mal, seit sie das Badezimmer verlassen hatte, vielleicht sogar erstmals, seit sie auf die Party gegangen war, das Gefühl, die Dinge im Griff zu haben.
Sie fragte sich, wie lange es dauern würde, bevor ihr auch das durch die Finger glitt.
VIeRTES KAPITEL
Warum den Tod fürchten?
Er ist das schönste Abenteuer des Lebens.
– Charles Frohman
Tana hatte ein Geheimnis, ein Geheimnis, das sie niemandem erzählte – einen Traum, der immer wiederkam. Zeitweise vergingen Monate zwischen diesen Träumen; manchmal träumte sie ihn eine Woche lang jede Nacht. In diesem Traum war sie mit ihrer Mutter zusammen, untot, in bauschende weiße Gewänder gekleidet, mit Rüschen am Kragen und am Saum. Sie liefen gemeinsam in einem dunklen Märchen aus Blut, Wäldern und Schnee durch die Nacht, mit Mädchen, die Haare wie aus Rabenschwingen und rosenrote Lippen und scharfe Zähne hatten, so weiß wie Milch.
Die Art und Weise, wie sie sich ansteckten, variierte, doch normalerweise passierte es wie folgt: Tana wurde als Erste Kalt. Die Details wurden ausgelassen, das Wie und Warum des Angriffs stand nicht zur Debatte und wurde nicht erwähnt. Der Traum begann meist damit, dass ihr Vater sie zur Kellertür schleppte und erklärte, er würde sie nie, nie, nie wieder rauslassen. Tana konnte noch so viel heulen und weinen und außer sich vor Kummer flehen und betteln, sie konnte ihn mit Tränen überschütten, sein Herz blieb hart wie Stein. Am Ende hatte er genug von ihren Tränen und warf sie die Treppe hinunter.
Sie stieß sich den Kopf an den Holzlatten und wollte sich am Geländer festhalten, doch obwohl sie schon mit den Nägeln darüber kratzte, entglitt es ihr. Als sie unten aufschlug, bekam sie keine Luft mehr.
Dann saß sie dort auf dem kalten Kellerboden, während Spinnen über ihre Hände krochen und Käfer knackten, während Mäuse aus dem Dunkel flitzten und piepsend Haarsträhnen für ihre Nester stahlen, während ihre Mutter bat, sie freizulassen, und ihre Schwester weinte. Doch jedes Mal wenn ihre Mutter Tanas Vater vorwarf, grausam zu sein, hängte er noch ein Schloss an die Kellertür, bis dort dreißig Messingschlösser hingen, für die er dreißig Messingschlüssel hatte. Tag für Tag musste er all diese Schlösser aufschließen, um für Tana eine Schüssel Wasser und eine Schüssel Haferbrei auf die oberste Stufe zu stellen. Und dann musste er sie alle wieder abschließen.
Schließlich kannte Tana den Klang der Schlösser und schlich die Treppe hinauf, wenn er begann, die Schlüssel darin zu drehen. Sie wartete auf ihn. Er war vorsichtig, aber nicht vorsichtig genug. Als er die Tür öffnete, sprang sie auf und biss ihn. Gemeinsam fielen sie in einem verschwommenen Wirrwarr die Treppe herunter. Und wenn sie aufwachte, war sie ein Vampir, und ihr Vater lag bewusstlos neben ihr.
Dann kam immer ihre Mutter nach unten, schloss Tana in ihre weichen Arme und sagte, dass alles gut werden würde. Sie würden bald zusammen fortgehen, aber erst müsste Tana sie beißen. Ihre Mutter bestand darauf und sagte immer wieder, dass sie es nicht ertragen könnte, wenn Tana allein in die Welt hinausginge, und dass sie immer bei ihr sein wollte. Manchmal verlegte sich ihre Mutter sogar aufs Betteln.
Bitte, Tana, bitte.
Tana biss sie immer. Als Tana noch jünger war, hatte das Blut in ihren Träumen wie Erdbeerbrause oder Erdbeereis geschmeckt. Wenn man zu schnell trank, bekam man von der Kälte Kopfschmerzen. Als sie älter wurde und schon einmal an einem verletzten Finger geleckt hatte, schmeckte es in ihren Träumen entsprechend nach Kupfer und Tränen.
Nachdem dann im Traum auch Tanas Mutter infiziert war, biss sie ihren bewusstlosen Mann, weil sie für ihre eigene Verwandlung Menschenblut brauchte und es ihm nicht schadete, da man von einem Biss durch einen Infizierten nicht Kalt werden konnte. Danach brachten sie ihn ins Bett, weil er wahrscheinlich müde wäre.
Er schlief ganz friedlich, während Tana und ihre Mutter Pearl versprachen, sie zu holen, wenn sie älter war. Dann zogen sie lange Kleider an und gingen in die Nacht hinaus, Mutter Vampir und Kind Vampir, um zu jagen und gemeinsam die Straßen unsicher zu machen.
Sie würden natürlich zu den Guten gehören, wie die aufopferungsvollen Wissenschaftler, die sich infizierten, um die Krankheit besser zu verstehen; wie die Kopfgeldjäger unter den Vampiren, die andere Vampire zur Strecke brachten; wie die Vampirfrau in Griechenland, die immer noch mit ihrem Mann zusammenlebte und ihm nachts das Essen kochte, das er sich aufwärmen konnte, wenn sie den Tag in einem Grab frisch umgegrabener Erde unter dem Rübenkeller verschlief. So würden auch Tana und ihre Mutter sein und niemals würden sie jemanden töten, nicht einmal aus Versehen.
Im Traum passte alles, alles war perfekt, alles war für immer gut.
Im Traum liebte Tanas Mutter sie über alles. Sie hatte sie lieber als den Tod.
Ich will kein Vampir sein, redete Tana sich immer wieder ein. Aber in ihren Träumen wollte sie es irgendwie doch.
FÜNFTES KAPITEL
Jung stirbt, wen die Götter lieben.
– Menander
Auf der Fahrt über den Rasen überfuhr Tana einen zusammengerollten Schlauch und zerstörte das Narzissenbeet von Lances Mutter. Dann legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr den Crown Vic möglichst nah ans Fenster. Als sie mit der Stoßstange die Mauer berührte, stieg sie aus, kletterte aufs Autodach und schlängelte sich unter der Scheibe hindurch zurück in das Gästezimmer – diesmal mit einem Montierhebel in der Hand.
Sie brauchte mehrere Versuche und schaffte es nur mit Hängen und Würgen. Als sie endlich wieder drin war, mit zerkratzten Armen und Beinen, stellte sie fest, dass es dunkler geworden war. Die Schatten wurden länger, da der Nachmittag unerbittlich in den Abend überging. Wahrscheinlich war es schon nach sechs oder gar sieben. Es stank penetrant nach Tod.
»Tana«, sagte Aidan, sobald er sie am Fenster sah. »Tana, die kommen rein, wenn es dunkel ist. Das haben sie schon angekündigt.« Er sah blass und verzweifelt aus, viel schlimmer als vorher. »Wir müssen sterben, Tana.«
»Condamné à mort«, sagte eine raue Stimme von der anderen Seite der Tür. Tana hörte, wie die fremden Wesen im Flur flüsterten, wie sie hungrig auf der Stelle traten und auf den Sonnenuntergang warteten.
Ihre Hände zitterten.
Sie drehte sich rasch zu Gavriel um, der wie eine Krähe in der Ecke kauerte und sie mit seinen unheimlichen Granataugen beobachtete. »Was bedeutet das?«
»Hier sind so viele eigenartige Sonnensprenkel«, rief er ihnen zu, ohne auf Tana einzugehen. »Kommt ruhig rein. Ich freue mich schon drauf, dass eure Haut Blasen wirft. Ich freue mich …«
»Sag das nicht!« In ihrer Panik schnitt sie ihm das Wort ab. Sollten die Vampire ins Zimmer gelangen, wüsste sie nicht, wie sie reagieren sollte.
Abhauen, schätzungsweise. Die anderen im Stich lassen.
Aidan wölbte den Rücken gegen die Fesseln. »Die reden in tausend Sprachen. Gerne Französisch. Irgendwas über den Dorn von Istra. Ich glaube, er hat ein Problem.«
»Und, stimmt das?«, fragte Tana.
»Nicht ganz«, antwortete Gavriel.
Tana blickte erschauernd und sehnsüchtig zum Fenster und zu ihrem Auto. Der Dorn von Istra? Vor einiger Zeit hatte sie im Spätprogramm die Sendung Wir lüften den Schleier: Vampirgeheimnisse aus der Zeit, bevor die Welt Kalt wurde gesehen. Zwei Wissenschaftler in Tweedjackets hatten über ihre Forschungen zum Thema, warum Vampire so lange im Verborgenen gelebt hatten, gesprochen. Früher hatten anscheinend einige Vampire aus alter Zeit wie gruselige Kriegsherren über weite Gebiete geherrscht und die anderen Vampire wie Sklaven gehalten. Vampire suchten sich Opfer, die nicht vermisst würden, und töteten sie nach jeder Nahrungsaufnahme. Doch wenn aus Versehen jemand lange genug überlebte, um selbst Blut zu saugen, war es Aufgabe des Dorn, diesen frisch verwandelten Vampir zu jagen und alle zu töten, die er in seinem kurzen, wilden Leben gebissen hatte. Offenbar war es zugleich eine Strafe und eine Ehre, einem der ehrwürdigen Vampire als Dorn zu dienen.
In der Sendung hatten die Tweedanzugträger sich darüber amüsiert, wie verzweifelt diese Dorne gewesen sein mussten, nachdem Caspar Morales auf Weltreise gegangen war, und wie sie sich abrackern mussten, um eine Infektionskrankheit auszurotten, die sich bereits unkontrolliert ausbreitete.
Anscheinend hatte der Dorn von Istra darüber den Verstand verloren. Die Sondersendung zeigte ein unscharfes Video von einem Treffen unter dem Friedhof Père Lachaise in Paris. Während elegant gekleidete Vampire um ihn herum ihren Verpflichtungen nachgingen, steckte der Dorn von Istra, Gesicht und Körper blutverschmiert, in einem Käfig und lachte. Er lachte sich kaputt, als sie den Videofilmer aufgetrieben und vor den Käfig geschleppt hatten, und heulte wie ein Irrer, bevor er dem Mann die Kehle durchbiss. Tana hatte gesehen, wie blass die anderen Vampire geworden waren. Sogar sie hatten Angst vor ihm.
»Der Dorn von Istra ist hinter dir her?«, fragte Tana. Die Vorstellung, dass der Dorn ausgebrochen war, lähmte sie. »Und das soll kein Problem sein?«
Gavriel schwieg.
Vielleicht wäre es doch besser, ihn dazulassen. Aidans Fesseln zu lösen und abzuhauen, auch wenn das hieß, einen angeketteten Vampir seinen Feinden auszuliefern, die in unbekannter Anzahl vor der Tür lauerten. Auch wenn das unfair war.
Tana holte tief Luft. »Das ist deine letzte Chance. Musst du gerettet werden?«
Er setzte eine eigenartige Miene auf – man hätte meinen können, sie hätte ihn geschlagen. »Ja«, sagte er schließlich.
Vielleicht lag es daran, dass fast alle tot waren und sie sich selbst ein bisschen tot fühlte, doch sie war der Meinung, dass auch ein Vampir es verdient hatte, gerettet zu werden. Möglicherweise wäre es sinnvoller, ihn im Stich zu lassen, aber sie würde es trotzdem nicht tun.
Als sie zu Gavriel ging, prüfte sie mit einem Blick die Anordnung der schweren Ketten. Eine war um den Bettpfosten geschlungen. Die Handgelenke waren mit massiven Handschellen vor seinen Körper gefesselt und mit weiteren Handschellen an seinen Füßen verbunden worden.
Man könnte ihn am besten befreien, indem man das Bett hochhob, was er vielleicht sogar selbst hätte schaffen können, wenn seine Hände nicht gefesselt gewesen wären. Tana bezweifelte, dass es ihr gelingen konnte. Jedenfalls nicht, solange Aidan auf der Matratze lag.
»Meinst du, du schaffst es, mich nicht zu beißen?«, fragte sie ihn.
Aidan schwieg lange. »Weiß nicht.«
Wenigstens war er ehrlich.
Sie holte Gavriels Knebel von einem Kleiderhaufen auf dem Boden und stieg auf den Rand des Bettgestells. »So schlimm ist es doch noch gar nicht bei dir. Probier’s.« Sie beugte sich vor und befestigte den Knebel, so schnell es ging, mit einem Doppelknoten im Nacken, damit er ihn nicht so schnell lösen konnte. Das hoffte sie zumindest.
Er rührte sich nicht und ließ sie gewähren. Als sie mit dem Knebel fertig war, hakte sie die Gummiseile an seinen Beinen aus. Das ging immerhin schnell, weil es keine Knoten gab. Allerdings musste sie dazu auf dem Bett über ihn steigen, und obwohl er Kalt war, obwohl sie in Gefahr schwebten, war Aidan noch dazu zumute, sie anzusehen und eine Augenbraue provozierend hochzuziehen.
Sie wollte ihm gerade das Maul stopfen, als sie an seinem Knöchel zwei Bisswunden entdeckte, die bereits leicht geschwollen waren. Und das Blut hatte einen bläulichen Farbton angenommen. Sie holte scharf Luft, sagte jedoch nichts und fasste sie nicht an. Das war so was von grauenhaft privat.
Dann, da kein Weg daran vorbeiführte, löste sie die Fesseln an Aidans Armen. Er setzte sich auf, rutschte ans Kopfende zurück und massierte seine Handgelenke. Sein dunkelbraunes Haar hing ihm verwuschelt ins Gesicht, als wäre er gerade aufgewacht.
Schaff sie ins Auto, ermahnte sie sich. Pack sie in den Kofferraum und fahr los – alles andere kannst du dir dann überlegen.
»Wenn du versuchst, den Knebel abzumachen, schlage ich dich mit dem Montierhebel!«, warnte sie Aidan, hob das Werkzeug auf und schwenkte es drohend.
Da Aidan nichts sagen konnte, deutete Tana das Geräusch, das er von sich gab, als Zustimmung.
»So, und jetzt hilfst du mir, Gavriels Ketten vom Bett loszumachen«, fuhr Tana fort.
Aidan schüttelte wild den Kopf.
»Wir haben keine Zeit, uns zu streiten«, sagte sie.
Er ließ die Schultern sinken und seufzte durch die Nase. Nach einem langen Blick von ihr stand er langsam auf und legte die Hände an das Fußende. Tana ging in die Hocke und zog an der schweren Kette, als Aidan das Bett hochhob. Dann krabbelte sie hektisch rückwärts und Aidan ließ das Gestell wieder los. Es krachte auf die Dielen und ließ sie erbeben.
Als der Vampir sich bewegte, klirrten die Ketten, die er hinter sich herzog, so unheimlich, dass Tana an die mittelalterlichen Verliese in Spätfilmen denken musste.
Er hob die Arme mit den Handschellen.
Aidan wollte sich zu Wort melden, doch wegen des Knebels kam nur unverständliches Gestammel heraus. Tana konnte sich denken, wie sein ironischer Kommentar gelautet hatte.
»Hier sind noch mehr von den Müllbeuteln, mit denen sie die Fenster zugeklebt haben«, sagte sie und kramte auf dem Boden in den Sachen, die die Vampire dagelassen hatten. »Wir könnten dich darin einwickeln, damit du nicht verbrennst, falls die Decke abrutscht, und die Beutel mit Isolierband festkleben – natürlich nur, wenn es dir nichts ausmacht, so bescheuert rumzulaufen.«
Der Vampir lächelte mit geschlossenem Mund.
Tana gab Aidan die Rolle mit Müllbeuteln und das Klebeband. Er hockte sich in den Schatten und bastelte eine Art Kunststoffrüstung für Gavriel, die genauso albern aussah, wie Tana vorausgesagt hatte – schon ohne Decken.
»Falls ich verletzt werde«, sagte Gavriel, »müsst ihr höllisch aufpassen.«
»Machen wir«, antwortete sie. »Keine Sorge.«
»Nein, Tana, hör zu«, sagte er. »Ihr müsst euch vor mir in Acht nehmen.«
Das war das erste Mal, dass er sie mit Namen anredete, und wegen seines sonderbaren Akzents hörte er sich anders an, fremd.
»Wir lassen es nicht so weit kommen, dass du dich verbrennst«, sagte sie und wandte sich ab, um Handtaschen zu öffnen und mit den Fingern in Jackentaschen zu kramen, weil sie wider besseres Wissen hoffte, einer ihrer Freunde hätte ein Messer mitgenommen. »Auch wenn du ein Vampir bist und es wahrscheinlich nicht besser verdient hast.«
Entschuldigung, sagte sie zu jedem einzelnen Toten, als sie ihre Sachen aufknöpfte und aufriss. Tut mir leid, Courtney. Tut mir leid, Marcus. Tut mir leid, Rachel. Tut mir leid, Jon. Entschuldigt, dass ich noch lebe und ihr schon tot seid. Tut mir leid, dass ich alles verschlafen habe. Tut mir leid, dass ich euch nicht retten konnte und jetzt auch noch eure Sachen durchwühle. Entschuldigung. Sie fand keine Messer oder Pflöcke. Es gab nur eine Schnur mit eingeflochtenen religiösen Symbolen aus aller Welt, darunter ein großes Evil Eye, das kristallen funkelte, und ein verkorktes Fläschchen mit Rosenwasser, in dem eine dornige Ranke trieb.
Tana konnte nicht vorsichtig genug sein. Sie stopfte das Fläschchen und die Schnur in ihre Handtasche. Dann nahm sie Rachel Meltzers Handy, wählte 911 und warf es aufs Bett.
Im Flur knarrte eine Diele.
»Kleine Maus«, sagte eine Stimme durchs Schlüsselloch. »Weißt du nicht, dass die Katze mehr Spaß hat, wenn du so zappelst?«
Aidan heulte fast hinter seinem Knebel. Tana wurde von Angst geschüttelt. Es war eine tierische Furcht, die alles andere ausblendete, endlos und unfassbar. Es gab Wesen, die denken und sprechen konnten und die sie trotzdem töten und fressen wollten. Sie war lange wie gelähmt.
Dann kämpfte sie sich durch die Woge ihrer Angst und blickte durchs Fenster nach draußen, wo die ersten orangefarbenen Strahlen des Sonnenuntergangs die Bäume in goldenes Licht tauchten. Es wurde dunkel.
»Wir müssen los«, sagte sie zu Aidan. Er war mit dem Einpacken von Gavriel noch nicht so weit, wie sie es gern gehabt hätte, doch ihnen lief die Zeit davon. Sie holte mit dem Montierhebel aus, schlug die Scheibe ein und entfernte hastig die hölzernen Querstreben.
Glasscherben fielen schimmernd zu Boden.
»Wir verschwinden jetzt!«, brüllte sie. »Los, Aidan, komm. Bring Gavriel hier rüber.«
Aus dem Handy kam wie aus weiter Ferne die dünne Stimme aus der Telefonzentrale. »Welchen Notfall wollen Sie melden? Hallo, hier ist 911. Welchen Notfall melden Sie?«
»Vampire!«, rief Tana und warf ihre Stiefel aus dem Fenster und das Werkzeug hinterher.
Aidan half Gavriel auf die Beine. So verpackt, sah er aus wie eine moderne Mumie. Das glänzende Klebeband hielt die Kombination aus Müllbeuteln und Decken zusammen, während er zum Fenster hoppelte. Tana hatte keine Ahnung, ob es ausreichte, damit er sich nicht verbrannte, doch es musste eben reichen. Sie hätte auch so schon am liebsten alle Pläne in den Wind geschlagen und wäre allein abgehauen, raus auf den Rasen, nur weg.
»Aidan, du steigst zuerst aus dem Fenster«, sagte Tana, nachdem sie ihre Angst heruntergeschluckt und sich alle anderen Gedanken verboten hatte. »Wir brauchen draußen jemanden, der Gavriels Füße nimmt.«
Aidan nickte und schwang die Beine übers Fenstersims. Er sah sie noch einmal an, als müsste er eine Entscheidung treffen. Dann sprang er und landete ungeschickt auf dem Dach des Crown Vic.
Tana hörte, wie das Holz der Tür splitterte, als würde ein großer Rammbock dagegen geschlagen. »Nein«, sagte sie leise. »Oh nein. Nein.«
»Lass mich zurück«, sagte Gavriel.
Beim nächsten Schlag an die Tür fiel die Kommode um und krachte an das Bett. Tana zwang sich, nach vorn zu sehen, und schob den verpackten Körper zum Fenster.
»Schnauze, sonst tu ich’s wirklich«, antwortete sie. »Setz dich, dann rüber mit den Beinen und fallen lassen.«
Er schob sich über das Sims, und Tana hielt ihn fest, damit er nicht auf der falschen Seite herunterfiel. Aidan stand unter dem Fenster und packte seine Füße. In der Hoffnung, das Isolierband würde nicht reißen, ließ Tana los.
Aidan half Gavriel auf den Kofferraum.
Hinter ihr wurde die Tür eingeschlagen.
Weiter, redete sie sich zu. Nicht umsehen. Doch sie tat es trotzdem.
Zwei Wesen standen in dem zersplitterten Türrahmen – ein männliches und ein weibliches. Ihre Gesichter waren verschwollen und rosa, aufgedunsen von dem vielen Blut, das sie getrunken hatten. Ihre Münder und die spitzen Zähne waren rot, die Augen hohl, die Kleidung steif mit dunklen Flecken. Das waren nicht die schicken Vampire aus dem Fernsehen; dies waren Albträume, die sich auf sie stürzten, sich durch die Jacken wühlten und vor den letzten Lichtstrahlen zurückzuckten.
Tana schwang sich bebend auf das Sims, doch ihre Hände zitterten so, dass sie fast vom Fensterrahmen abgerutscht wäre. Sie kam auf die Knie und warf sich ins Freie, aber sie verfehlte das Auto und landete auf dem Rasen.
Finger schlossen sich um ihre Wade und wollten sie zurückziehen. Nach einem brutalen Tritt zog sie sich mit den Armen vorwärts. Zähne streiften ihre Kniekehle, als sie sich losriss und vom Fenster fort krabbelte. Hinter ihr gellte ein schriller Schmerzensschrei. Tana fiel vor Schreck auf den Rücken und bekam keine Luft mehr. Benommen drehte sie sich auf die Seite und betrachtete den Rasen, auf dem Glasscherben glänzten, als hätte jemand nach einem Juwelenraub mit vollen Händen Diamanten in die Luft geworfen.
Aidan schaffte es, den Knebel auszuspucken, und raufte sich die Haare. »Du hättest sehen sollen, wie der Arm von dem versengt ist. Beinahe hätte er dich gehabt.«
Sie rappelte sich mühsam auf. Der Kratzer an ihrem Bein brannte und sie zitterte schon wieder von Kopf bis Fuß. »Ich glaube, er hat mich erwischt.«
»Was?« Aidan machte einen Schritt auf sie zu, doch Tana schüttelte den Kopf.
»Nicht jetzt«, sagte sie. Sie standen am Auto. Sie hatten es fast geschafft. »Hilf mir, ihn in den Kofferraum zu tragen.«
In die Decke gewickelt, sah Gavriel wie eine Leiche aus, die von ihren Mördern beseitigt wurde. Er lag gekrümmt auf der Seite, damit er der Sonne den Rücken zuwandte. Gemeinsam hoben Tana und Aidan ihn hoch und zerrten ihn vom Autodach runter. Doch Tana stolperte unter seinem Gewicht und zog in die falsche Richtung. Die Müllbeutel rissen und die Decke fiel ab. Sie rutschte aus und fiel ins Gras. Einen Augenblick lang sah sie zu, wie seine Flanke und seine Hand in der Sonne schwarz wurden und das Licht das Fleisch verschlang. Bevor sie etwas tun konnte, drehte Gavriel sich herum, die verletzlichen Körperteile zur Erde, wohin kein Licht kam.
»Gavriel?«, fragte Tana, stand auf und schlug die Decke wieder um ihn.
Er versuchte aufzustehen.
Taumelnd und erschöpft, öffneten sie den Kofferraum und wälzten Gavriel schwerfällig hinein. Aidan knallte die Haube zu und setzte sein Böser-Junge-tut-gleich-was-Böses-Grinsen auf.
»Aidan