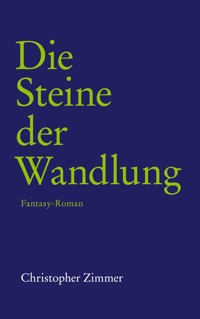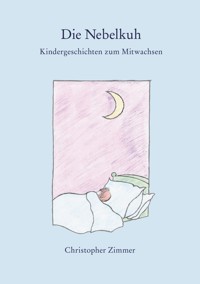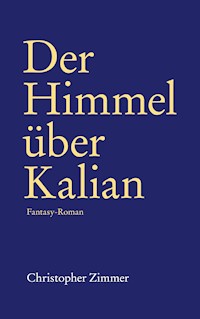Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den Geschichten und Gedichten in diesem Buch sitzt der Schalk im Nacken. Sie erzählen von Musikern, Hühnern und Neandertalern, schicken ein Kamel auf eine psychedelische Reise und einen Pfarrer zum Mond, und sogar ein amerikanischer Präsident gibt sich die Ehre. Dabei hat dieses bunte Sammelsurium von Texten vor allem eines im Sinn: zu erheitern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
I
NTRODUKTION
– B
ÜCHER
Prolog: Zwei Herren im Theater. Eine Valentinade
Concerto Grosso
I
NTERMEZZO
I – W
IESE UND
S
CHIRM
Geld regiert die Welt
Topfgeschichten. Vom Leben und Sterben der drei Hühner Esmeralda, Brunhilda und Aglaia und ihrer Nachkommenschaft in einem Durchgang und drei möglichen Nachspielen
I
NTERMEZZO
II – B
US UND
A
NTIKE
Historischer Exkurs über den Verbleib der Nordstrander Berge
Das Kamel, die Wüste, die größte Oase der Welt und eine Zugabe mit Folgen
I
NTERMEZZO
III – K
AMEL UND
M
ANN
Vorbeugende Maßnahmen zum Zweck der Prophylaxe in öffentlichen Baukörpern unter besonderer Berücksichtigung statischer Eigenschaften freischwebender Elemente
La mano de Dios
I
NTERMEZZO
IV – F
LOH UND
H
IPPOPOTAMUS
Contrabasso cantabile
I
NTERMEZZO
V – M
ELANCHOLIE UND
M
ALHEUR
Zum Beispiel zur Weihnachtszeit
weihnacht.com
I
NTERMEZZO
VI – L
EBEN UND
I
DYLL
Bennings. Ein amerikanisches Märchen
Der Maler
I
NTERMEZZO
VII – R
OSE,
B
ÄRLAUCH,
K
APITÄN
Exit
Ausgehend von einem Zettel
I
NTERMEZZO
VIII – H
AUS UND
B
ART
Epilog: Der Literaturgourmet. Hommage an Eugen Roth
C
ODA
– D
ICHTUNG
Vorwort
Piepmatz ist meine persönliche, kreative Schuhschachtel, in die «Kraut und Rüben» hineinpasst. Ein Spleen, der, ganz im Sinne des österreichischen Autors Heimito von Doderer, «ab ovo» (vom Ei, von Beginn an) 1 zu mir gehört und hoffentlich noch lange bunte Blüten treibt.
In «Madadayo», dem letzten Film des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa aus dem Jahre 1993, versammelt der emeritierte Deutschprofessor Uchida einmal im Jahr seine ehemaligen Studenten um sich, leert ein gewaltiges Glas Bier auf einen Zug und ruft: «Mada da yo!» («Noch nicht!»), was, im übertragenen Sinne, bedeuten soll: Ich lebe noch.
1981 habe ich während meines Studiums in Wien in einer, durch eine Mischung aus Fieber und Rotwein hervorgerufenen Laune den Piepmatz-Verlag gegründet. In den folgenden Jahren erschienen erst in größeren Abständen, dann immer regelmäßiger schlichte Broschüren mit schrägen, poetischen oder ausgelassenen Gedichten und Geschichten, mit denen ich eine wachsende und mit den Jahren sich wandelnde Schar von Zugewandten beglückte, Lebens- und Überlebenszeichen im Geiste des «Mada da yo!».
Einige von diesen und noch weitere Geschichten, die mir am Herzen liegen, habe ich im vorliegenden Buch – zum 40-Jahre-Jubiläum von Piepmatz – versammelt. Es ist ein ziemlich buntes Häuflein dabei zusammengekommen, weshalb ich diese Sammlung mit «Geschichten und Allotria 2» bezeichnet habe, auch um den Schalk anzudeuten, der in allen Texten, selbst den ernsteren, steckt.
Diese (un)gereimten Texte haben mich viele Jahre lang begleitet, manche von ihnen habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten öffentlich vorgetragen und damit einige Heiterkeit ausgelöst. Wenn sich nun bei dem Einen oder der Anderen beim Lesen dieser Geschichten und Nonsens-Verse 3 auch eine solche Heiterkeit einstellt, haben sie ihren besten Zweck erfüllt.
1 Der Begriff «ab ovo» findet sich in Heimito von Doderers (1896– 1966) Wiener Stadtromanen «Die Strudlhofstiege» (1951) und «Die Dämonen» (1956).
2 «Allotria» bedeutet so viel wie Spaß oder vergnüglicher Unfug.
3 Die Nonsens-Verse sind neben weiteren als «(Un)Gereimtes – 100 Reimereien um des Reimes willen» bei der ProgrammZeitung Basel von 2012 bis 2015 als Webkolumne erschienen.
INTRODUKTION
Literarisch
Manche Bücher sind gefährlich, and’re seicht, ihr Inhalt spärlich und als Ganzes recht entbehrlich. Wieder and’re sind, wie herrlich, mysteriöserweis’ und unerklärlich für die Massen so begehrlich … jenseits aller Logik – und das jährlich!
Prolog: Zwei Herren im Theater
Eine Valentinade 4
Erster Herr: «Aber es passiert ja nichts!»
Zweiter Herr: «Nun warten Sie doch erst mal ab, bis der Vorhang aufgeht.»
«Ach, der Vorhang muss aufgehen, damit was passiert?»
«Ja, natürlich.»
«Aber was ist, wenn er nicht aufgeht?»
«Unsinn! Er geht immer auf.»
«Wie langweilig.»
«Wie bitte?»
«Nun, langweilig ist es doch, wenn immer dasselbe passiert. Also, wenn der Vorhang, wie Sie sagen, immer aufgeht, ist das doch langweilig.»
«Aber was reden Sie denn da zusammen? Sicher haben Sie mit Ihrer Definition von Langeweile im Allgemeinen recht, aber doch nicht in diesem speziellen Fall des Theaters. Langweilig wäre es, wenn der Vorhang nicht aufgehen würde und nichts passiert.»
«Also kommt es doch vor, dass der Vorhang nicht aufgeht.»
«Na ja, vielleicht, um des lieben Friedens willen. Es kommt schon mal vor, dass er nicht aufgeht.»
«Und warum?»
«Nun, zum Beispiel, wenn etwas passiert ist.»
«Aha, und wenn nichts passiert, dann geht er auf?»
«Genau.»
«Dann wäre es doch besser, wenn der Vorhang erst gar nicht aufgehen würde.»
«Wieso denn das?»
«Nun, weil Sie doch eben sagten, dass erst was passiert, wenn der Vorhang aufgeht. Aber wenn was passiert, geht er ja gar nicht auf. Also wäre es schon besser, er ginge gar nicht erst auf, damit nichts passiert.»
«Aber nein. Ich habe gesagt, dass der Vorhang nicht aufgeht, wenn was passiert ist, also vorher, bevor was passiert, denn das, was passiert, wenn er erst mal aufgegangen ist, passiert ja nachher, wenn er schon auf ist. Und das, was nach dem Aufgehen des Vorhangs passiert, steht dem Aufgehen des Vorhangs nicht entgegen.»
«Ja, so, aha, wenn Sie meinen. Aber warum geht er denn jetzt nicht auf? Meinen Sie, dass etwas passiert ist?»
«Woher soll ich das denn wissen?»
«Nun, aus dem Nichtaufgehen des Vorhangs könnte man doch logisch folgern, dass etwas passiert ist.»
«Vielleicht. Aber wissen kann man’s nicht.»
«Nein, wissen nicht. Aber mutmaßen schon.»
«Ja! Ja!»
(Es wird dunkel im Saal)
Erster Herr: «Jetzt ist was passiert! Jetzt geht der Vorhang nicht auf.»
«Aber nein, durchaus nicht. Es wird immer dunkel im Saal, bevor der Vorhang aufgeht. Das ist sozusagen ein günstiges Zeichen. Eine Bestätigung, dass nichts passiert ist und der Vorhang gleich aufgehen wird.»
(Der Vorhang öffnet sich.)
Zweiter Herr: «Sehen Sie, es ist nichts passiert. Der Vorhang hat sich geöffnet. Sind Sie nun beruhigt?»
«Ja, schon, obwohl es ja langweilig ist.»
«Wieso das?»
«Sie haben doch gesagt, dass es im speziellen Fall des Theaters langweilig ist, wenn nichts passiert.»
«Ja, Herrschaftszeiten, aber doch nur, wenn nachher nichts passiert, weil der Vorhang nicht aufgeht. Nicht aber, wenn vorher nichts passiert, also der Vorhang aufgeht und doch etwas passiert. Nachher!»
(Eine Dame, hinter den Herren, verärgert zischend: «Ruhe!» Die Unterhaltung wird im Flüsterton fortgesetzt.)
Zweiter Herr: «Also, können Sie mir folgen? Wenn etwas passiert, weil der Vorhang hat aufgehen können, weil vorher nichts passiert ist, dann ist das nicht langweilig. Wenn aber nichts passiert, weil der Vorhang nicht hat aufgehen können, weil vorher etwas passiert ist, dann ist das langweilig. Ist Ihnen das nun klar?»
«Ja, in diesem speziellen Fall schon, wenn auch nicht im Allgemeinen.»
«Wieso?»
«Nun, wenn vorher was passiert und der Vorhang deshalb nicht aufgeht, gibt das immerhin Gesprächsstoff. Ganz so langweilig ist das also auch nicht.»
(Dieselbe Dame: «Nun geben Sie doch endlich Ruhe!» Schweigen. Die Handlung verlagert sich auf die Bühne. Pause. Licht im Saal.)
Zweiter Herr: «Furchtbar langweilig war’s. Finden Sie nicht auch?»
«Wieso denn, es ist doch was passiert. Der Vorhang ist doch aufgegangen.»
«Ja, sicher. Aber nur weil der Vorhang aufgegangen ist, ist das noch keine Garantie gegen die Langeweile.»
«Also jetzt widersprechen Sie sich aber selbst. Sie haben doch geradezu darauf bestanden, dass es auf gar keinen Fall langweilig ist, wenn der Vorhang aufgeht und etwas passiert.»
«Aber das gilt doch nur bis zu dem Augenblick, in dem sich der Vorhang öffnet. Dann gelten andere Regeln. Dann hat man sich über das, was passiert, eine Meinung zu bilden.»
«Mein Gott, wie kompliziert! Wenn ich gewusst hätte, wie ein solcher Theaterbesuch sich in ein Vorher und ein Nachher und in eine Langeweile oder Nichtlangeweile zergliedert, hätte ich mir den Besuch zweimal überlegt.»
«Aber nun lassen Sie sich doch nicht so leicht entmutigen. Kommen Sie, lassen Sie uns an der Bar weiter darüber reden.»
(Das Gespräch der Herren geht in der Menge unter. Als die Glocke zur Fortsetzung der Darbietung ruft, kommen die Herren mit roten Gesichtern schweigend an ihre Plätze zurück und warten – vorerst wortlos.)
Erster Herr nach einer Weile: «Aber warum geht denn der Vorhang nicht wieder auf? Meinen Sie, dass etwas passiert ist? Vorher?»
1. Variante: Der zweite Herr springt mit hochrotem Gesicht auf und verlässt entrüstet und heftig gestikulierend das Theater. Dieser Vorfall findet in der Premierenbesprechung des Lokalanzeigers seinen Niederschlag.
2. Variante: Der zweite Herr springt mit hochrotem Gesicht auf und erschlägt den ersten Herrn. Panik bricht aus. Der Vorhang geht nicht wieder auf.
3. Variante: Der zweite Herr legt dasselbe Verhalten an den Tag wie in der zweiten Variante, d.h. er erschlägt den ersten Herrn. Saaldiener entfernen die Leiche. Der zweite Herr wird durch freundliches Zureden beschwichtigt, der Vorhang öffnet sich und der besagte zweite Herr kann der Vorstellung bis zu ihrem Ende beiwohnen.
4 Karl Valentin (1882–1948), deutscher Komiker, Sprach-Anarchist, Volkssänger, Autor und Filmproduzent
Concerto Grosso
Il professore Gian-Battista Emanuele Vittorio Maria Saluzzi, vielgerühmter und verehrter Geigenvirtuose, Professor am Konservatorium von Bergonza (dessen außergewöhnlich guter Ruf nicht zuletzt ein Verdienst seiner langjährigen Tätigkeit als Direktor dieser Anstalt war, der er in sanfter Strenge und mit erhabenem Gemüte vorstand), Mitglied des Stiftungsrates zur Förderung der Schönen Künste, der Erhebung der Jugend im Geiste der Musik sowie der Verbreitung und Pflege der Werke des großen Bergoneser Komponisten Ferrugio Amanzi, dessen musikalisches Genie unbegreiflicherweise nie über die engen Grenzen seiner Heimatstadt gedrungen war (ein Skandal, wie Professor Saluzzi bei jeder Gelegenheit betonte, war er doch immerhin ein Enkel des verehrten Meisters und selber schon mit manch schöner Eigenkomposition hervorgetreten), Professor Saluzzi willigte, nach anfänglichem Zögern, dann aber mit zunehmender Rührung, ergeben und bescheiden ein, und so ward es denn beschlossene Sache: Il professore Gian-Battista Emanuele Vittorio Maria Saluzzi würde sein solistisches Können in den Dienst des alljährlichen Konzertes auf der Piazza Maggiore stellen, und es darf gesagt werden, ein jeder in Bergonza, der ein Herz und eine Seele für die Musik hatte, fieberte diesem ersehnten Ereignis entgegen. Plakate hingen bald zahlreich wie Blätter im Walde an Mauern und Säulen, von bewegten Damen mit zarter Hand verfasste Einladungen gingen in Hundertschaften an die Honoratioren und die Kunstgesinnten und Kunstbeflissenen der Stadt, und kaum ein Mund, der sich nicht unterstützend geregt und die Nachricht in leuchtenden Farben weitergereicht, besprochen und kommentiert hätte. Eine Welle geistiger Erhebung überflutete die Stadt und trug Professor Saluzzi, der gemessenen Schrittes sein Tagwerk verrichtete, dem großen Abend wie auf Musenflügeln entgegen. Auf dem Programm stand, dies sei hier, obwohl längst eine Selbstverständlichkeit, gesagt, das Concerto Grosso in e-Moll des großen und doch so tragisch verkannten Bergoneser Komponisten Ferrugio Amanzi.
Endlich war es soweit. Festlich geschmückt erstrahlte die Piazza Maggiore im Glanz der Lichter und an Dekorationen und Blütenpracht ward wahrlich nicht gespart worden, um dem Anlass den gebührenden Rahmen zu verleihen. Das Schwarz steifer Fräcke verdunkelte die dicht bestuhlten Reihen und dazwischen blitzten das blendende Weiß der krachenden Hemdbrüste der Herren und die Brillanten auf den zwar nicht immer schwanengleichen, aber dafür umso reicher behängten Hälsen der Damen, die einander mit offen zur Schau getragener Herzlichkeit und aus versteckten Blicken hervorbrechendem Hohn bedachten. Schon hatte das Orchester zu seinen Plätzen und Noten gefunden, schon der Konzertmeister die städtische Kapelle auf das A des Abends eingestimmt, da ging ein Raunen über den Platz, als Professor Gian-Battista Emanuele Vittorio Maria Saluzzi unter dem aufbrausenden Applaus – in einigem Abstand gefolgt vom Dirigenten, einem jungen Menschen, dessen Name nichts weiter zur Sache tut und der Verschwendung unnötiger Worte kaum erfordert –, als Professor Gian-Battista Emanuele Vittorio Maria Saluzzi die von fleißigen Handwerkern eigens für dieses Konzert errichtete Bühne betrat.
Sorgfältig und mit von langjähriger Liebe zur Musik durchgeistigten Händen hob er mit zarter Innigkeit die Geige an den Hals, ließ sich mit seitlich geneigtem Haupte und schönem Schwung der langen, weich gewellten Haare – Seufzer unter der Damenschar wurden hier laut –, ließ sich das A des Abends vom Konzertmeister darreichen, schüttelte milde den Kopf und korrigierte es mit einem leichthin gesprochenen Wort der Ermahnung, dem das Orchester sogleich voll Ehrerbietung und mit heiligem Eifer nachkam, und dann schenkte Professor Saluzzi auch dem Dirigenten, der eben in der Qual der Erwartung und unter dem Druck der Verantwortung und nicht zuletzt aus Ehrfurcht vor dem so überaus bewunderten Solisten dieses Abends bereits den dritten Taktstock zerbrochen hatte, schenkte diesem einen freundlichen Blick, der dennoch aus der Schwindel erregenden Höhe all der Jahre kam, die er diesem jungen Menschen an Erfahrung und Wissen um das Wesen der Musik voraushatte, und der eben darum diesen Menschen zwar ungewollt, aber umso wirkungsvoller in den Abgrund der Unwürdigkeit stieß, so dass zu fürchten stand, dass der Vorrat an Taktstöcken nicht für die ganze Länge des Abends genügen würde. Mit fiebrigen Augen nahm der Dirigent die huldvolle Erlaubnis des großen Solisten zu beginnen entgegen, hob die zitternden Hände in den dunklen Nachthimmel, an dem er vom silberkalten Licht der Sterne nicht Eingebung noch Hilfe zu erwarten hatte, und verharrte, nein, erstarrte für einen endlosen Augenblick, als ihn, doch nicht nur ihn, sondern auch jeden der Musiker, jeden Zuhörer, jeden noch so weit von der Piazza Maggiore entfernten Einwohner dieser Stadt, ja, selbst die Pflastersteine der Straßen, die Blätter an den Bäumen und die streunenden Katzen und Hunde von Bergonza das Geheimnis des Professors Gian-Battista Emanuele Vittorio Maria Saluzzi berührte.
Tja, dieses Geheimnis. Wie viele hatten schon gerätselt, worin es bestehen mochte. Was bewirkte diesen sonderbaren Zauber, der alle ergriff und in Bann schlug, wenn Professor Gian-Battista Emanuele Vittorio Maria Saluzzi zum Spiel ansetzte? Was ließ alle den Atem anhalten, was den Herzschlag für einen bedrohlichen Augenblick stocken? Hier, an dieser Stelle, sei es verraten. Es war … Konzentration, nein, mehr und besser noch, es war die Essenz der Konzentration, die Konzentration an und für sich. So und nicht anders war es mit dem Geheimnis des Professors Saluzzi beschaffen, und so und nicht anders nahm es als eine Quelle der Kraft seinen Anfang in ihm, weitete sich zu einem anschwellenden Meer, in dem alle und alles um ihn am Grunde des Schweigens endeten, um von dort, aus dieser Stille heraus, mit ihm, getragen von seinem virtuosen Spiel, zu den Ufern und Horizonten der Musik aufzubrechen und diesen Aufbruch zu erleben wie eine Geburt, wie einen Aufbruch zu einem anderen, einem besseren Leben, das Harmonie verhieß und zurückführte in die Gärten des Paradieses in einer Zeit vor dem Sündenfall, dorthin, wo die Zeit selbst Musik war und die Musik der Atem der Schöpfung.
So, wie an anderen seltenen Abenden zuvor, die wie Perlen auf die Kette der Erinnerung gereiht waren, so nahm das Geheimnis des Professors Gian-Battista Emanuele Vittorio Maria Saluzzi auch an diesem Abend seinen Lauf. Professor Saluzzi schloss die Augen, die er nicht vor dem Ende des musikalischen Werkes wieder öffnen würde, der Taktstock fiel, die Hände des Dirigenten eilten ihm im vergeblichen Versuch, diesen zu erhaschen, nach und das Concerto Grosso in e-Moll des großen und doch so tragisch verkannten Bergoneser Komponisten Ferrugio Amanzi erklang.
Hier nun geschieht Unverzeihliches, ja, geradezu Blasphemisches, denn an dieser Stelle des Concerto Grosso, an der doch vom großen Bergoneser Komponisten Ferrugio Amanzi nicht die kleinste Pause vorgesehen war, unterbrechen wir den Lauf der Erzählung, zerschneiden wir grausam den funkelnden Strom der Musik und wenden uns einem Phänomen zu, das allgemein als Stein des Anstoßes bezeichnet wird.
Wahrlich ein sonderbares Phänomen, das so klein und unbedeutend seinen Anfang nimmt, um aus einer Winzigkeit einen Giganten entstehen zu lassen. Wer kennt nicht das Bild des Schmetterlingsflügels, dessen zarter Schlag auf der jenseitigen Hälfte des Erdballs einen Wirbelsturm auszulösen vermag? Oder wer hat nicht schon das Beispiel des Wasserglases gesehen, dessen Inhalt von einem zwar leichten, aber stets gleichbleibenden, regelmäßigen Stoß zur Resonanzkatastrophe angeregt, bald über den Rand schwappt? Man kennt es, und es ist zu Beginn so klein, so nichtig, ein Nichts, ein Kieselstein vielleicht. So wie hier. So wie auch an diesem Abend. Ein Kieselstein. Mehr nicht.