
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Gemeinsam mit dem sprechenden Vogel Tanit und ihren Freunden Horn und Jock versucht die junge Eja zu verhindern, daß der letzte der fünf Ondurilsteine in die Hände des machtgierigen Asar fällt. Gelingt dies nicht, ist ganz Erdherz vom Untergang bedroht. Eine weite Reise beginnt, die Eja und ihre Gefährten durch eine Welt voller Abenteuer, Gefahren und seltsamer Wesen führt. Eine Reise, auf der sich die Rätsel von Erdherz und die Geheimnisse um Ejas Herkunft zu einer gemeinsamen Geschichte verbinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 881
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Teil 1
Die Stadt im Westen
1. Kapitel
Das Geschenk
2. Kapitel
Das Deichfest
3. Kapitel
Gorres Lied
4. Kapitel
Tanit
5. Kapitel
Eja
6. Kapitel
Horn Elder
7. Kapitel
Das Grab
8. Kapitel
Die Nebelfelder
9. Kapitel
Die Kiklits
10. Kapitel
Die Flucht
11. Kapitel
Das Floß
12. Kapitel
Die Wüste
13. Kapitel
Der Gesang der Tamahu
14. Kapitel
Das Meer des Nordens
15. Kapitel
Far-Uhl
16. Kapitel
Die Merod der Balhi-jata
17. Kapitel
Bhaskara
18. Kapitel
Am Sandarak
19. Kapitel
Unverhoffte Begegnung
20. Kapitel
Neue Pläne
21. Kapitel
Der Sturm der Zeit
22. Kapitel
Die Jagd
Teil 2
Der fünfte Stein
1. Kapitel
Erwachen
2. Kapitel
Erinnerung
3. Kapitel
Althaia
4. Kapitel
Der Weg der Geschichte
5. Kapitel
Der Rat der Edrahil
6. Kapitel
Nur ein Märchen
7. Kapitel
Südwärts
8. Kapitel
Der Gang
9. Kapitel
Die Brücke
10. Kapitel
Der Silberwald
11. Kapitel
Das Land ohne Schatten
12. Kapitel
Die Höhlen der Prazûl
13. Kapitel
Der Baum der Träume
14. Kapitel
Advenas Weg
15. Kapitel
Der brennende Pfeil
16. Kapitel
Asar
17. Kapitel
Der kleine und der große Narr
18. Kapitel
Warten
19. Kapitel
Das Tal der Vögel
20. Kapitel
Der Erzähler
21. Kapitel
Die Trennung des Bundes
22. Kapitel
Rückkehr nach Althaia
Vorwort
Es sind mehr als 25 Jahre vergangen, seit der Roman «Die Steine der Wandlung» erschienen ist. Nun möchte ich dieses Buch mit einer überarbeiteten und korrigierten Neuauflage wieder zugänglich machen.
Inspiriert durch die Lektüre von Tolkiens «Der Herr der Ringe» habe ich meinen ersten Fantasy-Roman geschrieben. So ist dieses Buch auch ein Dank an J.R.R. Tolkien, dessen fantastische Welt mir die Augen für meine eigene Fantasie geöffnet hat. Dafür bin ich noch heute dankbar.
Der Roman ist aber auch eine mitunter augenzwinkernde Hommage zu Tolkiens Ehren, mit zahlreichen Anspielungen auf «Der Herr der Ringe». Und selbst der Name «Tolkien» taucht zweimal auf spielerische Weise auf. Doch wo sich dieser versteckt, dieses Rätsel zu lösen überlasse ich dem Spürsinn der Lesenden.
Teil 1 Die Stadt im Westen
1. Kapitel
Das Geschenk
«Jock Aiting, du Narr! Du willst wohl wie eine jämmerliche Katzgeburt ersaufen? Da läufst du in der schlimmsten Regenschwemme seit Brasengedenken durch den Wald, während andere warm und behaglich am Feuer sitzen. Du Narr bist wohl erst glücklich, wenn du vor deiner Haustüre treibst, mit der Nasenspitze nach unten schaukelnd.»
Jock zog seinen Umhang mit klammen Fingern fester um sich. Die Kapuze ließ nur seine breite, tropfende Nase und seine Augen frei. Dicht drängte er sich an die nasse, schwarz glänzende Rinde eines verwitterten Baumriesen. Doch auch hier fand er keinen Schutz vor Wind und Wetter. Von allen Seiten trieb der Sturm seine Regenschauer wie Wasserwände heran und versuchte, dieses Häuflein Mensch so gründlich aus der Welt zu schaffen, als hätte es Jock nie gegeben.
Jock schimpfte und jammerte leise vor sich hin, dann lachte er plötzlich grimmig auf, verschränkte die Arme und hielt eine Rede in das Heulen des Windes hinein: «Nun, Meister Sturm, wenn Ihr’s nicht lassen könnt, so habt Euren Spaß und blast Euch nur die Seele aus dem Leib. Schließlich werdet Ihr doch ein Einsehen haben müssen, wenn Euch die Luft ausgeht. Beim ersten Sonnenstrahl ist’s dann vorbei, und Meister Aiting pfeift auf Euch. Ich will Euch also nicht weiter stören. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit Möchtegernen abzugeben. Ich sage nur, falls Ihr einen echten Aiting kennenlernen wollt, dann gebe ich Euch hier Gelegenheit dazu. Ihr werdet schon sehen, was Ihr …»
Plötzlich verstummte Jock, duckte sich rasch und kauerte sich zwischen die armdicken Baumwurzeln. Er hatte eine Stimme gehört. Eine schimpfende Stimme! Machte ihn da etwa jemand nach? Wer wagte es, ihn zu foppen? Na warte, dachte er. Komm nur näher, und ich zeig dir, was eine rechte Maulschelle ist!
Vorsichtig hob er den Kopf über die Wurzeln und spähte zwischen die Bäume. Es war schwer, etwas im Regen und im schwächer werdenden Licht der Dämmerung zu erkennen. Er sah nur einen Vogel auf dem Ast einer altersschwachen Ulme, der versuchte, unter den Blättern Schutz vor Regen und Wind zu finden, und der vor sich hin schimpfte.
Schimpfte? Jock starrte das Tier an. Ein sprechender Vogel? Und was für ein schöner obendrein! Beinahe so groß wie ein Kolkrabe, mit schwarzen, bläulich schimmernden Federn und einem kräftigen, leicht gebogenen Schnabel, der hell und silbern glänzte.
Pfeifend fuhr die Luft aus Jocks Lungen, die zu lange nicht mehr geatmet hatten. Der Vogel sah in Jocks Richtung. Jock bewegte sich nicht. Was für ein Fang das wäre, dachte er. Flieg bloß nicht fort! Doch der Vogel trat nur unsicher von einem Bein aufs andere und blickte unruhig umher.
Leise zog Jock eine Schleuder unter seinem Wams hervor und einen runden Stein aus dem Beutel, der an seinem Gürtel hing. Er legte den Stein in die Lederschlaufe und bewegte seinen Arm behutsam hinter sich. Dann, in dem Augenblick, als der Vogel seinen Blick ganz abwandte und die Flügel ausbreitete, um davonzufliegen, und dabei in den Beinen einknickte, um sich abzustoßen, in diesem unachtsamen Augenblick zwischen Ast und Flug, schnellte Jock den Arm über seinen Kopf hinweg und schleuderte den Stein. Der Stein traf den Kopf des Vogels, der lautlos zu Boden stürzte und unhörbar auf der weichen Erde aufschlug.
Mit hellem Jubelruf sprang Jock auf und eilte zu seiner Beute. Der Vogel rührte sich nicht. Er blutete aus einer kleinen Wunde am Kopf. Jock kniete nieder und legte die Hand auf das Tier. Das Herz schlug, der Vogel war nur betäubt. «Ein Meisterwurf!», rief Jock. «Ein echter Aiting!»
Vorsichtig band er Flügel und Beine des Vogels zusammen und wickelte ein Stück Stoff um die spitzen Krallen. Dann lief er zum Baum zurück und holte seinen Beutel. Er steckte den Vogel hinein, warf sich den Beutel über und machte sich auf den Weg.
Es war schon dunkel, als er den Dreieichenweg erreichte, der zum Hulzenhof führte. Der Sturm hatte sich inzwischen gelegt. Ein milderer Wind trieb die Wolken fort und gab den Nachthimmel frei. Dennoch hob sich das Haus im schwachen Licht der Sterne kaum vom Schwarz des Waldes ab. Nur der flackernde Schein eines Feuers, der durch die dünngegerbte Haut der Fenster drang, schwebte im Dunkel der Nacht. Jock atmete auf. Vielleicht bin ich noch nicht zu spät, dachte er und klopfte an die Tür.
«Nur herein mit dir, Jock», antwortete die knarrende Stimme des alten Alva Aiting auf sein Klopfen. «Nur herein mit dir und der ganzen Zeit der Welt, die du dir genommen hast, um uns armen Tröpfen das Leben sauer zu machen.»
Jock trat unter die Tür, zog unter Alvas Wortschwall schuldbewusst den Kopf zwischen die Schultern und schloss ergeben die Augen.
«Nein, du bist noch nicht zu spät», polterte Alva, als hätte er Jocks Gedanken erraten. «Eja Grünauge allein hast du das zu danken. Lieber hätte sie uns alle verhungern lassen, als zuzugeben, dass ihr Jock Aiting, der Freund der Schnecken und Einbeinigen, zu spät zu ihrem Geburtstagsfest erscheint. Ei nein, ei niemals, also hat sie uns darben lassen, um nur ja im Recht zu bleiben.»
Ein helles Lachen unterbrach den Alten. «Nun aber genug, Alva», rief Eja und zog Jock in die Stube. Jock öffnete die Augen und blickte sie dankbar an. Eja drückte ihn sanft auf einen Stuhl.
Eine kleine Gesellschaft hatte geduldig auf den späten Gast gewartet, mit leeren Mägen vor leeren Tellern, während ein köstlicher Duft aus vollen Töpfen die Stube erfüllte. Alva Aiting und Ejas Eltern, Una und Lars Tordal, und Eja, die heute ihren sechzehnten Geburtstag feierte. Ein wichtiger Tag für sie und ihre Eltern, denn in diesem Alter erlangte eine junge Brasin nach alter Sitte der Duna ihre Mündigkeit.
Una drückte Jock eine dampfende Schale heißen Tee in die Hände und hängte seinen tropfenden Umhang ans Feuer. Vorsichtig nippend trank Jock und fühlte, wie die Wärme langsam in seine erstarrten Glieder zurückkehrte.
Seinen Beutel hatte er auf die Ofenbank gestellt. Verstohlen äugte er zuweilen dorthin. Hoffentlich verdirbt mir der Vogel nicht die Überraschung, dachte er. Wenn er nur noch eine Weile stillhält. Doch der Vogel war entweder noch nicht wieder zur Besinnung gekommen oder er wagte nicht, sich zu rühren.
«Nun, da wir vollzählig sind, kann endlich ein wenig Festlichkeit bei uns einkehren», meinte Lars Tordal.
Er nahm ein Stück Holz und ein Messer zur Hand, fertigte mit wenigen Schnitten einen kräftigen Kienspan an und entzündete diesen am Herdfeuer. Den brennenden Span gab er Eja und sagte: «Seit deiner Geburt war es unsere Aufgabe, dir die Wärme eines Heimes und unserer Liebe zu geben. Jetzt hast du ein Alter erreicht, in dem der Keim für dein eigenes Leben liegt, für deine eigenen Wege. Dieser brennende Span sei ein Zeichen für dich, dass unser Heim und unsere Liebe immer bei dir sein werden, wohin dein Schicksal dich auch führen mag.»
Dann schwieg er, und einen stillen Augenblick lang sahen sie in die Flamme, deren unruhiges Flackern ihnen wie ein eiliges Flüstern erschien, dessen Worte sich überschlugen, weil die Zukunft so reich und vielgestaltig war, dass niemand von ihr erzählen konnte, bevor sie nicht in der Vergangenheit zur Ruhe gekommen war. Die Flamme tanzte in Ejas Augen, in deren tiefem Grün ein aus ihrem Innersten kommendes Licht dem Feuer wie eine Antwort entgegenleuchtete. Der Zauber, der alle erfasste, schien endlos. Doch als sich das Feuer Ejas Fingern näherte, tauchte sie den Kienspan in eine Schale Wasser, und das Zischen der verlöschenden Flamme weckte sie aus ihren Träumen.
Nun ließen sie sich Una Tordals Gerichte schmecken, und nicht lange, da scherzten und lachten sie alle, und selbst der alte Alva gab seine Geschichten so herzerfrischend zum Besten, als würde er sie nicht zum hundertsten Male erzählen, sondern als hätte er sie eben erst erfunden. Nur Jock wollte nicht so recht in diese Fröhlichkeit passen. Unruhig rutschte er auf seinem Stuhl herum und schielte zu seinem Beutel hinüber.
Schließlich erbarmte sich Lars Tordal, dem Jocks sonderbares Benehmen nicht entgangen war. «Nun, Jock, mir scheint doch, dir sitzt etwas auf dem Herzen, das schnell heraus muss, sonst könnte es passieren, dass es zu groß wird und einen gewissen jungen Aiting zum Platzen bringt.»
Eine feine Röte schlich sich auf Jocks braune Wangen. Er senkte verlegen den Kopf, doch seine Augen blitzten unter den wirren Strähnen seines dunklen Haarschopfes hervor. Geheimnisvoll schweigend stand er auf, holte seinen Beutel, stellte ihn vorsichtig auf den Tisch und begann ihn betont langsam und umständlich zu öffnen.
«Nun seht euch den Meister Heimlichtuer an», brummte Alva. «Da müssen ja wahre Schätze drin verborgen sein.»
Jock grinste nur verschmitzt und geschmeichelt und wurde noch langsamer und ungeschickter.
«Nun mach schon, Jock!», rief Eja aufgeregt.
Endlich hatte Jock den Beutel geöffnet und sagte feierlich:
«Mein Geschenk, Eja. Zu deinem Geburtstag.» Dann griff er mit der Hand in den Sack, zog diese aber gleich wieder mit einem Schrei heraus und steckte mit schmerzverzerrtem Gesicht einen blutenden Finger in den Mund.
Alle lachten über den armen Tropf, und Alva rief: «Eine Bestie! Ein Ungeheuer! Jock hat wohl einen Drachen herangeschleppt. Was für ein edles Geschenk.»
Da packte Jock verärgert seinen Beutel, drehte ihn um und schüttete den Inhalt kurzentschlossen auf den Tisch. Als der gefesselte Vogel auf der Tischplatte aufschlug, entfuhr es ihm: «Schairi, feldar a minait bosnag!» Sogleich aber klappte er seinen Schnabel wieder zu, zog wie ertappt den Kopf zwischen die Flügel und blieb reglos liegen.
«Wie herrlich!», jubelte Eja und klatschte in die Hände. «Ein sprechender Vogel! Was für ein schönes Geschenk!» Sie streckte die Hand aus und wollte den Vogel streicheln.
«Vorsicht!», rief Jock, der wieder seinen Finger in den Mund gesteckt hatte. Doch der Vogel hatte die Nähe der Hand bereits gespürt und machte eine schnelle Bewegung mit dem Kopf, um sich zu verteidigen. Eja zuckte zurück.
In diesem Augenblick sahen Eja und der Vogel einander an. Die Augen des Vogels waren von demselben leuchtenden Grün wie Ejas Augen. Es schien Eja, als wären diese Augen, die ebenso überrascht und fragend blickten, wie sie selbst es wohl tat, nicht die Augen eines Tieres, sondern menschlich wie die ihren. Lange konnten sie den Blick nicht voneinander lösen. Doch dann wurde der Vogel unruhig und wandte sich ab. Eja schaute verwirrt um sich und sah gerade noch, dass Una die Hand von Lars umkrampft hielt. Ihr Gesicht war blass wie nach einem großen Schreck. Als sie aber sah, dass Eja es bemerkt hatte, zwang sie sich rasch zu einem Lächeln, zog ihre Hand zurück und legte sie still in den Schoß.
Alva unterbrach das Schweigen: «Nun seht euch nur diese Augen an! Da scheint unsere Eja Grünauge wohl zu einem Zwilling gekommen zu sein, wenn man das von einem Vogel überhaupt sagen kann. Aber wenn er auch diese Augen hat, und wenn er auch redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, so habe ich doch kein Wort davon verstanden. Es werden wohl keine rechten Worte gewesen sein. Das arme Vieh wird irgendwo was aufgeschnappt haben, was es nun sinnlos nachplappert.»
«Ich weiß nicht», sagte Eja. «Es klang doch wirklich so, als wollte der Vogel etwas sagen. Und dann, diese Augen, so … ach, ich weiß nicht.»
«Na klar kann der Vogel richtig sprechen», rief Jock, der gar nicht begeistert war, dass seinem Geschenk auch nur ein Jota an Wert genommen werden sollte. «Ich werde es euch beweisen.»
Vorsichtig packte Jock den Vogel, wobei er die Nähe des Schnabels mied, band seine Krallen los und stellte ihn auf die Beine. Dann stupste er ihn und sagte: «Na komm schon, rede, sag was, und zeig, was du kannst!»
Doch der Vogel schwieg und schaute bloß auf dem Tisch herum, als gingen ihn die unverständlichen Absichten der menschlichen Wesen nicht das Geringste an.
«He!», schimpfte Jock. «Du glaubst wohl, du kannst uns was vormachen. Du denkst dir wohl, wenn du kein Wörtchen mehr von dir gibst, kommst du einfach so davon und wir lassen dich wegfliegen. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen.»
«Ach, lass ihn doch, Jock! Vielleicht hat er ja nur Hunger und Durst», meinte Eja. «Sei nett und hol ein paar Würmer aus dem Garten und was so ein Vogel sonst noch frisst.»
Schmollend trollte sich Jock hinaus. Eja füllte eine kleine Schale mit frischem Wasser und stellte sie vor den Vogel, der nach anfänglichem Zögern und misstrauischen Seitenblicken durstig zu trinken begann. Und als Jock wieder hereinkam, mit schmutzverschmierten Händen, in denen er eine stattliche Anzahl Regenwürmer hielt, verfolgte der Vogel neugierig, was sie taten.
Eja nahm einen dünnen Zweig, schnitt in sein eines Ende eine Kerbe, in der sie einen der Regenwürmer festklemmte. Dann hielt sie dem Vogel den Wurm vor den Schnabel. Der Vogel zuckte entsetzt zurück, und es schien allen, als würde er den Wurm voller Abscheu und Ekel anblicken.
«Na, so was!», staunte Alva. «Das ist aber ein seltsamer Vogel, der solch einen Leckerbissen verschmäht. Womit soll man ihn denn satt kriegen?»
Doch was sie auch versuchten, Körner, eine Fliege, Käfer, Ameisen, Mücken, der Vogel nahm nichts an. Schließlich gaben sie es auf. Doch während sie noch überlegten, was zu tun sei, trippelte der Vogel auf dem Tisch umher und kam dabei in die Nähe von Unas Heidelbeerkuchen. Kaum hatte er diesen erspäht, stürzte er sich mit Begeisterung darauf und begann hungrig einen Bissen nach dem anderen in sich hineinzuschlingen.
«Das hat die Welt noch nicht gesehen», rief Alva. «Ein Vogel, der eine gute Küche zu schätzen weiß. Vielleicht kann ihm Una noch von ihrem Pilzgericht anbieten.» Er schöpfte selbst etwas davon in eine Schale, die er dem Vogel hinschob. Und auch die Pilze ließ sich der Vogel gut schmecken.
«Nun, die Frage der Ernährung ist damit gelöst», meinte Alva. «Ich fürchte, Una, da hat dir Jock einen ungebetenen Esser mehr aufgehalst. Aber was für ein seltsamer Gast. So einen Vogel habe ich noch nie gesehen. Was für eine Art das wohl sein mag?» Doch niemand wußte ihm darauf eine Antwort zu geben.
«Er muss einen weiten Weg hinter sich haben», sagte Eja. «Sicher hätte er uns viel zu erzählen, wenn er nur wollte und wir ihn verstehen könnten.»
«Ich weiß, was wir machen», rief Jock. «Wir können doch Horn fragen. Der ist viel herumgekommen, mehr als jeder andere von uns und alle sonst im Raunatal. Der wird sicher eine Antwort wissen. Wo er jetzt wohl stecken mag?»
«Aber warum denn? Das ist doch nur irgendein Vogel. Was müsst ihr denn wissen, woher er kommt?», sagte plötzlich Una mit einer Stimme, die so voller Angst war, dass alle sie erstaunt ansahen.
«Schon gut, Una», meinte Lars und legte seine Hand beschwichtigend auf ihre Hand. «Es ist schon richtig so. Am besten ist, Eja entscheidet, was mit ihrem Geschenk geschehen soll. Sie ist nun in einem Alter, in dem sie lernen muss, selbst Entscheidungen zu treffen. Wohin das auch immer führen mag, es ist wohl die richtige Zeit dafür gekommen, nicht wahr?»
Er sah Una ernst und forschend in die Augen, ohne seine eigene Unruhe verbergen zu können. In Unas Augen traten Tränen, und da sie nicht wollte, dass die anderen dies sahen, senkte sie den Kopf und sagte leise: «Ja, es ist wohl gut so.»
Eja konnte nicht verstehen, warum die beiden so beunruhigt waren. Es war doch wirklich nur ein Vogel. Doch sie wollte ihren Eltern nicht weh tun und sagte: «Wir können ja morgen entscheiden, was zu tun ist. Es eilt ja nicht.»
«Ja, es eilt nicht», meinte ihr Vater. «Schlafen wir darüber und sehen, was der morgige Tag bringt.»
Ein sonderbarer Schatten hatte sich über die kleine Gesellschaft gelegt, und es wollte keine rechte Fröhlichkeit mehr aufkommen.
Alva und Jock verabschiedeten sich bald und brachen auf. Doch unter der Tür wandte sich Jock noch einmal an Eja. «Morgen komme ich wieder und baue dir einen schönen, großen Käfig für den Vogel. Pass auf, dass er dir bis dahin nicht davonfliegt!»
Als die beiden gegangen waren, schloss Lars die Läden vor den Fenstern, verriegelte sorgfältig die Tür und verschloss auch die Rauchklappe über dem Herd, so dass dem Vogel kein Fluchtweg mehr blieb. Dann löste er die Schnur, mit der die Flügel zusammengebunden waren. Der Vogel ließ alles mit sich geschehen und fügte sich den ruhigen Händen Lars Tordals ohne Gegenwehr. Er schien sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben und auch zu erschöpft zu sein, um sich auf einen Kampf einzulassen.
Eja trat vor ihn und sagte: «Du kannst mich sicher nicht verstehen, aber ich will dir doch sagen, dass du keine Angst haben musst. Ruh dich gut aus! Du hast sicher schlimme Tage hinter dir.»
Der Klang ihrer Stimme schien dem Vogel gutzutun. Er sah Eja dankbar an. Wieder hielt die Ähnlichkeit ihrer Augen sie gefangen. Eja hob vorsichtig eine Hand und streichelte sanft den Kopf des Vogels, der dies geschehen ließ und wie zur Antwort mit seinem Schnabel leicht über Ejas Hand strich. Und als Eja eine alte Decke auf die Ofenbank legte, die dem Tier als Schlafplatz dienen sollte, ließ sich der Vogel ohne Scheu darauf nieder.
«Nun komm, Eja», sagte Una. «Es ist Zeit zu schlafen.» Sie schloss Eja in die Arme und drückte sie lange an sich, als hätte sie Angst, sie zu verlieren und als wollte sie Eja nicht mehr loslassen.
«Gute Nacht, Mutter», sagte Eja. «Gute Nacht, Vater.»
Sie ging in ihr Zimmer und legte sich ins Bett. Eine Weile noch lauschte sie auf die Geräusche des Hauses und der Nacht. Dann schlief sie ein. In dieser Nacht träumte sie von seltsamen stummen Wesen, deren grüne Augen ihr etwas zu sagen schienen, das sie nicht verstehen konnte, so sehr sie es auch versuchte.
2. Kapitel
Das Deichfest
Ohne Erinnerung an die Träume dieser Nacht erwachte Eja. Lange lag sie mit offenen Augen in ihrem Bett und blickte zur Decke des Zimmers hinauf, an der die Lichter, die die Sonne durch die Blätter warf, wie im Spiel umhertanzten.
Vor dem Fenster erklangen die Laute des frühen Morgens. Der Tag dehnte sich und schüttelte den Schlaf aus seiner Stille, seinem Licht und aus der Kühle des schwindenden Morgentaus auf den Blüten, den Spinnweben und den Gräsern, die im Winde wehten und mit ihm zwischen Himmel und Erde schwankten.
Da fiel ihr der Vogel ein. Schnell waren Schlaf und Müdigkeit vergessen, und was noch blieb, vertrieb das kalte Wasser, mit dem sie sich wusch. Sie lief in die Wohnstube, plötzlich von Angst erfüllt, der Vogel könnte davongeflogen sein oder alles nur ein Traum. Doch der Vogel war da und wirklich, hüpfte in der Stube flügelschlagend umher und flatterte erschreckt auf, als Eja so plötzlich hereinstürmte.
Eja lachte und begrüßte ihn mit zärtlicher Stimme, die ihn sogleich beruhigte. Ohne Scheu flog er zu ihr und setzte sich auf ihre Schulter. Sie streichelte ihn und lief mit ihm zu ihrer Mutter, die das Essen zubereitete. «Ist er nicht schön?», rief sie. «Und wie gut wir uns schon verstehen. Was für ein Geschenk!»
Una lächelte über ihr Glück. Doch noch immer betrachtete sie den Vogel voller Scheu und mit einem Unbehagen, das sie sich selbst nicht erklären konnte. Jedes Mal, wenn sie ihn ansah, erschrak sie über die Menschlichkeit seiner grünen Augen und die Ähnlichkeit mit Eja. Doch dann schalt sie sich selbst eine Närrin und schüttelte die Beklemmung wie einen albernen Tagtraum ab. Es war doch nur ein Vogel.
Ein seltener, nie gesehener obendrein, dem es wohl anstand, so sonderbare Augen zu haben. Also gab sie sich freundlich und war tief berührt, wie rasch der Vogel ihre Zuneigung erwiderte und voll Ernst Gleiches mit Gleichem vergalt.
Unterdessen war Eja hinausgelaufen, wobei sie nicht vergaß, die Türe sorgfältig hinter sich zu schließen. Sie lief zu ihrem Vater in den Stall und half ihm, die Ziegen zu melken, die Schweine, Hühner und Kaninchen zu versorgen und frisches Wasser vom Brunnen ins Haus zu tragen.
Als sie fertig waren, setzten sie sich zu Tisch. Der Vogel mit seiner so untierischen Vorliebe für menschliche Nahrung sorgte für Heiterkeit, und unter Lachen und Scherzen zerstreuten sich alle Bedenken, die das seltsame Geschenk mit so viel Ängsten und Verwirrung umgeben hatten.
«Heute sollst du zu Ehren deines Geburtstages einen freien Tag haben», sagte Lars Tordal. «Und am Abend wollen wir gemeinsam ins Dorf zum Deichfest gehen. Du darfst zum ersten Mal dabei sein, wenn die großen Geschichten erzählt werden. Das ist ein wichtiger Tag für dich, Eja.»
Eja ließ sich das nicht zweimal sagen. Kaum hatten sie zu Ende gegessen, sprang sie vom Tisch auf und wollte mit dem Vogel auf der Schulter zur Türe hinaus.
«Halt, langsam, Eja!», rief Lars Tordal. «So wirst du nicht lange Freude an deinem Geschenk haben. Lass ihn lieber hier. Noch ist er nicht so zahm, dass er bei dir bleibt.»
Das musste sie einsehen und schweren Herzens ließ sie den Vogel zurück. «Ich komme bald wieder», sagte sie zu ihm und lief hinaus.
Die Wärme der Morgensonne, die mit den kühlen Lüften spielte, der blaue Himmel, der so wolkenlos und hoch war, dass man nicht lange in ihn blicken konnte, ohne zu glauben, sogleich in ihn hineinfallen zu müssen, endlos tief und endlos weit, die Blumen, die Wiesen, die Bäume, die Vögel und Bienen, das ganze geschäftige Treiben des frühen Tages halfen Eja bald über den kleinen Kummer hinweg, den Vogel zurücklassen zu müssen. Schon hatte sie sich in diesen Tag verliebt und lief den Dreieichenweg entlang. Dann bog sie in den Illmenweg ein und folgte diesem, solange er noch erkennbar war, bis sie schließlich ohne Pfad weiterlief, über Wiesen und durch kleine Böschungen, immer höher hinauf, das Tal immer weiter hinter sich zurücklassend.
Endlich erreichte sie ihr Ziel, das alte Fennerjoch, eine breite Hügelkuppe, auf der eine Wiese auf drei Seiten von dichtem Wald umschlossen wurde. An ihrem offenen Ende stand eine große Kastanie, ganz nahe am Abhang, der sich steil bis weit ins Tal senkte. Von dort hatte sie einen wunderbaren Ausblick auf die Rauna, die sich in sanften Schwüngen durch das weite Tal zog.
Eja liebte diesen Ort und diesen Baum und ließ keine Gelegenheit aus, hierherzukommen und ihren Gedanken freien Lauf zu lassen. Sie setzte sich in den Schatten zwischen die mächtigen Wurzeln des Baumes und blickte verträumt ins Tal hinab.
Das Raunatal lag still und fern unter ihr. Im klaren Licht der Frühe reichte ihr Blick weit vom Anfang des hochgelegenen Tales bis zu seinem Ende hin und fing sich an den scharfen, überdeutlichen Linien der Berge, die das Tal steinern umklammerten und zugleich schützend gegen die Außenwelt verschlossen.
Hoch ragten die Berge empor, an der Spitze nicht selten von ewigem Schnee bedeckt. Im Westen am höchsten standen Mutwand, Altenberger, Rosskopf, Schreckhorn und Ortel, im Osten Ziegenspitz, Mitterberg, die Türme der Gelfen und höher noch und gewaltig alle überragend die mächtige Weißzinne. Tief im Süden trafen die beiden Bergketten aufeinander. Undeutlich war in der Ferne das Rothorn zu sehen, über dessen Pass die Bewohner des Tales einst gekommen waren.
Zu Fluss und Berg
ins grüne Tal
nach Winters Nacht
mit Wolf und Wind
als kalt das Herz
und Auge blind
da kamen wir
am End der Qual
zu Fluss und Berg
ins schöne Tal
Eja sang vor sich hin und blickte durch die Blätter in das Muster aus Sonnenlicht und Himmelsblau hinauf. Neben ihr tauchte Jock auf und machte es sich auf einer Wurzel bequem. Als Eja verstummte, setzte er das Lied fort:
Bei Baum und Strauch
im grünen Tal
da merkten wir
mit einem Mal
der Brase hat
auch einen Bauch
doch hat ein End
auch diese Qual
an Herd und Tisch
im schönen Tal
«Das hast du erfunden», sagte Eja lachend. «Diese Strophe habe ich sicher noch nie zuvor gehört.»
Jock rutschte an der Wurzel hinab, bis er neben Eja lag, verschränkte die Arme unter dem Kopf und blickte wie sie in das Spiel des Lichts hinauf. Dann pfiff er Suso, den alten Hofhund der Aitings, der ihn begleitet hatte, heran und sagte: «Das war auch nötig, Eja. Man muss ja Sorge zu dir tragen. Wenn du noch länger hier gelegen und geträumt hättest, wäre in deinem Bauch ein Loch gewachsen, das den ganzen Berg verschlingen kann. Es ist längst Mittag und Essenszeit. Also komm, ich habe dafür gesorgt, dass reichlich etwas da ist.»
Er setzte sich auf und packte seinen Beutel aus, legte Äpfel, Nüsse und Brot auf eine Decke und einen Ziegenlederschlauch mit Wasser daneben. Eja ließ sich nicht zweimal bitten und griff zu.
Nachdem der erste Hunger gestillt war, meinte Jock mit vollem Mund: «Ich war inzwischen nicht faul und habe einen Käfig für deinen Vogel gebaut. Ich habe ihn bei euch zu Hause abgestellt, bevor ich hierhergekommen bin. Es bleibt uns vor dem Fest noch genug Zeit, um den Käfig auszuprobieren. Aber lass uns erst ein wenig schlafen. Ich bin noch müde von gestern Abend, und es wird heute sicher spät werden.»
«Einverstanden», sagte Eja. «Was Essen und Schlaf angeht, tut jeder gut daran, auf Jock Aiting zu hören, der darin wahrhaft ein Meister ist.»
Jock zog Eja scherzhaft strafend an ihren langen Haaren, und eine Weile balgten sie sich und verfolgten einander über die Wiese, während Suso wild kläffend um sie herumsprang, bis sie müde und erhitzt zurück in den Schatten des Baumes liefen, sich hinlegten und Seite an Seite einschliefen.
Eja schlief unruhig. Sie träumte, eine Stimme, die sich kaum vom Rauschen der Blätter im Wind unterschied, würde sie rufen, und als sie hinaufblickte, um zu sehen, wem die Stimme gehörte, sah sie in der Rinde des Baumes zwei große grüne Augen, die sie ernst anblickten. Eja konnte den Blick nicht abwenden. Es war ihr, als würde sie so tief in diese Augen sehen können, dass ihr Blick bis in den Stamm, in das Herz des Baumes wanderte und, tiefer noch, bis in seine Wurzeln hinab und von dort weiter in das Dunkel der Erde, das aber nicht schwarz war, sondern hell erleuchtet von einem grün funkelnden Licht, das Eja ganz und gar vertraut schien, als würde sie in sich selbst hineinblicken, und während sie tiefer und tiefer sank, neigte der Baum seine Zweige zu ihr herab, als wolle er sie wie mit Armen umfangen und für immer einschließen und mit hinabziehen in diese endlose Tiefe, die unergründlich war, erschreckend und verlockend zugleich.
Doch in dem Augenblick, als die Blätter des Baumes sie berührten und sie die kühle Haut der Zweige spürte, erwachte Eja und setzte sich verwirrt auf. Der Baum erhob sich still über ihr, blicklos und stumm, nur die Zweige und Blätter schwangen sanft im Wind. Und doch war es ihr, als könne sie in dem Baum mehr Lebendigkeit spüren, als ihm beim bloßen Hinsehen anzumerken war, als müsse er ein Geheimnis verbergen, das nicht für das Licht des Tages und die Neugier menschlicher Blicke bestimmt war, sondern nur für die Wahrheit und Verschwiegenheit der Träume.
Sie lehnte ihre Wange an den Stamm, schloss die Augen und richtete ihr ganzes Wesen diesem Baum entgegen, ohne sich zu fragen, warum sie es tat, und ohne Erstaunen über diese neue Welt, die sich hier vor ihr auftat, eine Welt, in der die Träume die Grenze zum Wachsein überschritten und nicht weniger wirklich waren als die gewohnten Geschehnisse des Tages.
Jock, der sich neben ihr regte, rief sie in die Wirklichkeit zurück. Gähnend setzte er sich auf, kratzte sich am Kopf und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Dann sprang er mit einem Blick auf die Sonne eilig auf und rief: «Jetzt aber los, Eja, wir haben ja den halben Tag verschlafen.»
Tatsächlich begann die Sonne schon zu sinken, und die Schatten waren lang geworden. Sie packten rasch die Reste ihrer Mahlzeit ein und liefen mit Suso um die Wette zum Hulzenhof zurück.
Als sie ankamen, fanden sie das Haus verlassen vor. Lars und Una waren sicher schon ins Dorf vorausgegangen. Der Vogel saß im Haus auf einer Stange, an der Lars eines seiner Beine mit einer Schnur festgebunden hatte, die es dem Vogel erlaubte, kurze Strecken herumzuflattern. Ab und zu pickte er mit seinem Schnabel an der Schnur herum, als wolle er sie loswerden und wieder freikommen.
Suso, der sich neugierig der Stange näherte und nach dem Vogel schnupperte, schien ihn zu ängstigen, so dass Jock den Hund fortschickte. Beleidigt kniff Suso den Schwanz ein und schlich sich davon, nicht ohne den Vogel mit einem nahezu menschlichen Blick der Verachtung zu strafen.
«Wir haben noch etwas Zeit», meinte Jock. «Lass uns den Käfig ausprobieren, dann können wir sicher sein, dass dein Vogel nicht das Weite suchen kann.»
Er holte den Käfig aus dem Schuppen und stellte ihn vor den Vogel. Der Käfig war groß und geräumig aus kräftigen Weidenzweigen zusammengefügt, mit einer kleinen Tür, die ein Band verschloss.
Jock öffnete den Käfig und näherte sich möglichst unauffällig dem Vogel, der ihn neugierig und mit argwöhnischen Blicken beobachtete. Plötzlich packte Jock schnell zu, steckte den Vogel, ohne erst die Schnur an seinem Bein zu lösen, in den Käfig und schloss die Tür hinter ihm.
Als der Vogel begriff, was mit ihm geschehen war und dass ihm nun gar kein Ausweg mehr blieb, begann er wild zu toben und so verzweifelt gegen die Stäbe des Käfigs anzustürmen, dass er in Gefahr geriet, sich zu verletzen.
«Oh Jock, wir haben einen Fehler gemacht», rief Eja erschrocken. «Er wird sich noch weh tun. Bitte, lass ihn wieder heraus! Er wird schon nicht wegfliegen und wenn doch, ist es mir immer noch lieber, als wenn er sich selbst ein Leid zufügt.»
Jock war selbst erschrocken. Eilig öffnete er die Tür und ließ den Vogel heraus. Der Vogel flog, so weit es seine Schnur zuließ, fort, versteckte sich in einem Winkel der Ofenbank und warf ihnen vorwurfsvolle Blicke zu.
«Ach, jetzt haben wir es uns mit ihm verdorben. Dabei hatten wir uns doch gerade erst angefreundet», sagte Eja, den Tränen nahe.
«Schon gut, schon gut», tröstete Jock sie. «Ich weiß, was ich zu tun habe.» Und er begann, den Käfig, für den Vogel deutlich sichtbar, Stück für Stück auseinanderzureißen. Als nichts mehr übrig war als ein Haufen zerbrochener Zweige, gab er sich schließlich zufrieden. «So, das müsste genügen», meinte er. «Das sollte dem Vogel zeigen, dass wir es gut mit ihm meinen.»
Eja ging auf den Vogel zu und versuchte, ihn mit leisen, zärtlichen Worten zu beruhigen. Sanft streichelte sie seine Federn, und endlich ließ er sich wieder hochheben und zurück auf die Stange setzen.
«Ich verspreche dir, dass so etwas nie wieder geschehen wird», sagte Eja. «Jock hat es doch nur gut gemeint.»
«Ja, ich hab’s wirklich nur gut gemeint», bestätigte Jock und streckte vorsichtig die Hand nach dem Vogel aus. Doch der wollte sich mit Jock nicht so einfach abfinden und hackte mit seinem scharfen Schnabel nach dessen Fingern, die Jock in Erinnerung an frühere schmerzhafte Erfahrungen schnell wieder zurückzog.
«Na ja, du brauchst noch etwas Zeit, um dich an mich zu gewöhnen. Aber eines Tages wirst du einsehen, dass auch Jock Aiting ein Vogelfreund ist. Weißt du, Eja, ich bin jetzt erst recht neugierig geworden, was für ein seltener Geselle das ist. Ich habe noch nie einen Vogel wie diesen gekannt. Es wird Zeit, dass wir uns auf die Suche nach Horn machen und ihm den Vogel zeigen. Er ist heute Abend sicher auch beim Deichfest.»
Eine Weile stritten sie sich noch, ob sie den Vogel nun mitnehmen oder doch besser dalassen sollten. Eja wollte ihn nach diesem Erlebnis auf keinen Fall allein lassen, doch Jock hielt es für besser, ohne den Vogel zum Fest zu gehen, weil er immer noch fürchtete, er könne entkommen. Außerdem, meinte er, würden die vielen Menschen den Vogel sicher sehr erschrecken und einschüchtern.
Das sah auch Eja ein und so vertröstete sie den Vogel auf ihre Rückkehr. Wieder schienen ihre Worte den Vogel zu beruhigen, auch ohne dass er sie verstand. Er hüpfte von der Stange auf seine Decke auf der Ofenbank und blieb dort still und ergeben sitzen, als sich die Tür hinter ihnen schloss.
Nun war es aber höchste Zeit. Sie mussten sich sputen, um nicht zu spät zum Fest zu erscheinen. Rasch gingen sie den Dreieichenweg entlang bis hinunter zur Rauna, wo sie auf den Unteren Waalweg stießen, der am Ufer der Rauna bis nach Palmücken, dem Hauptort der Brasen, führte. Dort trafen sie auf viele andere Brasen, die unterwegs zum Deichfest waren. Begrüßungen und Geschichten aus der Nachbarschaft verkürzten den Weg bis ins Dorf.
Als sie ankamen, war die Dämmerung schon weit fortgeschritten. Überall brannten Fackeln, die das Dorf in ein festliches Lichtermeer tauchten. An Ständen gab es Glühwein und Gewürzkuchen, und die für die Brasen typische laute, ja eigentlich ohrenbetäubende Musik erklang. Kleine Gruppen hatten sich zusammengefunden und spielten das Lieblingsinstrument der Brasen, den Presssack, ein Wirrwarr aus Röhren und einem Ziegenlederbeutel, der an einem Gürtel um den Bauch gebunden wurde.
Dieses Instrument bliesen die Brasen aus vollen Backen und manchmal auch mit mehr Herzenslust als Musikalität und vollführten einen Lärm damit, der jeden unliebsamen Geist sicher bis weit über alle Berge hinweg verjagen konnte. Dazu tanzten Paare mit schweren Schuhen auf einfachen, roh zusammengezimmerten Holzpodesten, die nicht selten unter den wilden Sprüngen der Tänzer zusammenbrachen. Unter lautem Gelächter halfen sie einander dann wieder auf die Beine, klopften sich gegenseitig den Staub aus den Kleidern und suchten sich ein anderes Holzpodest, das ihnen fester schien, um auf diesem umso wildere Sprünge zu vollführen.
Eja und Jock hielten sich nicht lange an den Ständen, der Musik und bei den Tanzenden auf, sondern suchten in der Menge erst nach Lars und Una, die sie kurz begrüßten, und dann weiter nach Horn. Sie drängten sich durch die engen
Gassen des Dorfes, vorbei an den Werkstätten des Schmieds, des Schusters und des Zimmermanns, vorbei auch am Mühlbach, der das Rad der Mühle in schweren Schwüngen drehte, bis sie neben dem Haus des Landboten zum Sandwirtshaus kamen. Als sie zur Tür hineinwollten, stießen sie mit einem großen Mann zusammen, der gerade heraustrat.
«Holla, Jungvolk!», rief er und las die beiden vom Boden auf. «Tordals Tochter Eja und Meister Aiting persönlich, wie mir scheint. Welche Ehre, mit solch edlen Gewächsen zu so später Stunde zusammenzustoßen.»
«Diese Ehre kann mir gestohlen bleiben», schimpfte Jock und rieb seinen Bauch, auf den Eja gefallen war. «Ihr tätet gut daran, einen Blick vor Eure Füße zu werfen, bevor Ihr so unvermutet aus einer Tür tretet und kleine, schwache Leute einfach über den Haufen rennt, Herr Elder. Wenn Ihr so in den Wäldern jagt, werdet Ihr wohl viel Wild mit Euren schweren Stiefeln erlegen.»
Horn blickte mit lachenden Augen auf Jock herab, der so kummervoll seine Glieder ordnete, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte begütigend: «Nun, nun, mein lieber Herr Aiting, ich glaube, wir tragen alle ein wenig Schuld an diesem schrecklichen Unglück. Aber vielleicht kann ich mein Teil daran mit einem Bier wiedergutmachen.»
«Das ist ein Wort, wie ich’s gerne höre», jauchzte Jock und hatte im Nu allen Schmerz vergessen. «Ich will gleich vorausgehen und Euer Angebot in Zahlung nehmen, bevor Ihr es Euch anders überlegt.» Schnell trat er ein und ließ Horn und Eja zurück.
«Ach, Jock ist doch einfach unbezahlbar», lachte Eja.
«Nun, hoffentlich nicht zu unbezahlbar», erwiderte Horn schmunzelnd. «Komm, wir wollen ihn nicht zu lange allein lassen, sonst könnte es geschehen, dass das Bier, das Meister Aiting in Zahlung nimmt, mich teuer zu stehen kommt.»
Sie traten in das Wirtshaus und gesellten sich zu Jock, der bald unter dem Einfluss des Bieres alle Gäste mit Geschichten und Liedern unterhielt und sich so manches Glas durch seine Unterhaltung dazuverdiente. Endlich mahnte der Wirt zum Aufbruch, denn es war Zeit geworden, zum Moosbühel zu gehen, auf dem der eigentliche Höhepunkt des alljährlichen Deichfestes stattfinden würde.
Die Gäste verließen das Wirtshaus. Draußen war die Musik verstummt. Alle anderen hatten sich auf den Weg zum Moosbühel gemacht, auf dem sich das Versammlungshaus der Brasen befand. Mächtige Eichen standen dort in Reihen nebeneinander und schlossen ein langgestrecktes Geviert ein. Die dicht belaubten Kronen bildeten ein Dach, durch das kaum ein Regentropfen drang. Hier saßen die Brasen auf einfachen Bänken, ohne allzu große Ordnung, buntgemischt in der weiten Halle, an deren erhöhtem Ende Recht gesprochen wurde, Ehen geschlossen oder, so wie am heutigen Tage, der Erzähler seinen Platz hatte.
Eja, Horn Elder und Jock bahnten sich einen Weg durch die Reihen und fanden einen Platz neben Lars und Una. Während sie auf den Beginn der Geschichten warteten, erzählte Eja Horn Elder von dem Vogel, den Jock ihr geschenkt hatte, der so groß sei, mit einem silbernen Schnabel und grünen Augen und der sogar sprechen könne, wenn auch in einer unverständlichen Sprache. Mit Jocks Unterstützung, die nicht sehr hilfreich war, da dieser nach dem vielen Bier mit etwas schwerer Zunge sprach, versuchte sie sich an die Worte zu erinnern, die sie gehört hatten. Doch nichts wollte so klingen wie das, was der Vogel gesagt hatte.
Schließlich beugte sich Alva Aiting, der hinter ihnen saß, vor und meinte: «Vielleicht irre ich mich ja, aber ich glaube mich zu erinnern, dass das erste Wort, das ich von ihm gehört habe, so ähnlich klang wie Schaira oder so.»
Horn richtete sich ruckartig auf, alle Ruhe fiel von ihm ab, er drehte sich nur mühsam beherrscht zu Alva um und fragte: «War es vielleicht das Wort Schairi, das ihr gehört habt?»
«Ja», rief Eja. «Das war es. Horn, kennst du diese Sprache? Kannst du sie verstehen?»
«Ich hatte also recht», fiel ihr Jock ins Wort. «Der Vogel kann wirklich sprechen und nicht nur Unfug ohne Sinn und Verstand nachplappern.» Triumphierend blitzte er Alva an.
«Na, meinetwegen», lenkte Alva ein. «Dann kann er eben sprechen.»
Dann redeten alle drei wild durcheinander auf Horn ein, der aber auf einmal ganz verschlossen wirkte. «Ich bin nicht sicher. Es ist lange her. Kann sein, dass ich mich täusche», wehrte er ab und wollte nicht mehr dazu sagen.
«Später», meinte er schließlich. «Ich muss mich erst wieder erinnern. Falls es überhaupt etwas zu erinnern gibt. Dann wollen wir uns den Vogel näher anschauen und sehen, was dabei herauskommt. Doch nun genug, es geht gleich los. Der alte Gorre ist schon an seinem Platz.»
Tatsächlich wurde es nun still in der Halle. Alle, die noch nicht saßen, suchten sich einen bequemen Platz. Eja, Jock und Alva mussten sich gedulden und ihre Neugier zügeln.
Lars und Una hatten in dem Stimmengewirr bis auf Bruchstücke kaum etwas von ihrer Unterhaltung mitbekommen, doch warfen sie immer wieder beunruhigte und fragende Blicke zu ihnen herüber. Aber sie mussten ihre Fragen, mochten sie ihnen noch so sehr auf dem Herzen liegen, auf später verschieben, denn die Zeit war gekommen, in der das alte Lied der Brasen angestimmt werden sollte, um alle Brasen an Vergangenes zu erinnern, damit es in ihrem Gedächtnis lebendig erhalten bliebe und ihnen bewusst machte, was es hieß, ein Teil der Gemeinschaft der Brasen zu sein.
Wie jedes Jahr zu dieser Zeit nahm der alte Gorre den Stab des Erzählers in die Hand und begann zu sprechen. Er war schon bald an die hundert Jahre alt, doch sein Gedächtnis bewahrte frisch und unversehrt die Überlieferung in sich, und seine Stimme hatte nichts von ihrer Kraft verloren. Klar füllte sie die weite Halle, mischte sich mit dem leisen Rauschen der Blätter über ihnen und verwob sich mit diesem zu dem unvergänglichen Lied all dessen, was vergänglich ist.
3. Kapitel
Gorres Lied
«Hört her, ihr Brasen aus dem einen Volk der Duna, und achtet auf meine Worte. Glücklich sind wir, gesegnet mit den Gaben der Erde und reich an den Freuden des Lebens. Doch nicht immer lebte der Brase im Glück. Windzeit kam, Wolfszeit, und riss ihn fort von Heim und Herd. Viel ist geschehen seit den Tagen des Anfangs, und viel soll erzählt werden, damit es nie vergessen werde. Hört also her, ihr Brasen aus dem einen Volk der Duna, und achtet auf meine Worte.»
So begann die Erzählung des alten Gorre, wie jedes Jahr zur Zeit des Deichfestes. Aufmerksam folgten die Hörer seinen Worten, die so weit zurückführten und an so ferne Orte, dass es sie oft mit Staunen erfüllte, dass sie selbst ein Teil dieser Geschichte sein sollten, die von ihnen erzählte, von ihrem Volk aus einer Zeit, als das Raunatal noch ferne unbekannte Zukunft war und nicht der vertraute Ort, noch keine Gewissheit, ja, nicht einmal ein Versprechen, das gegeben worden wäre, um verzweifelten Herzen Kraft zu spenden.
Die Erinnerung der Brasen reichte weit zurück. Vielleicht nicht bis zum Ursprung ihres Volkes, denn die Spur des Anfangs verlor sich im Dunkel der Vorzeit, von der nur noch Märchen und Sagen erzählten. Sicher war auch viel an Dichtung und Ausschmückung hinzugekommen, durch die Liebe, mit der die Geschichten die Zeit überdauert hatten, doch der Kern der Erzählung hatte sich unverändert erhalten und berichtete auch nach so langer Zeit noch von Geschehnissen, die längst vergangen waren und zugleich auch Gegenwart, lebendiges und unsterbliches Kind des Augenblicks.
Hoch im Norden begann die Geschichte der Brasen oder eigentlich der Duna, denn zu jener Zeit gab es noch nicht die beiden Stämme, in die dieses Volk sich später einmal teilen sollte. Hoch im Norden also begann die Geschichte der Duna, in einem Land, von dem nicht überliefert wurde, wie die Duna es nannten, als sie dort lebten. Erst nach ihrer Vertreibung gaben sie ihm den Namen Altsiedelland, als wäre ein anderer Name eine zu schmerzliche Erinnerung an das Verlorene.
Altsiedelland war bis weit hinauf zu der Grenze aus Eis und Schnee von tiefen, dichten Wäldern bedeckt. Lange lebten die Duna als Jäger in diesen Wäldern und wohnten in den Kronen riesiger Bäume, sicher vor wilden Tieren und vor den Wesen, die sie Odradek, Baumläufer, nannten.
Seltsame Gestalten waren dies, Wesen, die eine braune, rindige und rissige, mit Laub bedeckte Haut hatten und deren Augen im Dunkeln leuchteten. Sie kamen auf ihren Wanderungen vom hohen Norden Altsiedellands nicht selten bis weit hinab in die wärmeren, von den Duna bewohnten Gebiete, und es war ratsam, ihnen nicht zu begegnen, denn sie schienen Menschen nicht zu lieben und konnten ihnen übel mitspielen. So gingen ihnen die Duna aus dem Weg und blieben verschont, solange sie sich nur in den Baumkronen aufhielten, wenn die Odradek vorbeizogen.
Doch im Laufe der Zeiten wurde es immer schwieriger, einander zu meiden, denn die Odradek vermehrten sich. Immer mehr von ihnen kamen in die südlichen Wälder und machten den Duna das Leben schwer. So zogen sich die Duna über die Jahrhunderte allmählich aus den Wäldern zurück und wurden sesshafte Bauern, die in den Grassteppen und Moorgebieten des Südens neuen Lebensraum fanden und eine Blütezeit erlebten. Die Odradek ließen sie lange in Frieden leben, denn ihnen genügten die Wälder, und sie wagten sich nicht aus diesen hervor.
Doch Altsiedelland veränderte sich. Es wurde kälter. Die Eisfelder des Nordens drangen unaufhaltsam vor, und Wald um Wald verschwand unter den Schneemassen. Die Odradek wurden in den Süden abgedrängt, und es kam immer häufiger zu Zusammenstößen zwischen ihnen und den Duna. Die Zeiten des Friedens waren vorbei.
Die Odradek hatten sich inzwischen verändert. Sie waren den Menschen immer ähnlicher geworden. Doch noch war ihre Haut rindig und braun, und sie waren stärker und unverletzlicher. Viele Duna fielen im Kampf, ihre Felder wurden vernichtet und ihr Vieh getötet oder geraubt. Das Volk der Duna war vom Untergang bedroht. So blieb ihnen nur noch die Flucht aus Altsiedelland. Die Duna sammelten die Reste ihres einst so großen Volkes und überließen ihre Heimat den Odradek.
Es war ein Aufbruch ins Ungewisse. Die Duna trafen auf unfruchtbare Steppe, die bald in eine Steinwüste überging, die sich erst unübersichtlich und endlos nach Osten und Westen erstreckte, um sich dann mehr und mehr zu verengen, so dass von beiden Seiten bedrohlich das Meer näherrückte und eine schroffe, von Felsen und Klippen zerrissene Küste. Auf Karren und zu Fuß zogen die Duna mühselig durch diese steinige Wüste, das Wenige, das ihnen geblieben war, mit sich schleppend.
Schließlich erreichten sie das südliche Ende Altsiedellands, und vor ihnen lag das Meer. Weit und breit waren nur die dunklen Wogen und ein grauer, wolkenverhangener Himmel zu sehen. Möwen stürzten schreiend auf sie herab, und ein kalter Wind zerrte an ihren Kleidern. Sie schienen das Ende der Welt erreicht zu haben, ohne Ausweg und ohne Hoffnung auf einen neuen Anfang. Hierzubleiben hätte den sicheren Untergang bedeutet, und zurückzukehren war ihnen verwehrt. Wohin sollten sie sich wenden? Schiffe hatten und kannten sie nicht, und nirgendwo am Horizont war Land zu sehen. Wohin also?
«Wohin?», rief Gorre. «Windzeit, Wolfszeit war über sie gekommen, ihr Mut sank und Nacht fasste ihre Herzen.
Doch Marla, die Alte, hob ihre Stimme und sang:
Weit hinterm Meer
liegt grün das Land,
in alter Zeit
Erdherz genannt.
Wer hat den Mut
und sucht den Weg?
Zwei Schritte breit
der schmale Steg.
Wer ohne Furcht
die Schritte lenkt,
kein Blick zurück,
nur vorwärts denkt,
find’ hinterm Meer
so grün ein Land,
in alter Zeit
Erdherz genannt.
So sang Marla, die Alte, das Lied aus vergangener Zeit, wie sie es oft an den Wiegen der Traglinge gesungen hatte. Hoffnung kehrte zurück unter das Volk der Duna, und sie achteten das Lied nicht gering, sondern erkannten das Zeichen und folgten ihm.»
Kundschafter wurden ausgesandt, die die Ufer absuchten, und schließlich wurde weiter östlich ein Riff gefunden, das aus dem Wasser ragte. Doch das Meer war stürmisch. Reißende Wogen ergossen sich über die Felsen und machten diese unpassierbar. So mussten sich die Duna gedulden und sie schlugen ihr Lager am Beginn des Riffes auf, das sie das Hurnenriff nannten, denn Hurn, der Kundschafter, hatte es zuerst gesehen, und sein Name blieb für immer mit ihm verbunden.
Die Dauer eines Mondes mussten die Duna ausharren, bis sich das Meer beruhigte und der Himmel klar und wolkenlos wurde. Da sahen sie, dass das Lied die Wahrheit gesagt hatte. Der Weg über das Hurnenriff würde mühselig und gefährlich sein. Die Felsen waren glatt und nass, von Algen bedeckt, auf denen der Fuß nur trügerischen Halt fand. An vielen Stellen war der steinerne Pfad nur zwei Schritte breit, und Wasserstrudel zu beiden Seiten des schmalen Bandes zogen bedrohliche Kreise. Kein Duna konnte zu der damaligen Zeit schwimmen. Ein Fehltritt wäre der sichere Tod gewesen.
Und wie viel würden sie zurücklassen müssen! Kein Karren konnte das Riff überqueren. Nur was sie tragen konnten, konnten sie auch mitnehmen. Auch ihre Tiere würden den beschwerlichen Weg scheuen und in ihrer Angst eine Gefahr für die Duna sein. Aber es blieb ihnen keine andere Wahl, und sie setzten ihre ganze Hoffnung darauf, dass die Verheißung des Liedes sich als so wahr erwies, wie die Gefahr des Pfades sich als wahr erwiesen hatte.
So trennten sie sich wieder von vielem Hab und Gut und nahmen nur mit, was sie auf ihren Rücken tragen konnten. Und selbst von diesem Wenigen mussten sie vor Erschöpfung noch vieles zurücklassen. Jeder der Duna, Männer, Frauen, Alte und Kinder, nahm eine Last auf den Rücken und trug sie klaglos einem ungewissen Schicksal entgegen.
Um den Gefahren des Meeres zu begegnen, nahmen sie alles an Seilen, was sie bei sich hatten, und banden alle Duna damit in einer langen Reihe aneinander, immer genug Raum dazwischen lassend, dass sie sich frei bewegen und dennoch einander sicher vor Stürzen ins Wasser bewahren konnten. Nur die Tiere mussten frei laufen und wurden von den Duna, als sie aufbrachen, als erste auf das Riff getrieben. Sie scheuten zurück und brachen immer wieder aus. Nicht wenige Tiere stürzten dabei ins Meer, doch die übrigen fügten sich schließlich und gingen bald sicherer über die Felsen als die Menschen.
So zogen die Duna über das Riff, und es gelang ihnen, einander zu bewahren und wenn doch einer ins Wasser fiel, ihn wieder sicher auf den Weg zurückzuziehen. Sie marschierten, solange es hell war, und machten kaum Rast. Die Sorge, dass Sturm aufkommen und dass Nahrung und Trinkwasser zur Neige gehen könnten, trieb sie voran. Nur nachts hielten sie an. Zu groß war die Gefahr, im Dunkeln ins Meer zu stürzen. Dichtgedrängt versuchten sie einander Wärme zu geben und Schutz vor den scharfen Winden. Holz hatten sie keines dabei und konnten kein Feuer entzünden, um sich zu wärmen.
Am fünften Tag erreichten sie eine breite Stelle des Riffs, die beinahe schon eine kleine Insel genannt werden konnte. Dort fanden sie angeschwemmtes Holz, das von der Sonne ausgebleicht und getrocknet worden war. Endlich konnten sie sich wieder eine warme Mahlzeit zubereiten und die Nacht an kleinen, wärmenden Feuern verbringen. Als sie am nächsten Tag weiterzogen, schien ihnen das elende kleine Eiland wie eine verlorene Heimat, die sie ungern verließen, um den beschwerlichen und gefährlichen Weg durch das endlos scheinende Meer fortzusetzen.
Neun Tage waren sie gewandert, da zogen dunkle Wolken auf, und das Meer wurde bleiern und unruhig. Die ersten kleineren Wellen überspülten den Pfad und machten ihn noch schlüpfriger und unsicherer. Die Angst trieb die Duna an. Schweigend und verbissen drängten sie weiter, und keiner wollte sich als Erster eingestehen, dass der nächste Sturm ihr sicherer Untergang sein musste.
Die Wolken verbargen endlich die Sonne, und schon am frühen Nachmittag erschwerte ein dämmriges Licht die Sicht. Der Wind hatte sich gelegt, um vielleicht schon bald mit umso ungestümerer und vernichtenderer Kraft über sie herzufallen. Die lange Reihe der Duna, die über das Riff hinzog, wirkte in dem gewaltigen Raum des Meeres wie ein Nebelstreif, den der nächste Windstoß unweigerlich in Nichts auflösen würde. Nichts würde bleiben als das kahle, schwarze Felsenband, wie eine höhnische Mahnung an die vergebliche Hoffnung eines versunkenen Volkes.
Wieder war es Hurn, dessen Ruf sie von ihrer tödlichen Angst befreite. Seine hohe Gestalt ging an der Spitze der Duna auf dem Riff, das seinen Namen trug, voran und überragte alle. Verzweifelt spähte er durch die Dämmerung. Da plötzlich glaubte er im schwindenden Licht das weiße Schäumen einer fernen Brandung zu sehen. Doch noch traute er seinen Augen nicht. Zu sehr fürchtete er, die Hoffnung könnte ihm Träume für wahr vorgaukeln. Doch je weiter er ging, desto deutlicher wurde die Linie am Horizont, nahm klare Formen an, und die ersten, noch weit entfernten Geräusche der Brandung drangen zu ihm.
Endlich hielt er nicht länger an sich. Er streckte dem Land die Arme entgegen und rief mit lauter Stimme: «Oh grünes Land, Erdherz genannt, Rettung ist nah!»
Da fiel die lähmende Angst von allen ab, eine ungeahnte Kraft erfüllte sie, und ehe der Sturm losbrach, hatte der letzte der Duna seinen Fuß auf Erdherz gesetzt und nicht einer war verlorengegangen.
«Oh grünes Land, Erdherz genannt, Rettung war nah, als Hurn, der Wanderer, dich sah. Neues Land hatten die Duna betreten, neue Heimat zu finden, fern von Tod und Untergang. Doch neue Heimat will verdient sein. Steinern war das Gesicht des Landes, das sie fanden, nicht grün, wie verheißen, und neue Verzweiflung schien der Lohn zu sein für die Mühsal der Wanderung. Und Wolfszeit folgte auf Windzeit.»
Die Duna fanden ein wüstes und leeres Land vor. Die Steinwüste, die sie in Altsiedelland hinter sich gelassen hatten, schienen sie nur mit einer anderen vertauscht zu haben. Nichts als Dornengestrüpp und Disteln wuchs zwischen Felsbrocken und Steinen, die die einzige Abwechslung waren in einer Landschaft, in der Sand, Meer und Himmel zu einem einzigen, stürmischen Grau verschmolzen. Abgekämpft, müde und erschöpft waren sie den Unbilden des Wetters ausgesetzt. Wind, Sand und Regen peitschten auf sie ein und trieben Mensch und Tier schutzsuchend zusammen. Der Jubel über ihre Rettung wich einer neuen, kalten Verzweiflung über das abweisende Land, das sie nur unwillig empfing, als wollte es sie sogleich wieder ins Meer zurücktreiben.
Zwischen großen Felsen bauten sie sich aus Schwemmholz und den wenigen Tüchern, die sie bei sich hatten, notdürftig Zelte zusammen, die ihnen kaum Schutz vor Wind und Regen boten, aber doch wenigstens ein bescheidener Versuch waren, einen Anfang zu wagen, ein Zeichen zu setzen, das ihnen neuen Mut gab und eine Bleibe in dieser Welt, die sich aufzulösen schien im Tosen und Heulen von Wind und Meer. Sie hatten nicht den langen, beschwerlichen Weg zurückgelegt, nur um jetzt zu verzweifeln und aufzugeben, und so schöpften sie neue Kraft aus der Notwendigkeit, sich aufzulehnen gegen die Launen des Schicksals.
Sie blieben nur so lange an diesem ungastlichen Ort, bis sich der Sturm wieder gelegt hatte. Dann zogen sie am Strand entlang in östlicher Richtung. Im Westen und Norden bildeten steile Felsen eine undurchdringliche Barriere, hinter der sich ein Gebirge höher und höher auftürmte, je weiter sie nach Osten kamen.
Es war eine trostlose Wanderung in einer trostlosen Einöde, und dennoch wuchs ihre Hoffnung, je weiter sie nach Osten vordrangen. Der Himmel klarte auf, die Wolken verzogen sich, und die Sonne drang durch das trübe Grau des Himmels. Sie trafen auch bald auf Quellen und Bäche, die von den Felsen herabsprudelten, und je weiter sie kamen, desto mehr wich das Bild der kahlen Steinwüste einer grünen, weichbemoosten und grasigen Landschaft, die sich in milden Hügelschwüngen an den Bergen entlangzog und in sanften Stränden auslaufend ins Meer mündete. Erdherz schlug fruchtbar und lebensspendend unter ihren Schritten und erfüllte nun endlich ein Versprechen, das ihnen erst vor wenigen Tagen an einem grausigen Ort der Verzweiflung gegeben worden war.
Nach drei Tagen wichen die Berge ins Landesinnere zurück und gaben eine große Ebene frei, die wie in einem weiten Halbkreis geschwungen eine Meeresbucht umgab. Die Berge, die an ihrem anderen Ende den Bogen zum Meer hin wieder abschlossen, schützten die Bucht vor den salzigen Winden. Aus einem tiefen Einschnitt in den Felsen strömte ein Fluss hervor, der sich, in ein Delta aus vielen Armen aufgeteilt, ins Meer ergoss.
Draußen im Meer war eine Inselgruppe zu erkennen, die das schöne Bild, das sich den Duna bot, noch vollkommener zu machen schien. Nach all den Entbehrungen, die die Duna hinter sich hatten, standen sie lange still und ganz in den Anblick verloren, als fürchteten sie, mit der geringsten Bewegung das Bild zu zerstören und wie aus einem Traum zu erwachen.
Hier ließen sich die Duna nieder und nannten ihre neue Heimat die Tiefen Lande. Es war eine gefährdete Heimat, wie sie nur allzu bald merken sollten, denn jede Flut überschwemmte diesen flachen Landstrich und zerstörte so manches, was die Duna gerade mühsam errichtet hatten. Lange mussten sie um ihre neue Heimat fürchten und kämpfen, bis sie schließlich das Land mit einem großen Deich abschlossen, der ihre Felder und Häuser vor den Gewalten des Meeres schützte.
Auch den Fluss, die Marla, wie sie ihn in Erinnerung an die alte Marla, die ihnen einst das verheißungsvolle Lied gesungen hatte, nannten, zwangen sie in feste Bahnen, mit denen sie ihre Felder bewässern konnten, ohne dass er sie mit seinem ungestümen Lauf gleich wieder fortschwemmte.
Sie lernten schwimmen und bauten Schiffe, mit denen sie zu den Sandinseln hinausfuhren. Feorn war es, der Schiffebauer, der als erster die Sandinseln betrat. Unter seiner Führung wurden der Hafen auf der Hauptinsel und der Leuchtturm auf der Südinsel gebaut.
Die Duna der Sandinseln, die sich Feorner nannten, ließen sich dort fest nieder, und bald wollten sie sich nicht mehr den Gesetzen und Beschlüssen der Duna des Festlandes fügen. Diese nannten sich Brasen, was im Altdunan einst das Wort für Landgänger oder auch Kundschafter gewesen war, aber inzwischen war die alte Bedeutung vergessen worden.
Die Versammlung der Brasen bestand auf den alten Rechten und forderte von den Feornern Gehorsam und das Einhalten der Gesetze. Unbedachte Worte schürten den Streit. Es kam zur Schlacht, in der nicht wenige Brasen und Feorner ihr Leben ließen.
Als der Rausch verflogen war und Feorner und Brasen auf dem Schlachtfeld zwischen den Gefallenen und Verwundeten standen, befiel sie eine große Scham und Verzweiflung über ihre Tat, und nie wieder sollten Brasen und Feorner die Waffen gegeneinander erheben. Sie schlossen Frieden, begruben gemeinsam ihre Toten, und den Feornern wurden die Hoheitsrechte über die Sandinseln zugestanden, eigene Gesetze und eine eigene Ratsversammlung.
Doch ungeschehen war das Vergangene nicht zu machen. Die Duna teilten sich fortan in die Stämme der Brasen und der Feorner, und lange sollte es dauern, bis sie sich wieder das eine Volk der Duna nannten.
Auch äußerlich begannen sich die beiden Stämme im Laufe der Zeit zu unterscheiden. Die Feorner waren groß gewachsen, behender in ihren Bewegungen, aber verschlossener und wenig redselig. Die Brasen dagegen wirkten gedrungener, hatten etwas schwerfällige, bäurische Bewegungen, aber liebten es, sich zu unterhalten, und pflegten Musik und Tanz. Nur die alten Lieder wurden bei Brasen und Feornern gleichermaßen gesungen und erinnerten sie an ihre gemeinsame Herkunft und Vergangenheit.
Die Brasen betrieben Viehzucht und bestellten Felder und Äcker, die Feorner lebten vom Fischfang. Ein reger Tauschhandel aber versorgte beide Stämme mit den Gütern der anderen, und hin und wieder erneuerte eine Ehe die Bindungen zwischen den Stämmen. So lebten Brasen und Feorner lange Zeit einträchtig nebeneinander in den Tiefen Landen, die ihnen eine vertraute Heimat geworden waren, in der das Vergangene ohne Schrecken in Erzählungen versank.
Aber die Duna waren, wie schon in Altsiedelland, ein einsames Volk. Gegen Norden hin schlossen hohe Berge die Tiefen Lande ab, so dass sie nichts von anderen Völkern wussten, die hinter den Bergen leben mochten, und auch die Reisen entlang der Küste, die die Feorner auf ihren Schiffen unternahmen, brachten keinerlei Begegnungen mit anderen Lebewesen, die ihnen gleich gewesen wären. Doch konnten die Feorner auch keine zu weiten Fahrten unternehmen, denn ihre Schiffe waren nicht dafür gebaut, sondern nur für die Verbindung zwischen den Tiefen Landen und den Sandinseln und für den Fischfang geschaffen worden. Jahrhunderte vergingen, in denen die Duna ihr eigenes Leben führten, das unberührt blieb von aller Außenwelt.
Doch es kam die Zeit, in der diese Außenwelt sich um so entsetzlicher bemerkbar machte und die Duna gewaltsam aus ihrem beschaulichen Dasein riss.

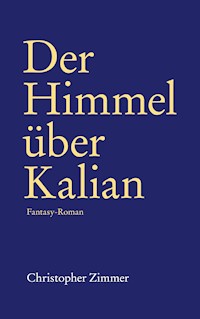














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












