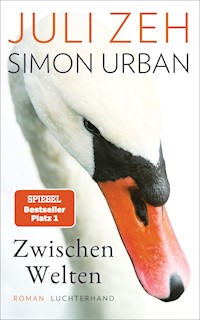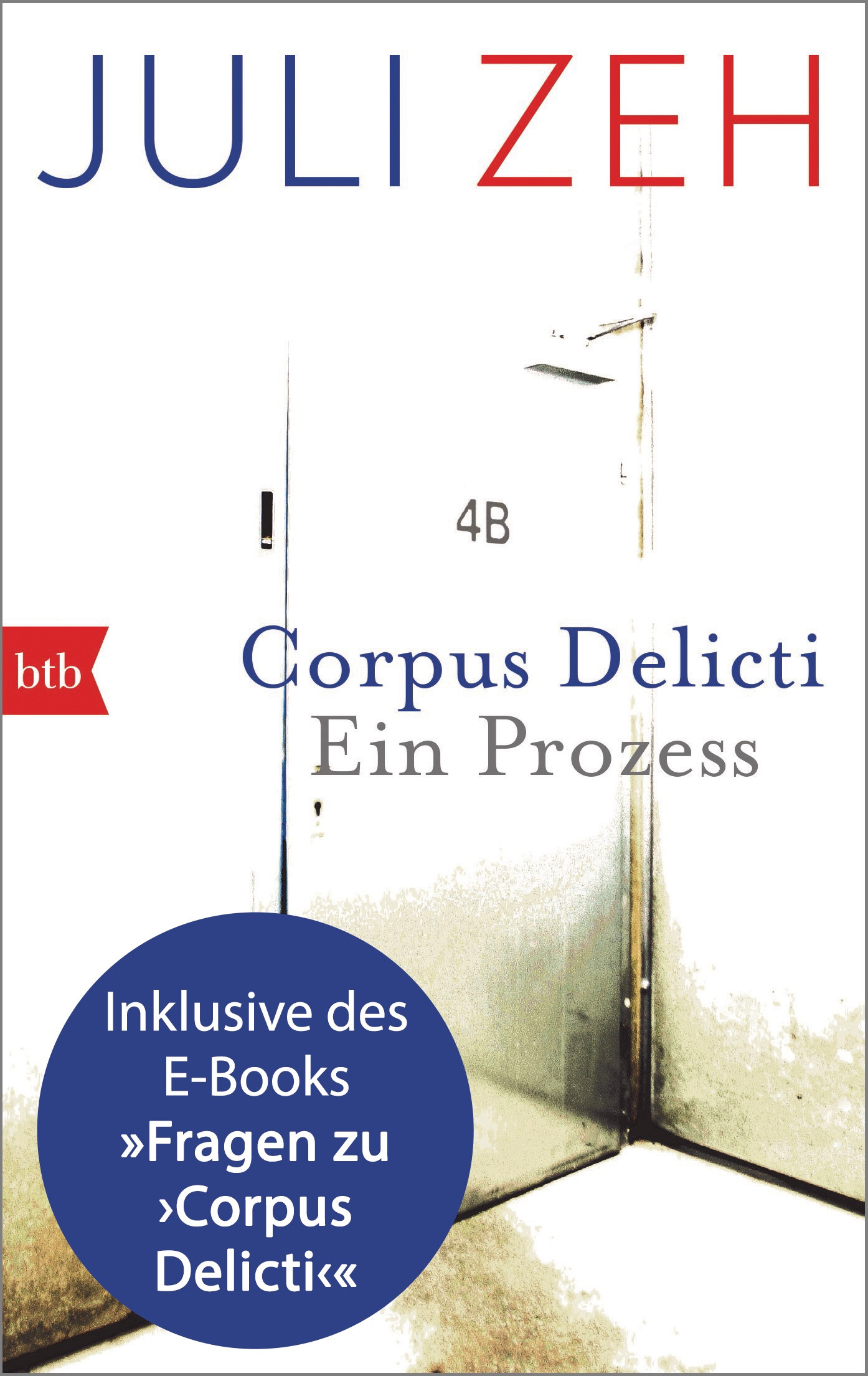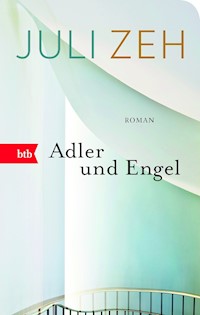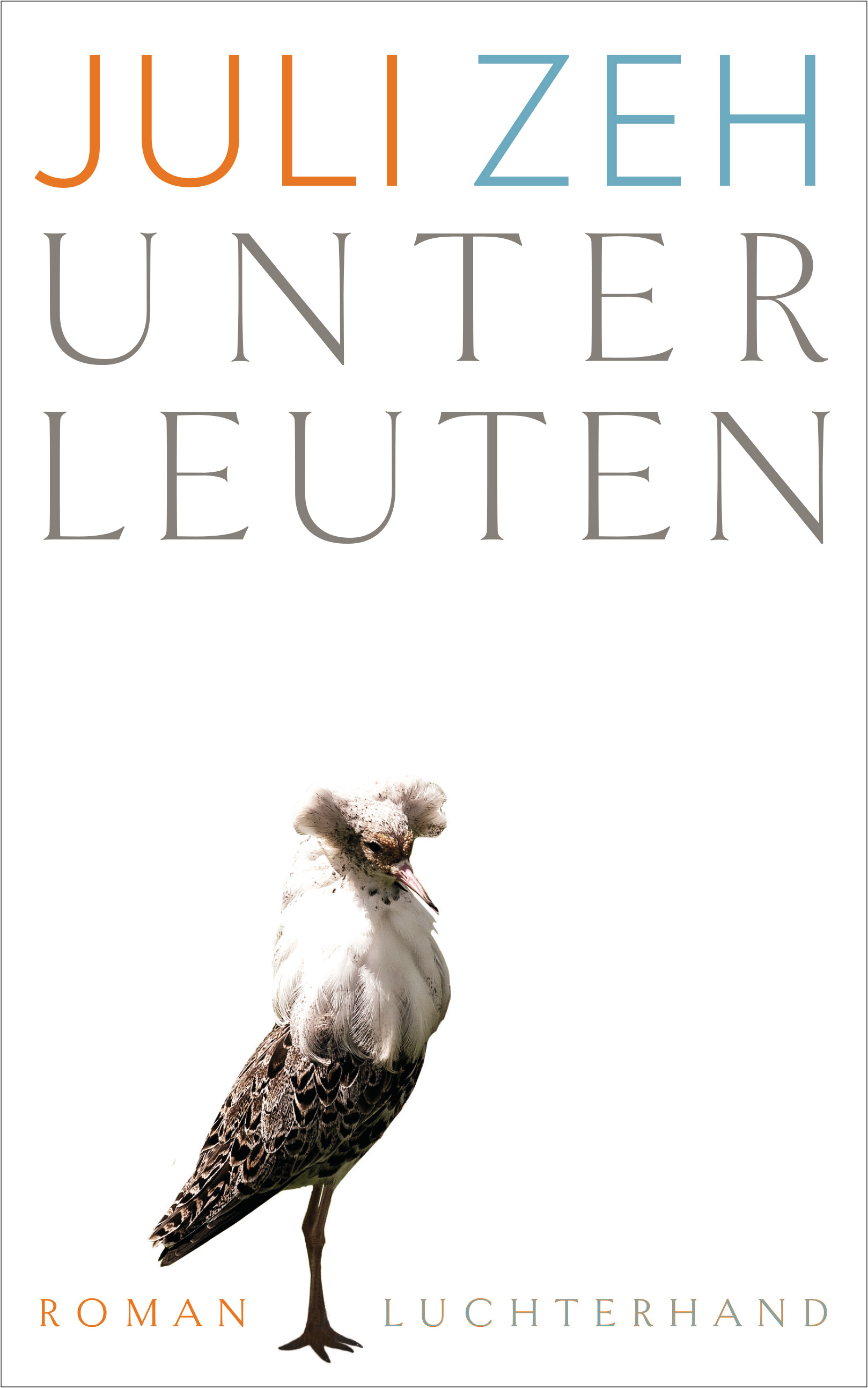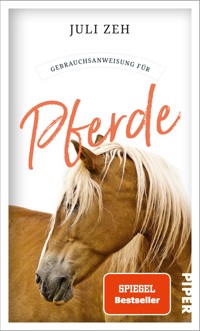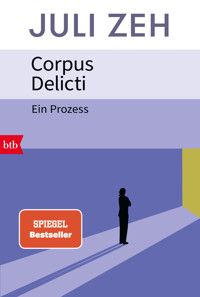
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wie weit geht unser Recht am eigenen Körper? Der moderne Klassiker von Juli Zeh in einer Neuausgabe
Jung, attraktiv, begabt und unabhängig: Das ist Mia Holl, eine Frau von dreißig Jahren, die sich vor einem Schwurgericht verantworten muss. Zur Last gelegt wird ihr ein Zuviel an Liebe (zu ihrem Bruder), ein Zuviel an Verstand (sie denkt naturwissenschaftlich) und ein Übermaß an geistiger Unabhängigkeit. In einer Gesellschaft, in der die Sorge um den Körper alle geistigen Werte verdrängt hat, reicht dies aus, um als gefährliches Subjekt eingestuft zu werden. Juli Zeh entwirft in »Corpus Delicti« das spannende Science-Fiction-Szenario einer Gesundheitsdiktatur irgendwann im 21. Jahrhundert, in der Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht geworden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Corpus Delicti
Das Vorwort
Das Urteil
Mitten am Tag, in der Mitte des Jahrhunderts
Pfeffer
Die ideale Geliebte
Eine hübsche Geste
Genetischer Fingerabdruck
Keine verstiegenen Ideologien
Durch Plexiglas
Eine besondere Begabung zum Schmerz
Bohnendose
Saftpresse
Nicht dafür gemacht, verstanden zu werden
Privatangelegenheit
Fell und Hörner, erster Teil
Rauch
Keine Güteverhandlung
Ein netter Junge
Wächter
In der Kommandozentrale
Recht auf Krankheit
Das Ende vom Fisch
Der Hammer
Which side are you on
Unzulässig
Schnecken
Ambivalenz
Ohne zu weinen
Unser Haus
Bedrohung verlangt Wachsamkeit
Die Zaunreiterin
Fell und Hörner, zweiter Teil
Das Recht zu schweigen
Der Härtefall
Das ist die Mia
Der größtmögliche Triumph
Die zweite Kategorie
Wie die Frage lautet
Vertrauensfrage
Sofakissen
Freiheitsstatue
Der gesunde Menschenverstand
Geruchlos und klar
Würmer
Keine Liebe der Welt
Mittelalter
›Es‹ regnet
Dünne Luft
Siehe oben
Zu Ende
Impressum
Zum Buch
Zur Autorin
Alle weiteren E-Books von Juli Zeh finden Sie auf www.juli-zeh.de
Leseprobe: Juli Zeh, Fragen zu „Corpus Delicti“
Newsletter-Anmeldung
Orientierungsmarken
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Copyright-Seite
Widmung
Hauptteil
Juli Zeh
Corpus Delicti
Ein Prozess
btb
Für Ben
Corpus Delicti
Das Vorwort
Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens – und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit.
Gesundheit könnte man als den störungsfreien Lebensfluss in allen Körperteilen, Organen und Zellen definieren, als einen Zustand geistiger und körperlicher Harmonie, als ungehinderte Entfaltung des biologischen Energiepotentials. Ein gesunder Organismus steht in funktionierender Wechselwirkung mit seiner Umwelt. Der gesunde Mensch fühlt sich frisch und leistungsfähig. Er besitzt optimistisches Rüstungsvertrauen, geistige Kraft und ein stabiles Seelenleben.
Gesundheit ist nichts Starres, sondern ein dynamisches Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Gesundheit will täglich erhalten und gesteigert sein, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, bis ins höchste Alter. Gesundheit ist nicht Durchschnitt, sondern gesteigerte Norm und individuelle Höchstleistung. Sie ist sichtbar gewordener Wille, ein Ausdruck von Willensstärke in Dauerhaftigkeit. Gesundheit führt über die Vollendung des Einzelnen zur Vollkommenheit des gesellschaftlichen Zusammenseins. Gesundheit ist das Ziel des natürlichen Lebenswillens und deshalb natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht und Politik. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es schon.
(Aus dem Vorwort zu: Heinrich Kramer, »Gesundheit als Prinzip staatlicher Legitimation«, Berlin, München, Stuttgart, 25. Auflage)
Das Urteil
IM NAMEN DER METHODE!URTEILIN DER STRAFSACHE GEGEN
Mia Holl, deutsche Staatsangehörige, Biologin
wegen methodenfeindlicher Umtriebe
hat die 2. Strafkammer des Schwurgerichts in öffentlicher Sitzung, an der teilgenommen haben:
1. Vorsitzender Richter am Schwurgericht Dr. Ernest Hutschneider als Vorsitzender,
2. Richter am Schwurgericht Dr. Hager und Richterin Stock als Beisitzer,
3. die Schöffen a) Irmgard Gehling, Hausfrau,b) Max Maring, Kaufmann,
4. Staatsanwalt Bell als Vertreter der Anklagebehörde,
5. Rechtsanwalt Dr. Lutz Rosentreter als Verteidiger,
6. Justizassistent Danner als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle,
für Recht erkannt:
I. Die Angeklagte ist schuldig der methodenfeindlichen Umtriebe in Tateinheit mit der Vorbereitung eines terroristischen Krieges, sachlich zusammentreffend mit einer Gefährdung des Staatsfriedens, Umgang mit toxischen Substanzen und vorsätzlicher Verweigerung obligatorischer Untersuchungen zu Lasten des allgemeinen Wohls.
II. Sie wird deshalb zum Einfrieren auf unbestimmte Zeit verurteilt.
III. Die Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen zu tragen.
Aus den folgenden Gründen …
Mitten am Tag, in der Mitte des Jahrhunderts
Rings um zusammengewachsene Städte bedeckt Wald die Hügelketten. Sendetürme zielen auf weiche Wolken, deren Bäuche schon lange nicht mehr grau sind vom schlechten Atem einer Zivilisation, die einst glaubte, ihre Anwesenheit auf diesem Planeten vor allem durch den Ausstoß gewaltiger Schmutzmengen beweisen zu müssen. Hier und da schaut das große Auge eines Sees, bewimpert von Schilfbewuchs, in den Himmel – stillgelegte Kies- und Kohlegruben, vor Jahrzehnten geflutet. Unweit der Seen beherbergen stillgelegte Fabriken Kulturzentren; ein Stück stillgelegter Autobahn gehört gemeinsam mit den Glockentürmen einiger stillgelegter Kirchen zu einem malerischen, wenn auch selten besuchten Freilichtmuseum.
Hier stinkt nichts mehr. Hier wird nicht mehr gegraben, gerußt, aufgerissen und verbrannt; hier hat eine zur Ruhe gekommene Menschheit aufgehört, die Natur und damit sich selbst zu bekämpfen. Kleine Würfelhäuser mit weiß verputzten Fassaden sprenkeln die Hänge, ballen sich zusammen und wachsen schließlich zu terrassenförmig gestuften Wohnkomplexen an. Die Flachdächer bilden eine schier endlose Landschaft, dehnen sich bis zu den Horizonten und gleichen, das Himmelsblau spiegelnd, einem erstarrten Ozean: Solarzellen, eng beieinander und in Millionenzahl.
Von allen Seiten durchziehen Magnetbahn-Trassen in schnurgeraden Schneisen den Wald. Dort, wo sie sich treffen, irgendwo inmitten des reflektierenden Dächermeers, also mitten in der Stadt, mitten am Tag und in der Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts – dort beginnt unsere Geschichte.
Unter dem besonders lang gezogenen Flachdach des Amtsgerichts geht Justitia ihren Routinegeschäften nach. Die Luft im Raum 20/09, in dem die Güteverhandlungen zu den Buchstaben F bis H stattfinden, ist auf exakt 19,5 Grad klimatisiert, weil der Mensch bei dieser Temperatur am besten denken kann. Sophie kommt niemals ohne ihre Strickjacke zur Arbeit, die sie bei Strafgerichtsverhandlungen sogar unter der Robe trägt. Rechts von ihr liegt ein Aktenstapel, den sie bereits erledigt hat; linker Hand verbleibt ein kleinerer Haufen, den es noch zu bearbeiten gilt. Ihr blondes Haar hat die Richterin zu einem hochsitzenden Pferdeschwanz gebunden, mit dem sie immer noch aussieht wie jene eifrige Studentin in den Hörsälen der juristischen Fakultät, die sie einmal gewesen ist. Sie kaut auf dem Bleistift, während sie auf die Projektionswand schaut. Als sie den Augen des öffentlichen Interessenvertreters begegnet, nimmt sie den Stift aus dem Mund. Sie hat mit Bell zusammen studiert, und er konnte schon vor acht Jahren in der Mensa nervtötende Vorträge über Rachenrauminfektionen halten, die durch den oralen Kontakt mit verkeimten Fremdkörpern verursacht werden. Als ob es in irgendeinem öffentlichen Raum im Land Keime gäbe!
Bell sitzt ihr in einiger Entfernung gegenüber und nimmt mit seinen Unterlagen einen Großteil der Tischplatte ein, während sich der Vertreter des privaten Interesses an die kurze Seite des gemeinsamen Pults zurückgezogen hat. Um die allgemeine Übereinstimmung zu unterstreichen, teilen sich das öffentliche und das private Interesse einen Tisch, was für beide Unterhändler ziemlich unbequem, aber nichtsdestoweniger eine schöne Rechtstradition ist. Wenn Bell den rechten Zeigefinger hebt, wechselt die Projektion an der Wand. Momentan zeigt sie das Bild eines jungen Mannes.
»Bagatelldelikt«, sagt Sophie. »Oder gibt’s Vorbelastungen? Vorstrafen?«
»Keine«, beeilt sich der Vertreter des privaten Interesses zu versichern. Rosentreter ist ein netter Junge. Wenn er in Verlegenheit gerät, fährt er sich mit einer Hand in die Frisur und versucht anschließend, die ausgerissenen Haare möglichst unauffällig zu Boden schweben zu lassen.
»Also einmaliges Überschreiten der Blutwerte im Bereich Koffein«, sagt Sophie. »Schriftliche Verwarnung, und das war’s. Einverstanden?«
»Unbedingt.« Rosentreter wendet den Kopf, um den Vertreter des öffentlichen Interesses zu taxieren. Dieser nickt. Sophie legt eine weitere Akte vom linken Stapel auf den rechten.
»So, Leute«, sagt Bell. »Der nächste Fall ist leider nicht ganz so einfach. Vor allem dich wird’s nicht freuen, Sophie.«
»Eine Kindersache?«
Bell hebt den Finger, an der Wand wechselt die Projektion. Es erscheint die Photographie eines Mannes in mittlerem Alter. Ganzkörper, nackt. Von vorn und hinten. Von außen und innen. Röntgenbilder, Ultraschall, Kernspintomographie des Gehirns.
»Das ist der Vater«, sagt Bell. »Bereits mehrfach vorbestraft wegen Missbrauchs toxischer Substanzen im Bereich Nikotin und Ethanol. Heute bei uns wegen Verstoßes gegen das Gesetz über Krankheitsfrüherkennung bei Säuglingen.«
Sophie macht ein bekümmertes Gesicht.
»Wie alt ist denn das Kleine?«
»Achtzehn Monate. Ein Mädchen. Der Vater hat die Untersuchungspflichten auf den Stufen G2 und G5 bis G7 vernachlässigt. Was noch dramatischer ist: Das Screening des Kindes ist unterblieben. Zerebrale Störungen nicht ausgeschlossen, allergische Sensibilität nicht abgeprüft.«
»So eine Schlamperei! Wie konnte das passieren?«
»Der zuständige Amtsarzt hat den Beschuldigten mehrfach auf seine Verpflichtungen hingewiesen und schließlich einen Betreuer bestellt. Und jetzt kommt’s: Als sich der Betreuer Zutritt zur Wohnung verschaffte, war das arme Ding völlig verwahrlost. Unterernährt, nervöser Brechdurchfall. Es lag buchstäblich im eigenen Kot. Noch ein paar Tage, und es wäre vielleicht zu spät gewesen.«
»Wie furchtbar. So ein Winzling kann sich doch nicht selbst helfen!«
»Der Mann hat private Probleme«, wirft Rosentreter ein. »Er ist alleinerziehend, und …«
»Das verstehe ich. Aber trotzdem. Das eigene Kind!«
Mit einer resignierten Handbewegung zeigt Rosentreter an, dass er im Grunde Sophies Meinung ist. Er hat die Geste gerade zu Ende gebracht, als sich die Tür des Sitzungsraums öffnet. Der Eintretende hat nicht angeklopft und scheint nicht bemüht, unnötigen Lärm zu vermeiden. Er bewegt sich mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der überall Zutritt hat. Sein Anzug sitzt vorbildlich mit jenem wohldosierten Schuss Unachtsamkeit, ohne den wahre Eleganz nicht auskommen kann. Die Haare sind dunkel, die Augen schwarz, die Glieder lang, aber ohne Schlaksigkeit. Seine Bewegungsabläufe erinnern an die trügerische Gelassenheit einer Raubkatze, die, eben noch mit halb geschlossenen Lidern in der Sonne dösend, im nächsten Augenblick zum Angriff übergehen kann. Nur wer Heinrich Kramer besser kennt, weiß, dass er unruhige Finger hat, deren Zittern er gern verbirgt, indem er die Hände in die Hosentaschen schiebt. Auf der Straße trägt er weiße Handschuhe, die er jetzt auszieht.
»Santé, die Herrschaften.«
Er legt seine Aktentasche auf einen der Besuchertische und rückt sich den Stuhl zurecht.
»Santé, Herr Kramer!«, ruft Bell. »Wieder auf der Jagd nach spannenden Geschichten?«
»Das Auge der vierten Gewalt schläft nie.«
Bell lacht und hört wieder damit auf, als ihm klar wird, dass Kramer keinen Witz gemacht hat. Dieser beugt sich vor, runzelt die Stirn und mustert den Vertreter des privaten Interesses, als könne er ihn nicht genau erkennen.
»Santé, Rosentreter«, sagt er, jede Silbe einzeln betonend.
Der Angesprochene grüßt flüchtig und versteckt den Blick in seinen Unterlagen. Kramer zupft seine Bügelfalten zurecht, schlägt die Beine übereinander, legt einen Finger an die Wange und übt sich in der Pose eines unauffälligen Zuhörers, was bei einem Mann seines Formats ein aussichtsloses Unterfangen ist.
»Zurück zum Fall«, sagt Sophie in demonstrativer Geschäftsmäßigkeit. »Was schlägt der Vertreter des öffentlichen Interesses vor?«
»Drei Jahre.«
»Das ist ein bisschen hoch gegriffen«, sagt Rosentreter.
»Finde ich nicht. Wir müssen dem Kerl klarmachen, dass er das Leben seiner Tochter gefährdet hat.«
»Kompromiss«, sagt Sophie schnell. »Zwei Jahre offener Maßregelvollzug, den er zu Hause ableisten kann. Einsetzung eines medizinischen Vormunds für das kleine Mädchen, medizinische und hygienische Fortbildung für den Vater. So wird sichergestellt, dass dem Kind nichts passiert, und die Familie bekommt noch eine Chance. Was meint ihr?«
»Genau das wollte ich auch beantragen«, sagt Rosentreter.
»Wunderbar«, lächelt Sophie, und zu Bell: »Ihre Begründung?«
»Eine Vernachlässigung der medizinischen und hygienischen Vorsorge gefährdet das Wohl des Kindes. Das Elternrecht beinhaltet nicht die Erlaubnis, dem Kind Schaden zuzufügen. Vor dem Gesetz steht das bewusste Zulassen einer Gefährdung dem absichtlichen Zufügen von Leid gleich. Das Strafmaß orientiert sich deshalb an der schweren Körperverletzung.«
Sophie macht eine Notiz.
»Bewilligt«, sagt sie und legt die Akte zur Seite. »Hoffen wir mal, dass die Sache damit im besten Sinn erledigt ist.«
Kramer kreuzt die Beine andersherum und sitzt wieder still.
»Also weiter.« Bell hebt den Zeigefinger. »Mia Holl.«
Die Frau auf der Präsentationswand könnte ebenso gut vierzig wie zwanzig Jahre alt sein. Das Geburtsdatum beweist, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt. Ihr Gesicht strahlt jene besondere Anmutung von Sauberkeit aus, die wir auch an den Anwesenden beobachten können und die allen Mienen etwas Unberührtes, Altersloses, fast Kindliches gibt: den Ausdruck von Menschen, die ein Leben lang von Schmerz verschont geblieben sind. Zutraulich blickt Mia den Betrachter an. Ihr nackter Körper ist schmal und zeigt dennoch eine drahtige Konstitution von hoher Widerstandskraft. Kramer richtet sich auf.
»Wohl wieder ein Bagatelldelikt.« Sophie blickt in die neue Akte und unterdrückt ein Gähnen.
»Wiederholen Sie den Namen.« Das war Kramer. Obwohl er nicht laut gesprochen hat, bringt seine Stimme jeden beliebigen Vorgang im Raum sofort zum Erliegen. Überrascht schauen die drei Juristen auf.
»Mia Holl«, sagt Sophie.
Mit einer Bewegung, als wolle er Fliegen verscheuchen, bedeutet Kramer der Richterin, die Güteverhandlung fortzusetzen. Gleichzeitig zieht er einen elektronischen Kalender aus der Tasche und beginnt, sich Notizen zu machen. Sophie und Rosentreter wechseln einen schnellen Blick.
»Was liegt vor?«, fragt Sophie.
»Vernachlässigung der Meldepflichten«, sagt Bell. »Schlafbericht und Ernährungsbericht wurden im laufenden Monat nicht eingereicht. Plötzlicher Einbruch im sportlichen Leistungsprofil. Häusliche Blutdruckmessung und Urintest nicht durchgeführt.«
»Zeigen Sie mir die allgemeinen Daten.«
Auf einen Wink von Bell laufen lange Listen über die Präsentationsfläche. Blutwerte, Informationen zu Kalorienverbrauch und Stoffwechselabläufen, dazu einige Diagramme mit Leistungskurven
»Die ist doch gut drauf«, sagt Sophie und gibt Rosentreter damit das Stichwort.
»Keine Vorbelastungen. Erfolgreiche Biologin mit Idealbiographie. Keine Anzeichen von physischen oder sozialen Störungen.«
»Hat sie die ZPV in Anspruch genommen?«
»Bis jetzt liegt kein Antrag bei der Zentralen Partnerschaftsvermittlung vor.«
»Eine schwierige Phase. Nicht wahr, Jungs?« Die Richterin lacht über Bells säuerliche und Rosentreters erschrockene Miene. »Ich würde in diesem Fall gern auf eine Verwarnung verzichten und Hilfestellung anbieten. Einladung zum Klärungsgespräch.«
»Meinetwegen.« Bell zuckt die Achseln.
»Eine schwierige Phase.« Lächelnd tippt Kramer auf seinem Display. »So kann man es auch ausdrücken.«
»Kennen Sie die Beschuldigte?«, fragt Sophie freundlich.
»Ich schätze die Zurückhaltung des Gerichts.« Mit charmantem Spott zwinkert Kramer ihr zu. »Auch Sie sind der Beschuldigten schon einmal begegnet, Sophie. Wenn auch unter anderen Umständen.«
Sophie wird nachdenklich. Wäre ihr Teint nicht ohnehin von gesunder Farbe, könnten wir sie erröten sehen. Kramer packt seinen Kalender ein und steht auf.
»Schon fertig?«, fragt Bell.
»Im Gegenteil. Ganz am Anfang.«
Während Kramer zum Abschied winkt und den Raum verlässt, schließt Sophie die Akte und zieht eine neue heran.
»Der Nächste, bitte.«
Pfeffer
Es kam aus dem Kinderzimmer! So!« Lizzie lässt das Treppengeländer los, beugt sich vor und schauspielert ein übertriebenes Niesen. »Haa-tschi! Haa-tschi!«
»Das ist nicht dein Ernst.« Die Pollsche schaut sich um, als hätte soeben ein Geist das Treppenhaus durchquert. »Das klingt doch wie …«
»Sag’s ruhig!«
»Wie ein Niesen.«
»Genau! Aus dem Kinderzimmer! Was glaubt du, wie ich gerannt bin.«
»So ein Quatsch!« Driss ist die Dritte im Bunde, hoch aufgeschossen wie ein junger Baum, mit dem sie die Abwesenheit weiblicher Rundungen teilt. Ein flaches Gesicht balanciert über dem Kragen des weißen Kittels, große Augen spiegeln das jeweilige Gegenüber. Auch ohne Sommersprossen hätte man Schwierigkeiten, einem Mädchen wie ihr die Volljährigkeit zu glauben.
»Was ist Quatsch?«, fragt die Pollsche.
»Erkältung ist seit den zwanziger Jahren ausgestorben.«
»Fräulein Blitzmerker.« Lizzie rollt die Augen.
»Neulich war doch wieder Warnung«, flüstert die Pollsche.
»Siehst du, Driss, die Pollsche liest den GESUNDEN MENSCHENVERSTAND. Ich also das Herz in der Hose und die Tür aufgerissen. Und was seh ich? Am Boden hockt meine Kleine mit dem Bengel von der Ute und steckt das Näschen in die Pfeffertüte. Niest wie eine Weltmeisterin.«
»Arzt haben die gespielt!« Die Pollsche beginnt zu lachen.
»Und deine Kleine war die Patientin.« Jetzt lacht auch Driss.
»Ihr habt’s erfasst, Kinder. Aber wer fast krank geworden ist vor Angst, das war ich.«
Die drei stehen beisammen, als wollten sie nachahmen, wie sie bereits gestern beisammengestanden haben und vorgestern und alle Tage davor. Genauso reicht die Kette aus Wiederholungen des immer gleichen Bilds in die Zukunft: Lizzie stützt sich auf den Schlauch der Desinfektionsmaschine, die Pollsche lehnt am Kasten des Bakteriometers, und Driss hat beide Arme auf das Treppengeländer gelegt. Als die Haustür aufgeht, verstummen alle drei mit einem Schlag. Da ist er wieder: Der Mann im dunklen Anzug. Das Gesicht ist zur Hälfte von einem weißen Tuch verdeckt, aber ein Blick in seine Augen genügt, um zu erkennen, wie schön er ist.
»Santé! Einen guten Tag, die Damen.«
»Ein guter Tag«, sagt Lizzie, stellt eine Hüfte aus und stützt die Hand darauf, »ein guter Tag wäre einer, an dem wir nichts mehr zu tun hätten.«
»Aber, mein Herr, Sie müssen nicht …« Driss zeigt dem Mann mit ausgestrecktem Finger ins Gesicht.
»Sie meint den Mundschutz«, sagt die Pollsche schnell.
»Das ist ein Wächterhaus«, sagt Lizzie. »Sie brauchen hier drin keinen Mundschutz.«
»Wie dumm von mir.« Kramer löst das Band hinter dem Kopf. »Da war doch die Plakette am Eingang.«
Den Mundschutz schiebt er in die Jackentasche. Während des anschließenden Schweigens wäre genug Zeit, ein Referat über Wächterhäuser zu halten. In Wohnkomplexen, deren Hausgemeinschaft sich durch besondere Zuverlässigkeit auszeichnet, können Aufgaben der hygienischen Prophylaxe von den Bewohnern in Eigenregie übernommen werden. Regelmäßige Messungen der Luftwerte gehören ebenso dazu wie Müll- und Abwasserkontrolle und die Desinfizierung aller öffentlich zugänglichen Bereiche. Ein Haus, in dem diese Form der Selbstverwaltung funktioniert, wird mit einer Plakette ausgezeichnet und erhält Rabatte auf Strom und Wasser. Die Wächterhaus-Initiative feiert auf allen Ebenen die größten Erfolge. Der Fiskus spart Geld bei der Gesundheitsvorsorge, und die Menschen entwickeln Gemeinschaftssinn. Wer auch immer in grauer Vergangenheit behauptet hat, das Volk sei zu faul oder zu dumm für eine basisdemokratische Mitwirkung am öffentlichen Leben – er hatte nicht recht. In Wächterhäusern beweisen die Leute, dass sie sehr wohl in der Lage sind, zum allgemeinen Nutzen zusammenzuarbeiten. Sie haben Freude daran. Man trifft sich, man diskutiert, man fällt Entscheidungen. Man hat, im wahrsten Sinne des Wortes, miteinander zu tun.
Heinrich Kramer, der, umringt von den drei Damen in weißen Kitteln, wie ein stolzes Pferd zwischen Ziegen im Treppenhaus steht, war an der Entwicklung der Wächterhaus-Idee maßgeblich beteiligt. Doch berühmt war er vorher schon. Jeder im Land weiß, wer er ist. Darin liegt der Grund für das anhaltende Schweigen, genau wie für das jetzt losbrechende Geschnatter.
»Hol mich der Virus!«
»Das ist doch …«
»Sind Sie nicht?«
»Mensch, Driss, jetzt starr ihn nicht so an, das ist ja peinlich.«
Kramer legt eine Hand ans Brustbein und verbeugt sich.
»Verbindlichsten Dank, meine Damen. Sagen Sie, wohnt hier bei Ihnen eine Frau Holl?«
»Die Mia!«, ruft Driss und klatscht in die Hände. Bei einem Ratespiel hätte sie richtig darauf getippt, dass Heinrich Kramer unter allen Nachbarn nach Mia Holl fragen wird. Auch wenn Driss das nicht erklären könnte: Für sie ist die Mia etwas Besonderes.
»Frau Holl wohnt ganz oben. Terrasse nach hinten.«
»Tolle Wohnung«, sagt die Pollsche. »Mit der Biologie verdient man nicht schlecht.«
»Zu Recht«, sagt Lizzie streng.
»Schön«, sagt Kramer. »Und ist Frau Holl zu Hause?«
»Immer!«, ruft Driss. »Zur Zeit, mein ich.« Sie beugt sich zu Kramer, als wolle sie ihm ein Geheimnis verraten. »Man sieht die Mia gar nicht mehr.«
»Frau Mia Holl«, korrigiert Lizzie, »geht derzeit nicht arbeiten.«
»Dann hat sie Urlaub?«
»Ach was!«, platzt die Pollsche heraus. »So ein hübsches Kind und immer allein! Die guckt Angebote durch.«
»Wir glauben«, sagt Lizzie vertraulich zu Kramer, »dass Frau Holl einen Partner sucht.«
Kramer nickt. »Dann will ich mal.«
»Die Mia ist eine Anständige.«
»Das versteht sich doch von selbst, Driss.«
»In einem Haus wie diesem.«
»Danke.« Kramer nickt in die Runde, während er den Kreis der Nachbarinnen durchbricht. »Sie haben mir sehr geholfen. Und meinen Glückwunsch zu diesem schönen Haus.«
Die Münder bleiben offen, aber stumm, während man Kramer und seinen Beinen und seiner ganzen elastischen Gestalt beim Treppensteigen zusieht.
Die ideale Geliebte
Weil das Leben so sinnlos ist«, sagt Mia, »und man es trotzdem irgendwie aushalten muss, bekomme ich manchmal Lust, Kupferrohre beliebig miteinander zu verschweißen. Bis sie vielleicht einem Kranich ähneln. Oder einfach nur ineinandergewickelt sind wie ein Nest aus Würmern. Dann würde ich das Gebilde auf einen Sockel montieren und ihm einen Namen geben: Fliegende Bauten, oder auch: Die ideale Geliebte.«
Während Mia mit dem Rücken zum Zimmer am Schreibtisch sitzt, vor sich ein paar Zettel, auf denen sie gelegentlich etwas notiert, liegt die ideale Geliebte auf der Couch, gekleidet in ihr eigenes Haar und das Licht der Nachmittagssonne. Durch keine Regung verrät die Schöne, ob sie versteht, was Mia spricht. Wir könnten uns fragen, ob sie Mia überhaupt wahrnimmt. Oder ob sie vielmehr in einer anderen Dimension existiert und dort ins Leere schaut, indes sich Mia bloß zufällig vor ihren Augen befindet, an einem Kreuzungspunkt zwischen den Welten. Der Blick der idealen Geliebten gleicht dem Starren eines Wassertiers, das keine Augenlider besitzt.
»Nur, damit etwas bleibt«, sagt Mia. »Um etwas Zweckloses zu schaffen. Alles, was einen Zweck hat, erfüllt ihn eines Tages und ist damit verbraucht. Selbst Gott besaß den Zweck, die Menschen zu trösten, und siehe da: Mit seiner Ewigkeit war es nicht allzu weit her. Verstehst du?«
In der Wohnung herrscht Chaos. Es sieht aus, als hätte hier seit Wochen niemand aufgeräumt, gelüftet oder geputzt.
»Natürlich verstehst du das. Es ist von Moritz. Er sagte: Wer Ewigkeit will, darf nicht einmal den Zweck des eigenen Überlebens verfolgen.«
Weil die ideale Geliebte nicht reagiert, dreht sich Mia mit dem Stuhl herum.
»Wenn er mich ärgern wollte, sagte er, ich hätte Künstlerin werden sollen. Seiner Meinung nach hat mich das naturwissenschaftliche Denken verdorben. Wie, fragte er, soll man einen Gegenstand oder gar ein geliebtes Wesen betrachten, wenn man ständig daran denken muss, dass nicht nur das Betrachtete, sondern auch man selbst nur ein Teil des gigantischen Atomwirbels ist, aus dem alles besteht? Wie soll man es ertragen, dass sich das Gehirn, unser einziges Instrument des Sehens und Verstehens, aus den gleichen Bausteinen zusammensetzt wie das Gesehene und Verstandene? Was, rief Moritz dann, soll das sein: Materie, die sich selbst anglotzt?«
Die ideale Geliebte hat mit Materie wenig gemeinsam. Vielleicht tut es Mia deshalb gut, mit ihr zu sprechen.
»Erst hat die naturwissenschaftliche Erkenntnis das göttliche Weltbild zerstört und den Menschen ins Zentrum des Geschehens gerückt. Dann hat sie ihn dort stehen lassen, ohne Antworten, in einer Lage, die nichts weiter als lächerlich ist. Das hat Moritz oft gesagt, und in diesem Punkt gab ich ihm recht. So verschieden haben wir gar nicht gedacht. Nur unsere Schlussfolgerungen waren nicht dieselben.«
Mit dem Stift zeigt Mia auf die ideale Geliebte, als gebe es einen Grund, sie anzuklagen.
»Er wollte für die Liebe leben, und wenn man ihm zuhörte, konnte man auf die Idee kommen, dass Liebe schlicht ein anderes Wort war für alles, was ihm gefiel. Liebe war Natur, Freiheit, Frauen, Fische fangen, Unruhe stiften. Anders sein. Noch mehr Unruhe stiften. Das alles hieß bei ihm Liebe.«
Mia wendet sich wieder dem Schreibtisch zu und macht Notizen, während sie weiterspricht.
»Ich muss das aufschreiben. Ich muss ihn aufschreiben. Das menschliche Gedächtnis sortiert 96 Prozent aller Informationen nach wenigen Tagen aus. Vier Prozent Moritz sind nicht genug. Mit vier Prozent Moritz kann ich nicht weiterleben.«
Eine Weile schreibt sie verbissen, dann hebt sie den Kopf.
»Wenn wir über Liebe sprachen, wurde er beleidigend. Du, sagte er zu mir, bist Naturwissenschaftlerin. Deine Freunde und Feinde siehst du nur unter dem Elektronenmikroskop. Wenn du das Wort Liebe sagst, muss sich das anfühlen, als hättest du einen Fremdkörper im Mund. Deine Stimme klingt anders bei diesem Wort. Liebe. Eine halbe Oktave höher. Dein Kehlkopf zieht sich zusammen, Mia, ein schriller Ton, Liebe. Als Kind hast du es sogar vor dem Spiegel geübt. Liebe. Du hast dir dabei selbst in die Augen gesehen und nach dem Grund gesucht, der dieses Wort so schwierig macht: Liebe. Es ist einfach so, Mia, dass du diesen Begriff nicht richtig aussprechen kannst. Für dich gehört er zu einer fremden Sprache, die nach einer unnatürlichen Gaumenstellung verlangt. Sag mal, ich liebe dich, Mia! Sag: Das Wichtigste im Leben ist die Liebe. Mein Lieber, Liebster. Liebst du mich? – Schon wendest du dich ab, Mia! Du gibst auf!«
Ein weiteres Mal dreht sie sich mit dem Schreibtischsessel herum, diesmal in einer ungestümen Bewegung.
»Und was war sein letzter Satz? ›Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann.‹ Wo war sie da, seine Liebe? Es gibt Sätze, die prägen das Gehirn wie eine Metallstanze, so dass man fortan nur noch in diesen Bahnen denken kann. Wie soll ich das vergessen? Wie soll ich das nicht vergessen? Du hast ihn gekannt, wahrscheinlich besser als ich. Keine Ahnung, ob er wusste, wie sehr ich ihn liebte. Ich weiß nicht einmal«, ruft Mia, »ob ich in der Lage bin, ihn angemessen zu vermissen!«
»Red keinen Scheiß«, sagt die ideale Geliebte. »Wir machen doch nichts anderes, bei Tag und bei Nacht. Wir vermissen ihn. Gemeinsam. Komm her.«
Als Mia aufsteht und den ausgestreckten Armen der idealen Geliebten entgegengeht, klingelt es an der Tür.
Eine hübsche Geste
Es gibt Momente, in denen die Zeit stehenbleibt. Zwei Menschen sehen einander in die Augen: Materie, die sich selbst anglotzt. Um die entstandene Blickachse, die sich hinter den Köpfen ins Unendliche verlängern lässt, dreht sich für ein paar Sekunden die ganze Welt. Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass hier nicht von Liebe auf den ersten Blick die Rede ist. Eher würden wir das, was gerade zwischen Mia und Kramer geschieht, das stumme Getöse am Anfang einer Geschichte nennen.
Mia hat ihm die Tür geöffnet, und für eine Weile spricht niemand ein Wort. Was Kramer denkt, ist schwer zu erraten; vermutlich wartet er einfach darauf, dass Mia die Gastgeberin in sich entdeckt. Er ist ein geduldiger Mann. Vielleicht nimmt er Rücksicht, verharrt respektvoll auf der Schwelle und will ihr Zeit geben, weil er versteht, in welch merkwürdiger Situation sie sich befindet. Schließlich erlebt man es nicht alle Tage, dass ein Mensch, den man im Geiste schon so viele Male und auf so unterschiedliche Arten zu Tode gequält hat, plötzlich leibhaftig vor einem steht.
»Seltsam«, sagt Mia, als sie die Sprache wiederfindet. »Ich habe das Fernsehen gar nicht angeschaltet. Und trotzdem sehe ich Sie.«
Darauf lächelt Kramer ein bezauberndes, offenherziges Lächeln, das ihm niemand zutrauen würde, der ihn nur aus den Medien kennt. Es ist ein Privatlächeln. Das Lächeln eines Menschen, der trotz großer Berühmtheit ganz der Alte geblieben ist.
»Santé«, sagt er, zieht den rechten Handschuh aus und streckt Mia die nackte Hand hin. Sie betrachtet diese Hand wie ein exotisches Insekt, bevor sie zögernd ihre Finger in seine legt.
»Eine hübsche Geste, wie aus einem alten Film«, sagt sie. »Scheint mir nicht recht zu Ihnen zu passen. Haben Sie keine Angst vor meinem Infektionspotential?«
»Das Wichtigste im Leben ist Stil, Mia Holl. Und Hysterie ist die schlimmste Feindin des guten Stils.«
»Ihr Gesicht«, sagt Mia nachdenklich, »ist wohl eine Art Etikett. Man kann es auf die unterschiedlichsten Ansichten kleben.«
»Darf ich reinkommen?«
»Sie verlangen, dass ich dem Mörder meines Bruders etwas zu trinken anbiete?«
»Durchaus nicht. Für eine so plumpe Einschätzung sind Sie zu intelligent. Aber etwas zu trinken hätte ich tatsächlich gern. Eine Tasse heißes Wasser.«
Kramer geht an Mia vorbei in die Wohnung und steuert das Sofa an, auf dem die ideale Geliebte schnell zur Seite rutscht. Kaum hat Kramer sich hingesetzt, wirkt das Sofa wie für ihn gemacht. Den angewiderten Blick der idealen Geliebten bemerkt er nicht, was ausnahmsweise weniger an seiner Selbstsicherheit liegt als an der Tatsache, dass er die ideale Geliebte nicht sehen kann.
»Nur der Vollständigkeit halber: Ich habe Ihren Bruder nicht ermordet. Wir sollten vielleicht eher fragen, woher er im Gefängnis die Angelschnur hatte, um sich aufzuhängen.«
Mia steht mitten im Raum, hat die Arme gekreuzt und die Finger ins Fleisch der Oberarme gekrallt, als wolle sie sich am eigenen Körper festhalten – oder verhindern, dass ihre Hände sich selbständig machen, um Heinrich Kramer zu erwürgen.
»Sie …«, stößt Mia hervor, »Sie bemühen sich nicht gerade, meinen Hass zu entschärfen.«
Kramer kann auch geschmeichelt lächeln; dazu streicht er sich übers Haar.
»Hassen Sie nur«, sagt er. »Ich bin hier, um mit Ihnen zu reden. Sie sollen mich nicht heiraten.«
»Dem stünden hoffentlich unsere Immunsysteme entgegen.«
»Interessanterweise«, Kramer legt einen Finger an die Nase, »wären wir immunologisch kompatibel.«
»Interessanterweise«, sagt die ideale Geliebte und legt ebenfalls einen Finger an die Nase, »sind Sie ein noch größeres Arschloch, als wir dachten.«
»Versuchen wir es mit Logik.« Mia hat ihre Stimme wieder unter Kontrolle. »Wenn Sie und Ihr Schwadron aus dreckigen Kläffern nicht diese Kampagne gegen Moritz gefahren hätten, wäre er vielleicht nicht verurteilt worden. Und ohne Verurteilung hätte er sich nicht umgebracht.«
»So gefallen Sie mir schon besser.« Kramer hat den rechten Ellbogen auf die Rückenlehne der Couch gelegt, als ob er die ideale Geliebte in den Arm nehmen wollte. »Logisches Denken liegt Ihnen, genau wie mir. Deshalb werden Sie mühelos Ihren Denkfehler erkennen. Kausalität ist keineswegs identisch mit Schuld. Sonst müssten Sie auch den Urknall für den Tod Ihres Bruders verantwortlich machen.«
»Vielleicht tue ich das.« Die Erde gerät auf ihrer Umlaufbahn in ein Schlagloch, Mia schwankt, will sich auf den Schreibtisch stützen und greift ins Leere. »Ich verurteile den Urknall. Ich verurteile das Universum. Ich verurteile unsere Eltern, weil sie Moritz und mich zur Welt gebracht haben. Ich verurteile alles und jeden, der ursächlich ist für seinen Tod!«
»Kommen Sie. Ich helfe Ihnen.«
Kramer erhebt sich, hilft Mia, die auf die Knie gesunken ist, beim Aufstehen und führt sie zum Sofa. Behutsam streicht er ihr das Haar aus der Stirn.
»Fass sie nicht an!«, zischt die ideale Geliebte.
»Ich geh uns mal eine Tasse heißes Wasser machen.« Kramer verschwindet in der Küche.
Genetischer Fingerabdruck
Der Vorfall, von dem hier gesprochen wird, liegt nicht lang zurück. Ein Blick auf die Fakten zeigt ein verblüffend simples Geschehen. Moritz Holl, 27 Jahre alt, ein zugleich sanfter und hartnäckiger Mann, der von seinen Eltern »Träumer«, von Freunden »Freidenker« und von seiner Schwester Mia meistens »Spinner« genannt wurde, meldete in einer gewöhnlichen Samstagnacht einen schrecklichen Fund bei der Polizei. Eine junge Frau namens Sibylle, mit der er sich nach eigenen Angaben zu einem Blind Date an der Südbrücke verabredet hatte, war bei seinem Eintreffen weder sympathisch noch unsympathisch, sondern tot. Man nahm die Zeugenaussage des völlig verstörten Moritz zu Protokoll und schickte ihn nach Hause. Zwei Tage später saß er in Untersuchungshaft. Man hatte sein Sperma im Körper der Vergewaltigten gefunden.