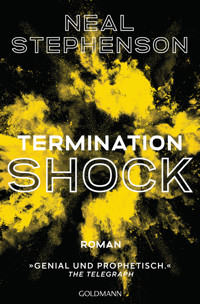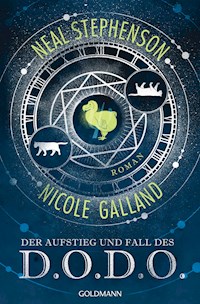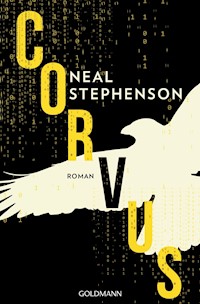
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn die digitale Welt über den Tod triumphiert?
Als Richard Forthrast, genannt Dodge, überraschend früh verstirbt, erfüllen seine Angehörigen seinen letzten Willen: Er hatte verfügt, dass sein Gehirn konserviert werden soll, bis die Technologie es eines Tages ermöglicht, die Daten seines Bewusstseins zu erfassen und hochzuladen. Viele Jahre später gelingt es dank eines komplexen Verfahrens tatsächlich, Dodge digitales Leben einzuhauchen. Er hat den Tod überwunden und erschafft nun eine neue Welt, die »Bitworld«, die bevölkert ist von digitalen Seelen wie seiner eigenen. Doch das schöne neue Jenseits ist nicht das erträumte Paradies – und schon bald entflammt dort ein erbitterter Kampf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1683
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Als Richard Forthrast, genannt Dodge, nach einer ambulanten Routineuntersuchung mit Vollnarkose nicht mehr aufwacht, müssen sein Bruder, seine Schwägerin, seine Nichte Zula sowie sein langjähriger Geschäftspartner Corvallis Kawasaki, genannt C-plus, seinen letzten Willen umsetzen. Dodge hat nämlich verfügt, dass sein Gehirn konserviert werden soll, bis die Technologie es eines Tages ermöglicht, die Daten seines Bewusstseins zu erfassen und hochzuladen.
Erst viele Jahre später gelingt es ausgerechnet Dodges Großnichte Sophia sein Gehirn in einem Experiment für ihre Abschlussarbeit an der Princeton University zu animieren. Dodges digitales Gehirn erinnert sich an fast nichts, aber unter Ausnutzung einer ungeheuren Rechnerleistung kreiert es Schritt für Schritt seine virtuelle Welt: die Bitwelt, die der realen Welt nicht unähnlich ist. In diesem digitalen Jenseits nennt sich Dodge nun Egdod und gibt sich eine menschliche Form mit kleinen Flügeln am Rücken. Seine Welt wird nach und nach von weiteren digitalen Seelen bevölkert: Verstorbenen, deren Organismus gescannt, archiviert und dann gebootet wurde. Doch das schöne neue Jenseits ist nicht das erträumte Paradies – und schon bald entflammt dort ein erbitterter Kampf …
Weitere Informationen zu Neal Stephenson sowie den lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Neal Stephenson
Corvus
Roman
Aus dem Amerikanischen von Juliane Gräbener-Müller
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Fall; or, Dodge In Hell« bei William Morrow, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2021
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Neal Stephenson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Nikolaus Stingl
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
CN · Herstellung: Han
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-24987-8V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:
Für O. L.
BUCH 1
TEIL 1
1
Dodge wurde wach. Auf dem Nachttisch rumorte sein Handy. Mit geschlossenen Augen griff er zielsicher danach, riss es vom Ladekabel und zog es zu sich ins Bett. Er tippte es ein Mal an, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Es verstummte. Er drehte sich auf die Seite und schob das Handy unters Kissen, damit er es, wenn der Wecker nach neun Minuten erneut losging, leichter wieder in den Schlummermodus würde versetzen können. Es war wie ein kleines Wunder, dass sein Gehirn über ein so ausgeprägtes 3D-Modell von seinem Bett und dessen Umgebung verfügte, dass er das, was er gerade getan hatte, mit geschlossenen Augen tun konnte. Allerdings bestand kein Anlass, sein Glück herauszufordern.
Er verspürte keine besondere Lust, noch einmal einzuschlafen, denn er hatte einen seltsam langweiligen Traum hinter sich, dessen zentraler Handlungsstrang anscheinend in der schwierigen Suche nach Kaffee bestanden hatte. In diesem Traum hatte er sich in der Kleinstadt in Iowa befunden, in der er aufgewachsen war. Deren Landschaft und handelnde Personen hatten sich vermischt mit Orten, an denen er gewesen, und Menschen, denen er begegnet war, seit er damals die Stadt im Rückspiegel seines Pick-ups hatte verschwinden sehen. Doch das Straßennetz dieser Stadt, das gerade mal ein paar quadratische Häuserblocks umfasste und von einem Jungen auf dem Fahrrad mühelos zu bewältigen war, stellte Jahrzehnte später das räumliche Gitterwerk dar, auf dem so gut wie alle seine Träume aufbauten. Es war das Millimeterpapier, das sein Verstand offenbar brauchte, um Dinge zu entwerfen.
In dem Traum hatte er sich auf die Suche nach Kaffee begeben, nur um sich ständig vor allen möglichen unglaublich prosaischen Hindernissen wiederzufinden. In der Erzählwelt des Traums war das merkwürdig frustrierend; es war einfach unrealistisch, dass so viele Eventualitäten ein so einfaches Vorhaben vereiteln konnten.
Aus Sicht des wachen oder zumindest nur noch dösenden Dodge gab es für all das jedoch eine einleuchtende Erklärung: Es war tatsächlich sehr schwer, an Kaffee zu kommen, solange man mit geschlossenen Augen im Bett lag.
Im Verlauf der folgenden Stunde tippte er noch mehrmals auf »Schlummern«. Dazwischen schlief er. Allerdings war es ein Dämmerschlaf, phasenweise mehrere Minuten am Stück halb bewusst und aufmerksam, bis seine Gedanken immer wieder zusammenhanglos wurden und sich in undeutlichen Fetzen verloren, die sich zu echten Träumen wie Spinnweben zu Spinnennetzen verhielten.
Er fragte sich, ob die Designer des Handys klinische Studien an Snoozern durchgeführt hatten, um zu dem Neunminutenintervall zu gelangen. Warum nicht acht Minuten oder zehn? Die Handyhersteller nahmen es mit dem Design bekanntlich sehr genau. Es dürfte datenbasiert gewesen sein. So war es kein Zufall, dass Dodge gerade genug Zeit zugestanden wurde, um den Bewusstseinsfaden zu verlieren, ehe der Wecker wieder klingelte. Wäre das Intervall viel kürzer gewesen, hätte er nicht die Zeit gehabt, wieder wegzudösen, weshalb man diese Funktion eigentlich nicht Schlummerfunktion hätte nennen dürfen. Bei einem viel längeren Intervall dagegen hätte sich der Schlummer zu echtem Schlaf vertieft. Dodge behielt immer noch grob den Überblick: Ich habe die Schlummertaste dreimal angetippt. Fünfmal. So oft, dass ich rund eine Stunde länger geschlafen habe.
Doch diese provisorischen Rechnungen wurden nicht von einem Gefühl der Schuld oder Dringlichkeit begleitet. Er wusste, dass es eigentlich keine Rolle spielte, denn während des kurzen Bewusstheitsintervalls, das auf das dritte Antippen der Snoozetaste folgte, war ihm eingefallen, dass er heute nicht im Büro erwartet wurde. Er sollte sich nämlich um elf Uhr, was noch Stunden hin war, einem ambulanten Routineeingriff unterziehen.
Neben dem Verlangen nach Kaffee ließ nur noch eins ihn einen gewissen Drang zum Aufstehen verspüren, und das war eigenartigerweise das vage Bewusstsein, dass dieser ganze zusätzliche Schlaf es ihm schwerer machen würde, sein Mittagsschläfchen zu halten. Das fand täglich um zwei oder halb drei statt. Daran hielt sich Dodge seit rund einem Jahrzehnt mit peinlicher Genauigkeit. Als er diese Gewohnheit angenommen hatte, hatte er sich gefragt, ob es mit dem Alter zusammenhing, denn die alten Knaben in seiner Familie waren bekannt dafür, dass sie in Kirchenbänken, Hollywoodschaukeln, ja sogar hinter dem Steuer einnickten. Er konnte sich jedoch erinnern, dass er, als er mit achtzehn in verschiedenen Schrottkarren durch den gesamten Westen der Vereinigten Staaten und Kanadas gefahren war, jeden Nachmittag von einem so starken Schlafdrang übermannt wurde, dass es schon fast wehtat. Er hatte immer versucht, dagegen anzukämpfen, oder schlicht vermieden, um diese Tageszeit Auto zu fahren. Wirklich verändert hatte sich seitdem nur, dass er jetzt reicher war, sodass er sich ein eigenes Büro mit Yogamatte und Kopfkissen in der Ecke leisten konnte, und weise genug, um sich nicht mehr gegen ein Schläfchen am Nachmittag zu wehren. Wenn er die Tür zumachte, seine elektronischen Geräte ausschaltete, die Matte ausrollte, sich hinlegte und für zwanzig Minuten dem Schlaf überließ, konnte er sich in einem Maße erholen, dass er danach für mehrere Stunden hellwach weiterarbeiten konnte.
Die Länge der Zeit, die er schlafend verbrachte, spielte letztlich keine Rolle. Er hatte beschlossen, dass der Schlüssel zu allem – das, was darüber bestimmte, ob der Mittagsschlaf ihn tatsächlich erfrischte – das Abreißen des Bewusstseinsfadens war: der Moment, wo er aufhörte, auf kohärente, fortlaufende, seiner selbst bewusste Weise zu denken, und wegdämmerte. Dieser war oft mit dem Zucken eines Arms oder Beins verbunden, dann nämlich, wenn er die Schwelle vom bewussten Denken zum Traum überschritt, wo er den Arm ausstrecken und einen Ball fangen oder eine Tür öffnen oder dergleichen tun musste. Wenn das Zucken ihn nicht weckte, hieß das, er hatte den Bewusstseinsfaden durchtrennt, und der Mittagsschlaf hatte seinen einzigen wahren Zweck erfüllt. Selbst wenn er zehn Sekunden später schon wieder aufwachte, war er genauso erholt – womöglich sogar noch erholter –, wie wenn er eine Stunde lang tief geschlafen hätte.
Er hatte das Zucken studiert. Wenn er, was immer seltener passierte, mit einer Frau schlief, zwang er sich zuweilen, wach zu bleiben, während sie einschlummerte; dann lauschte er auf ihre Atmung und spürte, wie sich ihr Körper an seinem entspannte, bis sie just im Augenblick des Wegdämmerns ruckartig eine ihrer Gliedmaßen bewegte.
Seine geschäftlichen Aktivitäten (er war Gründer und Vorstandsvorsitzender einer großen Computerspielefirma) erforderten mitunter, dass er in einem Privatjet zu der acht Zeitzonen entfernten Isle of Man flog, wo ein langjähriger Geschäftspartner – Autor und Privatier – in einem renovierten Schloss wohnte. Der Mann quartierte ihn jedes Mal in einem Zimmer oben in einem der Türme ein: einem runden Raum, der mit mittelalterlichem Krimskrams dekoriert war und mithilfe eines in die Wand eingebauten Kamins beheizt wurde. Darin stand ein Himmelbett mit einem schweren Baldachin. Vor zwei Jahren war Richard – so lautete nämlich Dodges richtiger Name –, nachdem er in dieses Bett gestiegen war und dort eine Weile schlaflos gelegen hatte, am Ende hinübergedämmert und in einen Albtraum geraten, in dem eine sehr gefährliche und unangenehme Person auftauchte, mit der er sich einige Jahre zuvor angelegt hatte. Er war mit dem halluzinatorischen Eindruck aufgewacht, dieser Mann stehe neben seinem Bett und schaue auf ihn herab. Was unmöglich war, da der Mann gar nicht mehr lebte – doch Richard hatte sich noch halb im Traum befunden, ein Zustand, in dem Logik außer Kraft gesetzt war und alles, was er wusste, das war, was er sah. Er versuchte, sich aufzusetzen. Nichts geschah. Er versuchte, die Arme zu heben. Sie bewegten sich keinen Millimeter. Er versuchte, Luft zu holen und zu schreien, doch sein Körper reagierte nicht auf den Befehl seines Gehirns. Er war ganz und gar hilflos, ja ihm fehlte sogar die Kraft des Gefangenen, der sich gegen seine Fesseln wehrt. Ihm blieb nichts anderes übrig, als diese schreckliche Angst und das Grauen seiner völligen Handlungsunfähigkeit zu durchleben, bis er irgendwie erneut wegdämmerte.
Kurz darauf war er aus dem Schlaf hochgeschreckt und hatte sich ruckartig aufgesetzt. Sein Körper funktionierte wieder. Dodge schlug die schwere Bettdecke zurück, schwang die Füße vom Bett und drehte sich dabei dem kaum einen Meter von ihm entfernten verglimmenden Feuer zu. Außer ihm befand sich niemand im Raum. Die massive, einer Festung würdige Tür war immer noch verriegelt. Der Eindruck eines Albtraums, der noch vor einer Minute so überzeugend gewesen war, wirkte jetzt lächerlich. Als Dodge sich probeweise wieder hinlegte und den Blick nach oben richtete, sah er, dass seine Nachttischlampe einen Flammenschatten auf den Baldachin über ihm warf und dass sich der Schatten hin und her bewegte, während das Feuer flackerte und die Holzscheite zusammensackten. Er musste beim Schlafen die Augen halb geöffnet und das für den Schatten eines Mannes gehalten haben.
Für den Albtraum gab es also eine Erklärung, nicht jedoch für die völlige Lähmung, die ihn dabei erfasst hatte. Später hatte Richard erfahren, dass es sich hierbei um ein allgemein anerkanntes und wissenschaftlich belegtes Phänomen namens Schlafstarre gehandelt hatte. Primitive Kulturen sahen darin eine Form der Verzauberung oder erfanden Geschichten über schauerliche Nachtmahren ähnliche Kreaturen, die sich dem Menschen auf die Brust setzten, ihn an sein Bett drückten und ihm die Luft aus der Lunge und die Schreie aus der Kehle sogen.
Es gab jedoch eine absolut einleuchtende Erklärung dafür. Wenn man wach war, konnte das Gehirn natürlich den Körper kontrollieren. Im Schlaf dagegen neigte man zum Träumen. Und im Traum konnte man rennen, kämpfen und sprechen. Würde der Körper aber weiterhin auf Befehle vom Gehirn reagieren, schlüge man im Bett wild um sich, gäbe Lautäußerungen von sich und so weiter. Daher hatte sich ein Mechanismus entwickelt, dank dem im Moment der Durchtrennung des Bewusstseinsfadens auch die Verbindung zwischen Gehirn und Körper unterbrochen wurde, so als legte man einen Schalter um. Beim Aufwachen wurde der Schalter dann wieder auf »An« gestellt, und man bewegte sich wieder so wie immer. Normalerweise funktionierte das System mit einem so erstaunlichen Grad an Perfektion, dass die meisten Menschen zeit ihres Lebens nicht einmal von seiner Existenz wussten. Doch jedes System unterlag Störungen. Dazu gehörte etwa das Zucken, das einen manchmal beim Hinüberdämmern durchfuhr – dann nämlich, wenn der Schalter einen Sekundenbruchteil zu spät reagierte. Eine andere, weitaus eindrucksvollere und furchterregendere Art von Störung zeigte sich hin und wieder vor allem bei Menschen, die – wie Richard auf der Isle of Man – außerhalb ihrer gewohnten Zeiten schliefen. Dann wurde man zwar wach, aber der Schalter ging nicht auf »An«, und man war weiterhin so vollkommen paralysiert wie kurz zuvor, als man sich noch im Tiefschlaf befand. Wie ein Mensch, der friedlich zu schlummern und zu atmen schien, tatsächlich aber einen schrecklichen Albtraum hatte, lag man dann mit offenen Augen in vollständiger unentrinnbarer Ruhe da, unfähig, irgendetwas gegen das imaginäre Monster auf der Brust, den Eindringling neben dem Bett, das alles verzehrende Feuer im Haus zu tun.
Jedenfalls waren für Dodge die einzigen dauerhaften Konsequenzen daraus weitere unsystematische Internetrecherchen über das Funktionieren von Schlaf und eine intensivere Selbstbeobachtung in Bezug auf seine eigenen Mittagsschlafpraktiken gewesen. Auf diese Weise hatte er seine – wissenschaftlich durch nichts belegte – Theorie entwickelt, dass der einzige Schlüssel zu einem gelingenden Mittagsschlaf darin lag, den Bewusstseinsfaden gerade so lange zu durchtrennen, dass der Schalter auf »Aus« gestellt werden konnte. Ging er dann wieder auf »An«, und sei es nur wenige Minuten später, führte das Gehirn-Körper-System einen Neustart durch, so wie bei einem abgestürzten Computer, den man nur für zehn Sekunden vom Netz nehmen und dann neu starten musste, damit er wieder voll funktionsfähig war.
Diese Vorstellung rund um die Fadendurchtrennung war das, was ihn schließlich munter machte, denn in seinem Kopf war irgendwie eine Verbindung geknüpft worden, und die würde ihn jetzt wach halten. Er hatte in seinem Leben den Punkt erreicht, an dem nur noch sehr wenige Dinge ihn zum Aufstehen zwingen konnten, doch zu den Rufen, denen er bereitwillig nachkam, gehörte der seiner eigenen umherschweifenden Gedanken und Überlegungen, der Drang seines Verstands, Verbindungen herzustellen.
Tatsächlich aus dem Bett brachte er ihn allerdings nicht. Das erledigte das Klingeln in seinen Ohren. Sein Tinnitus war heute besonders lästig – die Art und Weise, wie die Welt ihm sagte, dass er aufstehen und ein wenig Lärm machen solle. Lange Zeit hatte er unter einer milden Ausprägung gelitten, Folge von zu vielen Schusswaffen und Nägeln, die er in seiner Jugend abgefeuert respektive eingeschlagen hatte, und von zu vielen Nächten in Bikerbars von British Columbia. Vor ein paar Jahren war er dann ohne geeigneten Gehörschutz, genau genommen ohne jede Art von Schutz, aus nächster Nähe dem Lärm von anhaltendem Gewehrfeuer ausgesetzt gewesen. Seitdem hatte er kaum eine Phase ohne ein gewisses Maß an Klingeln in den Ohren – mal als hoher Ton, mal als Zischen – erlebt. Die Ursache dieses Leidens war einigermaßen rätselhaft. Es schien so etwas wie ein gut gemeinter Versuch des Gehirns zu sein, den Verlust an zuverlässigen Signalen von Ohren, die nicht mehr einwandfrei funktionierten, zu verarbeiten. Für diese Vorstellung sprach, dass es am allerschlimmsten war, wenn um ihn herum Stille herrschte; die Umgebung lieferte seinem Hörsystem keine guten Daten, an die es sich halten konnte. Die Lösung bestand darin, aufzustehen und Lärm zu machen. Nicht unbedingt viel. Nur die normalen Geräusche von Schritten und einem laufenden Wasserhahn, die dem Gehirn versicherten, dass da draußen eine kohärente Welt existierte, und ihm ein paar einfache Hinweise lieferten, was tatsächlich was war.
Er stand auf, zog eine Schlafanzughose an, ging Wasser lassen, nahm die Pillen, die er vor dem Frühstück nehmen sollte, und betrat das sogenannte große Zimmer seiner Penthousewohnung, die sich in der obersten Etage eines Gebäudes mit zweiunddreißig Stockwerken im Zentrum von Seattle befand. Es handelte sich um eine sehr teure Immobilie, die auf eine für Technologieunternehmer aus dem Nordwesten typische Weise so einfach, minimalistisch und informell ausgebaut und dekoriert war, dass es irgendwie schon wieder protzig wirkte. Einen Großteil ihrer westlichen Außenwand bildeten Glastüren, und die hatte er die ganze Nacht offen gelassen und so die Größe des Wohnbereichs verdoppelt, indem er ihn mit der Terrasse verband. Diese besaß ein Glasdach mit Infrarotstrahlern, wie man sie über dem Kassenbereich im Home Depot angebracht hatte, um die somalischen und philippinischen Kassiererinnen vor einer Unterkühlung zu bewahren. Sie machten es selbst dann behaglich, wenn 10 Grad Celsius herrschten und es regnete, was ungefähr die Hälfte des Jahres der Fall war. Im Spätsommer und (wie jetzt) frühen Herbst wurden die Heizstrahler nicht gebraucht, und so diente die Terrasse einfach als übergangslose Erweiterung des großen Zimmers. Die Terrasse ging auf die Elliott Bay und die dahinter liegenden Olympic Mountains hinaus.
Ungewöhnliche Spritzer in Pink und Lila leuchteten auf dem Holz, Leder und Stein. Richard hatte eine Großnichte, Sophia, die für ihn im Grunde wie eine Enkeltochter war und ihn oft besuchen kam. Letztes Wochenende hatten ihre Eltern – Richards Nichte Zula und ihr Mann Csongor – sie für zwei Nächte bei ihm gelassen, um sich einen kleinen Ausflug nach Port Townsend auf der anderen Seite des Puget Sound zu gönnen. Von Richards Terrasse aus konnte man direkt hinunter aufs Fährterminal schauen. Am Geländer hatte er ein riesengroßes, aus sowjetischen Militärbeständen ausgemustertes Fernglas auf ein Stativ montiert. Während die Fähre sich schwerfällig vom Terminal wegbewegte, hatte Richard Sophia auf einen Schemel gehoben und ihr geholfen, das Glas hinunter auf die Fähre zu richten, auf der Zula und Csongor, nachdem sie ihr Auto unter Deck geparkt hatten, aufs oberste Deck gestiegen waren und sich dort ans Heck gestellt hatten, um zu ihr hinaufzuwinken. Die ganze Angelegenheit war per SMS koordiniert worden und sehr zur Freude der kleinen Sophia mit der Präzision eines Drohnenangriffs vonstattengegangen. Richard hatte es auf unerklärliche Weise deprimiert, oder vielleicht war »nachdenklich melancholisch« gestimmt eine bessere Formulierung.
Darauf waren achtundvierzig Stunden intensiven Bondings zwischen Großnichte und Großonkel gefolgt. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne hatte sich Sophias Instrumentarium des modernen Kindseins überall in Richards Wohnung ausgebreitet. Selbst wenn sie nie wieder einen Fuß hier hineinsetzte, würde er noch in zwanzig Jahren Cheerios, Glitter, klebrige Fingerabdrücke und Haarspangen finden.
Am Sonntagabend, als die Eltern wieder in den Hafen einliefen, hatten sie das mit dem Fernglas wiederholt. Zula hatte erklärt, wie gut es psychologisch gesehen für ein Kind von Sophias Alter sei, seine Eltern fortfahren, dann aber auch zurückkommen zu sehen. Im allgemeinen Trubel der Verabschiedung hatten sie eine Einkaufstüte von Whole Foods mit einigen von Sophias Büchern stehen lassen. Richard hatte sie schon an die Tür gestellt, sodass es beim nächsten Mal schwieriger sein würde, sie zu übersehen. Doch während seine Kaffeemaschine lief, holte er sie wieder her. Zusammen mit seinem Kaffee nahm er sie mit zu dem niedrigen Tisch auf der Terrasse und zog zwei großformatige Bücher heraus, die er am Samstag für Sophia gekauft hatte. Beide zeichneten sich durch denselben Stil farbenfroher pseudonaiver Kunst aus, denn sie stammten beide vom selben Autorenpaar, Ingri und Edgar Parin D’Aulaire Das eine trug den Titel D’Aulaires Buch der griechischen Mythologie und das andere D’Aulaires Buch der nordischen Mythologie. Richard hatte sie spontan in die Hand genommen, als er und Sophia in einer Buchhandlung herumstöberten. Das Umschlagbild auf der Griechischen Mythologie, das er nur undeutlich aus dem Augenwinkel wahrgenommen hatte, war über seinen Sehnerv zum Gehirn gesprungen und hatte dafür gesorgt, dass sein Körper fast genauso erstarrte wie bei seiner Schlaflähmung auf der Isle of Man. Oder, näher am Kontext, so als hätte er einen Gorgonen geschaut (und könnte es nicht sogar sein, dass alte Mythen rund um Gorgonen und Basilisken vorwissenschaftliche Erklärungen für das Phänomen der Schlafparalyse waren?).
Die D’Aulaire-Bücher waren erschienen, als Richard jung gewesen war. Er hatte seine Kindheitsexemplare zerlesen, hatte sie immer wieder durchgeblättert, sich die Abstammungslinien der Titanen, der Götter und was nicht noch alles gemerkt, vor allem aber einfach die Bilder betrachtet, sie in sein Gehirn eindringen und es formen lassen. In ihrem allgemeinen Stil hatten sie viel von Illustrationen für kleine Kinder, was vermutlich genau der Grund dafür war, dass sie sich wie Herpes an kindliche Neuronen hefteten. Und wie Herpes hatten sich diese Bilder bis in sein Erwachsenenleben hinein still und inaktiv verhalten. Getriggert und virulent gemacht hatte sie die Tatsache, dass er, als er sie erspäht hatte, nicht darauf gefasst gewesen war. In der Buchhandlung letztes Wochenende hatte er sich der Auslage genähert wie ein antiker Hellene, der die Stufen zum Tempel des Zeus emporstieg, und das Buch betrachtet, genau wie er es in Erinnerung hatte, aber brandneu und ungelesen, mit einem neuen Vorwort eines berühmten modernen Romanautors, auf den die Bücher offenbar dieselbe betörende Wirkung gehabt hatten wie auf Richard. Sophia, die er den ganzen Weg über hatte mitziehen müssen, denn sie hielt seinen Oberschenkel umklammert und benutzte sein Hosenbein als Taschentuch, hatte etwas von dem Numinosen in der Reaktion ihres Großonkels gespürt; sie hatte aufgeblickt und sich angesteckt. Richard hatte die Griechische Mythologie und deren Begleitband Nordische Mythologie gekauft, war dann mit Sophia zurück in sein Penthouse gegangen, wo sie für den Rest des Tages vollkommen in die Geschichten eintauchten, und hatte sie ihren Eltern als besessenen Wechselbalg zurückgegeben, der über Wiederherstellungstaktiken der Hydra und die hausgroßen Fausthandschuhe des Utgardloki brabbelte und seine Altvorderen dafür tadelte, dass sie die griechischen und die nordischen Götternamen durcheinanderbrachten. Groß war Sophias Zorn gewesen, als sich herausgestellt hatte, dass die Whole-Foods-Tüte mit den Büchern stehen geblieben war. Weithin berühmt würde Onkel Richards Tat an diesem Nachmittag sein, wenn er nach seinem ambulanten Eingriff mit einem D’Aulaire unter jedem Arm im Bungalow der jungen Familie auftauchen würde.
In der Zwischenzeit musste er einen kleinen Aspekt mythologischer Verwirrung auflösen, damit Sophia nicht herausfand, dass er in diesem Punkt nicht hundertprozentig firm war, und ihn tadelte. Es hatte mit den Moiren und den Nornen zu tun.Kaum hatte Richard in der Buchhandlung die Griechische Mythologie in die Hand genommen, da hatte er auch schon das Stichwortverzeichnis aufgeschlagen und dort nach »Furien« gesucht. Das hatte er in einer verstohlenen, irgendwie schuldbewussten Haltung getan. Zu Richards Eigenheiten gehörte, dass ihm ein Gewissen oder Über-Ich im herkömmlichen Sinn dieser Begriffe fehlte. Er war eine Person ohne eingebaute erwachsene Kontrolle. Allerdings hatte er im Laufe seines Lebens neun oder zehn ernstzunehmende Freundinnen gehabt. Alle diese Beziehungen waren nach und nach den Bach hinuntergegangen, als diese Freundinnen ihn näher kennengelernt und Listen mit all dem erstellt hatten, was ihnen an Richard fehlte. Manche von ihnen hatten ihre Meinung bis zu einem die Beziehung beendenden kathartischen Ausbruch für sich behalten. Andere hatten ihre Vorhaltungen in Echtzeit frei geäußert. Doch als sie ihn vermutlich längst vergessen hatten, erinnerte sich Richard noch an jedes Wort davon. Ja mehr noch, sein Gehirn hatte irgendwie völlig autonome Simulakren dieser Ex-Freundinnen ersonnen, die für immer zwischen seinen Ohren lebten, zu den absonderlichsten Zeiten mit ihm sprachen und tatsächlich sein Denken und Verhalten beeinflussten; bevor er einen Angestellten feuerte oder irgendjemandes Geburtstag ignorierte, hielt er inne, um zu bedenken, welche Auswirkungen es haben würde, wenn eine oder mehrere der Furiosen Musen – wie er sie nannte – lange genug aus seinen Gehirndämpfen auftauchten, um ein paar beißende Kommentare von sich zu geben, die ihm ein schlechtes Gewissen machen würden. Diese Verschmelzung von Furien und Musen war natürlich seine eigene Erfindung und eine Abweichung von mythologischer Korrektheit, für die Sophia (die bereits in eine Art Nachwuchsliga der Furiosen Musen aufstieg) ihn zur Rechenschaft ziehen würde. Diese Vorstellung hatte er so lange mit sich herumgetragen, dass die Trennlinie zwischen den beiden Kategorien von Untergöttinnen inzwischen verschwommen war, und so dachte er, es könne erhellend sein, sie jetzt, wo er das Urbuch in Händen hielt, einmal nachzuschlagen.
Der Buchstabe F im Stichwortverzeichnis enthielt nur zwei Einträge: »Fata scribunda« und »Furien«, wobei letzterer lediglich einen Querverweis zu dem korrekteren Begriff »Erinnyen« darstellte. Die Erstgenannten wurden beschrieben als »drei alte Göttinnen, die die Lebensspanne des Menschen bestimmten«. Diese Worte hatte Richard nur überflogen, denn sein Interesse galt eigentlich den Furien. Dem Querverweis zu »Erinnyen« folgend schlug er Seite 60 auf, ihr erstes Erscheinen in dem Buch, und las von Seelen, die (immerhin auf einer Fähre) den Styx überquerten und unter »dunklen Pappeln« aus der Quelle des Lethe tranken, was sie dazu veranlasste zu vergessen, wer sie waren und was sie im Verlauf ihres Erdenlebens getan hatten. Gut. Aber dann hieß es, »große Sünder« würden dazu verurteilt, für immer unter den Peitschenhieben der Furien zu leiden. Dieser Teil passte also recht gut zu Richards Konzept von den Furiosen Musen. Allerdings war es beunruhigend, sich vorzustellen, dass man für immer ausgepeitscht werden konnte für Sünden, die man unter den dunklen Pappeln vergessen hatte. In der christlichen Höllenversion konnten sich die Sünder wenigstens erinnern, warum sie im ewigen Feuer schmorten; diese armen dummen Griechen dagegen konnten nur leiden, ohne zu wissen, warum; und übrigens sogar, ohne sich zu erinnern, wie es war, zu leben und nicht zu leiden. Richard war nicht einmal klar, ob eine Post-Lethe-Seele überhaupt noch als dasselbe Wesen betrachtet werden konnte, denn waren die eigenen Erinnerungen nicht ein Teil von einem?
Und doch hörte sich das alles in gewisser Hinsicht wahr an. Tatsächlich hatte er manchmal den Eindruck, nach wie vor unter Schuldgefühlen für Taten zu leiden, die er längst vergessen hatte – Dinge, die er getan hatte, als er noch nicht dieselbe Person gewesen war. Und wer hat nicht schon irgendein armes Schwein, einen Pechvogel erlebt, der ohne besonderen Grund einer ewigen Bestrafung unterzogen wird?
Die nächste Erinnyen-Stelle befand sich zufälligerweise genau vor einer Doppelseite über das heiterere Thema der Musen, gutes Material, weitaus Sophia-geeigneter und für Richard überdies eine Erinnerung daran, dass seine eigenen Furiosen Musen mindestens so kreativ wie rachgierig waren, denn manche seiner besten Arbeiten waren aus imaginären Dialogen mit diesen schätzenswerten Damen hervorgegangen. »Furien« war also der Text gewesen, den er gesucht hatte, und »Fata subscriba« ein zufälliger Subtext – doch irgendetwas daran machte ihm an diesem Morgen zu schaffen.
Es hatte mit den Fäden zu tun. Vor Kurzem, im Bett, hatte er über den Bewusstseinsfaden nachgedacht und darüber, dass ihn zu zertrennen – die Verbindung zwischen Gehirn und Körper zu unterbrechen – der Schlüssel zu einem ordentlichen Mittagsschlaf war. Und er wusste, dass es irgendwo in dem D’Aulaire ein Bild von den Fata subscriba gab, wie sie Fäden sponnen, abmaßen und durchtrennten. Während er seinen Kaffee trank, schaute er die ganze Griechische Mythologie danach durch, fand es aber nicht.
Der Kaffee war schlichtweg fantastisch. Die Maschine hatte mehr gekostet als Richards erstes Auto, und es gab nichts an Kaffeetechnologie, was nicht in ihre Hardware und ihre Algorithmen eingeflossen war. Die Bohnen stammten von einem handwerklichen Röster in knapp hundert Metern Entfernung – einem agilen Kaffee-Start-up, das von Spitzenbaristas gegründet worden war, die zunächst bei Starbucks gearbeitet und sich gleich nach Ende der Sperrfrist für ihre Mitarbeiteroptionen ausgegründet hatten. Der Geschmack des Kaffees war allerdings nicht nur deshalb so wunderbar, weil die Maschine und die Röster ihre Arbeit so gut gemacht hatten, sondern in dem grundsätzlichen Sinne, dass Dodge wach war, dass er lebte, dass er dieses Zeug tatsächlich mit seinem Körper auf eine Weise schmeckte, wie es der schlafende Dodge in einem Traum nie hätte tun können. In diesem Sinne war der wache Dodge dem schlafenden so überlegen wie eine lebendige Person einem Geist. Der von Kaffee träumende Dodge verhielt sich zum Kaffee trinkenden Dodge wie einer der Schatten des Hades – bei D’Aulaire mit trockenem Laub verglichen, das im kalten Herbstwind umherwirbelt – zu einem lebendigen Menschen aus Fleisch und Blut.
Er trank die erste Tasse leer, während er nach dem Bild mit dem Durchschneiden des Fadens suchte. Was er fand, war eine Beschreibung der Spinn-, Mess- und Schneidevorgänge, die von Klotho, Lachesis beziehungsweise Atropos durchgeführt wurden, aber nicht die bildliche Darstellung, die er, wie er sich ganz deutlich erinnerte, erst vor ein paar Tagen Sophia gezeigt hatte.
Bei seiner zweiten Tasse Kaffee kam ihm der Gedanke, in der Nordischen Mythologie nachzuschauen. Und da war sie: eine Halbseite im Vollfarbdruck mit drei Blondinen – hier hießen sie Nornen –, die die Fäden des Lebens am Fuß des Weltenbaums spannen. Urd, Verdande und Skuld. Sah man von Namen und Haarfarbe ab, schienen sie ein hundertprozentiger Ersatz für ihre griechischen Entsprechungen zu sein.
Nun hatte sich Richard, ehe er ein Studium hätte aufnehmen können, nach Kanada verdrückt und seitdem nie wieder einen Fuß in ein Klassenzimmer gesetzt, jedoch genug gelesen, um zu verstehen, dass Mythologie sich in Sedimentschichten herausbildete. Dies hier musste einer dieser Fälle sein, in dem es irgendeine frühe, der griechischen wie der nordischen vorausgehende Kultur gegeben hatte, die die Nornen / Fata scribunda ersonnen und in einer Grundschicht niedergelegt hatte, der ihre verschiedenen Nachfahren dann Weiteres hinzugefügt hatten. Folglich lasen sie sich immer wie ein Zusatz zu der stärker ausgestalteten Mythologie. Vielleicht aber auch umgekehrt. Man konnte sie zu leicht durcheinanderbringen. Richard, der in der Hightechindustrie zu Wohlstand gelangt war, sah in den Nornen oder Fata scribunda oder wie immer man sie nannte ein Grundelement des Betriebssystems. Zeus hatte keine Macht über sie. Sie kannten die Vergangenheit und die Zukunft. In diesen Geschichten wurden sie nur heraufbeschworen, wenn auf metaphysischer/kosmologischer Ebene irgendetwas kolossal danebengegangen war oder aber um Handlungslücken zu füllen. In der griechischen Fassung war Klotho die Spinnerin – die Urheberin dieser Fäden. Lachesis war die Abmessende. Das wäre also die Snoozetaste – während Dodge im Bett lag, hatte sie die ganze Zeit ihr Neun-Minuten-Maßband gezückt. Und Atropos war die Abschneiderin. Die griechische Version des Sensenmanns. Auch wenn nach der Theorie, die Dodge gerade entwickelte, der Bewusstseinsverlust beim Einschlafen prinzipiell derselbe war wie beim Sterben, außer dass man davon wieder erwachen konnte.
Er frühstückte nicht, weil ihn die Arzthelferin, die ihm den Termin für den Eingriff gegeben hatte, darauf hingewiesen hatte, dass er möglichst nüchtern erscheinen sollte. Stattdessen ging er duschen. Als er aus der Dusche trat, stellte er fasziniert fest, dass das Badezimmer durch ein seltsames Licht erleuchtet wurde, kühl und gesprenkelt, nicht künstlich, aber auch kein Sonnenlicht. Die Wirkung war surreal, so als käme man in eine Traumsequenz in einem Film, dessen Regisseur nicht über das nötige Kleingeld verfügt hatte, um etwas wirklich Traumartiges zu produzieren, und es so lediglich mit Lichteffekten simulierte. Das sonderbare Licht strömte durch ein nach Norden ausgerichtetes Fenster ein. Schweißte draußen jemand? Schließlich fand Richard heraus, dass die Sonne, die über dem Kaskadengebirge im Osten aufging, ihn quasi über Bande von den mit Silberbeschichtung versehenen Fenstern eines Büroturms einige Häuserblocks weiter traf. Dodge lebte nun schon seit fünf Jahren hier, aber gelegentlich überraschte es ihn immer noch, wie Sonnenlicht, von umliegender Architektur abgestrahlt, hier hereinfiel. Er glaubte, dass ein Astronom seine helle Freude daran haben könnte, die Winkel zu berechnen: wie sie von Stunde zu Stunde und von Jahreszeit zu Jahreszeit variierten.
Aufgrund des bizarren Lichts sah sein Gesicht im Spiegel irgendwie merkwürdig aus, anders als sonst. Auf der Suche nach Muttermalen drehte er den Kopf erst in die eine, dann in die andere Richtung. Richard, der eine rosige Haut hatte und zu Sommersprossen neigte, hatte sich über Jahrzehnte mental auf einen immer härter werdenden Kampf gegen Hautkrebs vorbereitet, der ihm laut den düsteren Prophezeiungen verschiedener Dermatologen mit ziemlicher Sicherheit bevorstand. Schon früh war er mit einer an klinische Paranoia grenzenden Angst zu seinen monatlichen Hautkontrollen gegangen. Aber dann waren Jahre vergangen, ohne dass irgendetwas passierte. Allmählich verspürte er sogar so etwas wie Enttäuschung darüber, dass dieser schreckliche Feind, gegen den er sich so gewappnet hatte, ihn zu übergehen schien.
Gerade fing er an sich zu rasieren, denn er hatte ein paar rötliche Stoppeln entdeckt. Bald würde medizinisches Personal sich an seinem Körper zu schaffen machen, während er selbst bewusstlos sein würde. Sie würden ihn nach Herzenslust anstarren und feststellen können, wo er es mit der Körperpflege nicht so genau nahm. Er war einigermaßen berühmt und sollte eigentlich auf solche Dinge achten. Womöglich hätte das Auswirkungen auf den Aktienpreis seiner Firma oder so etwas.
Er hatte angenommen, dass das seltsame Licht ein Phänomen von kurzer Dauer sein würde, und war daher angenehm überrascht, dass es mit jeder Minute stärker wurde. Die sonderbare Blässe reifte zu etwas Wärmerem, etwas Feuerartigem. Ein Strahl davon fiel durchs Fenster herein und beleuchtete das kleine Waschbecken und dessen Fliesenspiegel. Zum Rasieren hatte Richard gewohnheitsgemäß ein Stück Rasierseife benutzt – eine spezielle Art, die er von einer Firma in Südfrankreich bezog. Sie hatte einen angenehmen Duft, nicht parfümiert und nicht zu aufdringlich. Da er die Seife gerade erst in die Schale zurückgelegt hatte, befanden sich noch Blasen daran. In ein paar Minuten würden sie trocknen und zerplatzen, doch jetzt fingen sie das von dem gewaltigen thermonuklearen Inferno im Zentrum des Sonnensystems ausgehende Licht ein, das nach seiner Reise durch hundertfünfzig Millionen Kilometer Weltraum von den Fenstern des Büroturms reflektiert wurde. Jede Blase erzeugte einen überaus hell leuchtenden Lichtfunken, nicht weiß, sondern bunt schillernd, während irgendein prismenähnliches Phänomen innerhalb des Seifenfilms (mit den Details haperte es etwas bei ihm) das Licht in reine brillante Farben brach. Ein schönes, aber völlig alltägliches Phänomen, das ihm keinen besonderen Anlass zum Nachdenken gegeben hätte, wäre da nicht der Umstand gewesen, dass seine Computerspielefirma eine Menge Geld und Ingenieursjahre in den schwierigen Versuch gesteckt hatte, unter Verwendung von Maschinensprache eine imaginäre Welt vollkommener abzubilden, und genau das zu den Dingen gehörte, die am schwersten zu digitalisieren waren. Gewiss, es gab verschiedene Möglichkeiten, es nachzuahmen, zum Beispiel durch das Anwenden spezieller Shaderprogramme auf Seifenstücke während der sechzig Sekunden, nachdem sie benutzt worden und deshalb mit Schaum überzogen waren. Aber das alles waren einfach nur technische Tricks. Die Physik von Seife, Blasen, Luft, Wasser etc. tatsächlich zu simulieren war unglaublich teuer und zu seinen Lebzeiten nicht mehr zu realisieren.
Es war sogar dann schwierig, wenn man das Ganze vereinfachte, indem man jede Seifenblase nicht als ein kleines Wunder der Fluiddynamik, sondern als eine einfache reflektierende Kugel behandelte. Einige Jahre zuvor hatte einmal einer der Ingenieure von Corporation 9592 – ein typischer Geisteswissenschaftler, der zum Programmierer geworden war, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können – dies als das Problem der Hand met spiegelende bol erkannt und viele Vollblutingenieure aus der Fassung gebracht, indem er bei einem Meeting eine Grafik der Escher-Lithografie gleichen Namens öffnete. Es war ein Selbstporträt, auf dem der Künstler sich in einer reflektierenden Kugel, die er in der linken Hand hielt, widerspiegelte. Eschers Gesicht befand sich in der Mitte, doch um es herum konnte man eine geometrisch verzerrte Wiedergabe seines Arbeitszimmers sehen. Und in dessen Hintergrund ein Fenster. Dieses ließ natürlich Licht aus mindestens hundertfünfzig Millionen Kilometer Entfernung herein. Der Punkt war, dass man, um eine originalgetreue 3D-Computergrafik von einem so einfachen Objekt wie einer glänzenden Kugel zu rendern, theoretisch sämtliche Objekte im Universum berücksichtigen müsste. Der Programmierer – ein Neuzugang namens Corvallis Kawasaki – versah seine eigenen Ausführungen mit einer Fußnote, indem er erwähnte, dass das Problem der spiegelnden Kugel mindestens bis zu dem deutschen Genie und Universalgelehrten G. W. Leibniz zurückreichte, der darin, wie er schrieb, eine Möglichkeit sah, über Monaden nachzudenken. An diesem Punkt in dem Meeting hatten die etablierten Programmierer ihn ausgebuht, und Dodge hatte sich vorgenommen, den Knaben aus egal welchem Zweig im Org.-Plan, in dem er gelandet war, herauszuziehen und in Schräges Zeug, Dodges persönlicher Domäne, zu beschäftigen. Der Punkt hier war jedenfalls, dass jede einzelne Blase an der Oberfläche des Seifenstücks mindestens so kompliziert war wie Eschers Kugel. Eine solche Szene realistisch wiederzugeben war völlig indiskutabel. Darüber war Richard keineswegs enttäuscht, nein, es tröstete ihn, und er war froh – vielleicht sogar ein wenig selbstzufrieden –, dass er in einem Universum lebte, dessen Komplexität sich algorithmischer Simulation widersetzte.
Er schloss die Augen, während er sich Wasser ins Gesicht spritzte, und blickte dann wieder in den Spiegel. Jetzt war da in der Mitte, wo er von den hell leuchtenden Lichtfunken der Blasen geblendet worden war, ein kleiner Fleck. Dieser blinde Fleck würde schon bald schrumpfen und einer korrekten Ansicht dessen, was tatsächlich da war, weichen.
Doch in diesem Fall geschah das nicht. Als Richard erneut die Augen zumachte, um sich das Gesicht abzutrocknen, konnte er immer noch einen kleinen Flecken Nichts in seinem Gesichtsfeld sehen. Das war eine andere Art von Nichts als das Feld aus rotstichigem Schwarz, das seine Augen einfach aufgrund der Tatsache sahen, dass seine Lider sich über ihnen geschlossen hatten. Er wusste, was das war. Das Aufblitzen des reflektierten Sonnenlichts vor einer Minute hatte in seinem Gehirn ein Ding namens ophthalmische Migräne ausgelöst. Sie war schmerzlos und ungefährlich. Er bekam sie ein paarmal im Jahr. Es war eine visuelle Erscheinung – »Aura« –, verursacht durch eine vorübergehende Unterbrechung des Blutzuflusses zur Sehrinde. So fing es immer an, mit einem winzigen blinden Fleck, der nicht verschwinden wollte. Im Verlauf der nächsten halben Stunde wurde er größer und machte ihm das Lesen unmöglich. Dann wanderte er allmählich nach rechts und störte eine Zeit lang sein peripheres Sehen auf dieser Seite, bevor er, ohne eine Spur zu hinterlassen, verschwand.
Die betroffene Region – der Punkt, wo er absolut blind war – war nicht schwarz, wie man vielleicht hätte meinen können. Das ließ sich einfach dadurch beweisen, dass er die Augen schloss, sodass er tatsächlich nur Schwarz sah. Der blinde Fleck stellte sich dann als eine Region mit schwach umrissenen gelben und schwarzen Streifen dar, ähnlich den Mustern, die zur Kennzeichnung von Gefahrenzonen auf Fabrikböden gemalt wurden, nur dass diese hier blitzten und sich ständig veränderten, als wenn bei einem altmodischen Fernseher der vertikale Bildfang verrücktspielt.
Noch während er diese Bezüge herstellte, wappnete er sich gegen einen anzunehmenden Flankenangriff von Polycultia, einer der Furiosen Musen, die stets betonte, alles, was Richard sich nur ausdenken könne, sei kulturspezifisch. In diesem Fall dürfte sie womöglich mit Schützenhilfe von Cerebra rechnen, einer unfreiwillig beleidigenden FM, die gern darauf hinwies, dass jede Idee, die Richard hatte und die ihm klug erschien, in Wirklichkeit lediglich die unvollkommene Wiedergabe einer pfiffigeren Idee war, die ihr selbst schon vor langer Zeit gekommen war. Die erwartete Angriffslinie der Polycultia-Cerebra-Achse sah ungefähr so aus: Okay, da ein Teil von Richards visuellem Kortex nicht funktionierte, sah er in dieser Region »nichts«. Sein Gehirn war damit beschäftigt, fortwährend die Art von dreidimensionalem Modell des Universums zu konstruieren, das ihn zum Beispiel befähigte, mit geschlossenen Augen sein Handy vom Nachttisch zu nehmen. Von daher konnte es den Anblick eines Fleckes »Nichts« inmitten einer ansonsten kohärenten Realität nicht tolerieren. Also versuchte es, das Nichts mit etwas auszufüllen. Es war einfach die visuelle Entsprechung des Tinnitus.
Aber warum genau dieses Etwas? Er legte es sich zurecht als schwarze und gelbe Gefahrenstreifen, kaputte Fernseher etc., aber das lag nur daran, dass er ein nicht mehr ganz junger weißer Mann aus Iowa war. Eine Maori-Hebamme, ein schwuler römischer Zenturio oder ein Shinto-Buddhist im elften Jahrhundert hätte, von demselben zugrunde liegenden neurologischen Phänomen ereilt, das »Nichts« mit einer anderen Art von Schreckgespenst ausgefüllt, die sich aus dem jeweiligen Bestand an kulturellen Bezügen ergeben hätte – zum Beispiel dem magischen kalten Feuerwall, der (der Nordischen Mythologie zufolge) Gymirs Haus in Jotunheim umgab.
Seine vorübergehende Blindheit lieferte ihm eine Entschuldigung dafür, sich nicht dem Getöse auszusetzen. In früheren Zeiten hätte er gesagt, »nicht seine E-Mails zu checken«, dabei waren E-Mails heute die am wenigsten aufdringliche von allen Techniken, die das Miasma – wie Richard das Internet nannte – ersonnen hatte, um die Aufmerksamkeit seiner Nutzer zu erheischen. Richard fasste sie alle unter der allgemeinen Überschrift »Getöse« zusammen. Er hielt es für unwahrscheinlich, dass es im morgendlichen Getöse viel gäbe, das von Bedeutung wäre, denn er hatte seine persönliche Assistentin ein System von Zauber- und Abwehrsprüchen weben lassen: automatisch generierte »Out-of-Office«-Meldungen und dergleichen.
Folglich blieb ihm bis zu seinem Termin noch Zeit, die er sich vertreiben musste. Er steckte die D’Aulaires wieder in die Tüte. So gut er es als vorübergehend Halbblinder vermochte, durchkämmte er seine Wohnung nach weiteren Sachen von Sophia. Dann fuhr er mit dem Aufzug in die Eingangshalle des Gebäudes. Zwischen ihr und dem Gehweg lag eine Bäckerei mit Café. Dort wollte er sich die New York Times kaufen und, sobald seine Sicht sich wieder geklärt hatte, das Kreuzworträtsel machen. Nicht dass er unbedingt ein großer Kreuzworträtselfan war, aber schon die Tatsache, dass er Zeit hatte, sie damit zu verbringen, war in gewisser Weise ein Gradmesser dafür, dass er ein freier Mann war.
Vo, der Bäckereibesitzer, kam heraus, um ihn mit Namen zu begrüßen. Er war ein Vietnamese in den Sechzigern oder Siebzigern, der, wie Dodge annahm, infolge der französischen Kolonialherrschaft in seinem Heimatland Backfertigkeiten auf Weltklasseniveau erlangt hatte. Dieser Betrieb war eine ernstzunehmende Sache: nicht nur ein Tischbackofen unter einer Theke, sondern ein ganzer Komplex aus ausladenden Knetbrettern und Marmorplatten, Standmixern, so groß wie Außenbordmotoren, und begehbaren Backöfen, die weit in das Gebäude hineinreichten. Älteren Asiaten und mit Haarnetzen versehenen Hipstern konnte man dabei zusehen, wie sie Teig ausrollten und von Hand Croissants formten. Vo würde das Unternehmen erst dann als erfolgreich bezeichnen, wenn am Abend jedermann im Radius von einem halben Kilometer mit einem Baguette unterm Arm nach Hause ging.
Zur Vorderseite des Hauses hin stand ein halbes Dutzend kleine Tische, und direkt an der Fensterfront zum Gehweg befand sich eine lange Theke. Ein Nebeneingang stellte die Verbindung zur Eingangshalle des Gebäudes her. Auf diesem Weg kam Richard herein und nahm noch einen Kaffee und eine New York Times. Vo wollte ihm vermitteln, dass er tags zuvor von einem Bekannten am Pike Place Market einen Karton reife Äpfel aus dem Yakima Valley erworben hatte – gerade genug, um ein paar Tartes Tatin zu backen, die er für besondere Kunden in Reserve hielt. Was allerdings kein großes Geheimnis war, hatte der Apfelduft doch das ganze Erdgeschoss durchzogen. Vo pflegte seine verbale Kommunikation durch physische Demonstrationen zu unterstützen, eine Gewohnheit, die er vielleicht während der Jahrzehnte angenommen hatte, in denen er auf die harte Tour Englisch lernte. Einen von Richards Ellbogen behutsam mit der Hand umschließend führte er ihn hinter die Theke, um ihm einen dort verstauten Pappkarton zu zeigen, der zur Hälfte mit Äpfeln gefüllt war. Er bückte sich und durchwühlte sie, bis er ein passendes Exemplar gefunden hatte, das er herausnahm und Richard vors Gesicht hielt, wobei er es in einer Pose auf seinen Fingerspitzen thronen ließ, die stark an Eschers Hand met spiegelende bol erinnerte, nur handelte es sich hier natürlich um einen Apfel. Einen Apfel, vor dem frühere Generationen amerikanischer Lebensmittelkäuferinnen oder -käufer entsetzt zurückgeschreckt wären, hätten sie ihn in der Obst- und Gemüseabteilung ihres örtlichen Safeway gesehen. Er war halb so groß wie die kräftigen weichen Red Delicious, die man normalerweise in solchen Auslagen fand, hatte eine Farbe, die von einem fast purpurnen Rotton bis zu einem fast gelben Grünton reichte, ein paar kleinere Flecken und Vertiefungen und am Stiel noch immer ein Paar richtige Blätter. Doch er war so rund und fest, dass er aussah, als würde er jeden Moment explodieren. Vo hob ihn immer höher in die Luft und blickte dabei zwischen ihm und Richard hin und her.
»Na, das ist mal ein richtiger Apfel!«, sagte Richard schließlich. Das war keine besonders kluge Bemerkung, aber er wusste, dass es die einzige war, die Vo beruhigen würde. Dieser dankte es ihm damit, dass er darauf bestand, ihm den Apfel »zum Mittagessen« mitgeben zu dürfen. Richard nahm ihn mit der gebotenen Feierlichkeit entgegen, so wie ein japanischer Geschäftsmann eine Visitenkarte annahm, indem er mit den Fingern über die Rundungen der Frucht fuhr und sie in alle Richtungen drehte, um ihre Farbe zu bewundern, und legte sie dann vorsichtig in die Tasche, die er sich über die Schulter geworfen hatte. Bald fand er sich mit seinem Kaffee, dem Kreuzworträtsel und einem Stück Tarte an seinem angestammten Platz wieder.
Das hatte er zu mindestens zwei Dritteln verspeist, als ihm schlagartig bewusst wurde, dass er laut ärztlicher Anweisung vor dem medizinischen Eingriff nichts zu sich nehmen durfte. Bis eben hatte er sich auch daran gehalten, sich jedoch vergessen, als sich die Gelegenheit bot, ein Stück frisch gebackene Tarte Tatin zu essen.
Er betrachtete den restlichen Teil – den besten, denn er enthielt den knusprigen Rand, und Richard war als Kind immer dazu angehalten worden, das Beste bis zum Schluss aufzuheben – mit einer Mischung aus Schuld und Verlegenheit. Am Ende beschloss er, das Stück aufzuessen. Er bezweifelte, dass Essen im Magen zu haben wirklich eine erhebliche Gefahr darstellte. Es war einfach eine jener allgemeinen Empfehlungen, so wie die, beim Tanken sein Handy auszuschalten, die von Rechtsanwälten zu einer hysterischen Warnung hochstilisiert worden waren. Und sollte es tatsächlich gefährlich sein, war das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Drei Drittel eines Kuchenstücks im Magen zu haben konnte nicht viel schlimmer sein, als es bei zwei Dritteln der Fall wäre. Und wenn er den Rest auf dem Teller ließe, würde Vo es bemerken, in den falschen Hals kriegen und ihm womöglich seinen Sonderkundenstatus aberkennen.
Wichtiger als die mögliche medizinische Komplikation war die Frage, die ihm prompt in den Sinn kam, ob dieser Aussetzer ein frühes Anzeichen für Senilität war. Die Geschwindigkeit, mit der er das Kreuzworträtsel erledigt hatte, schien dagegenzusprechen. Aber dabei ging es nur um das Langzeitgedächtnis, oder? Er war sich nicht sicher. Als Junge hatte er sich die Existenz von so etwas wie Senilität gar nicht bewusst gemacht, bis ein älterer Cousin ihn während eines Familientreffens darauf hingewiesen und ihm eine kurze (und im Rückblick zum Schreien unpräzise) Zusammenfassung ihrer Symptome geliefert und währenddessen vielsagende Blicke auf Grandma geworfen hatte. Danach hatte der junge Richard seine frühere Naivität überkompensiert, indem er übertrieben wachsam auf ihren Ausbruch bei Familienmitgliedern geachtet hatte, die auch nur die geringsten Anzeichen von Altersschwäche zeigten.
2
Die Arzthelferinnen hatten mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass er im Anschluss an den Eingriff wegen der starken Medikamente, die sie ihm geben würden, nicht fahrtüchtig sein, dass er praktisch ein wandelndes nervliches Wrack sein würde und dass sie gar nicht erst mit dem Eingriff beginnen würden, falls er keine Begleitperson nennen könne, die ihn hinterher abholen und die Verantwortung dafür übernehmen würde, dass er sich von schweren Maschinen fernhielt. Entsprechend ging Richard nun zwei Häuserblocks weit zu einer Haltestelle, bestieg einen Citybus, der ihn zu dem Hügel oberhalb des Stadtzentrums bringen würde, und machte es sich auf einem Sitz etwa in der Mitte des Fahrzeugs bequem.
Er holte sein Handy aus dem Ruhemodus. Dessen Startbildschirm war, als hätte er die Windpocken, von kleinen roten Punkten mit vorwurfsvollen Zahlen darin übersät, den Folgen der tauben Ohren, die er volle zwölf Stunden für das Getöse gehabt hatte. Er zwang sich, diese Punkte nicht zu sehen, und rief stattdessen sein Adressbuch auf. Dort scrollte er zum Abschnitt K und fand fünf verschiedene Einträge für Corvallis Kawasaki. Manchen von ihnen waren kleine Bildchen beigefügt, die Richard halfen zu erraten, wie veraltet sie waren. Die meisten davon hatten sich in den Jahren angesammelt, in denen Corvallis Hand in Hand mit Richard bei Corporation 9592 gearbeitet hatte, der Spielefirma, die Richard zu einem Milliardär und Corvallis, im Lexikon der Hightechindustrie, zum Dezimillionär gemacht hatte. Die entsprechenden Fotos zeigten ihn meistens beim Biertrinken in Bars oder in verschiedenen Feierposen in Verbindung mit der wachsenden Berühmtheit der Firma in der Computerspielbranche. Eins davon war jedoch ein sehr konventionelles, offizielles Porträt von Corvallis in Anzug und Krawatte, mit ordentlich geschnittenem und gegeltem Haar. Diese Visitenkarte – die erst ein paar Monate alt war – wies ihn als technischen Direktor von Nubilant Industries aus, einer Firma, die Cloud-Computing betrieb. Entstanden war sie im vergangenen Jahr als Teil eines »Rollups«, im Jargon der Hightechbranche der Kauf und Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, die alle im selben Bereich agierten. Mithilfe einer saftigen Aktienoption war Corvallis dazu bewegt worden, seine Stelle bei Corporation 9592 zu verlassen und in die neue Firma einzutreten. Richard hatte ihn ungern ziehen lassen, musste jedoch zugeben, dass es hervorragend passte – Corvallis hatte die Übertragung sämtlicher Operationen von Corporation 9592 von altmodischen Serverracks auf die Cloud überwacht, und er war nicht so großzügig entschädigt worden wie andere, die ein günstigeres Timing erwischt hatten. Seit Corvallis’ Weggang zu Nubilant – deren Sitz sich in der Nähe des Zentrums von Seattle befand – hatten er und Richard sich verschiedentlich gegenseitig SMS geschickt und versucht, einen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden, um sich mal auf einen Drink zu treffen. Bisher hatte es noch nicht geklappt. Doch als Dodge seinen SMS-Verlauf mit Corvallis aufrief, fand er an dessen Ende einen Wust von Nachrichten vom vergangenen Wochenende, in denen Corvallis sich bereit erklärte, den Nachmittag freizunehmen und als Richards Begleitperson zu fungieren, ihn in seinem durch die Narkose benebelten Zustand in der Klinik abzuholen und, wenn er wieder zu Sinnen käme, vielleicht mit ihm essen zu gehen.
Omw zur Klinik, tippte Richard mit den Daumen. Dann zog er einen klobigen Kopfhörer aus seiner Tasche und setzte ihn sich auf. Die Geräusche des Busses wurden gedämpft. Er steckte das Kabel ins Handy und schaltete den Kopfhörer ein. Es handelte sich nämlich um einen elektronischen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Sofort begann er Gegenschall in Richards Ohren zu leiten, was alles noch stiller machte.
Corvallis schrieb zurück: OK. Auslassungspunkte auf dem Handydisplay zeigten an, dass er noch weitertippte.
Dodge rief die Musicplayer-App auf und fing an, seine Playlists bis zum Abschnitt P durchzuscrollen. Aufgrund der gespenstischen Stille, die die Geräuschunterdrückungsfunktion produzierte, verstärkte sich sein Tinnitus.
Corvallis fügte hinzu: Wenn d. d. danach fühlst gehen w. i. Büro vorbei – möchte d. zeigen was w. vorhaben – geile Sache!
Richard beschloss, darauf nicht zu antworten. Sosehr er Corvallis mochte, ihm graute vor Führungen durch Hightechfirmen. Er tippte auf die Wörter »Pompitus Bombasticus«. Der üppige Klangcharakter eines kompletten Symphonieorchesters, unterstützt durch einen Chor und verstärkt durch eine treibende moderne Percussionsektion, füllte seine Ohren. Pompitus Bombasticus war Richards Lieblingsgruppe, die offenbar nur aus einem einzigen Typen bestand, der allein in einem Studio in Deutschland arbeitete; die Philharmonie, der Chor und alles Übrige waren mit Synthesizern nachgeahmt. Diesem Typen war vor ein paar Jahren aufgefallen, dass sämtliche billigen Horrorfilme in ihren Soundtracks dasselbe Musikstück – Carl Orffs Carmina Burana – verwendeten. Das Werk war zu einem Klischee geworden, das eher Aufstöhnen oder Gelächter hervorrief als Schrecken. Der Deutsche, der ein Leben als notleidender Künstler geführt hatte, während er versuchte, als DJ Fuß zu fassen, hatte einen Einfall gehabt, der seine Karriere veränderte: Die Filmemacher der Welt bekundeten einen unersättlichen Bedarf an einer Sorte Musik, von der die Carmina Burana das einzige existierende Exemplar war. Der Markt (sofern man sich die Welt der Komponisten und Musiker als solchen vorstellen konnte) befriedigte diese Nachfrage nicht. Warum dann nicht Originalmusik machen, die klang wie der Soundtrack jener Art von Filmszene, in der unweigerlich die Carmina Burana ertönte? Sie musste ja nicht ganz genau so klingen, sollte aber schon dieselben Gefühle hervorrufen. Der Deutsche gab sich einen neuen Namen, nämlich Pompitus Bombasticus, und brachte ein namengebendes Album heraus, das von zahllosen aufstrebenden jungen Filmemachern, die das allgemeine Empfinden einte, dass sie sich, wenn sie die Carmina Burana noch ein einziges Mal hörten, Stifte in die Ohren stecken würden, mit Begeisterung gerippt, über Torrent-Dateien oder auch direkt heruntergeladen und gestohlen wurde. Seitdem hatte Pompitus Bombasticus fünf weitere Alben veröffentlicht, die Richard allesamt legal heruntergeladen und dieser einen langen Playlist einverleibt hatte. Die atemberaubende Schwungkraft und emotionale Bandbreite der Musik ließen das Spülmaschineausräumen so bedeutungsschwer erscheinen wie die Schlussszene von 2001: Odyssee im Weltraum. In diesem Fall legte sie einen Schleier falscher Eindringlichkeit über den Text von C-plus (wie Dodge Corvallis nannte). Aus Angst, C-plus könnte das in den falschen Hals bekommen, wollte er es nicht zugeben und ihm ins Gesicht sagen, aber in den späteren Phasen ihrer professionellen Beziehung war C-plus’ Rolle immer weniger die des technischen Allrounders und mehr die des allgemeinen intellektuellen Handlangers und Gefährten geworden. Wenn es um all das Zeug ging, das Richard in der extrem bewegten Zeit seines späten Teenager- und frühen Erwachsenenalters zu lernen versäumt hatte, war Corvallis Kawasaki seinem Dante der Vergil, seinem Sherman Mr Peabody.
Als zum Beispiel Richard vor ein paar Jahren erwähnt hatte, dass fast alle seine Träume in derselben Kleinstadt in Iowa angesiedelt waren, hatte C-plus ihm gesagt, das hänge mit einer berühmten Erkenntnis eines deutschen Philosophen namens Kant zusammen, der postuliert habe, dass der Verstand schlichtweg nicht in der Lage sei, über irgendetwas nachzudenken, ohne es in Raum und Zeit zu verorten. Das Gehirn sei nun mal so verdrahtet, daran könne man nichts ändern. In ihren Grundeigenschaften habe sich der junge Richard die Raumzeit angeeignet, indem er auf dem Fahrrad in einem bestimmten Straßenraster umherfuhr, in bestimmten Häuserblocks »Süßes oder Saures« verlangte und vor großen Jungs oder Konrektoren durch günstig gelegene Gärten davonrannte. Jetzt sei sie in sein »Konnektom«, den Schaltplan seines Gehirns, eingebrannt; sie sei das kantische Substrat jeglicher geistigen Aktivität im Zusammenhang mit Raum und Bewegung. Womöglich besorgt, dass Richard seiner Argumentation nicht folgen konnte, hatte C-plus sie zusammenfassend mit dem Hexagon-Grafikpapier verglichen, auf dem Nerds die Landschaften grafisch darstellten, in denen Kriegsspiele betrieben wurden. Genau dieses Detail hatte bei Richard den Verdacht aufkommen lassen, dass C-plus ihn gerade verarschte. Das alles war ohne besonderen Grund ganz kurz vor einer Aufsichtsratssitzung passiert: der wichtigsten Aufsichtsratssitzung in der Geschichte von Corporation 9592, in deren Verlauf sie verkündeten, dass der Jahresumsatz der Firma jetzt den des Römischen Reiches auf dem Höhepunkt des Augusteischen Zeitalters überstieg. Diese Aufgabe hatte Richard dem Finanzvorstand angedreht, der an so etwas seine helle Freude hatte. Während der Mann seine PowerPoint-Folien durchging, hatte Richard sein Handy hervorgeholt und in einem nur pro forma unternommenen Versuch zu verbergen, was er da tat, unter dem Konferenztisch Kant gegoogelt. Die Suchergebnisse deuteten auf schrecklich kompliziert zu lesende Seiten hin, genügten aber schon als Beweis dafür, dass es wirklich einen Menschen namens Kant gegeben und dieser sich tatsächlich mit solchen Themen befasst hatte.
Pompitus Bombasticus’ Musik ließ Richards fünfzehnminütige Busfahrt so inspirierend und doch tragisch erscheinen wie die Schlacht von Stalingrad. Als das Fahrzeug in Richtung Stadtmitte um eine Kurve fuhr, wurde es von einem Mann mit einem Stoppschild angehalten, während ein langer Lastwagen voller Erde in die Straße einfuhr, um seine Ladung an irgendeinen Ort zu bringen, an dem man Erdaushub ablud. Der Soundtrack in Richards Kopfhörer ließ diese mühsame, aber grundsätzlich einfache Operation als ein ebenso großes technisches Wunder erscheinen wie den Start eines massiven und doch anmutigen Raumschiffs aus seinem erdumkreisenden Trockendock. Dodge brauchte ein paar Minuten, um sich zurechtzufinden. Er begriff, dass, während er mit anderen Dingen beschäftigt gewesen war, ein älterer Wolkenkratzer – ein Gebäude, das seit den Sechzigerjahren die Skyline der Stadt mitbestimmt hatte – abgerissen worden war. Auf einem Schild war ein viel größeres Gebäude abgebildet, das ihn ersetzen würde. So altmodisch das auch war, irgendwie fühlte er sich verraten und verkauft. Kaum passte man mal einen Moment nicht auf, schon war ein Gebäude weg.
Doch gleich im nächsten Block stand ein Gebäude, das, als es vor vielleicht fünf, nein zehn Jahren erbaut wurde, ein gefeiertes architektonisches Ereignis dargestellt hatte. Jetzt gehörte es einfach zur Landschaft. Er fragte sich, ob er wohl noch leben würde, wenn man es abriss. Übrigens wusste man von ihm auch, dass er sich fragte, ob sein derzeitiges Auto wohl das letzte war, das er sich je kaufen, ob die Lederjacke, die er trug, ihn überleben würde. Dabei neigte er keineswegs zu morbiden Gedanken. Er war nicht depressiv, grübelte nicht besonders viel über den Tod nach. Er ging lediglich davon aus, dass er sich auf einem sehr langen Gleitpfad befand, der in vielleicht dreißig bis fünfzig weiteren Jahren zum Tod führte, und dass er bis dahin noch jede Menge Muße haben würde, sich darüber Gedanken zu machen. Für ihn hatte das Leben etwas von einem Schützengraben im Ersten Weltkrieg, der an einem Ende sehr tief war, jedoch immer flacher wurde, je weiter man kam, und allmählich in der Oberfläche aufging. In frühen Jahren war man so tief in ihm drin, dass man nicht einmal wusste, dass über seinem Rand Granaten explodierten und Kugeln durch die Luft zischten. Mit der Zeit wurden diese wahrnehmbar, aber nicht unmittelbar relevant. Irgendwann sah man dann, wie die ersten Menschen um einen herum durch Granatsplitter verletzt oder gar getötet wurden, aber selbst wenn es sich um gute Freunde handelte, wusste man bei aller Trauer und Erschütterung, dass sie statistische Ausreißer darstellten. Je weiter man allerdings marschierte, desto schwieriger wurde es, die Tatsache zu ignorieren, dass man sich der Oberfläche näherte. Vor einem starben Menschen einzeln, dann gruppen-, dann scharenweise. Am Ende, wenn man ungefähr hundert Jahre alt war, tauchte man aus dem Graben ins Freie auf, wo die verbleibende Lebensdauer in Minuten gemessen wurde. Richard hatte, bevor es so weit sein würde, noch Jahrzehnte vor sich, aber er hatte ein paar Leute um sich herum ins Gras beißen sehen, und wenn er in diesem Graben nach oben blickte, erkannte er in großer Entfernung – aber dennoch nah genug, um ihn zu sehen – den Rand, über dem die Kugeln in grell blitzendem Hagel flogen. Vielleicht war es aber auch nur die Musik in seinem Kopfhörer, die ihn so denken ließ.
Sie fuhren an einem guten Restaurant vorbei – einem von Richards Lieblingslokalen, wenn er zu einem Geschäftsessen einladen musste. Aus der angrenzenden Gasse kam ein Kastenwagen heraus und fädelte sich direkt vor dem Bus in eine Verkehrslücke ein. Er trug das Logo einer Firma, die offensichtlich Tischwäsche an Restaurants lieferte, die nobel genug waren, sie zu benutzen. Und schon war der kleine Wagen fort, unterwegs zum nächsten Restaurant, das er beliefern würde. Der Busfahrer ärgerte sich über die Art, wie er die Lücke für sich in Anspruch genommen hatte. Richard, der gut in der Zeit lag und für nichts verantwortlich war, ließ seine Gedanken einfach zum Verkehrsfluss wandern. Als sie an der kleinen Gasse vorbeikamen, sah er, wie aus einem Biertransporter Fässer mit Bier aus einer lokalen Brauerei abgeladen wurden. Die Zweckbestimmung von Tischwäsche- und Bierlieferwagen war unübersehbar, weil direkt auf ihre Seitenwände gedruckt, aber natürlich hatte jedes andere Fahrzeug auf der Straße und jeder Fußgänger auf dem Gehweg ebenfalls eine Zweckbestimmung. Es war das Zusammenfließen und die Interaktion all dieser Absichten, die eine Stadt ausmachten. Das anfängliche Scheitern der Spieldesigner von Corporation 9592 beim Digitalisieren dieses Gefühls führte dazu, dass Richard mehrere Monate lang tat, was Richard üblicherweise tat, nämlich Probleme anzupacken, die so sonderbar waren, dass allein das Eingeständnis ihrer Existenz für jeden, der nicht der Firmengründer war, das Ende seiner Karriere bedeutet hätte. Das Spiel hieß, ebenso wie die imaginäre Welt, in der es angesiedelt war, T’Rain. Die Geologie dieser Welt war von einem Mann, der sich Pluto nannte und in derlei Dingen sehr begabt war, überzeugend simuliert worden. Die Stadtlandschaft war aus nicht unmittelbar ersichtlichen Gründen weit weniger überzeugend geraten. Das war eins jener vermeintlich trivialen Probleme, die sich als ausgesprochen schwierig erwiesen hatten. Worauf es, nachdem sie Millionen von Dollar ausgegeben hatten, um Leute zu Seminaren einzufliegen und städtische Verkehrsflüsse auf Hochleistungsrechenclustern zu simulieren, letztlich hinauslief, war, dass in einer echten Stadt jeder irgendetwas zu tun versuchte. Manchmal hatte jeder ein anderes Ziel, dann wieder hatten alle (wie unmittelbar vor einem Sportereignis) dasselbe Ziel. Die Art, wie Menschen und Fahrzeuge sich bewegten, spiegelte deren Art, diese Ziele zu verfolgen, wider. Wenn jemand einige Zeit in einer Stadt der realen Welt verbracht hatte, lernte sein Gehirn, diese Verhaltensweisen zu deuten und sie als stadtartig zu verarbeiten und zu verstehen. Besuchte man aber eine erfundene Stadt in einem Massen-Mehrspieler-Onlinespiel, sah man dort in der Regel Verhaltensweisen von Gruppen, die nicht denen entsprachen, bei denen das Gehirn davon überzeugt war, etwas Reales zu sehen, sodass die Illusion scheiterte.