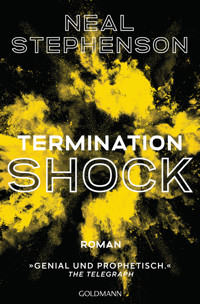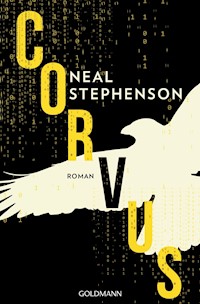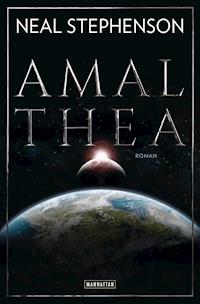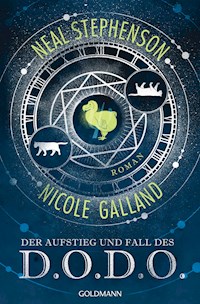
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
D.O.D.O. – das Department of Diachronic Operations – ist eine Geheimorganisation der amerikanischen Regierung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mittels Zeitreise die Magie in unsere Welt zurückzuholen. Denn selbst wenn Zauberei in der Gegenwart nur noch Stoff für Märchen und Mythen sein mag, so war sie doch real, bis sie im Jahr 1851 durch ein schicksalhaftes Ereignis für immer verschwand. Tatsächlich gelingt es, in die Vergangenheit zu reisen. Doch es ist ein riskantes Unterfangen mit ungewissem Ausgang, da niemand zu sagen vermag, welche Zukunft die Zeitreisenden bei ihrer Rückkehr erwarten wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1192
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
D.O.D.O. – das Department of Diachronic Operations – ist eine Geheimorganisation der amerikanischen Regierung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mittels Zeitreise die Magie in unsere Welt zurückzuholen. Denn selbst wenn Zauberei in der Gegenwart nur noch Stoff für Märchen und Mythen sein mag, so war sie doch real, bis sie im Jahr 1851 durch ein schicksalhaftes Ereignis für immer verschwand. Tatsächlich gelingt es, in die Vergangenheit zu reisen. Doch es ist ein riskantes Unterfangen mit ungewissem Ausgang, da niemand zu sagen vermag, welche Zukunft die Zeitreisenden bei ihrer Rückkehr erwarten wird …
Autoren
Neal Stephenson gilt seit seinem frühen Roman »Snow Crash« als eines der größten Genies der amerikanischen Gegenwartsliteratur. »Cryptonomicon«, seine Barock-Trilogie sowie »Anathem«, »Error«, »Amalthea« und sein jüngstes Werk »Der Aufstieg und Fall des D.O.D.O.« sind internationale Bestseller.
Nicole Galland hat sich in den USA als Autorin historischer Romane einen Namen gemacht und bereits mehrfach mit Neal Stephenson zusammengearbeitet. Sie lebt mit ihrem Mann in Martha’s Vineyard.
Neal Stephenson & Nicole Galland
Der Aufstieg und Fall des D.O.D.O.
Roman
Deutsch vonJuliane Gräbener-Müller
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Rise and Fall of D.O.D.O.« bei William Morrow/HarperCollins Publishers, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. AuflageDeutsche Erstveröffentlichung Dezember 2018Copyright © 2017 der Originalausgabe by Neal StephensonCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenAll rights reservedUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, nach dem Design von Mike Topping © HarperCollinsPublishers Ltd 2017Umschlagmotiv: © Shutterstock.com/Vitezslav Halamka/Voropaev Vasiliy/Aepsilon/MicroOneIllustration (Dodo): Joel HollandRedaktion: Nikolaus StinglAn · Herstellung: HanSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-23019-7V002www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
FÜR LIZ DARHANSOFF
ANMERKUNG DER AUTOREN
An die Leserin und den Leser:
Zu Ihrer Orientierung haben wir ein Personenverzeichnis sowie ein Glossar mit spezifischen Akronymen und Begriffen aus der D.O.D.O.-Welt beigefügt. Da die Listen viele Spoiler enthalten, stehen sie im hinteren Teil des Buchs.
N. S. und N. G.
AUFSTIEG UND FALL DES D.O.D.O.
Diachronik
[PRÄAMBEL, JULI 1851]
Ich heiße Melisande Stokes, und das ist meine Geschichte. Ich schreibe sie im Juli 1851 (christlicher Zeitrechnung oder – machen wir uns nichts vor – Anno Domini) im Gastzimmer eines bürgerlichen Hauses in Kensington, London, England. Eigentlich gehöre ich aber weder an diesen Ort noch in diese Zeit. Genau genommen will ich verdammt noch mal endlich hier weg.
Doch das wussten Sie schon. Denn wenn ich damit fertig bin, dieses Ding zu schreiben, das ich aus Ihnen bald ersichtlich werdenden Gründen Diachronik nenne, werde ich es zu den ausgesprochen unauffälligen Privatkontoren der Fugger-Bank in der Threadneedle Street bringen, dort in eine verschließbare Schatulle legen und sie dem mächtigsten Bankier von London übergeben, der sie in einem Gewölbe versiegeln wird, damit sie mehr als hundertsechzig Jahre lang niemand öffnet. Besser als alle Menschen auf der Welt verstehen die Fugger nämlich die Gefahren der Diachronen Scherung. Sie wissen, dass ein früheres Öffnen der Schatulle und Lesen des Dokuments eine Katastrophe auslösen würde, die Londons Bankenviertel ausradieren und an seiner Stelle einen rauchenden Krater hinterlassen würde.
In Wirklichkeit wäre es noch viel schlimmer als nur ein rauchender Krater … aber die Geschichte würde es, nachdem die überlebenden Augenzeugen ins Irrenhaus geschickt worden wären, als rauchenden Krater beschreiben.
Zum Schreiben benutze ich einen Federhalter mit einer Stahlfeder, Modell Nummer 137B, von Hughes & Sons Ltd. aus Birmingham. Ich habe die extrafeine Feder verlangt, teils, um Geld beim Papier zu sparen, und teils, um mir damit in den Finger zu stechen und ein bisschen Blut abzuzapfen. Der braune Ausstrich oben auf dieser Seite kann in jedem beliebigen DNA-Labor des 21. Jahrhunderts untersucht werden. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit dem, was in meinem Personalbogen im DODO-Hauptquartier steht, und Sie werden wissen, dass ich eine Frau aus Ihrem Zeitalter bin, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt.
Ich habe vor, alles schriftlich festzuhalten, was erklärt, wie ich hier gelandet bin, egal wie weit hergeholt oder halluzinatorisch es klingen mag. Um Peter Gabriel, einen Singer/Songwriter zu zitieren, der in neunundneunzig Jahren zur Welt kommen wird: »This will be my testimony.«
Ich versichere, dass ich gegen meinen Willen hier bin, nachdem ich vom 8. September 1850 (einen Tag bevor Kalifornien zum Bundesstaat erklärt wurde) und von San Francisco, Kalifornien, aus hierhergeschickt wurde.
Ich bestätige, dass ich nach Boston, Massachusetts, und ins erste Viertel des 21. Jahrhunderts gehöre. Dort und in dieser Zeit bin ich Teil des Department of Diachronic Operations: eines über ein geheimes Budget finanzierten Arms der amerikanischen Regierung, der aufgrund internen Verrats ziemlich aus den Fugen geraten ist.
In der Zeit, in der ich dies schreibe, 1851, lässt die Magie nach. Die Forschungsarbeit, für die DODO mich bezahlte, deutet darauf hin, dass Magie am Ende dieses Monats (28. Juli) aufhören wird zu existieren. Wenn das passiert, werde ich bis zum Ende meiner Tage hier in einer post-magischen Zeit gefangen sein. Die einzige Möglichkeit, wie überhaupt je ein Mensch erfahren wird, was aus mir geworden ist, besteht in dieser Aussage. Zwar ist es mir gelungen, in einer (für die Verhältnisse des Jahres 1851) komfortablen Wohnung mit Zugang zu Schreibfeder, Tinte, freier Zeit und Privatsphäre unterzukommen, doch nur auf Kosten meiner Freiheit; meine Gastgeber würden nicht in Erwägung ziehen, mich zu einem Abendspaziergang allein aus dem Haus gehen oder gar nach Hexen Ausschau halten zu lassen, die mir helfen könnten.
Noch eine Bemerkung, bevor ich richtig anfange. Falls je irgendjemand von DODO das hier liest, ergänzt bitte um Gottes willen die Liste der Helfershelfer, die wir an jedem der viktorianischen BZOs rekrutieren müssen, um Korsettmacher. Korsetts sollen eigentlich maßgeschneidert sein, um der tatsächlichen Körperform einer Dame zu entsprechen, und es ist unbequem, sich eins ausleihen oder »von der Stange« kaufen zu müssen, obwohl Dienstmädchen und ärmere Frauen das in der Regel tun (sie aber ihrer körperlichen Arbeit wegen nicht fest schnüren). Da ich hier ganz und gar auf Wohltätigkeit angewiesen bin, möchte ich meine Gastgeber lieber nicht bitten, mir ein Darlehen für ein maßgefertigtes zu gewähren, aber das (von meiner Gastgeberin geliehene) hier ist einfach fürchterlich. Dagegen fühlt sich ein Renaissance-Mieder wie ein Bikini an, ganz ohne Scheiß.
Diachronik
TAG 33 [ENDE AUGUST, JAHR 0]
An dem ich Tristan Lyons kennenlerne und auf der Stelle einwillige, in größere Schwierigkeiten zu geraten, als ich mir damals hätte vorstellen können
Ich traf Tristan Lyons im Gang vor den Fakultätsbüros des Instituts für Alte und Klassische Linguistik an der Harvard University. Ich war dort Dozentin, was so aussah, dass man mir die unbeliebtesten Lehraufgaben übertrug, die zudem keine Möglichkeit der Forschung mithilfe von Geldern der Universität und keine echte Jobsicherheit boten.
An diesem speziellen Nachmittag ging ich gerade den Korridor entlang, als ich aus dem Büro des Institutsleiters Dr. Roger Blevins laute Stimmen hörte. Seine Tür war angelehnt. Normalerweise stand sie weit offen, damit jeder, der vorbeiging, einen Blick auf Blevins Ego-Wand erhaschen konnte, an der jedes Abschlusszeugnis, jede Ehrung und jede Auszeichnung, ob ehrlich erworben oder nicht, prangte. Stand die Tür nicht sperrangelweit offen, war sie fest verschlossen und mit dem in 48-Punkt Lucida Blackletter gedruckten Hinweis versehen, man möge »Bitte nicht stören«, damit wir auch ja alle begriffen, in welch exklusiver Gesellschaft er sich befand.
Doch nun war sie völlig untypischerweise zu einem Viertel geöffnet. Neugierig spähte ich genau in dem Moment hinein, als ein adrett gekleideter Mann entschlossenen Schrittes auf die Tür zustrebte, während er mit einem Ausdruck irgendwo zwischen Abscheu und Belustigung zu Blevins zurückblickte. Sein Bizeps klatschte gegen meine Schulter, als er mich mit solcher Wucht anrempelte, dass ich aus dem Gleichgewicht geriet. Mit einer Rückwärtsdrehung landete ich ausgestreckt auf dem Boden. Er wich instinktiv zurück, wobei sein Rucksack mit lautem Krach an den Türpfosten schlug. Aus dem Inneren des Büros spuckte Blevins Stimme einen Strom von Beleidigungen aus.
»Entschuldigen Sie«, sagte der Mann, der etwa in meinem Alter war, sofort und lief rot an. Er schlüpfte in den Korridor hinaus und machte Anstalten, die Hand nach mir auszustrecken, um mir aufzuhelfen.
Da schwang die Tür mit ziemlicher Wucht noch weiter auf und mir geradewegs ans Schienbein. Ich gab ein Geräusch gequälten Protests von mir, worauf die großtuerische Stimme aus dem Inneren des Raums verstummte.
Blevins, das dichte graue Haar starr frisiert und gekleidet, als erwartete er, jederzeit zur Abgabe eines Expertengutachtens vereidigt zu werden, trat aus seinem Büro und blickte missbilligend auf mich herab. »Was machen Sie da?«, fragte er, als hätte er mich beim Spionieren erwischt.
»Meine Schuld, tut mir leid, Miss«, sagte der junge Mann, während er mir erneut eine Hand hinstreckte.
Blevins packte die Tür an der Kante und fing an, sie zuzuziehen. »Passen Sie auf, wo Sie langgehen«, sagte er zu mir. »Wenn Sie in der Mitte des Korridors gegangen wären, hätten Sie einen Zusammenstoß vermieden. Bitte fassen Sie sich und gehen Sie weiter.«
Dem jungen Mann warf er einen Blick zu, den ich aus meiner Lage nicht so recht einschätzen konnte, dann verschwand er wieder in seinem Büro und knallte die Tür hinter sich zu.
Nach kurzem betroffenem Schweigen hielt der junge Mann mir seine Hand noch näher hin, worauf ich sie mit einem dankbaren Nicken ergriff und mich hochzog. Dann standen wir ziemlich dicht nebeneinander.
»Es …«, fing er wieder an. »Es tut mir schrecklich leid …«
»Schon okay«, sagte ich. »Wie schlimm können Sie sein, wenn Sie Roger Blevins geärgert haben?«
Darauf blickte er verdutzt drein, so als gehörte es sich dort, woher er kam, einfach nicht, schlecht über Vorgesetzte zu reden. Eine Weile starrten wir einander an. Was mir vollkommen normal erschien. Er sah hübsch aus, ein bisschen nach Reserveoffizier-Ausbildungskorps, und sein Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass auch er nichts dagegen hatte, mich anzuschauen, obwohl ich nicht zu der Sorte Frau gehöre, für die Jungs aus dem Reserveoffizier-Ausbildungskorps sich auch nur im Entferntesten interessieren.
Plötzlich streckte er die Hand aus. »Tristan Lyons«, sagte er.
»Melisande Stokes«, erwiderte ich.
»Sind Sie am Institut für Alte und Klassische Linguistik?«
»Ja«, sagte ich. »Ich bin eine ausgebeutete und geknechtete Dozentin der Geisteswissenschaft.«
Wieder dieser überraschte, argwöhnische Blick. »Ich spendiere Ihnen einen Kaffee«, sagte er.
Das war dreist, aber da es mir so gefiel, dass er Blevins aus der Fassung gebracht hatte, hätte ich es unhöflich gefunden, ihn abblitzen zu lassen.
Er wollte mit mir zum Apostolic Café am Central Square gehen, zu Fuß vielleicht zehn Minuten die Massachussetts Avenue hinunter. Es war die Zeit im Jahr, wo man in Boston das Gefühl hat, dass der Sommer endgültig vorbei ist, und die über siebzig Colleges und Universitäten allmählich wieder zum Leben erwachen. Die Straßen waren voll mit den Minivans von Eltern aus dem gesamten Nordosten, die ihre Kinder zu deren Wohnungen und Studentenheimen zurückbrachten. Gehwege waren zugestellt mit ausrangierten Sofas und anderem Sperrmüll. Das stelle man sich zusätzlich zu dem üblichen städtischen Verkehr vor – Menschen, Autos, Fahrräder, die T – und alles war sehr laut und hektisch. Das nutzte Tristan als Vorwand, mit einer Hand meinen Ellbogen zu umfassen und mich so beim Gehen dicht bei sich zu haben. Dreist. Wie überhaupt der Gedanke, dass man zu zweit nebeneinander durch ein solches Gewühl gehen könnte. Doch mit erwartungsvollen Blicken und knappen Entschuldigungen schaffte er es immer wieder, uns einen Weg durch die Menge zu bahnen. Eindeutig nicht aus der Gegend.
»Können Sie mich gut verstehen?«, sagte er mir fast direkt ins Ohr, da ich mich nur einen halben Schritt vor ihm befand. Ich nickte. »Ich will Ihnen ein paar Dinge sagen, solange wir noch unterwegs sind. Wenn wir dann ins Café kommen, und Sie halten mich für einen Fiesling oder einen Irren, sagen Sie es mir einfach, und ich werde Ihnen lediglich einen Kaffee zahlen und mich aus dem Staub machen. Falls Sie mich aber nicht für einen Fiesling oder Irren halten, werden wir ein sehr ernsthaftes Gespräch führen, das Stunden dauern könnte. Haben Sie für heute Abend schon etwas vor?«
In der Gesellschaft, in der ich mich gegenwärtig bewege, hätte ein solches Vorgehen als derart ungeheuerlich gegolten, dass ich im Nachhinein kaum glauben kann, dass ich mich nicht unverzüglich verabschiedet und ihn stehengelassen habe. Doch damals fand ich seine peinliche Ungehörigkeit, seine Direktheit sogar ziemlich hinreißend. Und ich gebe zu, ich war neugierig auf das, was er zu sagen hatte.
»Eventuell«, erwiderte ich. (Im Vertrauen: hatte ich nicht.)
»Gut, hören Sie zu«, fing er an. »Ich arbeite für eine obskure Regierungseinrichtung, von der Sie noch nie gehört haben, und wenn Sie versuchen, sie zu googeln, werden Sie keinen Hinweis darauf finden, nicht einmal von abgedrehten Verschwörungstheoretikern.«
»Abgedrehte Verschwörungstheoretiker sind die Einzigen, die einen Ausdruck wie ›obskure Regierungseinrichtung‹ verwenden würden«, gab ich zu bedenken.
»Deshalb verwende ich ihn ja«, versetzte er. »Ich will gar nicht, dass irgendjemand mich ernst nimmt, es stünde meiner Effizienz im Weg, wenn Leute mir Aufmerksamkeit schenken würden. Ich erkläre Ihnen jetzt, was wir brauchen, und Sie sagen mir, ob Sie interessiert sind. Wir haben einen Haufen sehr alter Dokumente – eins sogar in Keilschrift –, die wir, zumindest grob, von ein und derselben Person übersetzen lassen müssen. Man wird Sie sehr gut bezahlen. Allerdings kann ich Ihnen nicht sagen, woher die Dokumente stammen oder wie wir daran gekommen sind oder warum wir uns dafür interessieren. Und Sie dürfen keiner Menschenseele je davon erzählen. Nicht einmal Ihren Freundinnen und Freunden: ›Übrigens, ich habe als Verschlusssache eingestufte Texte für die Regierung übersetzt.‹ Selbst wenn wir Ihre Übersetzung veröffentlichen, können Sie nicht die Urheberschaft beanspruchen. Wenn Sie beim Übersetzen des Materials außerordentliche Dinge erfahren, dürfen Sie sie nicht mit der Welt teilen. Sie sind ein Rädchen in einem Getriebe. Ein anonymes Rädchen. Damit müssen Sie sich einverstanden erklären, ehe ich weiterrede.«
»Deshalb hat Blevins Sie rausgeschmissen«, sagte ich.
»Ja, ihm liegt die Freiheit der Wissenschaft sehr am Herzen.«
Dass ich es mir da verkneifen konnte, zu LOL mich über ihn lustig zu machen, müssen Sie mir hoch anrechnen, geneigter Leser. »Nein, tut sie nicht.«
Das verblüffte Tristan, der mich ansah wie ein Welpe, dem man auf den Schwanz getreten hat. Nein, machen wir in Anbetracht seines Reserveoffizier-Gebarens lieber einen ausgewachsenen Deutschen Schäferhund daraus.
»Es hat ihm gestunken, dass er damit weder Ruhm erlangt noch Tantiemen bekommen hätte«, erklärte ich. »Aber das konnte er natürlich nicht zugeben. Also Freiheit der Wissenschaft oder so was.«
Darüber schien Tristan nachzudenken, als wir die Temple Street überquerten. Leute wie er sind dazu erzogen, Autorität zu respektieren. Blevins war auf seinem Gebiet eine Autorität. Das war also ein kleiner Test. War Tristans rechtschaffener Verstand kurz davor zu explodieren?
Durch das ganze Gewühl hindurch konnte ich im goldenen Licht der ersten Herbsttage den Eingang zur U-Bahn-Haltestelle Central Square erkennen. »Wie ist Ihre Haltung?«, fragte er mich.
»Zur Freiheit der Wissenschaft? Oder zur Bezahlung?«
»Bis jetzt haben Sie mich noch nicht in die Wüste geschickt«, sagte er. »Deshalb sprechen wir wohl über Letztere.«
»Hängt von der Höhe ab.«
Er nannte einen Betrag, der doppelt so hoch war wie mein Jahresgehalt, allerdings »… erst wenn Sie mich davon überzeugt haben, dass Sie die richtige Person für diesen Job sind.«
»Wofür werden die Übersetzungen verwendet?«
»Verschlusssache.«
Ich suchte innerlich nach Gründen, diese lukrative Unterhaltung nicht fortzusetzen. »Könnten Sie so etwas wie eine Rechtfertigung für unethisches Verhalten oder physische Gewalt seitens Ihrer obskuren Regierungseinrichtung liefern?«
»Verschlusssache.«
»Also ein Ja«, sagte ich. »Oder zumindest eine Möglichkeit. Sonst hätten Sie nämlich nein gesagt.«
»Die Summe, die ich eben genannt habe, ist die für einen Sechs-Monats-Vertrag. In gegenseitigem Einvernehmen zu verlängern. Zusatzleistungen verhandelbar. Trinken wir zusammen einen Kaffee oder nicht?« Wir näherten uns der letzten Abbiegung vor dem Apostolic Café.
»Ein Kaffee kann nichts schaden«, sagte ich. Damit spielte ich auf Zeit, während ich im Kopf zu rechnen versuchte: Das Vierfache meines derzeitigen Nettogehalts, das nie Zusatzleistungen enthielt. Ganz zu schweigen davon, dass ich meine Kompetenz im Fachbereich meines Mentors steigern würde.
Wir betraten das Café, eine schöne alte entwidmete Backsteinkirche mit hohen Gewölbedecken, Bleiglasfenstern und unpassenderweise modernen Holztischen und -stühlen, die über den Marmorboden verteilt standen. An einer Seite befand sich eine hochmoderne Espressostation und – äußerst irritierend, sosehr ich auch meine Erziehung überwunden hatte – eine Theke ungefähr da, wo einmal der Altar gewesen sein dürfte, und eine komplette Bar entlang der geschwungenen inneren Wand der Apsis. Das Lokal hatte erst vor Kurzem eröffnet, war aber innerhalb der Gemeinde der Technikfreaks von Harvard wie auch vom MIT bereits sehr beliebt. Ich war das erste Mal hier. Für einen Moment durchfuhr mich Neid, weil es in Cambridge nicht genug Linguisten gab, um ein so hübsches ausgewiesenes Mehrsprachen-Stammlokal zu rechtfertigen.
»Was darf’s denn sein?«, fragte die Barista, eine junge Amerikanerin asiatischer Herkunft mit interessanten Piercings, Tattoos anstelle von Augenbrauen und einem Auftreten, das Ich bin sooo interessant, und dieser Job ist so ätzend mit Ich führe insgeheim ein richtig cooles Leben, und dieser Job ist eine super Fassade mischte. Auf ihrem Namensschild stand: »Julie Lee: Professionelle « (was ich grob als »Klugscheißer-Oboistin« verstand).
Wir bestellten etwas zu trinken – Tristan schwarzen Kaffee; ich selbst etwas, das ich normalerweise nie nehmen würde: einen komplizierten Irgendwas-Latte-Irgendwas mit einer Menge Modewörtern, den ich aufs Geratewohl auf der Getränkekarte über dem Tresen ausgewählt hatte und der bei unserer Barista ein kurzes Grinsen hervorrief. Agenten von obskuren Regierungseinrichtungen, überlegte ich, wurden vermutlich in der psychologischen Beurteilung potenzieller Rekruten ausgebildet, und solange ich nicht genau wusste, ob ich sein Angebot weiterverfolgen wollte oder nicht, hatte ich keine Lust, von ihm richtig eingeschätzt zu werden. (Außerdem sah er ziemlich gut aus, was mich etwas kribbelig machte, sodass ich beschloss, mich hinter einer vorgespiegelten Exzentrik zu verstecken.) Das Ende vom Lied war, dass er sich mit einer duftenden Tasse dunkle Röstung hinsetzte, ich dagegen mit etwas nahezu Untrinkbarem.
»Sie haben das bestellt, um mich auf eine falsche Fährte zu locken, falls ich Sie gerade einem Psycho-Check nach Ninja-Art unterziehe«, sagte er beiläufig, als probierte er den Gedanken nur mal aus. »Ironischerweise sagt mir das mehr über Sie, als wenn Sie einfach das Übliche bestellt hätten.«
Ich muss schockiert ausgesehen haben, denn er grinste mit einer fast primitiven Selbstzufriedenheit. Es hatte etwas verstörend Prickelndes, so gründlich, so schnell und so heimlich durchschaut zu werden. Ich spürte, wie ich errötete.
»Wie?«, fragte ich. »Wie haben Sie das gemacht?«
Er beugte sich zu mir, große, kräftige Hände umfassten einander vor ihm auf dem Cafétisch. »Melisande Stokes – darf ich du sagen?« Ich nickte. »Mel.« – »Tristan.« Er räusperte sich auf eine sehr offiziell klingende, vorbereitende Art. »Wenn wir hiermit weitermachen«, sagte er, »passiert dreierlei. Zuallererst musst du die Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Anschließend musst du ein paar Probeübersetzungen für uns machen, damit wir einen Eindruck von deiner Arbeit bekommen, und dann müssen wir dich einer Hintergrundprüfung unterziehen.«
»Wie lange wird das dauern?«, fragte ich.
Das Vierfache meines Gehalts. Womöglich inklusive Zahnbehandlung.
Und kein Blevins.
Er hatte seinen Rucksack auf einen Stuhl neben sich gestellt. Jetzt klopfte er mit der flachen Hand darauf. »Das Formular für die Geheimhaltungserklärung ist hier drin. Wenn du es jetzt unterzeichnest, kann ich deinen Namen und deine Sozialversicherungsnummer per SMS nach D.C. schicken.« Er hielt inne, überlegte noch einmal. »Vergiss es. Die haben deine Nummer bereits. Es ist eher so, dass sie mit der Hintergrundprüfung fertig sein werden, bevor du den letzten Tropfen von was zum Teufel du da trinkst hinuntergekippt hast. Also geht es nur darum, wie lange du brauchst, um die Probetexte zu übersetzen, und wie lange unsere Leute brauchen, um einen Blick auf deine Übersetzungen zu werfen. Aber« – er hob warnend einen Finger – »das ist keine Witzveranstaltung. Mit der Unterzeichnung der Erklärung verpflichtest du dich, das hier zu machen. Es sei denn, wir erteilen dir eine Absage. Du kannst uns allerdings nicht absagen. Sobald du das Formular unterschreibst, hast du mich am Hals, für mindestens sechs Monate. Alles klar? Keine Halbherzigkeiten deinerseits. Vielleicht sollten wir uns einfach heute Abend unterhalten, und dann nimmst du die Erklärung mit nach Hause und gibst sie mir morgen, nachdem du ein Mal drüber hast schlafen können.«
»Wo würde ich dich morgen finden?«, fragte ich.
»Verschlusssache«, sagte er. »Ich würde dich finden.«
»Ich mag es nicht, wenn man mich stalkt. Lieber unterschreibe ich jetzt«, sagte ich.
Er starrte mich einen Augenblick an. Es war nicht ganz so wie in diesem ersten Moment, als wir einander angestarrt hatten und es sich so seltsam normal angefühlt hatte. Diesmal fühlte es sich bedeutungsschwer an. Ich wusste aber nicht genau, warum. Ich hätte gerne geglaubt, dass ich einfach froh war, Blevins loszuwerden und dabei auch noch mein Gehalt zu vervierfachen. Doch wenn ich ehrlich mit mir bin, gebe ich zu, dass ein eindeutiger Reiz darin lag, von jemandem mit so angenehmen Gesichtszügen ausgewählt zu werden.
»Gut«, sagte er, nachdem wir uns zwei Herzschläge lang angestarrt hatten. »Hier.« Er griff nach seinem Rucksack.
Ich las das Formular, in dem genau das stand, was Tristan beschrieben hatte, sodass es einerseits ein Standardvordruck, zugleich aber auch etwas Einzigartiges war. Ich streckte eine Hand aus, und Tristan gab mir einen simplen Kugelschreiber. Kein Vergleich mit der leicht blutverschmierten Hughes & Sons Ltd., Modell Nummer 137B, extra fein, mit der ich das hier schreibe.
Als ich das Formular unterschrieb, beugte er sich näher zu mir und sagte mit einer gewissen Selbstzufriedenheit in der Stimme leise: »Ich habe ein Stück von der Keilschrift in meinem Rucksack, wenn du mal einen Blick darauf werfen möchtest.«
Da fiel mir, glaube ich, die Kinnlade herunter. »Du trägst ein keilschriftliches Artefakt in deinem Rucksack mit dir herum?!«
Er zuckte die Schultern. »Wenn es den Untergang von Ugarit überstanden hat …« In seinen Augen lag ein jungenhaftes Strahlen. Jetzt gab er an. »Willst du es sehen?«
Ich nickte stumm. Er machte seinen Rucksack auf und zog einen Tonklumpen etwa von der Größe und Form eines Big Macs heraus. Der hatte also gegen den Türpfosten von Blevins Büro geschlagen. In kleinen ordentlichen Zeilen eingeritzt war … Text in Keilschrift. Tristan ging mit dem Klumpen um wie mit einem Fußball. Ich starrte das Ding einen Moment lang an, verwirrt durch den Anblick eines Gegenstands, wie ich ihn bisher nur, mit Handschuhen ausgerüstet, im Arbeitsraum eines Museums angetroffen hatte, während der hier wie zufällig auf dem Tisch neben meinem kaffeeartigen Getränk lag. Ich traute mich kaum, ihn anzufassen; das erschien mir respektlos. Doch schon bald hatte ich diese Empfindsamkeit über Bord geworfen, und meine Finger streichelten ihn. Ich studierte die Schrift.
»Das ist nicht Ugaritisch«, sagte ich. »Das ist Hethitisch. Es gibt ein paar akkadisch anmutende Zeichen.«
Er sah erfreut aus. »Schön«, sagte er. »Kannst du das lesen?«
»Nicht aus dem Stand«, sagte ich geduldig. Manche Leute haben eine sehr verklärte Vorstellung davon, was es heißt, mehrsprachig zu sein. Um aber nicht inkompetent zu erscheinen, schob ich rasch hinterher: »Hier ist das Licht so schlecht, dass es schwierig ist, die Formen zu erkennen.«
»Das wird bald anders«, sagte er und steckte den Klumpen mit derselben beiläufigen Grobheit wieder in seinen Rucksack. Kaum war er außer Sicht, fragte ich mich, ob ich ihn wirklich gesehen hatte.
Tristan griff erneut in den Rucksack und holte jetzt etwas anderes heraus: einen Stoß Papiere. Er schob sie mir über den Tisch zu. »Du hast noch den Stift«, sagte er. »Willst du gleich hiermit anfangen?«
Ich warf einen Blick auf die Papiere. Es gab sieben Schriftblöcke, fast keiner im lateinischen Alphabet – sogar die altlateinische Passage war in etruskischer Schrift. Mit einem Blick erkannte ich auch biblisches Hebräisch und klassisches Griechisch. Da ich Hebräisch am besten konnte, schaute ich mir das näher an.
Und blinzelte mehrmals, um sicherzugehen, dass ich mir das, was ich da sah, nicht bloß einbildete. Zur Sicherheit nahm ich mir noch das Griechische und dann das Lateinische vor. Dann hob ich den Blick zu Tristan. »Ich weiß bereits, was hier alles steht.«
»Hast du den Test schon mal gemacht?«, fragte er überrascht.
»Nein«, erwiderte ich bissig. »Ich habe ihn erstellt.« Auf seinen verwirrten Blick hin erklärte ich: »Ich habe diese speziellen Proben ausgewählt und den Übersetzungsschlüssel geschrieben, mit dem die Arbeiten der Studenten abgeglichen werden müssen.« Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden. »Das habe ich als Projekt gemacht, als ich Blevins’ Doktorandin war.«
»Er hat uns den Test verkauft«, sagte Tristan bloß. »Für einen Haufen Geld.«
»Er war für ein Graduiertenseminar über syntaktische Muster gedacht«, sagte ich.
»Mel«, sagte er, »er hat ihn uns verkauft. Ein Graduiertenseminar über syntaktische Muster hat es nie gegeben. Wir – das heißt, Leute ganz oben in meiner obskuren Regierungseinrichtung – arbeiten schon lange mit ihm zusammen. Wir haben Verträge mit ihm.«
»Ich würde diese Geheimhaltungserklärung mit Freuden siebzehnfach unterschreiben«, sagte ich, »um die Tiefe meiner Gefühle gegenüber Roger Blevins in diesem Moment zum Ausdruck zu bringen.«
Julie Lee, die professionelle Klugscheißer-Oboistin, rauschte vorbei und räumte, ohne zu fragen, unsere Tassen ab, als Tristans Handy ein Geräusch machte und er einen Blick auf das Display warf.
Er tippte etwas in das Handy und steckte es dann wieder in die Tasche. »Ich habe ihnen gesagt, dass du mit Bravour bestanden hast«, erklärte er, »und sie haben mir gerade mitgeteilt, dass du die Hintergrundprüfung bestanden hast.«
»Natürlich habe ich die Hintergrundprüfung bestanden«, sagte ich. »Wofür hältst du mich?«
»Du bist eingestellt.«
»Danke«, sagte ich, »aber wer immer sie sind, teil ihnen bitte mit, dass ich die Urheberin des Tests bin, den ich soeben bestanden habe.«
Er schüttelte ablehnend den Kopf. »Dann geraten wir in ein IP-Anfrage-Verfahren an der Universität, und alles wird kompliziert und öffentlich, und das ist keine Option für obskure Regierungseinrichtungen. Tut mir leid. Falls dieses Projekt sich allerdings in Wohlgefallen auflöst, kannst du es getrost mit Blevins aufnehmen.« Wieder piepte sein Handy, und er las die eingegangene Nachricht. »Aber jetzt machen wir uns erst mal an die Arbeit.« Er steckte das Handy in die Tasche und reichte mir die Hand. »Du führst ein angenehm unspektakuläres Leben. Mal sehen, ob wir das ändern können.«
Diachronik
TAGE 34–56 [SEPTEMBER, JAHR 0]
An denen ich auf Magie aufmerksam gemacht werde
Tristan beschloss, sofort – noch am selben Abend – mit den Übersetzungen anzufangen, und so bestellte er chinesisches Essen zum Mitnehmen, fragte nach meiner Adresse und sagte, in einer Stunde würde er mit den ersten von mehreren Dokumenten auftauchen. Ich war, das müssen Sie wissen, schockiert darüber, dass er mit antiken Artefakten auf dem Rücksitz seines klapprigen Jeeps durch die Gegend fuhr.
Damals bewohnte ich allein eine Einzimmerwohnung in einem Haus ohne Fahrstuhl in North Cambridge (ohne deshalb als einsame Jungfer oder leichtes Mädchen zu gelten, wie es in meiner gegenwärtigen Umgebung der Fall wäre). Sie lag in Fußnähe zur U-Bahn-Station Porter Square und eine kurze Fahrt mit dem Rad die Massachussetts Avenue hinunter und über die Abkürzung durch den Harvard Yard bis zum Institut (wobei ich diese Fahrt ja nicht mehr machen würde). Tristan erschien pünktlich mit dem chinesischem Essen in Plastiktüten und einem Sechserpack Old Tearsheet Best Bitter, das, wie ich noch lernen sollte, das einzige Bier war, das er für trinkbar hielt. Zwanglos nahm er den Wohn-Ess-Kochbereich in Beschlag, indem er das Essen auf die Küchentheke legte, weit weg vom Couchtisch, auf dem er vier Dokumente und die Keilschrifttafel, einen Notizblock und mehrere Stifte ausbreitete. Er sah sich in dem Raum um, warf einen prüfenden Blick auf meine persönliche Präsenzbibliothek, zog vier Wörterbücher heraus und stellte sie auf den Tisch.
»Lass uns erst essen«, sagte er. »Ich bin am Verhungern.«
Zum ersten Mal machten wir Small Talk. Nicht lange, denn er aß zu schnell, was ich bei diesem ersten Mal allerdings nicht kommentierte. Tristan hatte in West Point Physik studiert, war jedoch letztlich zum militärischen Geheimdienst der Army abkommandiert worden, was – auf Umwegen, von denen er gebetsmühlenartig mit dem Begriff »Verschlusssache« ablenkte – zur Rekrutierung durch seine »obskure Regierungseinrichtung« geführt hatte.
Bei mir war nichts Verschlusssache, ich gab die Quelle meiner polyglotten Neigungen preis: Da meine agnostischen Eltern katholisch und jüdisch aufgewachsen waren, buhlten beide Großelternpaare von meiner frühesten Kindheit an um meinen Glauben. Mit sieben schlug ich meinen katholischen Großeltern vor, statt in die Sonntagsschule zu gehen, das Neue Testament auf Lateinisch lesen zu lernen. Da sie glaubten, dass ich das niemals schaffen würde, willigten sie ein – und innerhalb von sechs Monaten war ich in klassischem Latein konversationssicher. Dadurch ermutigt, umging ich kurz vor meinem dreizehnten Geburtstag in ähnlicher Manier meine Bat-Mizwa, indem ich es mit einem College-Niveau in klassischem Hebräisch probierte. Meine jüdischen Großeltern boten an, mir für jede alte Sprache, die ich auf College-Niveau beherrschte, jeweils ein Hochschulsemester zu bezahlen. So konnte ich meine ersten drei Studienjahre finanzieren.
Tristan war von dieser Geschichte ausgesprochen angetan – von sich selbst fast so sehr wie von mir, so als klopfte er sich anerkennend auf die Schulter, weil er ein so außergewöhnliches Talent ausgewählt hatte. Als wir fertig gegessen hatten, nahm er das ganze Einweggeschirr, spülte es ab und räumte es ordentlich wieder in seinen Rucksack. »Gut, fangen wir an!«, sagte er, und wir gingen zum Sofa hinüber, damit ich die Dokumente in Augenschein nehmen könnte.
Außer der Keilschrifttafel gab es etwas in Guãnhuà (Mandarin) auf Reispapier, ungefähr fünfhundert Jahre alt – zu Tristans Ehrenrettung sei gesagt, dass er wenigstens das wohlweislich nur mit Handschuhen anfasste. Auf Pergament geschrieben gab es außerdem einen Text in einer Mischung aus Altfranzösisch und Latein, mindestens achthundert Jahre alt, würde ich sagen. (Scheiße noch mal, Es war verrückt, diese Dinge wie zufällig auf meinem Couchtisch liegen zu sehen.) Schließlich war da noch ein Zeitungsfragment, diesmal in Russisch, auf einem Papier, das im Vergleich geradezu brandneu aussah und von 1847 datierte. Der Bibliothekarin in mir fiel auf, dass sie alle mit demselben Stempel versehen worden waren – einem unscharfen Familienwappen, umgeben von verschwommenen Wörtern in einer Mischung aus Latein und Italienisch. Sie waren, mit anderen Worten, von einer Bibliothek oder privaten Sammlung erworben und irgendwann ordnungsgemäß gestempelt und katalogisiert worden.
Wie zuvor schon angekündigt, verriet mir Tristan weder, woher er diese Artefakte hatte, noch, warum es eine so scheinbar willkürliche Sammlung war. Nach mehreren Stunden mit ihnen erkannte ich jedoch das gemeinsame Thema … obwohl das, was ich da las, schwer zu glauben war.
Kurz gesagt, jedes dieser Dokumente handelte so selbstverständlich, wie eine Gerichtsakte vom Recht oder ein Arztbericht von medizinischen Untersuchungen handelt, von Magie – jawohl, Magie. Keine Zaubertrick-Magie, sondern Magie, wie wir sie aus Mythen und Märchen kennen: eine unerklärliche, übernatürliche, von Hexen eingesetzte Kraft – laut diesen Dokumenten waren es nämlich alles Frauen. Ich meine nicht den Glauben an Magie oder ein bloßes Faible für magisches Denken. Ich meine, dass der Verfasser jedes einzelnen Dokuments eine Situation erörterte, in der Magie eine Tatsache des Lebens war.
Die Keilschrifttafel zum Beispiel enthielt eine Erklärung, die festschrieb, was einer Hexe am Königshof von Kahta als Lohn für ihre Dienste zustand, und die Anwendungen von Magie regelte, die Höflinge von ihr erbitten durften. In dem lateinisch-französischen Text, den die Äbtissin von Chaalis verfasst hatte, ging es um die inneren Nöte einer ihrer Nonnen, die vergeblich versuchte, ihren magischen Kräften zu widerstehen, und die Äbtissin fragte sich, ob nicht sie selbst die Schuld daran trug, denn bei ihren Gebeten um die Befreiung der Schwester von ihren Kräften war sie nicht mit ganzem Herzen dabei, weil diese Kräfte das Leben in der Abtei oft einfacher machten. Das Guãnhuà verlangte etwas mehr Arbeit – mit asiatischen Sprachgruppen hatte ich bis dahin nur flüchtig zu tun gehabt. Das Ganze war ein Rezept aus den Provinzen für eine Speise mit allerlei schwer zu findenden Gewürzkräutern, wie sie dem Verfasser (einem Magistrat auf der Rundreise durch seinen Gerichtsbezirk) von erklärten Hexen (auf deren Aktivitäten in einer Fußnote unter dem Rezept hingewiesen wurde) beschrieben worden waren. Das Russische aus dem 19. Jahrhundert schließlich war geschrieben von einer sich selbst als solche bezeichnenden (alternden) Hexe, die über die nachlassenden Kräfte bei ihren Schwestern und bei sich selbst klagte. Auch hier fand sich ein beiläufiger Hinweis darauf, wie dringend man bestimmte Kräuter finden wollte.
Dies waren Rohübersetzungen, beinahe aus dem Stegreif angefertigt. Als ich mit der vierten fertig war, herrschte einen Moment lang Schweigen zwischen uns. Dann bedachte Tristan mich mit einem entwaffnend schelmischen Grinsen und bemerkte:
»Wenn ich dir nun sagen würde, dass wir über tausend solche Dokumente haben. Sämtliche Epochen, von sechs Kontinenten.«
»Und alle mit diesem Familienwappen versehen?«, fragte ich und deutete auf den verschwommenen Stempel.
»Das ist der Grundstock. Andere haben wir selbst gesammelt.«
»Nun, das würde gewisse Annahmen über das Wesen der Realität infrage stellen, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie hatte.«
»Wir möchten, dass du sie alle übersetzt und die gemeinsamen Kerndaten herauskristallisierst«, sagte Tristan.
Ich blickte ihn an. »Zu militärischen Zwecken, vermute ich.«
»Verschlusssache«, sagte er.
»Wenn ich beim Übersetzen einen Kontext habe, kann ich bessere Arbeit leisten«, hielt ich dagegen.
»Meine obskure Regierungseinrichtung hat über viele Jahre Dokumente dieser Art gesammelt.«
»Mit welchen Mitteln?«, platzte ich heraus, ebenso fasziniert wie bestürzt angesichts der Erkenntnis, dass eine kapitalkräftige Organisation für verdeckte Operationen auf solche Weise mit wissenschaftlicher Forschung konkurrierte. Das erklärte natürlich so manches.
»Das Kernstück der Sammlung kommt, wie du gemerkt hast, aus einer Privatbibliothek in Italien.«
»Von dem ZIF.«
»Wie bitte?«
»Dem Zwielichtigen Italienischen Finsterling«, sagte ich.
»Genau. Wir haben es vor einiger Zeit erstanden.« Sein Gesicht zuckte, und er brach den Augenkontakt ab. »Stimmt nicht. Ich war nur höflich. Wir haben es gestohlen. Ehe andere Leute es stehlen konnten. Lange Geschichte. Jedenfalls hat es uns jede Menge Hinweise geliefert, denen wir folgen konnten, um Weiteres in der Art zu beschaffen. Mit allen Mitteln, ehrlichen und unehrlichen. Jetzt glauben wir eine kritische Masse zu haben, die uns nach der Übersetzung einen Eindruck davon vermitteln kann, was genau ›Magie‹ war, wie sie funktionierte und warum sie ab Mitte des 19. Jahrhunderts nirgendwo mehr erwähnt wird.«
»Und diese Information braucht ihr für irgendeinen militärischen Zweck«, hakte ich nach.
»Wir möchten, dass sämtliche Übersetzungen von einer Person angefertigt werden«, sagte Tristan, der meine Frage geflissentlich überging. »Aus drei Gründen. Erstens, Budget. Zweitens, je weniger Augen, desto sicherer. Drittens und am wichtigsten: Wenn ein und dieselbe Person das ganze Material bearbeitet, besteht eine größere Chance, subtile Übereinstimmungen oder Muster zu erkennen.«
»Und warum genau seid ihr an diesen Übereinstimmungen oder Mustern interessiert?«
»Der gängigen Hypothese zufolge«, fuhr Tristan wie zuvor, also ohne mir wirklich zu antworten, fort, »gab es vielleicht ein weltweit grassierendes Virus, das nur Hexen befiel, worauf die Magie buchstäblich ausgerottet wurde. Ich persönlich glaube nicht an diese Version, muss aber erst mehr wissen, bevor ich eine andere Hypothese aufstellen kann. Ich habe aber so meine Vermutungen.«
»Und die sind alle Verschlusssache, stimmt’s?«
»Ob sie das sind oder nicht, ist Verschlusssache.«
Die Dokumente waren zahlreich, aber kurz; die meisten fragmentarisch. Innerhalb von drei Wochen hatte ich, allein an meinem Couchtisch arbeitend, zumindest Rohübersetzungen vom ersten Schwung des Materials angefertigt. Während dieser Zeit kündigte ich auch, bat meine Studentinnen und Studenten um Entschuldigung dafür, dass ich sie schon wieder verließ, ehe sie mich überhaupt kennengelernt hatten, zog aus meinem Büro in Harvard aus und schaffte es, meine Eltern zu beruhigen, dass ich nach wie vor arbeitete, ohne ihnen allerdings genau zu erläutern, was ich da machte. Währenddessen nahm Tristan mindestens zweimal täglich Kontakt mit mir auf, normalerweise, indem er persönlich erschien, gelegentlich auch, indem er anrief und in äußerst vagen Begriffen mit mir sprach. Niemals verkehrten wir per Mail oder SMS; er wollte nicht, dass etwas zwischen uns Gesagtes aufgezeichnet würde. Dieser Zwang zur Geheimhaltung hatte etwas ebenso Verwegenes wie Verstörendes. Ich hatte keine Ahnung, was er mit dem Rest seiner Zeit anstellte. (Natürlich fragte ich ihn. Wie seine Antwort lautete, kann man sich denken.)
Die Dynamik zwischen uns war außergewöhnlich, in meinem Leben sicher beispiellos. Es war, als hätten wir schon immer zusammengearbeitet, und doch gab es da unterschwellig noch etwas anderes, eine gewisse Emotionsgeladenheit, die sich nur am Anfang von etwas einstellt. Keiner von uns reagierte darauf, und während ich zu den Menschen gehöre, die das selten tun, ist er (wenngleich ausgesprochen diszipliniert und anständig) einer, der sofort auf so etwas reagiert. Also schrieb ich das Knistern zwischen uns dem Reiz einer gemeinsamen Anstrengung zu. Die intellektuelle Intimität dabei war wesentlich befriedigender als alle Beziehungen, die ich je gehabt hatte. Falls Tristan eine Freundin hatte, bekam nicht sie die guten Sachen. Die bekam ich.
Als er nach drei Wochen zu mir kam, um die letzten (wie ich arglos dachte) meiner Übersetzungen entgegenzunehmen, sah er sich in der Wohnung um, bis sein Blick an der Garderobe hängenblieb. Er musterte sie einen Augenblick, dann nahm er meinen Regenmantel vom Haken. Damals war es Ende September, und das Wetter begann umzuschlagen.
»Komm, wir unterhalten uns im Büro«, sagte er. »Ich kaufe dir was zu essen.«
»Es gibt ein Büro?«, fragte ich. »Ich dachte, deine obskure Regierungseinrichtung ließe dich aus deinem Auto heraus arbeiten.«
»Es liegt in der Nähe von Central Square. Carlton Street, vom Apostolic Café aus ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß. Wie klingt Chinesisch?«
»Hängt vom Dialekt ab.«
»Ha«, machte er, ohne zu lächeln. »Linguistenhumor. Ziemlich dürftig, Stokes.« Er hielt mir den Mantel hin. Ich griff danach. Er schüttelte den Kopf und blickte auf ihn hinunter. Womit er mir zu verstehen gab, dass er ihn mir nicht geben, sondern mir hineinhelfen wollte, eine Geste, die 1851 in London sehr viel verbreiteter war als zu jener Zeit an jenem Ort. Darauf folgte ein nicht besonders gelungener Slapstick, bei dem ich ihm den Rücken zukehrte und versuchte, mit den Händen die Armlöcher zu finden. Was für ein komischer Vogel.
Carlton Street war das arme Stiefkind in einer Großfamilie aus Gassen und Seitenwegen in der Nähe des MIT, wo eine Menge Biotechfirmen den Kinderschuhen entwuchsen. Ein Großteil des Viertels hatte sich das neue Image schicker Bürokomplexe mit reichlich Parklandschaften, Mini-Campussen, baulichen Schnörkeln im Doppelhelix-Stil und abstrakten Stahlskulpturen gegeben. Tristans Gebäude war jedoch noch keiner Umgestaltung unterzogen worden. Es besaß absolut keinen eigenen Charakter: ein Mitte des 20. Jahrhunderts auf der Länge eines Häuserblocks errichtetes zweistöckiges Gebäude, zusammengeschustert aus hochkant stehenden Betonplatten von einem schmuddeligen Grau, das es irgendwie noch schaffte, sich mit dem Gehweg zu beißen. Es gab ein paar Graffiti-Tags. Die schmucklosen Fenster waren sämtlich mit Vinyl-Lamellenvorhängen versehen, alle staubig und schief. Es gab keine Namensschilder der Mieter, keine Firmenschilder oder Logos, keinerlei Hinweis auf das, was sich darin befand.
Beladen mit Tüten voll chinesischem Essen und Bier, näherten wir uns in der Dämmerung dem gläsernen Eingang. Dieses Gebäude gehörte zu den wenigen Orten auf der Welt, die auch bei Dämmerlicht nicht besser aussahen. Tristan klatschte seine Brieftasche an eine in die Mauer eingelassene schwarze Platte, worauf das Türschloss mit einem Klicken aufging. Drinnen bewegten wir uns zwischen brummenden Leuchtstoffröhren und verfilztem Industrieteppich durch einen Flur mit mehreren fensterlosen Türen – Holzplatten, deren Griffe schmutzig umrandet waren und auf denen Schilder mit Namen von, wie ich vermutete, Hightech-Start-ups prangten. Manche davon hatten richtige Logos, manche in Blockschrift gedruckte kitschige Namen, und eins war bloß eine Internetadresse, die jemand auf eine Haftnotiz gekritzelt hatte. Wir gingen einmal längs durch das Gebäude und kamen an eine Tür neben einem Treppenhaus. Deren einziges Merkmal war die grobe Filzstiftzeichnung eines Vogels im Profil, angefertigt auf der Rückseite der Speisekarte eines China-Restaurants und mit blauem Klebeband am Holz befestigt. Der Vogel war irgendwie drollig, mit einem auffälligen Schnabel und großen Füßen.
»Dodo?«, riet ich.
Tristan antwortete nicht. Er schloss gerade die Tür auf.
»Das werte ich als ein Ja – du hättest mich doch zur Schnecke gemacht, wenn ich die falsche Spezies geraten hätte.«
Über die Schulter warf er mir einen undurchdringlichen Blick unter hochgezogenen Augenbrauen zu, während er die Tür aufschob und nach dem Lichtschalter tastete. »Du hast eine karikaturistische Begabung«, sagte ich und trat hinter ihm ein.
»DODO heißt dich willkommen«, sagte er.
»Department für … irgendwas?«
»Was als Verschlusssache eingestuft ist.«
Der Raum war höchstens drei mal viereinhalb Meter groß. Zwei Schreibtische waren in entgegengesetzte Ecken geschoben worden, jeder mit einem Flachbildschirm und einer Tastatur. Die Wände entlang stand eine Auswahl an gebrauchten IKEA-Bücherregalen, von denen ich annahm, dass er sie ein paar Wochen zuvor aus Müllcontainern gezogen hatte, und zwei hohe schmale Tresore, wie man sie zur Aufbewahrung von Gewehren und Jagdflinten benutzt. Obendrauf thronten militärisch anmutende Souvenirs, die wahrscheinlich aus einer früheren Phase von Tristans Karriere stammten. Die Regale waren mit alten Büchern und Artefakten gefüllt, die ich sehr gut kannte. Mitten im Raum stand ein langer Tisch. Darunter lag zusammengerolltes Bettzeug: nur eine Yogamatte, die um ein Kissen gewickelt und mit einem Spanngurt zusammengehalten war.
Ich zeigte auf das Bettzeug. »Wie lange hast du schon …«
»Ich dusche im Fitnessstudio, falls das deine Sorge ist.« Er zeigte auf den näher stehenden Schreibtisch neben der Tür. »Den da bekommst du.«
»Oh«, sagte ich, unsicher, was ich sonst sagen sollte. »Hast du … Schusswaffen hier drin?«
»Wäre das ein Problem für dich?«, erkundigte er sich, während er das chinesische Essen auf den Tisch in der Mitte stellte. »Falls ja, sollte ich es besser gleich erfahren, denn …«
»Was meinst du denn, wie viel Feuerkraft ihr braucht?«
»Ach so, dir sind die Waffentresore aufgefallen?«, fragte er, meinem Blick folgend. »Nein.« Er drehte sich zu einem davon um und tippte eine Reihe von Ziffern in die kleine Tastatur an der Vorderseite. Auf ein Piepen hin schwenkte er die Tür auf, um zu demonstrieren, dass der Tresor von oben bis unten mit Dokumenten vollgestopft war. »Das heikelste Material bewahre ich da drin auf.«
Mein Blick war zu meinem Schreibtisch gewandert. Ich betrachtete den Flachbildschirm, der ein paar grüne Textzeilen auf schwarzem Hintergrund zeigte und dessen Cursor an einer Stelle blinkte, an der ich offensichtlich irgendetwas eintippen sollte. »Woher hast du diese Rechner? Von einem privaten Flohmarkt 1975?«
»Auf denen läuft ein sicheres Betriebssystem, von dem du noch nie gehört hast«, erklärte er. »Es heißt Shiny Hat.«
»Shiny Hat.«
»Ja. Das klinisch paranoideste Betriebssystem der Welt. Dir, Stokes, mit deinem überentwickelten Sinn für Ironie wird vielleicht gefallen, dass wir es von Hackern erworben haben, die besonders in Sorge waren, von obskuren Regierungseinrichtungen ausspioniert zu werden. Jetzt arbeiten sie für uns.«
»Ob die wohl die Aktennotiz über die Erfindung der Computermaus bekommen haben? An meinem Arbeitsplatz sehe ich nämlich keine.«
»Grafische Benutzeroberflächen bergen Sicherheitslücken, die von Black-Hat-Hackern ausgenutzt werden können. Shiny Hat ist vor dieser Art von Schadsoftware sicher, aber die Benutzeroberfläche ist … spartanisch. Ich werde sie dir erklären.«
Sein Schreibtisch war übersät mit Kopien von allem, was ich in den vergangenen Wochen für ihn übersetzt hatte. Meine Aufzeichnungen waren mit seinen eigenen, mit Stiften in unterschiedlichen Farben geschriebenen Anmerkungen versehen. Einige davon brachte er mit zu dem Tisch in der Mitte, den ich zum Essen deckte. Während wir aßen, las er sich meine Arbeit für diesen Tag durch.
Dann gingen wir das gesamte bis dahin übersetzte Material noch einmal durch. Das dauerte bis zum Sonnenaufgang.
In all den Dokumenten, die ich enträtselt hatte, gab es so gut wie keine nützliche Information über das »Wie« der Magie, also das, was sich Tristans Bosse meiner Vermutung nach erhofft hatten. Ein paar Beispiele für Magie entdeckten wir insofern, als wir erfuhren, was sowohl von den Hexen selbst als auch von denen, die sie beauftragten, geschätzt wurde. Von höchstem Wert war das, was Tristan Psy-Ops (psychologische Operationen – im Wesentlichen Bewusstseinskontrolle) und Formveränderung (bei sich selbst oder anderen) nannte. Letztere galt als Waffe von erheblicher Bedeutung, ob es nun hieß, sich selbst in einen Löwen zu verwandeln oder einen Feind in eine niedrigere Lebensform. Als Hommage an Monty Python nannten wir sie Schwanzlurch. Von mittlerem Wert war die Transsubstantiation von Stoffen und die Belebung unbelebter Objekte. Von geringem Wert war die Raum-/Zeitverschiebung wie etwa die Teleportation, die quer durch die Hexenpopulationen als mühseliger Zeitvertreib gesehen wurde. Vieles von dem, was ich in meiner lesewütigen Jugend mit »Magie« verbunden hatte, war enttäuschenderweise nicht vorhanden – so gab es zum Beispiel nur wenige Hinweise auf die Beherrschung von Naturgewalten. Und absolut nichts darüber, wie all diese Dinge funktionierten.
Allerdings brachten wir etwas Bedeutendes über den Niedergang der Magie in Erfahrung, und das war es, was uns zur nächsten Stufe unserer Nachforschungen führte.
Diachronik
TAGE 57–221 [WINTER, JAHR 0]
An denen Tristan beschließt, die Magie wiederherzustellen
Im Morgengrauen brachte Tristan mich nach Hause, damit ich meine Bibliothek holen konnte, die seit dem Auszug aus meinem Büro im Institut einen beträchtlichen Teil meines Wohnzimmers eingenommen hatte. Er traktierte mich mit Kaffee und Croissants, bis ich mich imstande fühlte, einen neuen Tag zu beginnen, ohne den vorherigen abgeschlossen zu haben. Wieder in seinem Büro lächelte er mich breit an und verriet mir die Ziffernkombination zu einem der Waffentresore. Dieser war voll mit Manuskripten, Dokumenten und Artefakten, die ich noch nicht gesehen hatte. »Bei dem Tempo, mit dem du arbeitest, wirst du für diese Kiste vermutlich etwa einen Monat brauchen.«
»Ich hatte keine Ahnung, dass noch so viel zu tun ist«, sagte ich.
Er zog Dokumente aus dem Tresor, die er dann auf dem Tisch ausbreitete. »Warum sollte ich dich mit einem Sechsmonatsvertrag einstellen, wenn ich nur Arbeit für einen hätte? Da, wo das hier herkommt, gibt es noch viel mehr davon. Aber jetzt, wo wir das Gesamtbild umrissen haben, sollte es eigentlich leichter sein. Du weißt jetzt, wonach du suchst.«
»Ich weiß immer noch nicht, warum ich danach suche«, sagte ich.
»Du weißt, dass das Verschlusssache ist«, sagte er beinahe väterlich. »Setz dich doch. Möchtest du noch Kaffee? Ich arbeite zwar hier mit einem Minimalbudget, aber ich kann schnell zu Dunkin’ Donuts springen.«
»DODO«, sagte ich. »Department für …Optimale DOnuts?«
»Möchtest du Zuckerstreusel?«, fragte er.
Während er Donuts holte, packte ich meine Wörterbücher und Lexika aus und machte mich an die Arbeit.
Falls man meinen Übersetzungen trauen durfte, war die Magie zu Beginn der wissenschaftlichen Revolution (Kopernikus in den 1540ern etc.) eine allgegenwärtige und wirksame Kraft in menschlichen Angelegenheiten, und Hexen waren ebenso verehrte wie gefürchtete Mitglieder der meisten Gesellschaften, nicht anders als militärische Führer oder Priester und Mystiker (obwohl über sie seltener geschrieben wurde, da ihre Arbeit so oft die Entsprechung von »Verschlusssache« war). Als jedoch auf die Renaissance die Aufklärung folgte, verlor die Magie an Omnipräsenz und Wirkungskraft, vor allem in Bildungs- und Regierungseinrichtungen. Den Hunderten von Hinweisen in den Texten nach zu urteilen verblasste sie während der industriellen Revolution in zunehmendem Maße – ihr Einfluss war nach wie vor in Künstlerkreisen am größten und unter Philosophen am geringsten (zwei Gruppen innerhalb der Bevölkerung, die sich nach vielen Generationen der Verflechtung auseinander entwickelten), größer in Gesellschaften, die nicht mit einer boomenden Industrialisierung gesegnet waren, und etwas größer auch in islamischen Kulturen – und im 19. Jahrhundert verschwand sie dann vollkommen. Der letzte Text datierte vom 15. Juli 1851. Aus der Zeit danach hatte DODO keinerlei Hinweise auf Magie mehr finden können außer als etwas, »was es einmal gab, jetzt aber nicht mehr gibt«.
Ich übersetzte die Kiste mit fotokopierten Dokumenten in kürzerer Zeit, als Tristan angenommen hatte, doch eine Unterbrechung war nicht drin. Ich fing an, in toten Sprachen zu träumen, denn fast jeden Morgen wurden von unbekannten Kurieren in Zivilfahrzeugen alte Bücher, Schriftrollen und Tafeln in dem trostlosen Gebäude angeliefert. Department für Obendrauf Dreckige Objekte? Es gab eine Menge Dokumente in Englisch oder modernen westlichen Sprachen – zumeist Transkripte von Interviews, die frühe Anthropologen mit den Ältesten indigener Völker geführt hatten. Ich übersetzte diejenigen, die Tristan nicht selbst lesen konnte, und er baute eine Datenbank auf. Werte Leserin, werter Leser, wenn Sie nicht wissen, was eine Datenbank ist, seien Sie versichert, dass eine Erläuterung dieses Begriffs in keiner Weise Ihr Vergnügen an der Lektüre dieses Berichts steigern würde. Falls Sie es aber wissen, werden Sie mir dankbar sein, dass ich Ihnen die Details erspare. Schon mit modernen Benutzeroberflächen eine ziemlich öde Tätigkeit, war die Implementierung mit Shiny Hat der reinste Todesmarsch. Tristan musste kleine Computerprogramme schreiben, um einen Teil der Dateneingabe zu automatisieren.
Eins der Dinge, auf die wir achteten, war die Herkunft jedes Dokuments: Kam es aus der Library of Congress? Hatte jemand es einfach aus dem Internet heruntergeladen? Oder war es ein seltenes, vielleicht sogar einzigartiges Original? Trug es irgendwelche Stempel oder Kennzeichnungen von Bibliothekssammlungen? So hatte eine unverhältnismäßig große Zahl diesen rätselhaften Stempel auf der Titelseite, ein Bild, das ich inzwischen gut kannte: das Wappen irgendeiner Adelsfamilie mit ein paar Extraverzierungen rundherum. Da mir jede Information darüber fehlte, gab ich sie einfach unter dem Codenamen ZIF in die Datenbank ein. Etliche der ZIF-Dokumente trugen ältere Stempel von keiner geringeren als der Vatikanischen Bibliothek, was die Frage aufwarf, ob der ZIF sie gestohlen hatte. Oder ausgeliehen und nie zurückgebracht. Tristan sprach nicht darüber.
Fast so schnell, wie sie übersetzt werden konnten, tauchten neue Bücher auf. Wir leerten eine frisch eingetroffene Kiste und füllten sie umgehend mit Büchern, die bereits übersetzt waren, worauf die farblosen Kuriere sie fortschleppten. Wohin? Viele der Kisten wiesen ein mit Schablone gezeichnetes Logo auf, das ich damals nicht erkannte, von dem ich aber jetzt weiß, dass es eine modernisierte, vereinfachte Version der Handelsmarke war, die seit Urzeiten von der Bankiersfamilie namens Fugger benutzt worden war.
Diese Phase zehrte den größten Teil meiner sechsmonatigen Vertragslaufzeit auf, derweil ein grimmiger neuenglischer Winter einem schlammigen Frühling wich. Andere Mieter in dem Gebäude – zumeist schmuddelige Start-up-Firmen – gingen ein oder bekamen eine Finanzspritze und zogen aus. Dann tätigte Tristan jedes Mal ein paar Anrufe und hielt am Ende den Schlüssel zu den Räumen in der Hand, die sie gerade freigemacht hatten. Auf diese Weise erweiterte sich DODOs Bürofläche innerhalb des Gebäudes. Von den ehemaligen Nachbarn erbten wir billige Plastikstühle, ramponierte Kaffeemaschinen und zerbeulte Aktenschränke. Adrette Techniker kamen in Privat-PKWs und montierten an alle Türen Kartenlesegeräte, womit sie das erweiterten und abriegelten, was Tristan »die Grenze« nannte. Die Datenbank wuchs an wie eine Wollmaus unterm Bett. Tristan dachte über Möglichkeiten nach, Daten abzufragen, nach Mustern zu suchen. Wir druckten Dinge aus, pinnten sie an die Wände, rissen sie wieder herunter und fingen von vorne an, spannten farbiges Garn zwischen Reißzwecken. Wir begaben uns in Sackgassen, kamen wieder heraus; wir bauten riesige Jenga-Türme aus Spekulationen, die wir dann beinahe händereibend umstießen.
Worum es ging, war jedoch immer klar: um einen irgendwie gearteten Kausalzusammenhang zwischen der Zunahme wissenschaftlicher Erkenntnis und dem Niedergang der Magie. Eine problemlose Koexistenz der beiden war nicht möglich. Soweit die Datenbank dazu gebracht werden konnte, konkrete Zahlen auszuspucken, zeigte sich deutlich, dass die Magie ab Mitte des 17. Jahrhunderts langsam, aber sicher abgenommen hatte. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts konnte sie sich noch behaupten, in den 1830ern ging es dann jedoch deutlich bergab. Und im Laufe der Vierzigerjahre ließ die Magie dann ganz abrupt nach. Während unser Bestand an Dokumenten – viele von Hexen selbst verfasst – größer wurde und eine Phalanx gebrauchter Aktenschränke und Waffentresore füllte, die Tristan auf Craigslist billig erstanden hatte, waren wir immer besser in der Lage, den Rückgang von Jahr zu Jahr, dann von Monat zu Monat zu verfolgen. Diese armen Frauen äußerten sich erschrocken über das Nachlassen ihrer magischen Kräfte, manche erwähnten bestimmte Zaubersprüche, die wenige Wochen zuvor noch funktioniert hatten, jetzt aber wirkungslos waren.
Wie sich herausstellte, wurden 1851 – in dem Jahr, in dem ich mich befinde, während ich diese Worte hinkritzele – alle damaligen technischen Errungenschaften der Welt auf der internationalen Industrieausstellung in dem neu erbauten prachtvollen Crystal Palace im Londoner Hyde Park zusammengebracht. Tristans Hypothese besagte deshalb, dass dieses Zusammentreffen, diese bewusste Konzentration des gesamten technischen Fortschritts an einem einzigen Punkt in der Raum-Zeit, die Magie so weit geschwächt hatte, dass sie endgültig verpuffte. Wie ein ersticktes Feuer hatte sie, einmal ausgelöscht, nicht die Kraft, sich selbst wieder zu entzünden.
Die kausale Beziehung zwischen beidem entzog sich uns zunächst. Ich merkte an, dass die Magie zum Gedeihen Menschen brauchte, die an sie glaubten, doch diese Vorstellung tat Tristan als eher der Kinderliteratur denn der Realität zugehörig ab. Er war sich sicher, dass es eine mechanische oder physikalische Kausalität gab, dass etwas im Zusammenhang mit dem technischen Weltbild oder der Technik selbst irgendwie die »Frequenzen blockierte«, die die Magie benutzte. Wir begannen beide alles über die Londoner Industrieausstellung zu lesen, was wir bekommen konnten, in der Hoffnung, dass es eine Erleuchtung bringen würde.
(Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass ich weit über meine Aufgaben als Übersetzerin hinausging. Das Übersetzen, insbesondere von schwer verständlichen, in ausgestorbenen Sprachen verfassten Texten, ähnelt oft dem Lösen eines Rätsels. Hier hatten wir ein Rätsel, das alle anderen in den Schatten stellte! Tristans Begeisterung war ansteckend, und ich konnte mich ihr nicht entziehen. Da ich keine anderen Verpflichtungen hatte, ließ ich mich genauso von seinem Projekt einnehmen wie er selbst.)
Nach Tristans Vorschlägen holte ich stapelweise Bücher aus der Widener Library (Harvard hatte noch nichts von meiner Kündigung mitbekommen – vermutlich wollte Blevins diese Tatsache vertuschen, um nicht selbst schlecht dazustehen). Darunter waren Werke über alles Mögliche von der Heliografie über Königin Victorias Privatleben, Baruch Spinozas sexuelle Neigungen, Frederick Bakewell und den Sturmvorhersager bis hin zu Strouhal-Zahlen. Ich brachte sie Tristan, und wir teilten unsere Zeit zwischen deren sorgfältiger Lektüre und Recherchen im Internet.
Bald wussten wir mehr über die Internationale Industrieausstellung und ihre ungefähr dreizehntausend Ausstellungsstücke, als Prinz Albert je gewusst hatte. Über ihren Schaukasten, den Crystal Palace, wussten wir sogarmehr als Joseph Paxton, der Gärtner, der das verfluchte verflixte Ding entworfen hatte. Es war wenig Hilfreiches darunter. An einem Märzabend jedoch, als ich auf der Couch aus einem Kommissionsladen saß, die ich unbedingt hatte kaufen wollen, um den Raum aufzupeppen, und Tristan auf dem Teppich (selbe Provenienz) neben einem niedrigen Tisch mit einem Bier drauf herumlümmelte, wir beide triefäugig vom vielen Lesen, stieß ich auf eine Passage in einem obskuren Büchlein mit dem Titel Atemberaubende und anregende astronomische Anekdoten, erschienen 1897. Hier erfuhr ich, dass sich während der Dauer der Internationalen Industrieausstellung von 1851 (sie ging über mehrere Monate) anderswo in Europa, um genau zu sein, im preußischen Königsberg, eine relativ interessante Begebenheit zutrug: Zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine Sonnenfinsternis erfolgreich fotografiert.
Diese Schilderung las ich laut vor. Und versetzte Tristan damit in einen Zustand höchster Erregung. Er hatte bereits vermutet, dass von allen technischen Entwicklungen speziell die Fotografie am ehesten die Magie behindert haben könnte. Irgendwie war er sich dessen jetzt sicher. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich ihn so weit beruhigt hatte, dass er sich klar ausdrücken konnte.
»Ich will ehrlich zu dir sein: Als Physiker bin ich eine Niete«, gab er zu. »Ich habe es zwar als Hauptfach studiert, war in diesem Bereich aber nie beruflich tätig. Wenn du mir allerdings einen Schnitt verpasst, wird aus mir immer noch Physikerblut fließen. Bis ins Grab werde ich davon überzeugt sein, dass es, falls Magie einmal existierte, eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt.«
»Das klingt für mich widersprüchlich«, sagte ich. »Unsere ganze Arbeitshypothese besagt doch, dass die Wissenschaft sie irgendwie zerstört hat.«
Er hob eine Hand. »Nicht so schnell. Hast du schon mal von der Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik gehört?«
»Nur beim Smalltalk auf Cocktailpartys, bei dem du die Augen verdrehen und tief aufseufzen würdest.«
»Nun, es gibt bestimmte Experimente, deren Ergebnisse nur dann Hand und Fuß haben, wenn das beobachtete System bis zu dem Moment, wo der Forscher seine Beobachtung macht, tatsächlich in mehr als nur einemZustand existiert.«
»Ist das Schrödingers Katze? Davon habe nämlich sogar ich gehört.«
»Das ist das klassische Beispiel. Übrigens ist es nur ein Gedankenexperiment. Niemand hat es je wirklich durchgeführt.«
»Das ist gut so. PETA würde über so jemanden herfallen.«
»Weißt du, wie es geht?« Ohne meine Antwort abzuwarten, fuhr Tristan fort: »Du steckst eine Katze in eine verschlossene Kiste. Darin befindet sich eine Vorrichtung, die imstande ist, die Katze zu töten, indem sie ein Glasröhrchen mit Giftgas oder Ähnlichem zerbricht. Ausgelöst wird diese Vorrichtung durch einen Zufallsgenerator wie etwa eine kleine Menge radioaktiver Substanz, die entweder zerfällt – und damit eine geringe Strahlung verursacht – oder nicht. Du machst den Deckel zu. Die Katze und das Gift und die radioaktive Substanz werden zu einem geschlossenen System – du kannst nicht vorhersagen oder wissen, was passiert ist.«
»Ich weiß also nicht, ob die Katze lebendig oder tot ist«, sagte ich.
»Nicht nur, dass du es nicht weißt. Du kannst es nicht wissen. Es gibt buchstäblich keine Möglichkeit dazu«, sagte Tristan. »Aus Sicht der klassischen Physik ist es entweder das eine oder das andere. Die Katze ist entweder wirklich lebendig oder wirklich tot. Nur weißt du zufällig nicht, was von beidem. Aus Sicht der Quantenphysik dagegen ist die Katze wirklich lebendig und tot zugleich. Sie existiert gleichzeitig in zwei miteinander unvereinbaren Zuständen. Erst wenn du den Deckel hochhebst und reinschaust, tritt der Kollaps der Wellenfunktion ein.«
»Langsam, langsam, bis kurz vor Schluss war ich ja noch bei dir!«, protestierte ich. »Wann haben wir denn angefangen, über – wie hast du das genannt? – eine ›Wellenfunktion‹ zu sprechen? Und wie kommt diese – was immer es ist – zum Kollaps?«
»Mein Fehler«, sagte er. »Das ist einfach Physikerjargon für das, was ich beschrieben habe. Wenn du das Gedankenexperiment ›Schrödingers Katze‹ mathematisch ausdrücken müsstest, würdest du eine Gleichung hinschreiben, die man Wellenfunktion nennt. Diese Funktion hat mehrere übereinandergelegte Terme – ist also nicht nur ein Ding.«
»Mehrere Terme«, wiederholte ich ausdruckslos.
»Genau. Ein Term bedeutet hier einen mathematischen Bestandteil – er ist für eine Gleichung das, was ein Satzglied für den Satz ist.«
»Du willst also damit sagen, dass es einen Term für ›Katze ist lebendig‹ und einen anderen für ›Katze ist tot‹ gibt? Ist es das, was du mit diesem Sprachgebrauch meinst?«
»Ja, o Linguistin!«
»Und wenn du sagst, dass sie übereinandergelegt sind …«
»Mathematisch bedeutet das nur, dass sie gewissermaßen addiert werden, damit man ein kombiniertes Bild des Systems erhält.«
»Bis es ›kollabiert‹ oder was auch immer.«
Er nickte. »Mehrere übereinandergelegte Terme ist ein Quantending. Es ist die Essenz der Quantenmechanik. Nun haben wir da aber die interessante Tatsache, dass diese Art von Mathematik nur so lange funktioniert – also eine genaue Beschreibung des Systems liefert –, bis du den Deckel anhebst und reinschaust. An diesem Punkt siehst du eine lebendige Katze oder eine tote Katze. Punkt. Es ist zu einem klassischen System geworden.«
»Department für … Offensichtlich Desaströse Observationen?«, fragte ich.
Er verdrehte die Augen.
»Jedenfalls ist es das, was du mit dem Kollaps der Wellenfunktion meinst.«
»Ja, das ist einfach Physikersprech für das, was passiert, wenn alle einander überlagerten Terme – die Beschreibungen verschiedener möglicher Realitäten – sich auf ein einziges klassisches Ergebnis reduzieren, das unser Gehirn verstehen kann.«
»Du meinst, unser wissenschaftliches, rationales Gehirn«, verbesserte ich ihn.
Ein Ausdruck leichter Befriedigung überzog sein Gesicht. »Genau.«
»Aber damit kommen wir doch zu meiner Theorie zurück!«, beschwerte ich mich.
Er wirkte leicht verwirrt. »Und die wäre?«
»Diejenige, die eher zur Kinderliteratur als zur Realität gehört – erinnerst du dich?«
»Ach ja. Die Menschen müssen an die Magie glauben.«
»Ja!«
»Das ist nicht ganz das, was ich meine«, sagte er. »Ja, menschliches Bewusstsein ist auch mit dabei. Aber lass mich ausreden. Wenn du die Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik akzeptierst, bedeutet das, dass alle möglichen Ergebnisse tatsächlich irgendwo eintreten.«
»Es gibt eine Welt mit einer lebendigen Katze und eine andere mit einer toten Katze.«
»So ist es. Ganz im Ernst. Vollständige, komplett eigenständige Realitäten, die gleich sind, außer dass in der einen die Katze tot ist und in der anderen lebendig. Und die Quantenüberlagerung? Die bedeutet einfach, dass der Wissenschaftler, der die Hand am Deckel der Kiste hat, eine Weggabelung ist. Beide Wege – beide Welten – stehen ihm offen. Er könnte in die eine oder in die andere einbiegen. Und wenn er den Deckel aufklappt, fällt die Entscheidung. Jetzt ist er in der einen oder der anderen Welt, und ein Zurück gibt es nicht.«
»Okay«, sagte ich. Nicht im Sinne von Das sehe ich wie du, sondern von Ich höre dir zu.
»Der Wissenschaftler hat keine Kontrolle darüber, welchen Weg er nimmt«, fuhr Tristan fort.