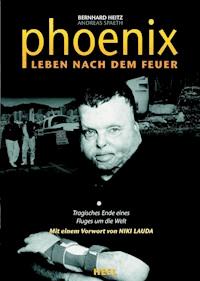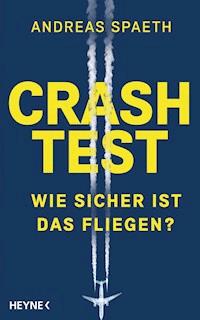
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
8. März 2014: das Verschwinden von Flug MH 370. 24. März 2015: Absturz von Germanwings 9525. Warum sterben immer wieder Hunderte Menschen bei einem Flugzeugabsturz? Andreas Spaeth, Deutschlands gefragtester Luftfahrtjournalist, geht den Ursachen der spektakulärsten Abstürze der letzten Jahre auf den Grund und kommt zu einer beunruhigenden Diagnose. Ob ungenügend ausgebildete Piloten oder überforderte Fluglotsen, ob versagende Kollisionswarngeräte oder ein plötzlicher Druckabfall: Trotz aller technischen Fortschritte – ein Absturz ist nie ganz auszuschließen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der Autor
Andreas Spaeth ist Absolvent der Deutschen Journalistenschule in München und arbeitet seit über 25 Jahren als freier Luftfahrtjournalist. Seine Artikel erscheinen regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Welt am Sonntag, der Neuen Zürcher Zeitung, Spiegel Online und vielen Fachzeitschriften in Deutschland, Großbritannien und den USA. Die Online-Kolumnen von Andreas Spaeth auf airliners gehören zu den meistgelesenen Beiträgen im deutschen Luftfahrtjournalismus.
Das Buch
Wie konnte im März 2014 Flug MH370 spurlos im südlichen Indischen Ozean verschwinden, eine moderne Boeing 777 mit 239 Menschen an Bord? Und wie sucht man eigentlich in Tausenden Metern Wassertiefe nach einem Flugzeugwrack? Hat die Luftverkehrsbranche seit dem Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine im Juli 2014, bei dem 298 Menschen starben, die nötigen Konsequenzen gezogen? Wie kann es sein, dass ein psychisch labiler Kopilot im Cockpit eines Airbus A320 der Germanwings sitzt und das Flugzeug mit 150 Menschen an Bord im März 2015 in den französischen Alpen mutwillig zum Absturz bringt? Andreas Spaeth gibt Antworten auf diese heiklen Fragen und zeigt Sicherheitslücken im modernen Luftverkehr auf. Sie gehen jeden an, der sich in ein Flugzeug setzt. Sein Fazit: Fliegen ist sicher, aber ...
ANDREAS SPAETH
CRASH
TEST
DIE VERBORGENEN RISIKEN DES FLIEGENS
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Verlagsgruppe Random House weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.
Originalausgabe 04/2016
Copyright © 2016 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-18354-7V001
www.heyne.de
Für Silvia, meine Pilotin
DANKSAGUNG
Flugkapitän Peter-Christian Möhrke gebührt mein Dank für das fachliche Lektorat.
Und mein Dank geht an Jan-Arwed Richter vom Flugunfallbüro Jacdec für die Anfertigung der Illustrationen.
INHALT
Vorwort
KAPITEL 1
Gestartet, aber nie gelandet
EXKURS
Hinter den Kulissen einer Flugzeugsuche im Ozean
KAPITEL 2
Selbstmord am Steuerknüppel
KAPITEL 3
Desorientierte Piloten taumeln in den Absturz
KAPITEL 4
Triumph über die drohende Katastrophe
KAPITEL 5
Gefiederte Feinde zwingen zum Gleitflug in den Hudson
KAPITEL 6
Zusammenstoß am Himmel
KAPITEL 7
Geisterflieger über Griechenland
KAPITEL 8
»Sie haben Feuer hinter sich!« – Flammen im Flugzeug
KAPITEL 9
Abgeschossen! Wenn der Krieg die Reiseflughöhe erreicht
EXKURS
Eine neue Gefahr – Drohne auf Kollisionskurs!
ANHANG
Checkliste – So fliegen Sie sicherer
Quellen
VORWORT
Fliegen ist sicher, aber …
Wir steigen alle ins Flugzeug, immer häufiger. Fast dreieinhalb Milliarden Menschen befördert der weltweite Luftverkehr derzeit in einem einzigen Jahr, rechnerisch mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Tendenz kräftig steigend. Wir alle nehmen dieses Wunder als gegeben hin, dass man einfach in eine große Röhre steigt, einige Stunden mehr oder weniger komfortabel darin sitzt, und dann manchmal am anderen Ende der Welt wieder aussteigt. Und immer heil ankommt, wovon man absolut ausgehen kann. Wenn aber eine Flugreise tatsächlich mal schlecht endet, beherrschen solche Nachrichten tagelang die Schlagzeilen – und treffen bei vielen Menschen auf latent, zumindest im Unterbewusstsein, vorhandene Flugangst. Denn ganz tief im Inneren ist sie vielen eben doch nicht geheuer, diese Reise hoch über dem vermeintlich sicheren Erdboden. Dabei lauern dort viel größere Gefahren für Leib und Leben als beim Fliegen.
In diesem Buch will ich zeigen, wo im modernen Luftverkehr weiterhin Gefahren drohen. Und die haben fast immer mit Menschen zu tun. Etwa 70 Prozent der tödlichen Unfälle in der Passagierluftfahrt sind auf ihr Versagen zurückzuführen, meist bei Piloten, aber auch bei anderen Beteiligten wie Fluglotsen. Die hier beschriebenen Fälle sind Einzelfälle, und sie sind oft dramatisch. Zeigen sie doch, wie nahe Tod oder Überleben auch in der durchorganisierten, digitalisierten und scheinbar leicht beherrschbaren modernen Welt beieinander liegen können. Und wie viel dabei davon abhängt, dass es zur richtigen Zeit am richtigen Ort fähige Menschen gibt, die schicksalhafte Geschehnisse oder technische Fehler auf eine Weise ausbügeln können, wie es eben nur Menschen vermögen. Ich bin im Laufe der Recherchen für dieses Buch fasziniert worden von Männern wie Richard de Crespigny, dem Flugkapitän von Qantas-Flug QF 32, und wie er es geschafft hat, gegen alle Wahrscheinlichkeit seinen schwerst beschädigten Riesen-Airbus A380 sicher zu landen und eine der größten Katastrophen der zivilen Luftfahrt doch noch abzuwenden. Und ich bin schockiert über das Unvermögen anderer Piloten, etwa auf Flug AF447 über dem Südatlantik oder der Asiana-Boeing 777 in San Francisco, die perfekt intakte moderne Flugzeuge durch ihr Unvermögen in die Katastrophe gesteuert haben. Dieses Buch will keine Angst machen, es will erklären und möglichst faszinierend beschreiben, was hinter Unfällen steckt, die für einige wenige Tage die Schlagzeilen beherrschen, bevor sie dann schnell wieder aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwinden. Was natürlich der Luftfahrtbranche sehr recht ist, denn die Anzahl der Menschen, die aus Flugangst gar nicht oder kaum fliegen, ist beträchtlich, und damit entgehen den Fluggesellschaften große Einnahmen.
Manche Themen aber halten sich wochenlang, über Monate oder sogar Jahre im öffentlichen Bewusstsein, und die Diskussionen flammen bei jeder neuen Meldung wieder auf. So der verschwundene Flug MH370. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Sicherheitsthemen in der Verkehrsluftfahrt, aber dieser Fall ist in jeder Hinsicht einzigartig. Und weil quasi nichts über das Schicksal dieses Fluges bekannt ist, bietet er eine Projektionsfläche für alle Arten von Fantasien, Theorien und Spinnereien, die sich weder schlüssig belegen, aber leider auch nicht stichhaltig widerlegen lassen. Auch hier will dieses Buch versuchen, die bekannten Fakten zu ordnen, ohne selbst den Anspruch erheben zu können, eine wirklich schlüssige Theorie für das Verschwinden zu liefern, wie es viele andere von sich behaupten.
Auch wenn das allein niemandem die möglicherweise vorhandene Flugangst nimmt, muss hier noch einmal die Statistik angeführt werden. Nach Abzug der zwei Malaysia-Airlines-Tragödien, die verschwundene MH370, vermutlich kein Unfall, und die abgeschossene MH17, sind die vergangenen Jahre die sichersten in der Geschichte der zivilen Luftfahrt gewesen. Das gilt vor allem für das Rekordjahr 2013: Damals kamen 251 Menschen in Passagierflugzeugen mit 19 oder mehr Sitzen ums Leben. Das sind immer noch 251 zu viele. Aber angesichts der Verkehrszahlen trotzdem eine extrem stolze Bilanz, bei über 36 Millionen Flügen. Auch 2014 kann sich ohne die Malaysia-Airlines-Vorfälle sehen lassen, obwohl es im vorvergangenen Jahr bei Unfällen 387 Tote gab, allerdings auch bei jetzt 3,3 Milliarden weltweiten Passagieren auf 38 Millionen Flügen. Das Jahr 2015 setzte den positiven Trend mit gerade mal 107 Opfern auf Passagierflügen fort.
Doch es lässt sich auch anders ausdrücken, wie sicher Fliegen ist: Zu jeder Zeit sind eine halbe Million Menschen am Himmel unterwegs, jeden Tag weltweit neun Millionen Reisende, die in ein Flugzeug steigen. Seit 2006 jedoch liegt die Anzahl der Opfer im weltweiten Flugverkehr konstant bei unter 1000 pro Jahr. Besonders krass ist der Vergleich zum wichtigsten Bereich der Mobilität der Menschheit, dem Verkehr auf der Straße, egal ob zu Fuß oder in einem Fahrzeug. Hier starben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO 2010 insgesamt 1,24 Millionen Menschen, ein Toter alle 25 Sekunden. Allein in Indien waren in diesem einen Jahr 238562 Opfer rund um den Straßenverkehr zu beklagen. In Deutschland gab es 2013 immer noch 3340 Verkehrstote. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Blitzschlag zu sterben, liegt bei eins zu 10,5 Millionen, und diejenige, bei einem Flugzeugunglück sein Leben zu verlieren, in Europa und den USA derzeit bei etwa eins zu 29 Millionen. Für jeden tödlichen Unfall im Luftverkehr gab es zuletzt 5,7 Millionen unfallfreie Flüge. Noch in den 1970er-Jahren ereignete sich statistisch alle 670000 Flüge mit einem westlichen Passagierjet ein Unfall mit Toten.
Die positive Entwicklung des Luftverkehrs hin zu extremer Sicherheit durch immer zuverlässigere Technik in den vergangenen Jahrzehnten ist wahrlich beeindruckend. Noch 1960 waren 1411 Tote zu beklagen in der Fliegerei – bei gerade mal 106 Millionen Fluggästen im Jahr. Bei der Boeing 707, dem ersten bedeutenden Langstreckenjet aus den 1960er-Jahren, gab es bei einer Million Starts noch 4,27 tödliche Unfälle. Bei den heute gängigsten Mittelstreckenjets Airbus A320 und Boeing 737 liegen die Werte bei unter 0,15 tödlichen Crashs je Million Starts. Ein englischer Analyst hat ausgerechnet, dass es unter Beibehaltung der Sicherheitsstandards der 1950er-Jahre und dem heutigen Flugaufkommen jeden Tag zehn tödliche Flugunfälle im Passagierverkehr geben würde, das heißt im Laufe nur eines Jahres wären unfassbar hohe Opferzahlen irgendwo zwischen 50000 und 200000 Toten in der Luftfahrt zu beklagen. Also steht heute alles zum Besten mit der Luftfahrtsicherheit? Nein! Mehr darüber in diesem Buch.
Andreas Spaeth
Hamburg, im Dezember 2015
KAPITEL 1
Gestartet, aber nie gelandet
Dass ein modernes Verkehrsflugzeug einfach verschwindet und nicht wieder auftaucht, war undenkbar – bis zum mysteriösen Fall MH370
Es ist der 2. Juli 1937, als eine Legende beginnt, über die sich bis heute viele Menschen den Kopf zerbrechen. Die berühmteste Pilotin der Welt, die Amerikanerin Amelia Earhart, damals 39 Jahre alt, muss an diesem Tag die schwierigste und längste Etappe ihres geplanten Rund-um-die-Welt-Fluges schaffen. Sie hat bereits viele Rekorde eingeheimst, etwa 1932 als erste Frau den Atlantik als Solopilotin überwunden. Gemeinsam mit ihrem Navigator Fred Noonan startet Earhart am 1. Juni in Miami mit dem Ziel, in ihrer zweimotorigen Lockheed Electra 10E die ganze Welt zu umrunden. Nach 26 Stopps in zwei Monaten erreicht der Flug am 29. Juni 1937 die Stadt Lae in Neu-Guinea. Nach nur zwei Tagen Vorbereitung steht die mit Abstand weiteste Einzelstrecke an – insgesamt 2556 Meilen (4734 Kilometer) über Wasser nach Howland Island, einer unbewohnten Koralleninsel knapp nördlich des Äquators im Pazifik, fast exakt auf halbem Wege zwischen Australien und Hawaii. Das Minieiland misst gerade 1,8 Quadratkilometer, hier will Earhart Station machen und auftanken. Dafür hat die amerikanische Küstenwache ihr Patrouillenschiff Itasca geschickt, das per Funkpeilung das Flugzeug zu der winzigen und kaum aus dem Wasser ragenden Insel leiten soll. Doch die Lockheed Electra kommt auf Howland Island nie an. Sofort läuft die bis dahin größte Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt an, 64 Flugzeuge und acht Kriegsschiffe suchen insgesamt 390000 Quadratkilometer Meeresoberfläche ab, eine Fläche größer als die heutige Bundesrepublik, völlig vergeblich, gefunden wird nichts. Die Suche, damals unvorstellbare vier Millionen US-Dollar teuer, endet am 19. Juli 1937, 17 Tage nach dem Verschwinden. Weitere private Missionen folgen, doch auch ohne Ergebnis. Earhart wird am 5. Januar 1939 offiziell für tot erklärt. Bis zum heutigen Tag sind weder das Flugzeug oder Überreste der Insassen gefunden worden, nicht einmal kleinste Stücke, die eindeutig der Lockheed Electra oder ihren Insassen zuzuordnen wären. Und das, obwohl bis in die jüngste Zeit immer wieder neue Suchmissionen unternommen werden. Das Mysterium des spurlosen Verschwindens der berühmten und glamourösen Pilotin und ihres Navigators samt des Flugzeugs beschäftigt die Menschen weiterhin – erst 2012 startet eine erneute Unterwasserexpedition mit einem ferngesteuerten U-Boot. Wieder ohne etwas zu finden. In Ermangelung harter Fakten halten sich auch noch heute, nach fast 70 Jahren, eine Vielzahl oft kruder Erklärungsversuche, werden Bücher geschrieben und Filme gedreht über Amelia Earhart und ihr Verschwinden.
Solche Mysterien sind in der Luftfahrt äußerst selten. Wikipedia listet von 1856 bis heute 160 Fälle auf, inklusive verschwundener Ballons und Luftschiffe. Passagierflüge von Fluggesellschaften tauchen nur zwei auf – 1989 eine im Himalaya verschwundene Fokker-27-Propellermaschine der Pakistan International Airlines mit 54 Menschen an Bord sowie 1995 eine in die Straße von Molo ins Wasser gestürzte indonesische Twin Otter, ebenfalls ein Propellerflugzeug, mit 14 Insassen. Von 1948 bis 2014 erwähnt das Flugsicherheitsportal Aviation Safety Network insgesamt 89 spurlos verschwundene Flugzeuge weltweit, davon 27 über Land und 62 auf See abhanden gekommene. Darunter sind 28 Fälle von Passagierflügen, 21 aus dem militärischen Transportbereich, 19 Frachtflüge und elf Überführungsflüge, zehn fallen in andere Kategorien. Die meisten, nämlich 38 insgesamt, ereigneten sich zwischen 1960 und 1979. Der tödlichste Fall ist kaum bekannt: Am 15. März 1962 befindet sich eine zivile Lockheed L1049H Super Constellation der amerikanischen Fluggesellschaft Flying Tiger Line auf einem Militär-Charterflug. Es ist die Anfangsphase des Vietnamkriegs, und das Flugzeug soll amerikanische Soldaten von der Travis Air Force Base in Kalifornien nach Saigon im damaligen Südvietnam bringen; zum Tanken legt das Flugzeug Stopps in Honolulu, Wake Island, Guam und der Clark Air Base auf den Philippinen ein.
Die Ankunft in Guam hat sich wegen Motorproblemen vor dem Abflug in Honolulu schon verzögert. Um 22.57 Uhr Ortszeit startet die Constellation zu ihrem rund achtstündigen, 2600 Kilometer langen Flug von Guam auf die Philippinen, in den Tanks ist genügend Treibstoff für neun Stunden Flug. An Bord befinden sich 107 Menschen, 96 militärische Passagiere und eine elfköpfige zivile Besatzung; Flugkapitän Gregory P. Thomas gehört zu den erfahrensten der Gesellschaft. Das viermotorige Propellerflugzeug mit dem Kennzeichen N6921C, Rufzeichen 21 Charlie, ist nachts über dem Pazifik unterwegs, das Wetter ist gut, keine Turbulenzen und 15 Meilen Sicht im Mondlicht. Um 22 Minuten nach Mitternacht gibt die Super Connie ihre letzte Positionsmeldung durch, es ist das letzte Mal, dass jemand etwas vom Flug Flying Tiger 739 hören wird. Etwa eine Stunde später, gegen halb zwei Uhr morgens, sieht die Besatzung des liberianischen Öltankers Lenzen etwa 800 Kilometer westlich von Guam eine extrem intensive, helle Explosion am Himmel, kurz vorher meinen die Seeleute eine Dunstwolke wahrzunehmen. An der vermuteten Position des Flugzeugs verläuft der Marianengraben, mit fast 11000 Metern der tiefste Meeresgrund der Erde. Es ist davon auszugehen, dass die Trümmer der Super Constellation darin verschwinden. Denn auch im März 1962 starten die Amerikaner eine der größten Suchaktionen der Geschichte. Über 1300 Mann in 48 Flugzeugen und acht Schiffen suchen innerhalb von acht Tagen insgesamt 520000 Quadratkilometer Ozeanoberfläche ab – doch nicht ein einziges Teil, das zweifelsfrei zum Flugzeug oder seinen Insassen gehört, wird je entdeckt. Einen Cockpitstimmrekorder oder ein Datenaufzeichnungsgerät an Bord gibt es damals nicht. Zweifelsfrei scheint zu sein, dass eine Explosion in der Luft das Flugzeug vom Himmel holt, denn eine Super Constellation kann ohne Fremdeinwirkung nicht so plötzlich und katastrophal abstürzen.
Theorien über die Unglücksursache entstehen aus Mangel an Fakten viele. Die Schiffsbesatzung geht von einer schiefgelaufenen Geheimoperation aus – zumal der Funkoffizier vergeblich und wiederholt versucht hatte, Marinestationen umliegender Inseln zu kontaktieren – und keine Antwort bekam. Auch ein Schiff, möglicherweise ein Kriegsschiff, meint ein Matrose in der Nähe des Explosionsorts gesehen zu haben, das theoretisch die Maschine hätte abschießen können. Sabotage erscheint ebenfalls denkbar, denn wie sogar der Untersuchungsbericht einräumt, habe das Flugzeug bei Zwischenstopps in Honolulu, Wake Island und Guam längere Zeit unbewacht in spärlich beleuchteten Bereichen des jeweiligen Vorfelds gestanden. Fast jeder auf diesen Flughäfen hätte das Flugzeug »ungehindert betreten können«, heißt es im Bericht. Außerdem explodiert am gleichen Tag eine zweite Flying-Tiger-Constellation auf den Aleuten, die ebenfalls auf der Travis Air Force Base gestartet war. Schließlich erscheint eine viel profanere Erklärung denkbar – Motorprobleme. Die vier Kolbenmotoren der Super Connie sind für ihre Anfälligkeit bekannt. Nicht umsonst gilt die von Fans als schönstes je gebautes Flugzeug gerühmte Constellation scherzhaft als »beste Dreimotorige der Welt«. Nur drei Tage vor dem Absturz muss 21 Charlie nach Honolulu umkehren, nachdem es einen massiven Leistungsabfall in Triebwerk Nummer vier gegeben hatte. Was auch immer in dieser Mondnacht im Jahr 1962 über dem Pazifik geschehen ist – Tatsache ist, dass hier 107 Flugzeuginsassen sterben und es dafür bis heute keinerlei Erklärung gibt.
Im modernen Jetzeitalter erachtet man das Verschwinden eines Flugzeugs, zumindest eines größeren Passagierjets, lange als undenkbar. Dazu ist der Luftverkehr schlicht zu genau überwacht durch ein dichtes Netz von Navigations-, Beobachtungs- und Verfolgungssystemen. Doch bereits 2003 ereignet sich ein höchst mysteriöses Verschwinden eines Verkehrsflugzeugs – allerdings nicht auf einem offiziellen Flug und vermutlich mit nur zwei Menschen an Bord. Einer von ihnen ist Ben Charles Padilla, ein Flugingenieur, Flugzeugmechaniker und Privatpilot, der verschwindet, während er in Afrika, in der angolanischen Hauptstadt Luanda, für eine in Florida beheimatete Flugzeugleasingfirma arbeitet. Die hatte eine Boeing 727, früher bei American Airlines im Liniendienst, nach ihrem Ausscheiden aus deren Flotte übernommen und an die angolanische Staatslinie TAAG vermietet. Doch der Deal geht schief, und die Boeing steht 14 Monate ungenutzt auf dem Flughafen, wobei sich Flughafengebühren von über vier Millionen US-Dollar anhäufen. Kurz vor Sonnenuntergang am 25. Mai 2003 betritt Padilla gemeinsam mit einem Mechaniker aus dem Kongo, den er kurz vorher eingestellt hat, das Flugzeug. Zuvor hatten beide mit angolanischen Mechanikern daran gearbeitet, die dreistrahlige Boeing wieder flugtauglich zu machen, um sie danach an eine nigerianische Airline zu vermieten. Die Kabine des 1975 gebauten Passagierjets, Kennzeichen N844AA, die bei American Airlines mit 150 Sitzen bestückt war, ist zu dieser Zeit bereits mit zehn Treibstofftanks à 500 Gallonen (1892 Liter) anstelle von Passagiersitzen ausgestattet. Damit soll Diesel zu abgelegenen Diamantenmienen geflogen werden. Ben Padilla ist lediglich zertifiziert, Sportmaschinen zu fliegen. Die 727 dagegen benötigt eine entsprechend ausgebildete, dreiköpfige Besatzung im Cockpit.
Aber an diesem Abend rollt das Flugzeug los, ohne mit dem Kontrollturm von Luanda Kontakt aufzunehmen. Es fährt offenbar unmotiviert über die Rollwege und biegt nach Augenzeugenberichten schließlich ohne Freigabe durch die Fluglotsen auf eine der beiden Pisten ein. Ohne leuchtende Positionslampen und mit abgeschaltetem Transponder, der sonst automatisch Daten wie Flugnummer und Flughöhe übertragen würde, hebt das Geisterflugzeug in Richtung Südwesten ab und fliegt hinaus auf den Atlantik. Weder von dem Jet noch von seinen vermutlich zwei Insassen wird jemals wieder eine Spur auftauchen. Es bleibt völlig unklar, wer die 727 geflogen ist, vermutlich Padilla, und vor allem, warum sie startete und wohin. In amerikanischen Militär- und Geheimdienstkreisen herrscht nach 9/11 die Befürchtung, sie könnte als fliegende Bombe eingesetzt werden. Eine mögliche Terrorattacke, die Nutzung für illegale Transporte oder Versicherungsbetrug sind die drei Theorien, die als Erklärungsversuche kursieren. Zumindest die Terrorangst legt sich – 2005 schließt das FBI den Fall ab. Die Gründe auch dafür bleiben verborgen, der Fall ein dauerhaftes Mysterium. Und eine abenteuerliche Geschichte, die sich Insider erzählen, die aber nie eine größere Öffentlichkeit erreicht. Erst am 8. März 2014 dann geschieht ein Fall, der wie kaum ein anderes Vorkommnis mit einem Flugzeug jemals zuvor die Weltöffentlichkeit aufrüttelt und sich anhaltend ins Bewusstsein vieler Menschen gräbt, auch solchen, die sich sonst keinerlei Gedanken über den Luftverkehr machen.
Es ist ein feuchtheißer Freitagabend im tropischen Spätsommer, der 7. März 2014. Die Geschichte beginnt am Kuala Lumpur International Airport, abgekürzt KLIA. Der gigantische Flughafen der malaysischen Hauptstadt gibt ein Zeugnis darüber ab, wie das Land sich selbst sehen möchte: aufstrebend, modern, weltoffen, transparent. Passagiere lieben den modernen KLIA, mit seinen hohen, geschwungenen Dächern, den riesigen Fenstern, die viel Tageslicht ins Gebäude lassen, den echten Palmen im Gebäude und sogar einem Dschungelpfad im Satellitenterminal. Der 1993 eröffnete Großflughafen soll vor allem Singapur als Drehkreuz Konkurrenz machen, doch der nur rund 40 Flugminuten entfernte Changi Airport hat stets die Nase vorn mit zuletzt 54 Millionen Passagieren im Jahr 2014. KLIA aber gehört mit 49 Millionen Fluggästen im gleichen Jahr ebenfalls zu den größten Airports, rangiert weltweit auf Platz 20. Ein Handicap gegenüber Singapur mit seiner starken Fluggesellschaft hat Malaysia, die nationale Airline schreibt seit Jahren rote Zahlen und ist ein extrem kompliziertes, behördenartiges Gebilde. Beim Bordservice allerdings haben die Malaysier zu Recht einen hervorragenden Ruf.
An diesem Freitag im März zeigt sich das Tropenwetter in unmittelbarer Äquatornähe von seiner anstrengendsten Seite, am Tag mit bis zu 36 Grad Celsius und extremer Luftfeuchtigkeit. Auch die Fluggäste, die am späten Abend bei »nur« noch 30 Grad Celsius Lufttemperatur mit dem Auto oder dem Flughafenzug »KLIA Ekspres« am Flughafen weit außerhalb der Stadt ankommen, sind froh, das klimatisierte Terminal zu betreten. Die Nacht gehört am KLIA zu den Hauptverkehrszeiten; das tagsüber oft nur spärlich gefüllte Flughafengebäude ist um diese Zeit brechend voll, viele Flüge nach Europa und Australien heben um Mitternacht herum ab. Über 200 Passagiere haben an diesem Abend ein nicht so weit entferntes Ziel in Asien, sie sind auf Flug MH370 der Malaysia Airlines nach Peking gebucht, der unter einer sogenannten Code-Sharing-Vereinbarung auch von der chinesischen Partnergesellschaft China Southern Airlines als Flug CZ748 verkauft wird. Planmäßige Startzeit ist um 40 Minuten nach Mitternacht, die Ankunft in der chinesischen Hauptstadt für den Morgen um 6.30 Uhr vorgesehen. Zwischen beiden Metropolen gibt es keine Zeitverschiebung, die tatsächliche Flugzeit beträgt kaum fünfeinhalb Stunden. »Red Eye« nennen Amerikaner solche Nachtflüge.
Die große Mehrzahl der Passagiere von Flug MH370 sind Chinesen; genau 153 Fluggäste stammen aus dem Zielland. Gerade mal 50 Malaysier sind zahlende Gäste in dieser Nacht, dafür gibt es noch Kunden 13 anderer Nationalitäten, die größtenteils KLIA zum Umsteigen nutzen. Unter ihnen sieben Indonesier und sechs Australier – sowie zwei Iraner, die trotz ihres asiatischen Aussehens von den malaysischen Behörden unentdeckt und ungehindert mit in Kuala Lumpur gekauften, gestohlenen europäischen Pässen reisen, einer als Österreicher, einer als Italiener, beide wollen nach Deutschland. Am auffälligsten an diesem Abend und am lautesten ist eine Gruppe 30 chinesischer Künstler, die gerade eine dreitägige Kunst- und Kalligrafie-Ausstellung in Kuala Lumpur hinter sich gebracht hat, aus Anlass des 40. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern. Für einige der Teilnehmer ist es die erste Auslandsreise überhaupt. Auch der Amerikaner Philip Wood gehört zu den Reisenden nach Peking an diesem Abend. Der 51-jährige Texaner hat lange in Peking gelebt, dort seine amerikanische Freundin Sarah Bajc kennengelernt. Gemeinsam sind sie gerade dabei, nach Kuala Lumpur umzuziehen, in Peking wartet Sarah auf Philip, der ihr beim Packen helfen will. Er wird künftig bei IBM in Malaysia arbeiten, Sarah hat bereits einen Job in ihrem Beruf als Lehrerin an einer High School in Kuala Lumpur. Philip Wood hat Glück gehabt und einen guten Platz ergattert – gleich in der ersten Reihe der Economy Class, am Gang auf Sitz 11C, wird er nach Peking fliegen, so zeigt seine Bordkarte.
Um diese Zeit stehen die beiden Piloten für Flug MH370 im Briefing-Raum von Malaysia Airlines, wo sie die übrige Besatzung treffen, alle zwölf Crewmitglieder sind Malaysier. Niemand von ihnen würde sich freiwillig für diesen kurzen Nachtflug melden, als das Beste daran empfinden die Flugbegleiter, sechs von ihnen Männer, die Möglichkeit, während ihres 24-stündigen Aufenthalts in Peking einen Einkaufsbummel zu unternehmen. Flugkapitän für MH370 heute Nacht ist Zaharie Ahmed Shah, 53 Jahre alt, der von der Insel Penang stammt und seit 1981, als er als Pilotenschüler seine Karriere bei der nationalen Fluggesellschaft begann, bei Malaysia Airlines im Cockpit sitzt. Zaharie trägt Glatze und ist von gedrungener Erscheinung, was seine Aura von Autorität eher noch unterstreicht. In seiner langen Karriere hat er bereits 18365 Flugstunden absolviert und eine Vielzahl an Flugzeugtypen geflogen, von der zweimotorigen Turboprop Fokker 50, auf der er anfing, bis zu großen Jets. Seit 1991 ist er Kapitän, zunächst auf der Boeing 737, seit 1996 auf dem Großraumflugzeug Airbus A330 und seit 1998 schließlich auf der noch größeren Boeing 777. Seit 2007 ist er auch Fluglehrer und im Auftrag der malaysischen Luftfahrtbehörde Prüfer für andere Piloten, die ihre Typenlizenz (type rating) für die Boeing 777 erwerben. Der Kontrast zu seinem Kopiloten in dieser Nacht könnte nicht größer sein. Fariq Abdul Hamid ist erst 27 Jahre alt und wird als Babyface beschrieben. Er ist seit 2007 bei Malaysia Airlines und war von 2010 an Kopilot auf der Boeing 737, schulte dann auf die A330 um. Jetzt hat er nach langen Simulator-Sessions und fünf Trainingsflügen unter den Augen eines Checkpiloten, den letzten kurz zuvor nach Frankfurt, seine Konversion auf die Boeing 777 fast abgeschlossen. Flug MH370 ist sein letzter Trainingsflug, bereits beim nächsten Flug soll er seine Prüfung zum Ersten Offizier auf der 777 ablegen. Hamid kann 2763 Flugstunden vorweisen. Das Leben meint es gerade gut mit ihm – am Sonntag, wenn er aus Peking zurück in Kuala Lumpur ist, will er seinen soeben gekauften Audi A4 abholen.
Im Piloten-Briefing-Raum erhält Zaharie einen Umschlag mit allen wichtigen Daten zum geplanten Flug MH370. Darin der Flugplan mit der vorgesehenen Route und allen Wegpunkten, die die Maschine nach der entsprechenden Programmierung des Bordcomputers abfliegen wird. Auch Angaben über das zu erwartende Wetter, Flughöhen und die zu tankende Treibstoffmenge sowie Beladungs- und Passagierliste finden sich in dem Umschlag. Die Flugdauer in dieser Nacht ist mit fünf Stunden, 34 Minuten berechnet. Neben 239 Menschen werden über 14 Tonnen Luftfracht an Bord sein – darunter zweieinhalb Tonnen frische Mangosteen-Früchte und 221 Kilo Lithium-Ionen-Batterien. Die Boeing 777 wird für den Flug nach Peking den Berechnungen zufolge 37,2 Tonnen Treibstoff verbrauchen. Getankt werden 49,1 Tonnen, damit kann das Flugzeug rechnerisch sieben Stunden und 31 Minuten in der Luft bleiben und notfalls auch einen der beiden vorgesehenen Ausweichflughäfen in Jinan in Ostchina oder in Hangzhou südlich von Shanghai erreichen.
Die beiden Piloten sind nie zuvor miteinander geflogen und ein extrem ungleiches Paar: Zaharie der Veteran, mit allen Wassern gewaschen und manchmal desillusioniert, und Fariq, der selbstbewusste und ehrgeizige Neuling, der den heutigen Flug kaum erwarten kann. Zwei Jahre zuvor hat sich Fariq eine Dummheit geleistet, die ihn die Pilotenkarriere hätte kosten können – aber er kam ungeschoren davon: Auf einem Flug von Phuket nach Kuala Lumpur holte er zwei blonde australische Urlauberinnen ins Cockpit, die Piloten rauchten mit ihren attraktiven Besucherinnen und plauderten, man machte Fotos, auf denen eine der Damen die Pilotenmütze auf dem Kopf trägt, die Bilder tauchten in sozialen Netzwerken auf. Doch jetzt sind die lockeren Tage für Fariq vorbei: An diesem Märzabend sagt Captain Zaharie seinem jungen Kopiloten, er solle den gesamten Flug nach Peking durchführen als Pilot Flying, also das Flugzeug vom Start bis zur Landung unter seiner Kontrolle haben. Eine solche Arbeitsteilung im Cockpit ist normal, oft führt der Kopilot selbstständig den gesamten Flug durch, während der Kapitän den Funkverkehr übernimmt und die Abläufe überwacht. Etwa eine Stunde vor Abflug machen sich die beiden Piloten auf zum Gate C1. Ohne viel zu reden, so zeigen es die Überwachungskameras, gehen beide zügig durch die Sicherheitskontrolle, Zaharie voran.
Um am KLIA zu ihrem Flugsteig C1 zu kommen, müssen Besatzung und Passagiere von MH370 mit einem automatischen Personenzug vom Terminal aus in das Satellitenterminal fahren. Drei Minuten benötigt das führerlose Transportsystem bis zum Abfertigungskomplex; auf dem Weg dahin fällt der Blick über die Weiten des Vorfelds und die vielen Flugzeuge, die hier um diese Zeit auf den Start warten. Die große Mehrzahl davon gehört Malaysia Airlines, die auch sechs Riesen-Airbus-Jets des Typs A380 betreibt. Schon eine Stunde vor Abflug ist der Warteraum für Gate C1 voll, doch dank der großzügigen Gestaltung mit orangefarbenem Teppich, schwarzen Sitzen und einigen großen Flachbildschirmen fühlt es sich nicht überfüllt an. Kurz vor Mitternacht werden die Passagiere von Flug MH370 nach Peking zum Einsteigen aufgefordert. Für den Flug bereit steht die Boeing 777-200ER mit der Registration 9M-MRO – 9M ist das Länderkennzeichen für Malaysia. Es ist die 404. produzierte der bisher fast 1400 von den Boeing-Werken in Seattle ausgelieferten Boeing 777. Das zweistrahlige Langstreckenflugzeug ist ein Verkaufsschlager. Dieses Exemplar ist zum ersten Mal im Mai 2002 geflogen und kurz darauf neu an Malaysia Airlines geliefert worden. Mit 53471 Flugstunden auf 7526 Flügen befindet es sich im normalen Rahmen für ein zwölfjähriges Flugzeug, nur einmal gab es mit 9M-MRO zuvor einen Zwischenfall, als die Boeing am Boden in Shanghai eine andere Maschine berührte und eine Flügelspitze beschädigt wurde. Insgesamt 282 Plätze bietet Malaysia Airlines in ihren Boeing 777-200, von denen die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt 15 betreibt, davon 35 in Business Class mit etwas überholten Sitzen, die sich nicht in ganz ebene Betten verwandeln lassen, sowie 247 Sitzen in Economy Class. Mit 227 Passagieren, die jetzt einsteigen, ist das Flugzeug nicht ausgebucht. In der vorderen Kabine sitzen in dieser Nacht gerade mal elf Business-Class-Gäste, die viel Platz beanspruchen können.
Flug MH370 verlässt pünktlich die Parkposition, um 0.27 Uhr Ortszeit wird das Flugzeug vom Gate zurückgeschoben und das erste Triebwerk angelassen. Kopilot Fariq steuert die Boeing zur Startbahn 32R, Kapitän Zaharie kümmert sich um den Funkverkehr. Um 0.40 Uhr gibt der Tower die Startfreigabe: »Three Seven Zero, Three Two right, cleared for take-off. Good night.« Zaharie bestätigt aus dem Cockpit: »Three Two right, cleared for take-off Malaysian Three Seven Zero. Thank you, bye.« Flug MH370 ist auf dem Weg nach Peking und startet den routinemäßigen Steigflug. Nach genau 20 Minuten, um 1:01:14 Uhr, erreicht die Boeing 777 ihre vorgesehene Reiseflughöhe von 35000 Fuß (10668 Meter). Um diese Zeit werden in Business Class die ersten Getränke serviert, nur die wenigsten Passagiere wollen mitten in der Nacht noch essen, sondern haben das bereits in der großzügigen Golden Lounge von Malaysia Airlines am KLIA getan. Die meisten bitten darum, erst zum Frühstück geweckt zu werden, versuchen bis dahin, ein paar Stunden zu schlafen. In Economy Class sind dagegen zwei Passagiere viel zu aufgeregt, um zu schlafen: Auf Platz 30C sitzt der 19-jährige Iraner Pouria Nour Mohammad Mehrdad, der mit dem in Thailand gestohlenen Pass des 61-jährigen ehemaligen Masseurs Christian Kozel aus Salzburg reist. Vier Reihen hinter ihm sitzt sein 18-jähriger Freund Reza Delevar, der als 37-jähriger Italiener Luigi Maraldi mit dem ebenfalls entwendeten echten Pass des Diebstahlsopfers unterwegs ist. Beide tun weiterhin so, als würden sie sich nicht kennen, sicher ist sicher. Die Boeing 777 ist jetzt über dem Südchinesischen Meer unterwegs. Um 1:19:24 Uhr ist es an der Zeit, dass die Lotsen bei Lumpur Radar in Malaysia Flug MH370 an ihre Kollegen der vietnamesischen Flugsicherung in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon, übergeben. Dazu übermitteln sie ihnen die neue Funkfrequenz: »Malaysian Three Seven Zero contact Ho Chi Minh One Two Zero decimal Niner. Good Night«, hören die Piloten den Lotsen aus Kuala Lumpur in ihren Kopfhörern. »Good Night Malaysian Three Seven Zero«, antwortet Kapitän Zacharie aus dem Cockpit. Dies sind die letzten Worte und das letzte Lebenszeichen, das die Welt jemals von Flug MH370 hören wird. Jetzt tritt das Flugzeug in eine Grauzone zwischen den Flugsicherungen zweier Länder ein, abgemeldet bei der Flugüberwachung des einen, noch nicht angemeldet bei der Flugsicherung des anderen Landes. Falls es einen Plan gäbe zu verschwinden, wäre dies der ideale Ort und Zeitpunkt.
Um 1:21:13 Uhr, 90 Sekunden nach dem Abschiedsgruß von Kapitän Zaharie an die Lotsen in Malaysia, stellen beide Transponder an Bord ihre Arbeit ein. Diese Geräte senden, wenn sie vom Sekundärradar am Boden abgefragt werden, einen Squawk-Code aus vier Zahlen jeweils zwischen eins und sieben, außerdem Daten zur Identifikation des Flugzeugs wie Flugnummer und Flughöhe auf die Bildschirme der Fluglotsen. Durch wiederholte Abfrage kalkuliert das Radarsystem Flugrichtung und -geschwindigkeit. Folgerichtig aber verschwindet Flug MH370 in diesem Moment von der Anzeige der Flugsicherung bei Lumpur Radar – ohne Vorwarnung oder eine Notfallmeldung. Von einer auf die nächste Sekunde können die Fluglotsen das Flugzeug nicht mehr sehen. Ein gleichzeitiger Ausfall beider Transponder ist extrem unwahrscheinlich, und abgeschaltet wird er nur am Boden oder bei der Isolierung eines Kurzschlusses. Oder wenn jemand sein Flugzeug ganz bewusst unsichtbar machen will – wie die Attentäter am 11. September 2001 bei den von ihnen in den USA entführten Flugzeugen. Bei der Luftraumüberwachung von Ho-Chi-Minh-Stadt hört man nichts von MH370. Üblicherweise erfolgt die Anmeldung beim nächsten zuständigen Kontrollcenter innerhalb von Sekunden nach Verlassen der Zuständigkeit des vorherigen. Auch Funkverkehr findet von Bord des Fluges MH370 nicht mehr statt – was bedeutet, dass auch die gesamte Funkanlage entweder ebenfalls ausgefallen ist oder bewusst abgeschaltet wird. Die Boeing 777 als modernes Verkehrsflugzeug gilt als eines der bestausgerüsteten überhaupt in Sachen Kommunikationselektronik – an Bord sind drei VHF- und zwei HF-Funkgeräte, ein Satellitentelefon und eben zwei Transponder. Dass dieses vielfältige Arsenal auf einem ansonsten normal verlaufenden Flug auf einen Schlag funktionsunfähig und unbenutzbar wird, ist nicht vorstellbar.
Suche erst im Südchinesischen Meer, dann im Indischen Ozean – das Verschwinden von Flug MH370 gibt viele Rätsel auf.
Bereits in diesem Moment beginnt eine lange Kette von Verzögerungen und Versäumnissen, Verspätungen und Vertuschungsversuchen in der Reaktion auf das plötzliche Verschwinden des Flugs nach Peking. So vergehen scheinbar endlose 17 Minuten, bis sich die vietnamesische Flugsicherung um 1.38 Uhr mit den Kollegen in Kuala Lumpur in Verbindung setzt und meldet, dass mit MH370 kein Kontakt hergestellt werden konnte. Offenbar hatten die Vietnamesen selbst zunächst vergeblich versucht, den Malaysia-Airlines-Flug zu erreichen, es dann gegen 1.30 Uhr auf dem Umweg über ein anderes Flugzeug probiert, das sich auf dem Weg nach Tokio-Narita befand. Dessen Pilot hörte nur seltsames Gemurmel von MH370 oder Geräusche wie von einem blockierten Mikrofon, überlagert von starken statischen Störgeräuschen aus dem Äther. Um 1.37 Uhr schließlich hätte es eine automatische Übertragung von Triebwerksdaten von Bord des Fluges MH370 geben müssen, die alle 30 Minuten stattfindet. Damit wird automatisch die Leistung und Funktionsfähigkeit der Triebwerke vom Boden aus überwacht, die Daten dieses ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) genannten Systems hätten sowohl beim Triebwerkshersteller Rolls-Royce in England als auch in der Operationszentrale von Malaysia Airlines in Kuala Lumpur eingehen sollen und waren bis dahin einwandfrei empfangen worden. Irgendwann zwischen 1.07 und 1.37 Uhr musste also auch ACARS ausgefallen sein – oder es wurde abgeschaltet. Ein manuelles Abschalten ist selbst für Spezialisten schwierig zu bewältigen, auch Piloten sind dafür nicht trainiert, weil es keinen wirklichen Grund dazu geben kann. Und um ACARS vollständig lahmzulegen, muss jemand eigens über eine Luke im Kabinenboden in den mit Elektronik vollgestopften, engen Avionikraum unterhalb des Cockpits steigen, den normalerweise nur Wartungstechniker am Boden betreten. Tatsache ist, dass MH370 seit 1.21 Uhr in dieser Nacht auf keinem einzigen der üblichen, sehr vielfältigen möglichen Kanäle mehr irgendeine Nachricht an die Außenwelt sendet. Doch bis das am Boden jemand begreift, dauert es unnötig lange.
ENDE DER LESEPROBE