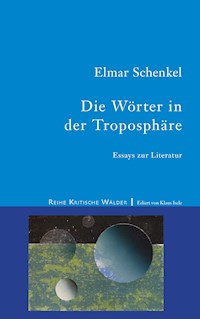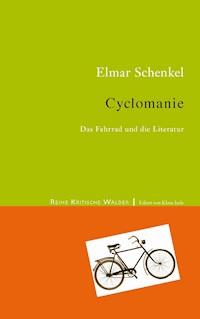
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kritische Wälder
- Sprache: Deutsch
Elmar Schenkels Essay erhellt die seltsamen Beziehungen zwischen dem energetisch besten Fahrzeug des Planeten und der Welt der Wörter; er bewegt sich abwechselnd zwischen Radeln und Dichten, zwischen Radstürzen und poetischen Aufschwüngen. Viele große Autoren - von Twain und Zola bis zu Tolstoi und Beckett - wurden vom Radfahren inspiriert. Frauen entdeckten durch das Rad die Möglichkeiten der Emanzipation und schrieben darüber, etwa Simone de Beauvoir. Dadaisten, Surrealisten, SF-Autoren, auch Filmregisseure und Künstler entwickelten die absurdesten Dimensionen des Fahrrads. Von frühen Weltumradlern ist in diesem spannenden Buch ebenfalls die Rede sowie von Frauen, die auf dem Jakobsweg oder im Himalaya radelten. So entsteht eine kleine Geschichte der Literatur und Kultur durch die Augen des Fahrrads, das ohnehin einer Brille gleicht - oder dem mathematischen Symbol für Unendlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorderlicht: Fahrrad und Essay
Das fremde Rad
Erfindung
Italiener
Laufrad
Zirkus
König Leopolds Fahrrad
Eine neue Körpersprache
Brille und Zweirad
Pferde, Zentauren, Cyborgs
Das irische Fahrrad
Aliens
Befreiung
Die Frau im Sattel
Die Männer zerbrechen sich den Kopf
Die Philosophen besteigen (nicht) das Rad
Eine deutsche Philosophie des Fahrrads
Geflügelte Räder
Heldenepos: die Tour de France
Schnelle Räder
Tag des Fahrrads, Nacht des Fahrrads
White Bicycle
Subversive Räder
Italienische Räder
Auf Tour
Gemächlich
Jugendstil
Einsame Radler
Das Weltenrad
Sternzeichen
Kleine Cyclografie
Rücklicht: Dankradeln
DEN GEMÄCHLICHEN UND GELGENTLICH FREIHÄNDIG FAHRENDEN RADLERN LEIPZIGS GEWIDMET
VORDERLICHT
Fahrrad und Essay
Es ist einmal beobachtet worden, daß die Bewegung des Essays der Bewegung des Wanderns ähnlich sei. Eine gewisse Ungleichmäßigkeit, die ständigen kleinen Abschweifungen, die Lust am Zögern und Zaudern, am Verweilen und Plaudern – all das sind Kennzeichen des Wanderns oder besser noch Spazierengehens wie auch der essayistischen Schreibweise. Wie ist es nun mit dem Rad? Ich denke, auch das Radeln, sofern es nicht Rasen heißt, gehört in das Bewegungsfeld des Essays. Während Auto, Flugzeug und Eisenbahn den größeren und erfolgreicheren Gattungen der Literatur zugeordnet werden müßten, dem Drama und dem Roman also, ist dem Rad eine Zwischenstellung eigen. Es steht – wie der hybride Essay – zwischen Ansätzen zur Hochgeschwindigkeit auf der einen Seite und dem Trödeln auf der anderen.
Zwar dürfen Fahrräder nicht auf Autobahnen und Schnellstraßen erscheinen, doch nehmen sie generell am Autoverkehr teil. Zugleich teilen sie sich oft, legal oder nicht, Fußwege und Fußgängerzonen mit Fußgängern oder Reitwege mit Reitern. Überhaupt schlängeln sie sich manchmal durch das Gesetz. Radfahrer sollen etwa beim Überqueren roter Ampeln gesehen worden sein, und ebenso hört man, daß sie gelegentlich Einbahnstraßen im falschen Sinne benutzen. Wo ein Auto wegen Poller oder Menschenansammlungen nicht mehr weiterkommt, da fädelt sich ein Radler mühelos durch. Auch Höfe und Gassen, Gärten und Treppen sind nicht unbedingt als finale Hindernisse für die radelnde Spezies anzusehen. All das deutet darauf hin, daß die Literaturgattung, die diesem Modus der Fortbewegung entspricht, nichts anderes sein darf als höchst flexibel und subtil.
Damit dieser Essay auch der Straßenverkehrsordnung entspricht, habe ich ihn ausgerüstet mit einigen Beleuchtungselementen (Zitate leuchten vorne, Quellenangaben in der Cyclografie hinten, als Reflektoren dienen große Namen von Twain bis Tolstoi, als Katzenauge Goethe). Manchmal, wenn es kritisch wird, klingelt es, aber die Bremse muß der Leser selbst ziehen. Die Bücher auf dem Gepäckträger kann man nach beendeter Fahrt zu Rate ziehen oder, um sich nicht weiter damit zu belasten, heimlich in einem fremden Fahrradkorb liegenlassen, wo sich ohnehin schon diverse Werbekarten befinden.
Warum aber über das Fahrrad schreiben? »Daß mein Fahrrad nicht schreiben kann, weiß ich auch«, schrieb Jürgen Becker einst mit einer Gewißheit, die ich nicht ganz teile. Vielleicht gibt es inzwischen schreibende Fahrräder, auch wenn die meisten wohl Analphabeten sind. Dafür können sie gute Geschichten erzählen. Sie haben nicht nur viel erlebt in den Romanen und Reisebüchern, in denen sie als Protagonisten auftreten. Sie sind auch aufgrund ihrer Eigenheit, ihrer Konstruktion und ihres Charakters Wesen, die etwas zu erzählen haben. Das Fahrrad ist eine der genialsten Erfindungen auf diesem Planeten. Es wurde in den Zeiten der ersten Industrialisierung entwickelt und hat doch etwas sehr Einfaches und Nicht-Maschinelles zur Grundlage. Es ist primitiv, verglichen mit all der Apparatur, die im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts die Erde und Menschen zu verändern begann. In einer Zeit nach der elektronischen Sintflut mutet es vorsintflutlich an, es ist eine gleitende Paradoxie. Aber es übertrumpft alle komplizierte Maschinerie in einem wichtigen, eines Tages vielleicht überlebenswichtigen Punkt: Es hat die beste Ratio von Energieverbrauch. Gebe ich einem Radfahrer ein Pfund Speck, so kommt er mit den Kalorien entscheidend weiter als alle anderen Fahrzeuge und Tiere dieser Erde. In dieser energetischen Verfolgungsjagd führt er das Feld an, gefolgt von Lachs, Pferd und Jumbo-Jet. Wir müssen daraus schließen, daß der Sieger in diesem Rennen planetarischen Zuschnitt hat. Daher sind wir geradezu verpflichtet, uns das Fahrrad genauer anzuschauen.
Das fremde Rad
Der Mann kann nicht schlafen, denn er weiß, daß in dieser Hütte, in der er liegt, irgendwo in der Wüste Nevadas, ein chinesischer Bahnarbeiter einen anderen umgebracht hat. Es ist zwei Uhr nachts, der Mond scheint über Winnemucca, und Thomas Stevens schleicht mit seinem Fahrrad an den Bahngleisen entlang, begleitet vom Heulen der Kojoten und dem unheimlichen Schrei eines unbekannten Vogels. Dann wieder das Abwarten: Ein majestätischer Gewittersturm, wie ihn nur der Westen kennt, zieht auf, und Stevens kauert mit seinem Rad unter einem Felsvorsprung. Auf weiten Strecken muß er sein Hochrad tragen, es gibt einfach keine befahrbaren Wege, und manchmal begegnet ihm ein Indianer, der diese merkwürdige Erscheinung mit ausdruckslosem Gesicht zur Kenntnis nimmt: ein Weißer, der zwei Räder auf den Schultern trägt, ein kleines, ein großes. Manchmal auch, um sich einen Spaß zu machen, schießen Cowboys auf ihn, dann ist er eine fahrende Zielscheibe. In einem Spielsalon wird er gezwungen, akrobatische Runden auf dem Billardtisch zu drehen.
Der Amerikaner Thomas Stevens fuhr in den 1880er Jahren als erster Mensch auf einem Hochrad durch die Vereinigten Staaten und schließlich um die Welt, zumindest war er der erste, der über solch eine Tat ein Buch schrieb. Der Bericht ist faszinierend: Wir werden Zeuge, wie das technische Gerät in all seiner Mechanik, und man möchte hinzufügen: Spinnenhaftigkeit, hier einen ersten Versuch unternimmt, Fuß auf dem Planeten zu fassen.
Das Fahrrad ist zunächst fremd. Erst wenn seine Fremdheit zur Ruhe gekommen ist, wird es eine eigene Aura entwickeln; wenn es, wie Walter Benjamin über die Aura sagte, »seinen Schatten auf den Ruhenden wirft«. Doch mit der Aura des Fahrrads ist es heute längst vorbei. Die Erfahrung von Aura ist exklusiv und läßt sich nicht vereinen mit Massentourismus und Fabrikherstellung. Spätestens mit dem Ersten Weltkrieg verliert das Fahrrad seine persönliche Ausstrahlung. Dennoch werden nachfolgende Generationen versuchen, etwas von dieser Aura zurückzugewinnen, eine Erinnerung, eine Täuschung, ein Wunschbild: das schnelle Fahrrad des Briefträgers in Jacques Tatis »Jour de Fête«, das gestohlene Rad in den »Fahrraddieben«, das abgenudelte des Don Camillo oder das weiße Fahrrad von Yoko Ono und John Lennon. Tausende von Fotomotivsuchern arbeiten daran: das Fahrrad an der Mülltonne, das verschneite Rad, die traulich aneinandergelehnten Liebesräder. Und so mancher entwickelt über die Jahre ein inniges Verhältnis zu seinem verbeulten Gerät oder seinem zuverlässigen Renntier.
Das Fahrrad lädt ein zur Poesie, zum Rausch, zum Eros; es malt absurde Kreise in lineare Landschaften, es verbindet, trennt, stürzt; und es läßt sich nicht bremsen, es ist eine artistische Herausforderung, es gleicht einem Zaubertrick, mit anderen Worten: Es ist, wenn nicht Kunst, so doch ein kleines Kunststück. Film, Malerei, Reklame und Literatur haben sich vom Fahrrad anregen lassen, von seiner Skurrilität und Bizarrerie ebenso wie von dem Balanceakt und dem Rausch der Geschwindigkeit, aber auch von all den sozialen Veränderungen, die es verkörperte, verursachte oder beschleunigte. Sprach- und Bildfähigkeit des Menschen haben ihn veranlaßt, auf dieses neuartige motorische Ereignis zu reagieren, es körperlich zu beherrschen, symbolisch zu umgarnen oder auch nur zu verstehen. Ich möchte mich in dieser kleinen Darstellung nur mit der Literatur beschäftigen, insoweit diese eine verbale Schneise in die Untergründe unserer Bewegungswelten darstellt. Mich interessiert, wie und was über Fahrräder geschrieben wurde, in Romanen, Gedichten, Essays, Reiseberichten und philosophischen Traktaten.
Literatur könnte man definieren als sprachliche Bewegung um ein Geheimnis herum oder auf eines zu. Das Fahrrad ist ein solches Geheimnis. Es ist ein sehr fremdes Gerät, da es keine Verlängerung oder Verstärkung des menschlichen Körpers darstellt wie der Hammer oder das Lasso. Es ist fast so etwas wie die in der Mechanik verkörperte Zahl Pi, für die wir kein Fassungsvermögen haben. Pi und Kreis sind nicht zu trennen, und beim Fahrrad haben wir es zunächst mit zwei Kreisen zu tun. Doch die Bewegung der Pedalen bildet einen dritten Kreis, und einem Beobachter von einem anderen Stern würde es vorkommen, als versuchten die Radler seit 150 Jahren auf dieser Erde durch das ewige Treten die beiden Kreise in einen dritten zu überführen. Ein theologisches Programm geradezu!
Erfindung
Das Fahrrad steht am Ende einer Entwicklung, in der Räder zu großer Macht gekommen sind, der Industrialisierung. Es scheint aufgrund seiner Primitivität geradezu einen Rückschritt zu signalisieren. Vielleicht steht es aber auch für die Entdeckung des Einfachen, das erst am Ende von Entwicklungen möglich ist. Schon um 1900 hat dies der Kulturwissenschaftler Michael Haberlandt so gesehen:
Aber noch hatte die Urmaschine nach all dem Großen, zu dem sie schon ausgewachsen war, eine Form übrig, in der sie der Menschheit ihr eigenstes Wesen am reinsten überlieferte. Es war das Fahrrad, das uns in das eigentliche Erbe des technischen Grundgedankens, der im Rad verkörpert ist, erst voll einsetzte. Dieses jüngste und letzte Räderwerk, das auf dem Boden rollt, ist auch der echteste Sprosse des Radgeschlechtes, reines Vollblut neben den nützlichen schweren Ackergäulen von Locomotive oder Omnibus, der Urgedanke des Rades in feinster Zuspitzung. (Haberlandt, 127)
Was aber hat es mit dem Rad auf sich? Wo treffen wir es in unserem Universum an? Kreisende Bewegungen gibt es auf allen kosmischen Ebenen, von der galaktischen Nebelbildung bis hin zum Milchstrudel in der Kaffeetasse, von der Zellteilung bis hin zu ozeanischen und atmosphärischen Wirbeln. Dennoch dauerte es lange, viel länger als die Beherrschung des Feuers oder die Entwicklung von Sprache, daß Menschen das Rad aus der Natur herausnahmen, um es sich in den Dienst zu stellen. Kreisförmiges, zyklisch orientiertes Denken scheint diesem Akt vorausgegangen zu sein. Möglicherweise aber hat genau dieses zyklische Denken das Rad verzögert oder verhindert. Zu den ältesten menschlichen Graffiti gehören Wirbel und Spiralen. Die Vorgänge von Geburt und Sterben, die Wiederholung der Jahreszeiten, vor allem die kreisförmigen Wege von Sonne und Mond haben den Menschen gezeigt, daß auf den Kreis Verlaß ist, mehr als auf die Linie, die nur irgendwohin führt. Wer immer jedoch das Rad erfunden hat, hat den symbolischen, sinnstiftenden Kreis zur Linie ausgerollt und damit eine geschlossene Ordnung aufgebrochen. Die Erfindung des Rades ist der erste Schritt zur Verweltlichung, er ist ein Abschied von den Göttern, aus denen kreisförmige Ruinen geworden sind.
Das Rad ist in sich ein Paradox, wie der Meister der Paradoxie G. K. Chesterton einmal bemerkt hat. Es stellt eine Revolution dar, im wörtlichen Sinne eine Umdrehung. Verfolgen wir zwei gegenüberliegende Punkte auf dem Rad, so sehen wir dies: Während der eine sich nach vorne und nach unten bewegt, dreht sich der andere nach hinten und oben. Chesterton schließt daraus, daß einer Revolution immer zwei Bewegungen innewohnen – die eine zukunftsgewandt, die andere auf Ursprünge zurückzielend. Die Französische Revolution kämpfte für die Zukunft, doch zugleich stellte sie eine Rückkehr nach Rom dar. Mit anderen Worten, weder die Revolution noch das Rad entgehen einem bestimmten Gesetz, das uns mitgegeben ist: Jeder Fortschritt ist von einem Rückschritt begleitet. Als der Mensch den Fuß entlastete und das Pferd bestieg oder sich einen Karren baute, gewann er viel Raum und Zeit, viel Bequemlichkeit, aber er verlor die Wahrnehmungen, die ihm zuvor seine Füße brachten. Seine Reichweite dehnte sich aus, aber auf Kosten anderer, und das bedeutete Krieg und Unterwerfung. Das Rad soll in Mesopotamien zusammen mit den ersten städtischen Kulturen aufgetaucht sein. Ackerbauende Gesellschaften benutzten es zur Bearbeitung der Ländereien, etwa zum Wasserschöpfen, bevor es zum Kriegsgerät wurde, als Rad am Streitwagen eines Darius oder eines Pharaonen. In anderen Kulturen blieb das Rad ruhig. Man kannte es und bildete es ab, etwa in Süd- und Mittelamerika, aber es bewegte sich nicht, allenfalls in der Vision. Es mochte das Rad der Zeit sein, ein Kalender, aber es stand still, wie es Kalender zu tun pflegen. Das Rad blieb kultisches Objekt und umging die Geschichte.
Dort, wo das Rad in die Geschichte hineinrollte, tat es das nicht von selbst. Es mußte gezogen werden, und so wird es mehrere Jahrtausende lang gewesen sein. Erst in der Renaissance, als man begann, an den Grundgedanken der gesellschaftlichen und technischen Verfassung zu rütteln, tauchen die ersten Modelle von selbstfahrenden Radfahrzeugen auf. Sie sind den Räderwerken der Uhr entsprungen, die ja im ausgehenden Mittelalter das Zeitalter des Mechanischen eröffnete. Aus den regelmäßigen Gebeten der Mönche entstand die moderne Zeiteinteilung, aus ihr kam die Mechanik und daraus das Räderwerk der Uhren. Die großen Turmuhren dieser Zeit, ob in Rostock, Prag oder Rouen, bilden symbolisch noch den Zusammenhang mit dem kosmischen Räderwerk von Sonne, Mond und Planeten ab, nicht nur astronomisch, sondern auch astrologisch. Sie bringen die Zeit der Sterne in die Zeit der Menschen hinein, kreisförmige Zeit. Aus der Klosterzeit wird Weltzeit, nur werden jetzt andere Gebete gesprochen.
In der Hauptstadt der Uhrenherstellung, in Nürnberg, baute man in der Renaissance und später Wagen, die man fahrende Uhrwerke nennen könnte. Sie dienten der Dekoration und Überraschung und wurden etwa zum Ruhme des Kaisers Maximilian als Triumphwagen zum Einsatz gebracht. Hans Hautsch, ein Nürnberger Konstrukteur, führte um 1650 ein Fahrzeug gegen Geld vor, welches »keiner Vorspannung wie ein ander Wagen [bedarf] / weder von Pferden / Ochsen oder anders / sondern wann man sich darauff setzt / vnd nimmt den Stab mit dem Wurmskopff in die Hand / so kan man den Wagen hin lencken / wo man will […] vnd geht solcher Wagen in einer Stund 2 tausend Schritt.« (zit. bei Berns, 69) Ein Fußgänger ist allerdings immer noch dreimal so schnell wie dieses Gefährt. Vermutlich wurde es von innen her mit Kurbeln angetrieben, ähnlich wie jene Apparate, die damals das perpetuum mobile vortäuschen sollten, oder gar wie Maelzels Schachautomat, der von einem kleinwüchsigen Türken von innen her bedient wurde. Die Nürnberger Kollegen Stephan Farffler und Stephan Schiffter bauten etwas später, um 1680–90, mit Handkurbeln bewegbare Rollstühle, wie sie übrigens 250 Jahre zuvor schon der Venezianer Giavanni da Fontana entworfen hatte. Der Medienhistoriker Jörg Jochen Berns bemerkt zu der Verwandtschaft von fürstlichem Gefährt und Rollstuhl dieses: »Daß Konstrukteure von fürstlichen Trionfofahrzeugen zugleich Rollstühle für Krüppel bauten, ist denkwürdig […] vor Gott und Göttern sind auch die Fürsten Krüppel; sie bedürfen des Vehikels, um ihre Gottähnlichkeit vorzutäuschen. Die Differenz von Fürst und Krüppel blieb darüber freilich nicht vergessen. Bei ihren technisch verwandten Prothesenfahrzeugen wurde sie sinnfällig dadurch, daß die der Fürsten allegorisch verlarvt waren, während die Krüppel ihre Mechanik offen zeigten.« (Berns, 72)
Diese Transparenz des Geräts erbt das Fahrrad von den Rollstühlen, während das Automobil die Verlarvung, oftmals auch in allegorischer Form, von Triumphwagen und Kutsche weiterführt. Schon dadurch macht sich das Rad zum Gefährt des kleinen Mannes, der emanzipierten Frau oder des Demokraten, wenn nicht gar Sozialisten. Es ist zwar zunächst nur Spielzeug der herrschenden Aristokratie, doch wird es zunehmend von den anderen Gesellschaftsklassen benutzt, bevor es endgültig zum Massenfahrzeug wird. Dies zeigt auch: Es braucht sich nicht in seiner Konstruktion zu verstecken wie der Rolls Royce hinter seinem Engel, über den uns der Kunsthistoriker Panofsky aufgeklärt hat. Es braucht keine Hierarchien zu verbergen, keine irrationalen Herrschaftsformen. Das Auto dagegen beruft sich geradezu auf religiöse Legitimation. So ist es symptomatisch, daß der Feuerwagen des Hezekiel im Alten Testament dem sächsischen Bastler Melchior Bauer (geb. 1733) ein Vorbild für seinen selbstfahrenden »Cherubwagen« war, den er Königen, wenn auch ohne Erfolg, anbot. In diesem »Himmelswagen« oder »Gnadenstuhl« können wir das Automobil vorausleuchten sehen, und vielleicht ist alle Technik ja zunächst ein Traumbild, ein Märchentext, der im Laufe der Geschichte nach und nach umgesetzt wird. Aus den Siebenmeilenstiefeln werden Eisenbahnen und aus den fliegenden Teppichen Flugzeuge.
Italiener
Einer der grossen technischen Träumer war Leonardo da Vinci. Bei Restaurierungsarbeiten fand man im Jahre 1965 auf der Rückseite von Leonardos Handschriften (Codex Atlanticus) die Skizze eines Fahrrads mit Pedalen und Kette, begleitet von einigen obszönen Bildchen wie einem geflügelten Penis. Das sah ganz nach Leonardos Entwurf aus, und wahrscheinlich hatten seine Schüler noch ein wenig dazugeschmiert. Die Liebe Italiens zum Fahrrad flammte wieder einmal auf, auch wenn ein Leonardo-Experte es als Fälschung durchschaute. Bis heute hält sich in Italien dieser Glaube an Leonardo als Erfinder des Fahrrads. Er hatte doch Hubschrauber, Taucherglocken und Maschinengewehre erfunden, warum nicht auch das viel einfachere Fahrrad? Aber das Fahrrad ist vielleicht zu einfach, als daß es leicht zu erfinden wäre. Das Allereinfachste ist ja zumeist fast unsichtbar und kaum zu begreifen. Es ist nicht das Ergebnis von immer weiteren Akkumulationen, sondern von Entschälungen, Reduktionen und überraschenden Kehrtwendungen. Die geniale Erfindung ist eine Wendung zur rechten Zeit, an der einzig möglichen Stelle.
Den Italienern, radbegeistert wie sie sind, fiel es schwer, von Erfindungsmythen Abschied zu nehmen. Der toskanische Autor Curzio Malaparte, der eigentlich Kurt Erich Suckert hieß und den Untergang der Deutschen an der Wolga beschrieb (Kaputt), liebte das Fahrrad und die Heroen des Radrennsports – den Italiener Gerbi oder den Franzosen Petit-Breton, die beiden großen Antagonisten Bartali und Coppi. Sie waren weiße Gipsfiguren und zugleich wahre Helden von antiker Größe, das Radrennen nichts als eine moderne Fassung der Ilias. Kein größerer Augenblick im Leben des jungen Malaparte, als beim »Berge, Seen und Meer«-Rennen, das von Turin bis Genua führt, der große Gerbi unter dem Geschrei der Menge am kleinen Kurt vorbeifliegt und ihm seinen schönen Strohhut vom Kopf reißt, um ihn sich auf die schweißüberströmte Stirn zu setzen: »Das war mein erster persönlicher Beitrag zum Fortschritt des Radsports.« Später nimmt sich Malaparte vor, die USA per Rad zu durchqueren. Dazu kommt es aber nicht. Der Erste Weltkrieg machte seiner Fahrradliebe ohnehin einen Strich durch die Rechnung. Erst nach dem Krieg findet er sein altes Rad wieder, den »treuen Schutzgeist meiner Jugend, da war er, gealtert, verrostet, aus der Mode«. Das Rad, das ist die Jugend, der Krieg ist das Jahrhundert, das alles blitzschnell altern ließ, und an den Rädern konnte man es erkennen. Daher Malapartes Anruf der Vergangenheit. Vergessen wir nicht, daß der Autor auf allen Seiten und in allen Parteien seiner Zeit war, von den Faschisten bis zu den Kommunisten. Geächtet wurde er ebenso von allen, verbannt und gefangengesetzt schließlich von seinem einstigen Idol Mussolini. Kein Wunder, daß er sich des Fahrrads erinnert, seines eigenen ebenso wie des italienischen Fahrrads an sich: »Das Fahrrad gehört in Italien genauso zum nationalen Kunsterbe wie die Mona Lisa von Leonardo, die Kuppel des Petersdoms oder die Göttliche Komödie. Erstaunlich, daß es nicht von Botticelli, Michelangelo oder Raffael erfunden worden ist.«
Die Geschichte der Erfindungen ist eine Geschichte der nationalen Eitelkeiten, das weiß Malaparte, der seinen Namen dem Bonaparte entgegensetzen wollte, besser als jeder andere. Eines Tages kommt er in die nordenglische Stadt Leeds und sieht dort die Statue eines Mannes mit einem Bronzelenker in der Hand. Es ist der Erfinder des Fahrrads. Seinen Namen will er lieber nicht nennen, sonst ziehe wieder eine Trauerwolke über die Seele Italiens. Auf einem Foto sieht man Malaparte einsam auf dem Dach seiner wunderschönen Villa auf Capri radeln.
Laufrad
Wer mag dieser englische Erfinder gewesen sein? Die populären angloamerikanischen Fahrradhistorien verweisen gerne auf Kirkpatrick MacMillan, einen schottischen Hufschmied, als Erfinder des Fahrrads. Man behauptet, er habe den Rückantrieb erfunden und damit die Grundlage des modernen Fahrrads. Doch die Geschichte ist durchwachsen von Unwahrscheinlichkeiten. In ähnlich populären Quellen findet man einen Hinweis auf einen französischen Comte de Sivrac, der um 1791 auf einem Laufrad, der sogenannten Célerifère, geritten sein soll. Diese Geschichte, wie so viele, stellte sich als eine Fälschung heraus, und man fragt sich, warum sich das Rad so gut zu Fälschungen eignet. Der französische Technikhistoriker Baudry de Saunier hatte sie zum Jubiläum des Fahrrads hundert Jahre später in die Welt gesetzt, um gegenüber den Deutschen nach der Niederlage von 1870 wieder Terrain gutzumachen. Die Fälschung flog auf, als man tatsächlich auf einen Jean-Henri Siévrac stieß, der im Jahre 1817 ein Patent angemeldet hatte auf ein pferdgezogenes Fahrzeug; möglicherweise handelte es sich auch nur um eine Importbescheinigung.
Jubiläen sind immer schon ein schöner Anlaß für Fälschungen gewesen, denn nichts hypnotisiert so wirkungsvoll wie eine runde Zahl im Dezimalsystem. Die Geschichte der Fahrradentwicklungen ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, die historischen Vorgänge zu rekonstruieren. Gut, daß das Internet so leise ist und man die Aufschreie der verletzten Eitelkeiten nicht hören kann, die bei den Diskussionen um die Priorität des Fahrrads zum elektronischen Himmel aufsteigen. Bis heute beten Zeitungen und Bücher die nationalen Mythen fromm nach.
Die Geschichte der Erfindungen weist so manche Parallele zur Geschichte der Literatur auf. Wer ist der Erfinder des Romans? War es ein Spanier (Cervantes), war es ein Engländer (Defoe), eine Engländerin (Aphra Behn), ein Deutscher (Grimmelshausen), ein Franzose (Chrétien de Troyes) eine Japanerin (Murasaki Shikibu), war es ein Grieche (Heliodor)? Am Ende müssen wir sagen, daß es viele sind, die zu einer Erfindung ebenso beitragen wie zu einer literarischen Gattung. Aus Gründen der geistigen Ökonomie, des Partikularismus und der Mnemotechnik beharrt die Nachwelt jedoch darauf, einen Namen präsentiert zu bekommen. Doch die Kehrseite der Repräsentation ist immer Verdrängung.
Die erste Frage ist: Was ist ein Roman, was also ist ein Fahrrad? Wenn ich die Definition festlege, fällt es leichter, Erfindernamen zu nennen. Wenn ein Fahrrad als Zweirad definiert wird, das durch menschlichen Antrieb bewegt wird und lenkbar ist, dann fällt, nach internationalem Konsens, der Name eines badischen Erfinders, eines Individualisten und Exzentrikers, der von der Um- und Nachwelt mit ungerechtem Spott überzogen wurde.
Karl Freiherr Drais von Sauerbronn wurde 1775 in Karlsruhe geboren, wo er 1851 auch starb. Drais war Forstmann (ohne Forstamt) und Erfinder, jedenfalls ein unruhiger Geist, der sich in vielen Bereichen übte. Alles, was mit Bewegung physischer oder geistiger Art, mit Medien der Übertragung und des Speicherns zu tun hatte, faszinierte ihn. Er erfand ein Aufzeichnungsgerät für Klaviere, die erste Tastenschreibmaschine, einen Schnellschreibapparat, einen Fleischwolf und noch manch andere nützliche Geräte. Aber bekannt wurde er durch das Zweirad, auch Veloziped oder Draisine genannt.
Drais interessiert uns, weil die Art und Weise, wie er zu seiner Erfindung kam, eine literarische ist. Die erste entscheidende Frage lautete: Wie kann der Mensch sich unabhängig machen von einem Zugtier, vor allem dem Pferd? Die Frage entstand, weil Europa durch klimatische Probleme und durch die napoleonischen Kriege Hungersnöten entgegensah und Pferde zunehmend schwerer zu halten waren. Es war 1813, das Jahr der Völkerschlacht von Leipzig, Napoleon war auf dem Rückzug von Rußland, da entwikkelte Drais einen vierrädrigen Wagen ohne Pferd, der über eine Tretmühle und später über eine Kurbelwelle angetrieben wurde. Er nannte ihn Fahrmaschine. Der erste Schritt in einer literarischen Montage: Der Mensch macht sich zu seinem eigenen Pferd. Wir können auch sagen, am Ursprung der literarischen Phantasie, vielleicht der Kunst überhaupt, liegt die Verwandlung. Zweiter Schritt: Das Ganze wird halbiert. Nach der Metamorphose folgt die Teilung. Man kann es auch in dieser Abfolge sehen. Am Anfang liegt die Teilung, das heißt, der Wagen wird vom Pferd getrennt, dann folgt die Verwandlung des Menschen in ein Pferd, und schließlich folgt wieder eine Teilung, die zu einer neuen Metamorphose führt. Am Ende steht ein Zentaur, nennen wir ihn den Radfahrer.
Der Technikhistoriker Joachim Krausse hat diese Montage auf ihre literarischen Wurzeln hin zurückverfolgt:
Wird der Wagen halbiert, wird das Pferd halbiert, wird der Reiter halbiert. Es bleiben übrig: zwei Wagenräder, zwei Pferdebeine mit Sattel, ein Oberkörper, der die Zügel in der Hand hat. […] Die Phantasie eröffnet […] eine verrückte Dreiecksbeziehung zwischen Reiter, Pferd und Wagen: Der Reiter ist das Pferd, und das Pferd ist der Wagen! […] Wie in Wortspielen die Wörter, so können bei unserem Umbau die Teile bald diese, bald jene Bedeutung annehmen […] So kann das Rad ein Rad, aber auch ein Bein sein, das Reiterbein kann ein Reiterbein, aber auch ein Pferdebein sein. Das Pferdebein kann ein Reiterbein oder ein Rad sein. […] Der Draisinenreiter ist sowohl ein Kutscher als auch ein Fahrgast als auch ein Pferd. Kindisch! (Krausse, 86)
Am Ursprung also kindlich-kindisches Denken, Spielen mit Gegenständen, die unversehens eine neue Bedeutung erhalten, also ein Spiel, das auch Sprache selbst hervorbringt, den Umgang mit Zeichen, die mal dieses, mal jenes bedeuten. Das Spiel ist die eine Seite, das andere sind die harten Fakten der Naturgesetze, von Schwerkraft, Gleichgewicht, Geschwindigkeit und Energie. Nicht jede Dreiecksbeziehung gelingt, vielleicht nur die seltensten, und eine dieser seltenen hat Drais angeschlagen. Man möchte weiter in seinen Geist schauen, der sich auch mit binären Systemen beschäftigt hat, mit einer Rechenweise, die sich an Leibniz’ 0/1 Schema orientiert. Genau hier liegt ja der Ursprung unseres digitalen Denkens. Leibniz wiederum hat es sich bei den Chinesen an-, vielleicht auch abgeschaut, an den Hexagrammen des I-Ging, den Morsezeichen des Universums. Auch Drais war diesen Morsezeichen auf der Spur. Seine Suche nach Reduktion und Beschleunigung zeigte sich nicht nur in seinen Schreibmaschinen, sondern eben auch im Laufrad. Es sind Konzepte, die die Grundlagen unserer Moderne bilden, vom Computer bis zur Raumfahrt.
Mag das Veloziped schon literarisch gedacht worden sein, so sollte doch die Literatur Drais auf andere Weise noch einholen. Er war der abhängige Sohn eines liebevollen, aber auch strengen Vaters, des badischen Oberhofrichters Karl Wilhelm Drais. Als Richter verurteilte dieser den Mörder des Dichters August Kotzebue, den Studenten Carl Ludwig Sand. Sand hatte den konservativen Kotzebue, der den neuen Nationalismus der Deutschen immer wieder angegriffen hatte, in Mannheim vor den Augen seiner Kinder ermordet mit den Worten: »Hier, du Verräter des Vaterlandes!« Er versuchte sich umzubringen, wurde verhaftet und später hingerichtet. Ein Märtyrer für das junge Deutschland war geboren, man verehrte ihn nicht nur in den Burschenschaften. Eine abgeschnittene Locke oder ein Holzstück vom Schafott wurden als heilige Reliquien aufbewahrt. Für Drais jr. aber bedeutete dies so etwas wie Sippenhaft. Mit dem Urteil seines Vaters zog er sich den Haß der studentischen Burschenschaftler, der Nationalisten sowie der liberalen fürstenfeindlichen Intellektuellen zu. Der Sohn mußte mitbüßen und wurde gemobbt. So wanderte er für einige Jahre nach Brasilien aus. Ein Anhänger Sands, der freiheitsliebende Romancier und Essayist Karl Gutzkow, versetzte der Reputation des jüngeren Drais den Todesstoß, der ihn bis in unsere Zeit zu einem Gespött machte. In seinem zweibändigen, unter dem Pseudonym E. L. Bulwer verfaßten Werk Die Zeitgenossen von 1837 findet sich das Kapitel »Der Stein der Weisen«. Dort zieht er Drais durch den Kakao und macht sich über sein kindisches Fahrspielzeug lustig:
Die ganze Maschine ist auf Lächerlichkeit angelegt, denn nur Kinder können sich derselben, der komischen Gestikulationen wegen, die man dabei machen muß, bedienen. Es sieht fast so aus, wenn man auf der Maschine sitzt, als wollte man auf dem Straßenpflaster Schlittschuh laufen. Genug, seit Erfindung dieses ganz zwecklosen Spielzeugs, hat Hr. von D. so zu sagen seinen Verstand verloren. (Gutzkow, Band I, 254)