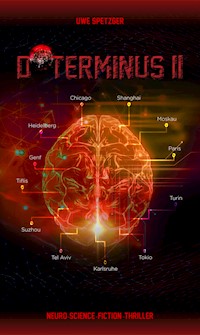
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
D*Terminus II - ein Neuro-Science-Fiction-Thriller mit frei erfundenen Personen und Geschichten, jedoch logisch verknüpft mit wissenschaftlich verbürgten und allgemein akzeptierten Fakten. Ein Buch, das Anlass zum Hinterfragen und "Hirnen" gibt. D*Terminus II handelt von der künstlichen Erweiterung der Hirnleistung durch Manipulation des menschlichen Gehirns. Ein internationales Expertenteam aus 13 Neurowissenschaftlern entwickelt eine neue, abenteuerliche Technologie und beweist in wagemutigen Selbstversuchen, dass dadurch eine unbegrenzte Informationsspeicherung in ihren eigenen Gehirnen erzeugt werden kann. Durch Implantation spezieller DNA-Chips erlangen die Forscher unter anderem die Fähigkeit alle Sprachen zu verstehen und zu sprechen. Die unermessliche Vielfalt an weltweitem Wissen ist nun jederzeit abrufbar. Aus dieser Materie entsteht eine dramatische und unglaubliche Geschichte. Die Macht dieser Innovation und die daraus resultierenden Möglichkeiten, die solch ein übermenschliches Gehirn birgt, verursachen abscheuliche, kriminelle Verwicklungen. Das zuvor beschauliche Leben und Arbeiten der Wissenschaftler in ihren jeweiligen Heimatländern ändert sich fundamental. Sie werden zu tragischen Marionetten in einem weltumspannenden düsteren Netzwerk. Im Kontext wissenschaftlich erwiesener Fakten wird ein facettenreicher, dichter und schillernder Spannungsbogen erzeugt, in dem Fiktion und Realität unzertrennlich zu einer gefährlichen sowie fraglichen - einer neuen - Wahrheit verschmelzen. Wahrlich ein sensationeller Neuro-Science-Fiction-Thriller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 779
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
* * *
Dieses Buch unterliegt den modernsten Statuten von Fake News. Die dargestellten Verbindungen zwischen real existierenden und frei erfundenen Personen beruhen zum Teil auf den utopischen und assoziativen Gedankengängen des Autors sowie auf möglichen Fehlschaltungen von viral infizierten neuronalen Netzwerken und könnten durch einen Echokammer-Effekt bei der Recherche in sozialen Medien noch verstärkt worden sein.
* * *
UWE SPETZGER
wurde 1962 in Karlsruhe geboren. Seit vielen Jahren leitet er als ärztlicher Direktor die Neurochirurgie am Klinikum Karlsruhe und lehrt an der Fakultät für Informatik am Institut für Anthropomatik und Robotik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).
In seiner wissenschaftlichen Karriere veröffentlichte Uwe Spetzger zahlreiche Publikationen und Fachbücher über computer-assistierte Gehirn- und Wirbelsäulenchirurgie.
Aufgrund einer gravierenden Beinverletzung konnte er für einen längeren Zeitraum weder seiner neurochirurgischen Tätigkeit im Operationssaal, noch seiner Lehrtätigkeit am KIT nachgehen. Diese erzwungene Auszeit war Auslöser für seinen packenden Debütroman D*TERMINUS II – mit zahlreichen realen und fiktiven Bezügen zu brisanten aktuellen Themen sowie einem leidenschaftlichen, wenn auch surrealen Blick in die Zukunft der Medizin und Wissenschaft.
D*Terminus II —
ein Neuro-Science-Fiction-Thriller mit frei erfundenen Personen und Geschichten, jedoch logisch verknüpft mit wissenschaftlich verbürgten und allgemein akzeptierten Fakten. Ein Buch, das Anlass zum Hinterfragen und „Hirnen“ gibt.
D*Terminus II handelt von der künstlichen Erweiterung der Hirnleistung durch Manipulation des menschlichen Gehirns. Ein internationales Expertenteam aus 13 Neurowissenschaftlern entwickelt eine neue, abenteuerliche Technologie und beweist in wagemutigen Selbstversuchen, dass dadurch eine unbegrenzte Informationsspeicherung in ihren eigenen Gehirnen erzeugt werden kann.
Durch Implantation spezieller DNA-Chips erlangen die Forscher unter anderem die Fähigkeit, alle Sprachen zu verstehen und zu sprechen. Die unermessliche Vielfalt an weltweitem Wissen ist nun jederzeit abrufbar. Aus dieser Materie entsteht eine dramatische und unglaubliche Geschichte. Die Macht dieser Innovation und die daraus resultierenden Möglichkeiten, die solch ein übermenschliches Gehirn birgt, verursachen abscheuliche, kriminelle Verwicklungen. Das zuvor beschauliche Leben und Arbeiten der Wissenschaftler in ihren jeweiligen Heimatländern ändert sich fundamental. Sie werden zu tragischen Marionetten in einem weltumspannenden düsteren Netzwerk.
Im Kontext wissenschaftlich erwiesener Fakten wird ein facettenreicher, dichter und schillernder Spannungsbogen erzeugt, in dem Fiktion und Realität unzertrennlich zu einer gefährlichen sowie fraglichen – einer neuen – Wahrheit verschmelzen. Wahrlich ein sensationeller Neuro-Science-Fiction-Thriller.
Impressum
© 2019 Uwe Spetzger, Neurochirurgische Klinik,
Städt. Klinikum Karlsruhe, Moltkestraße 90, D-76133 Karlsruhe
Das Werk – einschließlich seiner Teile – ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Der Begriff D*TERMINUS® ist ebenfalls urheberrechtlich geschützt.
www.determinus.de
Danksagung
Meiner geliebten Frau Martina K. Scheurer
Jureck Kulcke
Dr. Hermann Eisele
Cornelia Vogel & Alexander Rosenbaum
Idee zum Begriff D*TERMINUS
Jureck Kulcke, Karlsruhe
Grafik & Layout
projektart – vogel rosenbaum & partner, Karlsruhe
Lektorat
nebensatz.com, Heidelberg
Lektorat und Korrektorat
Rechtanwaltskanzlei Scheurer, Karlsruhe
Foto S. 2: Christian Ernst – Prof. Spetzger im OP (2015)
Foto S. 495: Susann Spetzger – Papa mit Messer im Kopf (2016)
Fotos QR-Codes: Uwe Spetzger, Christian Ernst Illustration Umschlag: © monsitj, ktsdesign – Adobe Stock
ISBN
978-3-7497-2597-7 (Paperback)
978-3-7497-2598-4 (Hardcover)
978-3-7497-2599-1 (e-book)
Umwelthinweis: Dieses Buch inklusive des Schutzumschlages wurden auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
… für meine Familie
… für meine Freunde
… für meine Kollegen
… für Euch … für Dich
UWE SPETZGER
D*TERMINUS II
Ein Neuro-Science-Fiction-Thriller
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Shanghai 2027
Turin im Februar 2017 – zehn Jahre zuvor
Karlsruhe im Frühsommer 2005 – die Idee
Baku im Herbst 2005 – das Team entsteht
Osaka und Tokio im Frühling 2006 – das erste Treffen
Shanghai im Herbst 2006
Moskau kurz vor Weihnachten 2007
Shanghai im Mai 2008 – Tierexperimente oder Religion
Karlsruhe im Sommer 2009 – die Spanienrundfahrt
Heidelberg 2010 – Hans und die Prionen
Chicago im Spätsommer 2011
Tiflis im Oktober 2011
Tel Aviv im Sommer 2012 – biologische Computer und der DNA-Chip
Suzhou im Frühjahr 2013 – das Gift der Cyanobakterien
Genf im Herbst 2013 – die Strahlen und unsere Finanzen
Karlsruhe und Turin im Frühjahr 2014 – die erste Operation bei Giacomo
Genf und Paris im Sommer 2014 – die zweite Operation bei Yvette
Karlsruhe und der Mummelsee im Herbst 2014 – die dritte Operation bei Toshiro
Winter 2014 – die ersten Auswirkungen der Operationen
Shanghai im Frühjahr 2015 – Zentralisierung unseres Projektes
Cricova im Sommer 2015 – geheimes Datenversteck
Shanghai im Frühjahr 2016 – Operationen bei Natalia, Yves und Michael
Winter 2017 – unsere letzte Videokonferenz
Treffen am Turmberg – Weihnachten 2017
Paris im Februar 2018
Shanghai im Frühjahr 2018 – die Tragödie um Wei und seine Frau Qiong
Cricova im Mai 2018 – das große Aufräumen
Hokkaido im Herbst 2018 – die Wanderung mit Opere
Paris im Winter 2018 – Yvettes Tod
Chaos 2019 – die Gruppe zerfällt
Entführung – im Sommer 2027
2027
Vorwort
Das menschliche Gehirn war und ist bis heute immer noch ein unbegreifliches Wunderwerk. Die Steuerung aller Körperfunktionen, das Gedächtnis, die Psyche, die intellektuellen Fähigkeiten, all das ist im rätselhaften Zusammenspiel der Milliarden von Neuronen in unseren Gehirnen verborgen. Als perfekt ausgebildete Neurochirurgen sind wir heute in der Lage, komplexe Operationen am menschlichen Gehirn durchzuführen, ohne dieses geniale Mysterium ernsthaft zu schädigen. In der letzten Dekade hatte der Einsatz modernster Technologien in der Gehirnchirurgie den lang erhofften Segen und Heilung für viele Patienten gebracht. In diesem Zeitalter, der funktionserhaltenden Neurochirurgie, hatten wir Gehirnchirurgen viel dazugelernt und mittlerweile waren wir in der Ära der funktionsverbessernden Therapie angekommen. Doch mit unserem innovativen Projekt, das menschliche Gehirn derartig zu manipulieren, waren wir definitiv zu weit gegangen.
Die Idee unseres innovativen Forschungsprojektes war, einen implantierbaren Neurochip herzustellen und durch angezüchtetes Nervengewebe mehrere Areale im menschlichen Gehirn miteinander zu verschalten. Die künstlich augmentierten Gehirne der operierten Personen erlangten dadurch ein nahezu unbegrenztes Speichervolumen und die Manipulationen ermöglichten alle Sprachen zu verstehen und auch zu sprechen.
Dreizehn renommierte Neurowissenschaftler aus allen Teilen unserer Welt realisierten in enger jahrelanger Zusammenarbeit dieses unglaubliche Projekt und stellten sich schließlich alle wagemutig der experimentellen operativen Manipulation an ihren eigenen Gehirnen. D*TERMINUS II schildert die obskure Verwirklichung eines grandiosen Wissenschaftsprojektes und den glorreichen Aufstieg sowie den dramatischen Niedergang der Protagonisten.
Das Forscherteam in alphabetischer Reihenfolge:
(1) Charles war das technische Gehirn: Ein wahres Computergenie, das in Stresssituationen mit einer enormen Geschwindigkeit und unglaublichen Geschicklichkeit seinen Bleistift zwischen Daumen und der ersten drei Fingern balancierte und damit stets alle nervös machte. Es gab niemanden der mit höherer Geschwindigkeit einhändig auf eine Computertastatur einhackte und das mit minimaler Fehlerquote. Charles war mit Leib und Seele Informatiker im Fachgebiet Mensch-Maschine-Schnittstelle und humanoide Robotik am renommierten KIT.
(2) Giacomo war Neuroanatom an der Universität in Turin und ein liebenswert Verrückter. Er hatte uns aus so manch hitziger und nicht enden wollender Diskussion herausgeholt mit der Frage, »was für einen Wein gibt es heute eigentlich zum Abendessen«. Gelegentlich nannten einige von uns ihn nicht Giacomo, sondern Jakobus obwohl er nicht in allen Belangen, streng katholisch war.
(3) Hans war ein typischer Grundlagenforscher: Introvertiert und hochbegabt, der seine Meinung nur dann kundtat, wenn jedes Detail korrekt und wissenschaftlich zu 125% belegbar war. Ein typischer Nerd, der aufgrund seiner wissenschaftlichen Scheuklappen nur selten den Blick von seinem Forschungsthema abwendete. Hans wohnte noch bei seiner Mutter und arbeitete als Tumorbiologe am European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg.
(4) Jeannette war eine phänomenale Neurogenetikerin an der Tbilisi State Medical University in Georgien. Mit ihren karierten Wollröcken, den engen Rollkragenpullovern und ihrer etwas zu gegenständlichen, aber suberotisch wirkenden Brille sah sie stets wie eine junge Studentin aus. Jeannette wirkte immer viel kleiner, zerbrechlicher und unnahbarer, als sie in Wirklichkeit war.
(5) Jinjin - die Goldene - war eine hochangesehene Neurowissenschaftlerin und Leiterin des tierexperimentellen Forschungslabors an der Tongji Universität in Shanghai. Von ihrer Körpersprache her sowie ihrem Outfit betrachtet, wäre Jinjin eher als die chinesische Variante von Eminem durchgegangen, was an ihrem finsteren Gesichtsausdruck, ihrer ruppigen Sprache und ihren gold-blondierten, struppig-kurzen Haaren lag.
(6) Michael sah aus wie ein distinguierter Aristokrat mit einer ihn umgebenden Corona und entstammte einer der reichsten Bankiersfamilien der Schweiz. Die finanzielle Unterstützung seines Vaters sollte sich initial als Segen aber langfristig auch als Fluch für unser Projekt erweisen. Er war einer der innovativsten Physikprofessoren, der unter anderem am CERN für die European Organization for Nuclear Research in Genf tätig war.
(7) Natalia war eine grandiose Neurochirurgin mit dem Fachgebiet moderne Psychochirurgie am Burdenko Institut in Moskau. Sie war eine wunderschöne Frau, die unter Zuhilfenahme aller Tricks ihr Alter geschickt verbarg. Neben ihrer Forschungstätigkeit war ihr Alter daher eines der bestgehüteten Geheimnisse: Ihre ewig jugendliche Mimik, die dynamischen Bewegungen ihres durchtrainierten Körpers und die teuren Cremes mit unaussprechlichen Inhalten kaschierten ihr wahres Alter perfekt. Natalia konnte hinreißende Liebesgeschichten erzählen, wobei sich die meisten am Ende als ihre eigenen herausstellten.
(8) Sarah war eine Granate und eine nicht zu bremsende und überschäumende Persönlichkeit. Sie hatte ihr AHDS perfekt in ihre wissenschaftliche Karriere integriert und war als Dozentin für Elektrotechnik an der Universität in Tel Aviv sowie bei mehreren Hightech Unternehmen in ihrem Spezialgebiet Nano- und Biochiptechnologie als Beraterin tätig. Wenn sie ihre Ritalin Tabletten vergaß, was durchaus häufiger vorkam, hielt sie diese Mehrfachbelastung problemlos mehrere Tage ohne Unterbrechung durch.
(9) Toshiro war ein undurchschaubarer, hagerer Asket, ein genialer und hochintelligenter japanischer Informatiker und Mikrochipdesigner, der mit einem furchtbaren und schlecht verständlichen Akzent Englisch sprach. Nicht nur von seinem Erscheinungsbild, sondern auch von seiner Geisteshaltung her verkörperte Toshiro die traditionelle Aura eines ehrwürdigen Samurais.
(10) Wei war Bakteriologe und Virologe an der Soochow University in Suzhou und sah mit seinem kantigen Gesicht und seinem muskulösen Körper wie ein olympischer Zehnkämpfer des chinesischen Leichtathletikverbandes aus. Physisch war Wei ein Superschwergewicht und fast unüberwindbar, psychisch jedoch eher Fliegengewichtsklasse. Seine mysteriöse Hinrichtung durch zwei gezielte Kopfschüsse signalisierte den tragischen Wendepunkt unseres Forschungsprojektes.
(11) William war ein angesehener Neurologe mit dem Spezialgebiet experimentelles Sprachmonitoring an der University of Illinois in Chicago. Er war mehrsprachig aufgewachsen und für uns immer das lebende, multilinguale und intellektuelle Bindeglied, die eigentliche Sprachreferenz in unserer Forschergruppe. Er kommunizierte fliesend in acht Sprachen und bewies uns damit stets, wie unglaublich das menschliche Gehirn differenziertes Sprechen umsetzen konnte.
(12) Yvette war unsere ethisch-moralische Instanz. Sie war Professorin am Lehrstuhl für Neuropsychologie an der Sorbonne in Paris und eine charismatische Grazie. Nach ihrer Einschätzung war das freundschaftliche Grundverständnis der gesamten Gruppe untereinander, sowie der gemeinsame und unbändige Forscherdrang ein unglaublicher Glücksfall, aus dem ein familiengleicher Freundeskreis entstand, der manch dramatische Zerreißproben überstand.
Ein aus 13 auserwählten Individualisten unter abenteuerlichen Geschehnissen zusammengewachsener Freundeskreis und eine fabelhafte Schicksalsgemeinschaft aus weltweit anerkannten sowie wagemutigen Neurowissenschaftlern.
* * *
Die Erzählung unserer tragischen Geschichte beginnt in Shanghai im Jahr 2027 nach einem Schädel-Hirn-Trauma des Neurochirurgen Yves und dem abscheulichen Tod seines Freundes Wei, dem genialen chinesischen Virologen. War damit das grandiose und mittlerweile seit über zwanzig Jahren sehr erfolgreich verlaufende, abenteuerliche Hirnforschungsprojekt letztendlich doch gescheitert?
* * *
Es war ein sehr holpriges Erwachen, ein mir bis dato völlig unbekanntes und aus der alleruntersten Etage meiner geistigen Verfassung heraufsteigendes unwirkliches Gefühl. Ich vernahm aus meiner diffusen, geistigen Umnachtung den barschen Wortlaut: »xing lai«, was so viel bedeutete wie: »Los aufwachen – lange Nase«. Ein durchdringendes akustisches Signal in heiserem Xiang, das sich mühsam den Weg von meinem linken Ohr zum Hörzentrum und schließlich bis in die tieferen Gehirnareale meines Bewusstseins bahnte. Hinzu kamen die etwas zeitversetzt auftretenden optischen und olfaktorischen Sinnesreize, die mich zäh aus meinem komaähnlichen Zustand in das vermeintliche Jetzt beförderten. Mittenhinein in einen frühen aber schon recht schwülen Sommermorgen in der leeren Bar Rouge im Zentrum von Shanghai.
Mein ärztliches Gehirn diagnostizierte an mir eindeutig eine Störung des Innenohrs mit einem Ausfall des Gleichgewichts- und Hörorgans. Mein Bogengangsystem meldete ‚schiefe Ebene‘ und ich vernahm nur ein hochfrequentes, hellgraues Rauschen auf meinem linken Ohr. Der bellend raue, chinesische Befehlston war eindeutig nur auf einem Ohr zu hören. Ich empfand diese furchtbare Geräuschbelästigung in Mono momentan jedoch mehr als ausreichend. Ob ich diese lauten Hasstiraden in Stereo überhaupt in meinem derzeitigen Zustand ertragen hätte?
Langsam wurde mir klar: Mein linkes Ohr war taub. Vermutlich durch einen heftigen Schlag gegen meine Schädelbasis, denn es kam ein pochender Schmerz an meiner linken Kopfseite hinzu, der sich kontinuierlich steigerte. Mehr konnte ich aktuell nicht aus meinem Gedächtnisspeicher hervorholen, da mir die psychische Anstrengung des Erinnerns bereits recht heftige Kopfschmerzen bereitete. Mein angeschlagenes Gehirn versuchte sich durch die Schmerzsensationen möglicherweise aktiv vor diesen aufsteigenden, dunklen Gedanken zu schützen. Neben der sich langsam entfernenden, nörgelnden Blechstimme hörte ich sanftes, pulssynchrones Rauschen und leise Wischgeräusche. Die Lokalisierung, woher dieses Wischen kam, gelang mir aber nicht. Durch den Ausfall meines rechten Ohrs war auch die akustisch-räumliche Zuordnung verloren gegangen. Die leiser werdenden Beschimpfungen waren kein lupenreines Xiang. Es hörte sich aufgrund der Verschmelzung der Alveolaren eher nach einem Sichuan-Dialekt an, was typisch für die südwestlichen chinesischen Sprachen ist, analysierte ich. Es freute mich, dass mein Gehirn langsam wieder vernünftig zu arbeiten begann. Ich registrierte meine sich kontinuierlich verbessernde Hirnleistung, was mich beruhigte.
Mein Geruchssinn identifizierte schließlich eindeutig einen schlecht ausgespülten älteren Putzlappen. Mein Geschmackssinn analysierte etwas Eisenhaltiges mit Wachholdernote. Überdurchschnittlich lange benötigte ich jedoch für die kognitive Rekonstruktion und die korrekte Deutung meiner Sinneswahrnehmungen. Die Auswertung und sinngemäße Verarbeitung waren eindeutig gestört. Es dauerte viel zu lange, bis mir meine Situation vor einigen Stunden zunehmend klarer wurde. Kurz vor dem Schlag gegen meinen Kopf, der diese erhebliche Amnesie verursacht haben musste, hielt ich ein Glas Gin in der rechten Hand. Der frische, noch scharfkantige Eiswürfel hatte vermutlich beim Anprall des Faustschlages meine Mundschleimhaut lazeriert. Ich öffnete meinen Mund und palpierte vorsichtig mit dem Zeigefinger die obere und untere Zahnreihe. Die Backenzähne schienen festverankert. Aber beim Schließen des Mundes durchstach mich ein elektrischer Schmerz an der Innenseite der Wange, wie wenn man unkontrolliert auf eine Fischgräte biss und die sich gnadenlos durchs Zahnfleisch bis auf den Kieferknochen bohrte.
Im Moment erfüllte ich die klassischen Kriterien eines Patienten mit einem Schädelhirntrauma. Zur eigenen Person war ich voll orientiert, zum Ort so einigermaßen und meine zeitliche Orientierung war nur sehr unscharf vorhanden. Hier war mir gerade mal das Jahr 2027 präsent. An den Wochentag und selbst an den Monat konnte ich mich momentan nicht erinnern. Dass ich mit dem Gesicht nach unten neben einem stinkenden Putzlappen auf dem dreckigen Fußboden lag, wurde mir nur ganz allmählich bewusst.
Parallel zu dem sich sortierenden Kurzzeitgedächtnis überprüfte ich in meiner stabilen Seitenlage meine neurologischen Funktionen. Die Finger ließen sich zwar etwas verlangsamt und mühsam bewegen, folgten aber völlig sinngemäß der motorischen Befehlskette. Ich streckte gleichzeitig den linken Zeige- und Ringfinger. Die restlichen Finger an der linken Hand ließ ich gebeugt. Eine banal klingende, jedoch bewegungstech - nisch äußerst schwierig durchzuführende Handbewegung. Aber auch das funktionierte einwandfrei und ich glaubte dabei mein eigenes Lächeln zu spüren. Die Fingerbewegungen induzierten jedoch diffuse Schmerzen in meiner linken Hand und beim Bewegen der Finger fühlte ich feuchte Textilfransen. Simple motorische und sensorische Reize schienen also wieder zu funktionieren. Auch die neuronalen Verschaltungen in den tiefen, vorderen Hirnanteilen waren somit unbeeinträchtigt. Schließlich konnte ich durch die Kombination der Geruchsinformation zusammen mit der haptischen Wahrnehmung meiner Finger das Objekt, das sich neben meinem Kopf befand, eindeutig als einen Putzlappen identifizieren. Die optische Sinnesinformation durch das gemächliche Öffnen der Augen bestätigte dann tatsächlich ein graubraunes, abscheulich dreckiges Textilgeflecht, nur wenige Zentimeter vor meiner Stirn entfernt. Ich versuchte daraufhin aktiv zu akkommodieren, um auf das Objekt direkt vor meinen Augen scharfzustellen. Dies erbrachte die eindeutige visuelle Bestätigung nach erfolgtem Abgleich aus den Assoziationszentren meines Gehirns – Putzlappen.
Das Akkommodieren, ein aktiver Vorgang durch die Anspannung der entsprechenden inneren Augenmuskeln, verursachte jedoch durch diese Muskelkontraktionen bei mir schmerzhafte Missempfindungen hinter beiden Augen. Reflektorisch schaltete ich meinen Blick sofort wieder auf Unendlich. Daher verblieb die im Dunst versinkende, leicht verzerrte Skyline von Pudong lange wie ein Standbild in meinem Sehzentrum. Mein optisches System fokussierte abwechselnd auf Nah und Fern, also auf den direkt vor mir liegenden Putzlappen und auf die Skyline von Pudong, die man durch die großen Fenster sah. Ich erkannte den Oriental Pearl Tower in der scheinbaren Unendlichkeit, der aber völlig irreal, wie der gesamte Horizont etwa im Winkel von 45 Grad, schräg nach oben verlief. Die dritte kleinere, rote Kugel und damit die gesamte Spitze des Pearl Towers verlor sich im diffusen morgendlichen Smog von Shanghai. Ein wahrlich schräges Bild. Die verkippte Wahrnehmung des Wahrzeichens von Shanghai wurde aber nicht nur durch meine stabile Seitenlage verursacht.
In meiner Ausbildung zum Neurochirurgen hatte ich gelernt, dass Patienten mit einem Schädelhirntrauma von einer Lagerung mit erhöhtem Kopf profitieren. Hierdurch wird unter anderem der venöse Rückstrom des gestauten Blutes verbessert und das geschädigte Gehirn kann abschwellen. Dadurch wird der Hirndruck gesenkt; das war dringend notwendig bei mir. Dementsprechend fasste ich den Plan: Aufstehen und Kopf hoch – die Maximalvariante der Hirndrucktherapie.
Beiläufig bemerkte ich, dass mein Langzeitgedächtnis ohne Einschränkungen funktionierte. Die Erinnerungen an meine geliebte und wunderschöne Frau waren völlig unbeeinträchtigt, greifbar nah, fast real und hochemotional. Ich spürte mein Herz sofort schneller schlagen bei den Gedanken an Stella. Auch die Stimmen meiner Kinder wie auch meiner Mutter waren sofort präsent. Ebenso der strenge, aber meist gütige Blick meines Vaters. All dies erschien mir unverfälscht und nicht manipuliert.
Die Umsetzung meines Plans aufzustehen und diesen Ort hinter mir zu lassen, war gedanklich schnell gefasst, aber mit deutlich mehr motorischen Umsetzungsproblemen behaftet, als erwartet. Es war das offenporige, abscheulich stinkende, dunkelgraue fransige Textil vor meinem rechten, direkt über dem Boden liegenden Auge, was mich stets daran erinnerte, dass dies keine für einen Neurochirurgen adäquate Stelle zum Übernachten war. Definitiv eine Ausnahmesituation. Die gesammelten Sinneswahrnehmungen aus den jeweiligen Assoziationszentren wurden in meinem durchgerüttelten Gehirn im Moment nicht sinngemäß und vor allem nicht schnell genug sortiert. Alle Informationen fügten sich – nicht wie sonst – spontan zu einem schlüssigen Bild in meinem Kopf zusammen. Mit dem langsam zurückkehrenden Bewusstsein – und aus den nun stetig ankommenden Informationen, Erinnerungen und Sinnesreizen – analysierte mein verlangsamt arbeitendes Gehirn meinen derzeitigen Gesamtzustand. Der war äußerst bedenklich.
Objektiv betrachtet lag da kurz vor Sonnenaufgang ein regungsloser Mann in einem hellen, maßgeschneiderten Anzug auf dem schmutzigen Boden eines der angesagtesten Clubs in Shanghai. Kein ruhmreicher Anblick und kaum vorstellbar, dass dieser Mann in der letzten Woche den höchsten nationalen Preis für Wissenschaft und Technik in China verliehen bekam. Grotesk, wie sich eine ältere Putzfrau verzweifelt mühte, ihm auf die Beine zu helfen und erschrak, als er dann langsam, wie eine erwachende Echse, seinen kaltblutigen Kopf anhob.
Durch die Lageänderung ins Aufrechte nahm das Schwirren in meinem Kopf erheblich zu. Die wohligen und mir ein Lächeln auf das Gesicht zaubernden Gedanken an meine Frau und meine Kinder wurden durch den akuten Schwindel, das Kämpfen gegen den Würgereiz und den Drang zu erbrechen jäh in den Hintergrund gedrängt. Wie auf einem Schiff bei rauer See versuchte ich jetzt mein geschädigtes Gleichgewichtsorgan im Innenohr durch optische Informationen zu überlisten. Ich schaute angestrengt auf den Horizont, diese Maßnahme hatte mich bisher immer zuverlässig vor Seekrankheit bewahrt. Genauer gesagt versuchte ich eine der im Morgenlicht rot glitzernden Kugeln des Pearl Tower zu fixieren. Der Blick durch die großen, offenen Terrassenfenster der Bar Rouge half mir allerdings im Moment überhaupt nicht weiter. Die gegenübergelegenen Hochhäuser von Pudong schienen sich unharmonisch zu bewegen. Durch das Aufrichten aus meiner Seitenlage zeigte der Pearl Tower nun zwar wieder senkrecht nach oben, wie es sich für ein Wahrzeichen auch gehört, aber der Turm nahm dennoch keine normale Haltung ein. Vor meinen Augen schien sich der Pearl Tower mit seinen roten Kugeln in der Skyline von Pudong zu bewegen und wand sich vor meinen Augen wie ein zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmter Regenwurm.
Es waren nur ein Tsingtao und ein Martini Bianco. Der Gin Tonic war durch den Faustschlag größtenteils im Anzug versickert. Unweigerlich drängte sich mir der Verdacht auf, dass mein Freund Wei, seinem Namen – der Mächtige – alle Ehre machend, mir einen ordentlichen Haken verpasst hatte. Womöglich hatte er mir dazu auch noch einen chemischen Knockout im Martini verabreicht.
Auf die alt und gebrechlich wirkende, aus Südchina stammende Putzfrau Chen Lu gestützt, wankte ich auf die noch im Schatten liegende große Terrasse der Bar Rouge hinaus. Mir war sterbensschlecht und ich erbrach mich völlig unkontrolliert über die Brüstung der Terrasse aus der siebten Etage hinab auf den Bund. Morgentau strich mir großmuttergleich über meine jetzt nicht nur blutige und zerknitterte, sondern nun auch anderweitig ramponierte Anzugjacke. Sie brachte mir ein Glas Leitungswasser. Dies enthielt wahrscheinlich weniger Gift, aber mindestens genauso viel Schadstoffe wie der Martini von gestern Abend. Ich hoffte beim Runterschlucken des handwarmen, extrem nach Chlor riechenden Wassers, dass die opake Trübung nur von den Spülmittelresten herrührte, die sich noch im Glas befanden. Das Wasser schmeckte scheußlich, tat mir aber dennoch gut. Chen Lu setzte sich neben mich auf eines der weißen Sofas ohne Rückenlehne. Sie hatte endlich aufgehört mit ihren gebetsmühlenartigen Beschimpfungen. Ihr nervtötendes Nörgeln war in echtes Mitleid umgeschlagen.
Dann schaute der erste Sonnenstrahl zwischen den Hochhäusern hindurch und nahm die morgendlichen Farben aus der Skyline von Pudong. Die dicht gedrängten Hochhäuser sahen gegen das grelle Sonnenlicht wie die untere Zahnreihe eines gewaltigen Drachens aus. »Eine Zahnreihe, die dringend eine kieferorthopädische Sanierung notwendig hätte«, sprach ich leise vor mich hin. Es mussten psychoaktive Substanzen in dem Drink gewesen sein. »Chen Lu, bitte bringe mir noch mal ein Glas Wasser, aber spül es bitte vorher aus«, sagte ich zu ihr in Xiang. Sie lächelte freudig und konnte ihre Verwunderung über meinen lupenreinen südchinesischen Dialekt kaum verbergen. Glücklicherweise war heute früh niemand außer mir und Morgentau im sonst so überfüllten Club. Äußerst ungern hätte ich in meinem erbärmlichen Zustand ein YouTube-Video mit meinem Namen in den sozialen Netzwerken gefunden.
Die Sonne blendete und als ich die Augen schloss bemerkte ich, dass hinter meinen geschlossenen Augenliedern viel zu bunte Trugbilder und virtuelle Videosequenzen abliefen. Rasend schnell, wie in einem Zeitraffer. Je länger ich die Augen geschlossen hielt, desto hektischer und beunruhigender wurden diese schnell geschnittenen Bildfolgen. Mein Gedächtnisspeicherchip assoziierte damit spontan den Film Koyaanisqatsi: Life Out of Balance – das cineastische Meisterwerk aus dem Jahre 1982. Nur die Musik, die ich zu diesen apokalyptischen Bildern zu hören glaubte, war nicht von Philip Glass. Ich hörte die Musik in Mono, da ich in meinem linken Ohr nur ein wasserähnliches Glucksen vernahm und seltsamerweise war die Musik von Dr. Alban mit seinem Hit aus dem Jahr 1993 – Sing Hallelujah!
Diese Zeitsprünge beziehungsweise die optische und akustische unpassende Melange verwirrten mich zunehmend. Die Bilder rasten hinter meinen Augenlidern, aber das Öffnen der Augen war ohne Sonnenbrille auch keine vernünftige Alternative. Ich hatte Panik, dass bereits durch ein kurzes Augenöffnen das grelle Sonnenlicht, gebündelt von der Augenlinse und durch den knöchernen Sehnervenkanal hindurchgeleitet, ein schwarzes Loch in den dahinterliegenden Hypothalamus brennen könnte. Als ich mich umdrehte und mein Gesicht aus der Sonne nahm erkannte ich, dass die Musik nicht aus meinem traumatisierten Hirn, sondern aus dem Kopfhörer des DJs kam. Der stand hinten im Club vor seinen digitalen Plattentellern und studierte die Übergänge der Tracks für den kommenden Abend ein. Also doch keine massiven akustischen Halluzinationen beruhigte ich mich selbst. Ob die optischen Trugbilder mit der sich bewegenden Skyline von Pudong noch vorhanden waren, konnte ich gegen das grelle Sonnenlicht nicht ausmachen.
Ich sollte schnellstens hier verschwinden, war mein nächster annähernd klarer Gedanke. Somit fasste ich den Plan, sofort aufzustehen, sich bei Chen Lu zu bedanken und sich zu verabschieden. Wie konnte eine greisenhafte Putzfrau mit einer derartig skoliotisch verkrümmten Wirbelsäule überhaupt arbeiten? Und wie konnte jemand mit solch einer unfreundlichen, nörgelnden Stimme denn nur Morgentau heißen? Chen Lu gab Sprechlaute von sich, wie sie beim Aufschrauben festsitzender Radmuttern beim Wechseln der Winterreifen entstehen. Ich musste mich weit zu ihr hinunterbücken, so klein und verbogen war sie. Völlig unangemessen küsste ich sie aus einem Gefühl unendlicher Dankbarkeit für die fürsorgliche Hilfe auf ihre faltige Stirn und sagte: »Merci pour tout«. Warum ich französisch mit ihr sprach und ob sie dies als Chinesin überhaupt verstand? Ich wusste es nicht, und passend zu meinem schmerzenden Unterkiefer sang im Hintergrund der coole Zahnarzt immer noch – Hallelujah. Meine Güte, war mein Hirn durchgeschüttelt!
Im Fahrstuhl war es stickig. Der Schalter für die Lüftung war nicht zu betätigen. Irgendein begabter Feuerspucker muss die 18 Sekunden dauernde Auf- oder Abzugfahrt dazu genutzt haben, den hierfür angebrachten Plastikwippschalter der Aufzuglüftung plan einzuschmelzen. Die Aufzugtür öffnete sich im Erdgeschoss, aber wie ich in das bereitstehende Taxi gekommen war, diese kurze Zeitsequenz fehlte mir dann wieder. Mein Großhirn arbeitete definitiv noch nicht adäquat. »Zur Tongji-Universität«, sagte ich zu dem nicht vorhandenen Fahrer. Wie selbstverständlich sprach ich mit dem Display des Monitors, wo mich, wie in den modernen chinesischen Taxen heute üblich, ein lächelndes Emoji begrüßte. Das animierte Emoji fragte mich freundlich in Chinesisch nach meinem Fahrziel. Unmittelbar nachdem meine europäischen Gesichtszüge durch den Scanner detektiert worden waren und noch bevor ich antworten konnte, wechselte die Sprache ins Englische. Nach weiteren zwei Sekunden begrüßte mich die Stimme dann ganz persönlich mit meinem Namen und bestätigte mir auf Deutsch die Fahrzeit und Kosten bis zum Zielort. Die Gesichtserkennungssoftware war hier in China bereits seit Jahren allgegenwärtig und auf allerhöchstem Niveau.
Mir wurde bewusst, dass ich gar nicht genau wusste, warum ich ausgerechnet dorthin wollte. Ich fasste mir hektisch hinter mein Ohr und fühlte den flachen Chip über dem Hinterhaupt. Glücklicherweise ging der Schlag auf und nicht hinter das Ohr, dachte ich. Dass mein multimodaler Sprachchip voll funktionsfähig war, hätte mir eigentlich bereits früher auffallen können, da ich mich mit Morgentau in der Bar Rouge problemlos in Xiang unterhalten hatte. Falls es mir nicht in den nächsten Minuten einfallen sollte, was ich an der Tongji-Universität wollte, könnte ich zumindest mal eine Überprüfung meiner elektrophysiologischen Neurochips in unserem Labor durchführen lassen. Am besten sollte ich gleich eine MR-Tomographie machen lassen, denn mein Gedächtnischip funktionierte definitiv nicht adäquat. Ich erinnerte mich nur zögerlich daran, dass nachmittags unsere Forschergruppe immer freie Untersuchungszeiten an der neuen 12Tesla-Maschine hatte.
Auf der Yan‘an Elevated Road hatte sich ein Unfall ereignet und auf dieser Hochstraße gab es kein Entkommen. Es schien einer der neuen E-Mobile zu sein, das da vorne brannte und gerade von einem robotischen Greifarm hochgehoben wurde. Ich erkannte nicht ob es ein Nio war, da dunkler Qualm das Fahrzeug komplett umhüllte. Das Problem mit brennenden Elektroautos war immer noch nicht adäquat gelöst, denn brennende Akkus waren eigentlich nicht zu löschen, man konnte sie nur kühlen. Daher hatte man sich in Shanghai bereits vor einigen Jahren für die pragmatische Variante mit mobilen Abklingbecken entschieden. Es war einer dieser großen roten Feuerwehrfahrzeuge, der die zweite Fahrbahn versperrte und in dessen 25.000 Liter Wassertank gerade das lichterloh brennende Elektroauto untergetaucht wurde. Aus dieser unfallbedingten Engstelle in der fünfspurigen Straße resultierte dann der obligate morgendliche Verkehrsinfarkt. Wie bei einer Herzkranzgefäßverengung schoben sich dicht an dicht die autonom fahrenden Autos langsam an den Engstellen vorbei. Wie die roten Blutkörperchen in unserem Gefäßsystem, nur dass sich die Karosserien der Autos nicht verformten, um so selbst den geringsten Platz zu nutzen. Darüber sollten die sonst so innovativen Köpfe von VW oder Mercedes mal nachdenken. Solch eine platzsparende Verformung oder die Sludge-ähnliche Aneinanderreihung der modernen Autos, wie es Blutkörperchen an Engstellen im Blutgefäßsystem vollführen, das wäre für das Stadtmobil der Zukunft eine echte Optimierung. Hier hängt das alte Europa immer noch viel zu sehr am Individualverkehr und damit weltweit hinterher.
Ich saß nun schon über eine Stunde im autonom fahrenden Taxi und empfand dies als schikanöse Bevormundung und unglaubliche Beschneidung meiner Individualität; als staatlich diktierte Freiheitsberaubung. Obwohl ich nun bereits länger in Shanghai lebte und täglich dieser angeordneten Gleichschaltung ausgesetzt war, entdeckte ich hier sofort wieder den typischen Europäer in mir. Diese doch recht überschaubare Distanz vom Bund bis zur Tongji University war sonst mit meinem glücklicherweise immer noch individuell steuerbaren Motorrad bei taktisch geschickter Fahrweise deutlich unter 15 Minuten machbar. Seit der Einführung des 6G Netzwerk Standards in ganz Shanghai im letzten Jahr war jedoch das Ende des motorisierten Individualverkehrs absehbar. In Europa wurden solche gesellschaftlich relevanten Themen immerhin noch diskutiert, hier in China wird es voraussichtlich einen einstimmigen Beschluss der Volkskammer geben, der dann zügig umgesetzt wird.
Ganz unvermittelt wusste ich plötzlich wieder, warum ich hierher unterwegs war. Jinjin hatte mir gestern Nachmittag mit Nachdruck gesagt und danach auch noch mehrere Drohmails geschrieben, dass ich unbedingt mein Motorrad aus dem Geräteschuppen an der Universität entfernen musste. Für heute Mittag hatte sich nämlich erneut der nationale Wissenschaftsrat zur Begutachtung unseres Brain-Machine-Interface-Projekts angekündigt. Das ältere Motorrad unter all den medizinisch-technischen Geräten und dazu mit einem Regierungskennzeichen, das wäre der glatte Genickbruch für das gesamte Forscherteam. Daran konnte ich mich plötzlich detailliert erinnern. Aber schon bei der Farbe meines Bikes hatte ich wieder Probleme. War es gelb, rot oder schwarz? Zudem hatte ich keine Ahnung, was für ein Fabrikat es war. Allerdings wusste ich, dass es über die Tongji-Universität zugelassen war und dass es ein offizielles Regierungskennzeichen hatte. Wie ein Schuljunge beruhigte ich mich selbst: Du hattest schon so viele Motorräder – auch in Karlsruhe und in Paris steht oder stand eine Ducati –, kein Wunder, dass es dir gerade nicht einfällt. Urplötzlich hatte ich ein verzerrungsfreies und präzises Bild der Monster 1200S in glänzendem Liquid Concrete Grey vor meinen Augen. Anscheinend schien die Verbindung zu meinem Speicherchip jetzt wieder zu funktionieren und ich konnte mich nun genau erinnern.
Unter der graulackierten Heckabdeckung der Sitzbank war ein perfekt passendes, gut geschütztes Geheimfach eingearbeitet, in dem meine kleine schwarze österreichische Freundin untergebracht war. Vor genau zwei Tagen hatte sich Jinjin mit fadenscheinigen Argumenten meine Glock ausgeborgt. Ich hatte sie ganz bewusst nicht gefragt, was sie denn mit der Waffe vorhatte, obwohl ich neugierig war. Nach ihrer Aussage hatte sie mir die Pistole komplett geladen mit siebzehn Patronen wieder zurückgegeben. Daran konnte ich mich jetzt auch wieder erinnern. Das autonom fahrende Taxi bog endlich auf den Campus der Universität ein und hielt exakt vor dem Geräteschuppen. Ich bezahlte mit dem Chip in meinem linken Unterarm und stieg aus. Ohne darüber nachzudenken, und anscheinend als motorisch abgespeichertes Bewegungsmuster, gab ich die zwölfstellige Zahlenkombination fehlerfrei ein. Meine Finger glitten hierbei fast automatisch, flüssig und gezielt von meinem Kleinhirn gesteuert über die Metalltastatur. Zusätzlich hielt ich meinen subkutan implantierten Identifikationschip an das Lesegerät und das schwergängige alte Rolltor mühte sich mit mürrischen Lauten langsam nach oben. Das Geräusch des sich widerwillig bewegenden Tors aktivierte akustische Assoziationen zu Morgentaus nörgelnden Lauten von gerade eben und meine pochenden Kopfschmerzen meldeten sich auch wieder. Aktiv aus meiner Erinnerung hätte ich diese Zahlenfolge zum Öffnen des Tors, die seit einigen Monaten nun wieder wie früher zusätzlich zur elektronischen Erkennung benötigt wurde, definitiv nicht benennen können.
Es begann damals vor einigen Jahren mit dem Entsperren von Mobiltelefonen mittels Fingerabdruckscans. Diese hochsensiblen Daten – die exakte Kontur des individuellen Fingerabdrucks – blieb selbstverständlich nicht nur auf dem jeweiligen Gerät abgespeichert, sondern war durch entsprechende Schadsoftware relativ einfach frei im Darknet zugänglich. Mit Hilfe eines preiswerten 3D Druckers konnte in kürzester Zeit das Oberflächenrelief jeder Fingerkuppe präzise nachgebildet werden. Beim größten online Bankraub im Jahr 2023 wurden durch gefälschte Fingerabdruckscans Milliardenbeträge veruntreut. Gesicherte Türen sowie Schleusen zu Sicherheitsbereichen waren mit dieser Technologie sekundenschnell überwindbar und die als unüberwindbar angepriesene biometrische Sicherheitstechnik verpuffte in einem weltweiten Betrugsskandal. Daher wurde im letzten Jahr auch die Öffnungsmechanismen der Türen mit der zuvor üblichen Fingerprintmethode in unserem Labor eingestellt.
Wir waren nun angekommen im Zeitalter der Entindividualisierung. Moderne, vermeintlich intelligente Menschen hatten es letztendlich geschafft, ihre eigenen detailgetreuen Nachbildungen zu generieren, allerdings mit denselben Fehlern und individuellen Unzulänglichkeiten – egoistische, aber keinesfalls makellose Kopien ihrer selbst. Alles und Jeder war aufgrund spezieller Algorithmen reproduzierbar geworden. Die humane Individualität war genauso wie die singuläre Wahrheit relativ und damit interpretierbar geworden. Für unser tägliches Leben benötigten wir überall gesicherte, eigenständige Algorithmen, sekündlich wechselnde Passwörter und nicht einmal unserer als so individuell betrachteter genetischer Code war einzigartig, sondern mittels banaler Sequenzanalyse ermittelbar geworden. Geschweige denn unser Fingerabdruck – eine mittlerweile veraltete und gänzlich unsicherer Technologie. Unsere körperliche Individualität und sämtliche biometrische Daten waren wie jeder andere Algorithmus manipulierbar und austauschbar geworden, nur unsere Gehirne bargen noch genügend Individualitätsmerkmale.
Ich dankte meinem gut trainierten Gehirn und ging wie programmiert zu meinem Motorrad, öffnete die graue Verkleidung an der Sitzbank und nahm die matt glänzende Pistole in die Hand.
Man benötigte wenig kriminalistisches Gespür, denn der feine Hauch von Schwefel und Waffenöl sowie der Versuch möglichst unbeteiligt und ungefährlich in der Hand zu liegen, verrieten meine österreichische Freundin sofort. Jinjin hatte mir geschworen, sie hätte die Waffe nicht abgefeuert. Da ich ihr in der letzten Zeit so vertraute wie ihren beiden Insel-Lanzenottern, die in der alten Lalique Bonbonniere neben ihrem Bett wohnten und alle 28 Tage einen unschuldigen Vogel fraßen, sah ich nun sofort nach. Die Waffe war ungesichert. Ich sicherte sie, nahm das Magazin heraus und zählte die Patronen nach. Es waren nur noch fünfzehn der Teilmantelgeschosse vorhanden. Ungläubig zählte ich nochmals – vierzehn, fünfzehn. Ich roch an der Mündung und nahm den frischen Schwarzpulvergeruch, der von einer eigentümlichen Duftnote begleitet war, deutlich wahr. Ich rätselte länger über den eigentümlichen Geruch der Pistole und mein Gedächtnischip assoziierte mit der Basisnote des Odeurs stets Elektrokauter. Was hatte ein Elektroskalpell, das üblicherweise bei chirurgischen Eingriffen zur blutarmen Durchtrennung durch Hitzekoagulation von Gewebe benützt wird, mit meiner Glock zu tun. Ich verwarf den wirren Gedanken und deutete ihn als Fehlinterpretation meines Gedächtnischips aufgrund des Schädelhirntraumas. Viel wichtiger war: Weswegen und auf wen wurden die beiden Schüsse – sechzehn und siebzehn – abgefeuert?
Im Chinesischen bedeutet Jin das Gold. Als Verb heißt jin eintauchen. Kam ihr Name von ihrer etwas golden schimmernden Haut aufgrund ihrer väterlichen, brasilianischen Gene? Sie hatte den initial von ihrem Vater gewählten Namen Maria eigenständig und gegen den ausdrücklichen Willen ihrer Eltern damals als Siebzehnjährige in Jinjin geändert. Die tiefschwarzen wilden Tätowierungen an ihren Schultern und Armen, die ihren goldigen Mischlingsteint verstärkten, waren auch keine ausreichende Erklärung. Die goldblondierten, kurzen und wild in alle Richtungen abstehenden Haare wären schon ein Argument für ihre Namensänderung, aber goldig wirkte Jinjin nun überhaupt nicht. Möglicherweise hatte es aber auch etwas mit ihren beiden geliebten goldfarbenen Insel-Lanzenottern zu tun. Tödlich giftige Biester, die in den meist abgedunkelten Räumen ihrer unaufgeräumten Wohnung hinter dem alten Glas stets golden schimmerten.
Die Geschichte mit ihrer Namensänderung interessierte mich und wie sie auf Jinjin gekommen war wollte ich sie eigentlich immer schon fragen. Nach meinem Klopfen an der schäbigen roten Holztür ihrer Wohnung hörte ich, dass sie telefonierte. Sie öffnete aber sofort, wie wenn sie auf mich gewartet hätte. Es war ihr Mann am anderen Ende der satellitengestützten Leitung, den sie zu beschwichtigen versuchte. Anscheinend völlig vergebens. Grob nahm ich ihr das Telefon aus der Hand und unterbrach das Telefonat ziemlich unhöflich. »Ich muss dich jetzt dringend etwas fragen Jinjin. Wo und wie sind die beiden 9-mm-Kaliber-Patronen aus meiner Pistole zur Anwendung gekommen. Und vor allem warum?« Das „Wann“ war mir eigentlich klar. Es musste gestern Abend gewesen sein. Aber noch wichtiger war mir die Frage: »Wieso hast du plötzlich einen koreanischen Reisepass mit einem anderen Namen, aber deinen biometrischen Daten? Und bitte sag mir, ob dein Name wirklich Jinjin – die Goldige – ist.« »Warte hier an der Tür, Yves«, war ihre knappe Antwort in lupenreinem Deutsch. Sie telefonierte daraufhin weiter mit ihrem Ehemann, wobei sie gekonnt zwischen zuckersüßen, kirschblütenzarten, verheißungsvoll gehauchten Schmeicheleien und rauestem, befehlsartigem Kasernenhofton wechselte – in Japanisch.
»Yin und Yang sind verschwunden«, sagte sie unmittelbar, nachdem ich erneut das Telefonat unterbrochen hatte und sie schob mich unsanft zurück nach draußen in den Türrahmen. »Irgendjemand hat die beiden Luftlöcher in der Bonbonniere vergrößert und ich vermute, sie sind da durchgeschlüpft. Wenn sie noch hier in der Wohnung sind, ist es lebensgefährlich.« »Die Luftlöcher vergrößert - so ein Quatsch!«, sagte ich unwirsch. In Jinjins nicht sehr großer, aber messieartig vollgestopften Wohnung waren die beiden lebensgefährlich giftigen Schlangen wahrscheinlich unauffindbar. Vielleicht räumt sie wenigstens dann mal ihre Bude auf, war mein nächster Gedanke.
Ich hatte schon beim allerersten Mal, als ich die beiden relativ schlanken goldbraun gefärbten Reptilien in der wunderschönen alten Glasbonbonniere gesehen hatte, mit einer Schublehre die beiden Luftlöcher vermessen. Es waren exakt 9 Millimeter. Den Kopf der beiden hochgiftigen Biester, die sich nur langsam bewegten und geduldig hinter dem Glas warteten, hatte ich auf mindestens 18 bis 20 Millimeter geschätzt. Der Vergrößerungsfaktor durch die Glasbrechung war hiervon bereits subtrahiert. Dennoch war dieses approximative Übermaß der Schlangenköpfe im Vergleich zu den beiden Luftlöchern für mein Empfinden immer nur eine relative Sicherheit. Ob Jinjin um mich besorgt war oder um die - quasi zu ihrer Familie gehörenden und zudem vom Aussterben bedrohten beiden Giftschlangen - erschloss sich mir in diesem Moment nicht.
Aufgrund dieser unklaren Situation und meiner definitiv nicht existierenden Freundschaft zu Yin und Yang entschied ich, die relevanten offenen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt zu klären. »Du bist mir einige grundlegende Erklärungen schuldig«, sagte ich zu Jinjin, als ich mich umdrehte und ging. »Ich bin Dir überhaupt nichts schuldig«, rief sie mir zornig hinterher. Sie stampfte wütend mehrfach mit ihren dunklen Lederstiefeln auf den knarzenden Holzboden und hielt dabei das Telefon mit ihrem Ehemann in der Leitung gegen ihren Oberschenkel gepresst. »Du hast mein Leben zerstört. Unser aller Leben. Du bist der Schuldige! Du solltest nach schlüssigen Erklärungen suchen!«
Dies hallte lange nach in meinem schmerzenden Kopf, als ich beschloss, Wei einen Besuch abzustatten. Meines Erachtens war er mir ebenso einige Erklärungen schuldig. Aus meiner ganz egoistischen Betrachtungsweise war Wei höchstwahrscheinlich sogar verantwortlich für meine momentanen Gedächtnislücken und auch meine heftigen Kopfschmerzen. Aufgrund meines angeschlagenen körperlichen wie geistigen Zustandes dachte ich kurz darüber nach, den Zug zu nehmen. Ein weiteres Argument, nicht mit dem Motorrad oder dem Auto zu fahren, war ein pdf-Dokument, das mir Charles vor langer Zeit als E-Mail zugeschickt hatte. Dieses aus meinem optisch-fotografischen, parieto-okzipitalen Assoziationszentrum aufleuchtende Erinnerungsfragment hatte ich bereits vor mehreren Jahren gelesen. Aber aktiv durch meinen Gedächtnischip getriggert schob sich diese abgespeichert schriftliche Information hinauf in die verarbeitungsfähige Erinnerungsebene meines Thalamus. Vor meinem geistigen Auge analysierte ich dann den bereits 14 Jahre alten Jahresbericht des WHO Global Status Report on Road Safety in Bezug zu meiner aktuellen, ziemlich angeschlagenen Situation. Dank der perfekt funktionierenden Technologie und meines glücklicherweise einwandfrei arbeitenden Gedächtnischips konnte ich mich dezidiert an alles in diesem Dokument erinnern. Trotz meines gestrigen Schädel-Hirn-Traumas konnte ich mir jedes Detail, obwohl ich es vor langer Zeit gelesen hatte, ins Gedächtnis rufen. Ich war mir nun sicher, dass der in mein Gehirn implantierte Chip und die entsprechenden neuronalen Verbindungen ungestört funktionieren. Bildhaft und gestochen scharf sah ich die exakten Zahlenwerte und sogar die dazugehörigen Grafiken der Studie vor mir. In dieser Statistik des weltweiten Straßensicherheitsberichts von 2013 wurden die Verkehrstoten nach Staaten weltweit pro 100.000 Einwohner aufgelistet. Durch meine künstlich augmentierte Hirnleistung sah ich die Werte, in bunten Stabdiagrammen grafisch aufgearbeitet, exakt vor meinem geistigen Auge: San Marino 0,0. Mit seinen über 30.000 Einwohnern hatte der kleine Staat im Jahr der statistischen Erhebung keinen einzigen Verkehrstoten zu beklagen. Dies verwunderte mich bei der dort im Apennin vorherrschenden, stets sportlich italienischen Fahrweise und den ziemlich kurvigen Straßen. Deutschland hingegen 4,7 – was einer Gesamtanzahl, je nach zitierter statistischer Quelle, von immerhin 3.339 Verkehrstoten im Jahre 2013 entsprach. Die Rate in den USA lag bei 11,4 auf 100.000 Einwohner. Ein Wunder, dass William bei seiner unaufmerksamen Fahrweise durch die nächtlichen Straßen von Chicago nicht bereits zu den Verkehrstoten zählte. In Georgien lag die Rate bei 15,7 – was mir bei dem chaotischen Verkehr, wie ich ihn in Tiflis erlebt hatte, noch eher gering vorkam. In Russland waren es 18,6 Verkehrstote je 100.000 Einwohner. Bei 143.500.000 Einwohnern in Russland im Jahre 2013 ergab dies rechnerisch die Anzahl von exakt 26.691 im Straßenverkehr getöteten Personen. Nach Angaben der russischen Verkehrspolizei waren jedoch in diesem Jahr 27.953 Menschen ums Leben gekommen. Welche anderen Todesfälle und Todesarten hier subsumiert wurden und wie viele andere, möglicherweise verschleierte Todesfälle hier hinzugerechnet wurden, bleibt ein russisches Staatsgeheimnis. Man könnte diese differierende Zahl natürlich auch als statistische Unschärfe abtun. Wobei 1.262 getötete Menschen in einem Jahr eine doch recht stattliche Anzahl für eine sogenannte statistische Unschärfe sind.
Für meine Entscheidungsfindung, ob ich jetzt mit dem Auto fahren sollte, war momentan die Rate an Verkehrstoten für China von 20,5 relevant. Statistisch evaluiert also mehr als eine um 400 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, hier in China, als im heimischen Straßenverkehr auf den bundesdeutschen Autobahnen im nahezu unbegrenzten Geschwindigkeitsrausch umzukommen. Wobei die chinesische Zahl 20,5 für Shanghai sicher nicht mit der von Gesamtchina vergleichbar war. Allerdings war mein derzeitiger psychischer und physischer Zustand definitiv auch nicht als statistisch repräsentativ zu werten. Zudem waren die Zahlen sowieso uralt und noch vor der Einführung des autonomen Fahrens erhoben worden. Neuere Statistiken hierüber waren seltsamerweise bisher nicht zu bekommen. Möglicherweise – so meine wirren Gedanken – war das als so todsicher angepriesene autonome Fahren gar nicht so sicher, wie es immer in den Medien proklamiert wurde. Wie seltsam: ich kramte in meinem Gedächtnisspeicher, fand aber keinerlei Erinnerungsfragment über eine repräsentative Statistik zur aktuellen Unfallquote oder Sterberate des autonomen Fahrens im Jahre 2027.
Statistiken sind echte Monster. Interpretierbar, drehbar in alle Richtungen und jederzeit für und wider alles und allem verwendbar. Auch hier erwies sich wieder der signifikante Nachteil eines unermesslichen Gedächtnisses. Solch ein Gedächtnis verlangsamt die Entscheidungsfindung und reduziert letztendlich die Entschlussfreudigkeit. Der Dumme entscheidet schnell, spontan, unwissend, aus dem Bauch heraus. Aber gibt es denn wirklich valide Daten, ob das Resultat dieses bauchgetriggerten Entscheidungsalgorithmus statistisch signifikant ungünstiger ist?
Oft wird im Zusammenhang von computerunterstützter Entscheidungsfindung im Vergleich zu menschlichen Entscheidungsmerkmalen diskutiert, ob nun Bauch- oder Kopfentscheidungen die angemessenere Maßnahme darstellen. Hier wird die Bauchentscheidung häufig als intuitive und schnellere, fast heroische und oft als die menschlichere Entscheidung klassifiziert. Den Kopf mit dem Bauch als Lokalisation für eine Entscheidung zu vergleichen, ist aus neurowissenschaftlicher Sicht jedoch komplett unangemessen. Eine unsägliche Definition für üblicherweise hochkomplexe, multimodale und in der Regel von mehreren sensorischen Systemen getriggerte Entscheidungsalgorithmen. Was ist eigentlich eine Bauchentscheidung?
Sogenannte Experten sagen uns, dass eine Bauchentscheidung sowieso nur gerechtfertigt ist für Leute mit viel Erfahrung auf einem Gebiet, in dem sie diese Entscheidung fällen. Für einen Neurochirurgen, der tagtäglich am Gehirn arbeitet, gibt es keine Bauchentscheidungen. Aus gehirnchirurgischer Sicht gibt es eigentlich nur Kopfentscheidungen. Natürlich finden sich wie immer Ausnahmen. Eine typische Ausnahme für eine Bauchentscheidung fällt mir als Gehirnchirurg natürlich sofort ein. Es ist die Indikation zur operativen Behandlung eines Wasserkopfes. Das überschüssige Hirnwasser wird durch die chirurgische Anlage eines Liquor-Shunts drainiert. Hierbei wird operativ ein Schlauchsystem mit kleinen Ventilen implantiert, welches das Hirnwasser aus dem Kopf in den Bauchraum oder in eine Herzkammer ableitet. Nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte das Hirnwasser aufgrund der geringeren Komplikationsraten, wenn möglich, in das Bauchfell abgeleitet werden. Wird der Katheter also in den Bauch und nicht ins Herz verlegt, so ist dies meiner Meinung nach dann eine typische kopfgetriggerte Bauchentscheidung. Selbst bei einer kardialen Ableitung ist dies eine wissenschaftlich evaluierte Kopfentscheidung und keine Herzensangelegenheit. Generell gilt für einen Neurochirurgen, der täglich am Gehirn operiert: Eine sogenannte Kopfentscheidung ist auf alle Fälle die bessere Überlegung. Durch meinen knock-out hatte ich wahrlich immer noch Probleme meine Gedanken zu ordnen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Eindeutige Folgen des doch erheblichen Schlages, den ich gestern Nacht in der Bar Rouge abbekommen hatte.
Mir tanzten plötzlich wieder die Zahlen des WHO Global Status Report on Road Safety vor meinem geistigen Auge. Thailand mit 38,1 und die Dominikanische Republik mit 41,7 Verkehrstoten je 100.000 Einwohner. Diese sehr hohe Todesrate erschien mir bei den dort eher gemäßigten Fahrweisen statistisch fragwürdig. Aber in diesen beiden Ländern verfälschten mit Sicherheit die von Mekong sowie karibischem Rum vernebelten Touristen, die zu Hauf am Straßenverkehr teilnahmen, die Werte signifikant nach oben. Diese meist nicht behelmten und mitunter komplett reaktionslosen, alkoholisierten Fremdlinge auf gemieteten und klapprigen Motorrollern, sowohl in Thailand als auch in der Karibik, sollten eigentlich jedem versierten Statistiker als systematische Fehlerquelle auffallen.
Niue, ein Inselparadies in der Südsee, war mit 68,3 Verkehrstoten pro 100.000 Einwohner aber der absolute Spitzenreiter. Es verwunderte mich bereits damals beim Lesen der Statistik, dass es ausgerechnet hier weltweit statistisch die meisten Verkehrstoten gab. Ausgerechnet in Niue, einer sehr kleinen Koralleninsel, so ziemlich in der Mitte zwischen den Fidschi- und Cookinseln gelegen. Auf Niue gab es gerade einmal 1.465 Bewohner und das auf einer Fläche kleiner als München. Eher unwahrscheinliche Gegebenheiten für einen tödlich endenden Frontalzusammenstoß. Diese Insel ist die Spitze eines erloschenen Vulkans und sieht aus wie ein aus der Südsee herausgehobenes Korallenriff. Betrachtet man jedoch die bizarren, zerklüfteten Steilküsten von Niue, wird die statistisch sehr hohe Verlustrate schon etwas verständlicher. Vor allem da die mehr oder manchmal auch weniger befestigte, etwa 70 Kilometer lange Rundstraße oft ungesichert direkt am Abgrund entlangführt. Hinzu kommt, dass es auf Niue keinen öffentlichen Nahverkehr gibt und Palmdiebfleisch, eine echte Delikatesse auf den polynesischen Inseln, halluzinogen wirken kann. Aber auch der übliche Kava-Konsum in dieser Region trägt mit Sicherheit zu dem schlechten statistischen Wert für den Inselstaat Niue bei.
Kava, auch Rauschpfeffer genannt, ist eine Pflanze, die in den westlichen und auch östlichen Kulturen als Medizin, in der Südsee eher als Genussmittel konsumiert wird. In Deutschland war Kava aufgrund von ungeklärten Leberschäden mit Todesfolge passager vom Markt genommen worden. Kava ist aber mittlerweile wieder als verschreibungspflichtige Substanz mit einem entsprechenden Rezept in der Apotheke erhältlich. Die Substanz hat eine leicht schmerzlindernde und entspannende Wirkung. Der Genuss mindert Unruhen, führt zu leichter Euphorie und Gesprächigkeit und löst Muskelverkrampfungen. Womöglich war davon auch etwas in dem gestrigen Drink, war mein kurzer Gedanke.
Solange die Zubereitung des Kava-Getränkes keinen Alkohol enthält, sind relevante Nachwirkungen selbst nach dem Genuss von größeren Mengen bisher nicht beschrieben. Die Kavapyrone sind in Wasser aber nur sehr schwer löslich; jedoch in unpolaren Lösungsmitteln, wie zum Beispiel Alkohol, sehr leicht löslich. Das dürfte vermutlich ein weiterer statistisch signifikanter oder vermutlich der entscheidende Faktor für den einen Verkehrstoten im Jahre 2013 auf diesem polynesischen Korallenriff gewesen sein. Wie und wo er oder sie im Straßenverkehr von Niue ums Leben kam und unter welchen Umständen, verschweigt die Statistik. Ein echtes Einzelschicksal.
Was ich an Statistiken immer schon gehasst habe, ist deren Randunschärfe. Diese Grauzone am linken und rechten Rand der Gauß’schen Verteilungskurve ist der vage Interpretationsspielraum der statistischen Ergebnisse. Dort verlässt man den sicheren Boden der Wissenschaft. Durch dasselbe eigentlich sehr solide wirkende Tor der Mathematik konnte man hier entweder einen nach Frühling duftenden Garten Eden oder die adstringierende Vorhölle betreten. Ob San Marino mit Niue mittlerweile den letzten oder je nach sensationslüsterner Betrachtungsweise den ersten Platz getauscht hatten, entzog sich meiner abgespeicherten Kenntnis. Durch ein Einzelschicksal wäre die gesamte, sicherlich mit viel materiellem und personellem Aufwand durchgeführte Statistik grundlegend anders zu bewerten. Ein Verkehrstoter mehr in San Marino und ein Toter weniger in Niue würden die Ergebnisse wahrlich auf den Kopf stellen. Statistiken sind nichts als empirische Orakel.
Ich nahm mir vor, die aktuelle Verkehrstotenstatistik sobald als möglich im unzensierten www. zu recherchieren. Wobei ein Verkehrstoter mehr oder weniger, dass würde hier in China völlig unbemerkt im statistischen Grundrauschen dieser Zwei-Milliarden-Volksrepublik untergehen. Ich wollte nicht Bestandteil der neuen Straßenverkehrstotenstatistik werden und entschied mich daher heute gegen das aktive und somit aktiv für das autonome Autofahren.
Ein einziges Zufallsereignis verändert die objektiven mathematischen Werte. Aber ist es nicht an uns intelligenten Menschen, gerade solche Veränderungen zu detektieren, vernünftig einzuordnen und zu bewerten? Was sonst unterscheidet uns noch von Maschinen, die ihre Analysen nur anhand der programmierten Algorithmen und vordefinierten Schwellenwerte erstellen? Wie lautete doch ein ehemaliger Werbeslogan von Alfa Romeo – ohne Hirn wären wir nur Maschinen –, nein, mein chip-unterstütztes Arbeitsgedächtnis korrigierte mich sofort – ohne Herz … was für eine katastrophale Fehlinterpretation. Immerhin war dieser Spruch schon siebzehn Jahre alt.
Mein Gehirn durchforstete meinen Speicherchip nach weiteren Informationen. Ich erinnerte mich, gelesen und anscheinend als relevant abgespeichert zu haben, dass auf Niue mehr Palmdiebe als Menschen leben. Der Birgus latro, die größte Landkrabbe und ein furchterregend aussehender Geselle, war auf dieser Südseeinsel also in der Überzahl. Palmdiebe sind klassische Linkshänder, da sie die größere Arbeitsschere immer links tragen. Mit dieser großen Schere kann der Krebs aufgrund der gigantischen Verschlusskraft selbst Kokosnussschalen aufknacken. Verlässliche statistische Angaben, wie viel Palmdiebbabys eigentlich als Rechtshänder schlüpfen, gibt es nicht. Somit ist es mit der großen Schere links beim Palmdieb wie beim Intelligenzquotienten bei uns Menschen. Es bleibt letztendlich unklar, ob es soziale Faktoren sind oder ob es genetisch festgelegt ist. Voraussichtlich zeigt die stringente frühkindliche Erziehung – sowohl beim Gebrauch der Schere als auch beim IQ – einen messbaren Einfluss. Ob die elterliche Schulung beim Öffnen der Kokosnüsse, die anscheinend immer mit der linken Schere geschieht, letztendlich dazu führt, dass bisher nur Palmdiebe mit der großen Schere links gesichtet wurden, ist jedoch unbekannt. Hierüber gibt es keinerlei statistische Auswertungen, sondern nur sehr abenteuerliche stochastische Interpretationen.
Mein durch den Schlag traumatisiertes Gehirn zeigte immer noch erhebliche Probleme bei der strukturierten Informationsverarbeitung, aber mein cerebrales Erinnerungsportfolio zu Palmdieben barg noch weitere interessante Informationen. Diese Riesenkrabben hatten vor vielen Jahren einen zweifelhaften Bekanntheitsgrad erzielt, da sie mit dem Tod von Amelia Earhart in Verbindung gebracht wurden. Earhart erlangte internationale Berühmtheit und schaffte fünf Jahre nach Charles Lindbergh als erste weibliche Pilotin die Atlantiküberquerung im Alleinflug. Es war aber vor allem ihr politisches und soziales Engagement, das sie auszeichnete. Earhart war eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen der 30er Jahre und blieb deshalb für viele in positiver Erinnerung. Ihr ehrgeiziges Projekt, die Erde entlang des Äquators mit einem Flugzeug zu umrunden, scheiterte jedoch tragisch in der Südsee. Die Presseberichterstattung, die Mutmaßungen, die Gerüchte und zum Teil auch Verschwörungstheorien über ihr Verschwinden hatte ich alle gelesen, direkt nachdem ich den Hollywoodfilm mit Hillary Swank gesehen hatte. Der Pioniergeist von Amelia Earhart faszinierte mich. Man hatte Hillary Swank als Besetzung für diesen Film wegen ihrer durchaus vergleichbaren und markanten Gesichtskonturen treffend ausgewählt. Es war auch ein schauspielerisch hervorragend gemachter Film, wobei Swanks Körpergröße von 168 cm aber deutlich zu gering war.
Die reale und erheblich größere Amelia Earhart verschwand am 2. Juli 1937 mit ihrem Flugzeug in der Nähe der Phönixinseln, eigentlich nur wenige Längengrade von Niue entfernt. Das Flugzeugwrack, ihre Besatzung und sie selbst wurden jedoch nie gefunden. Die bei einer erneuten, großangelegten und erst viele Jahre später durchgeführten Suchaktion entdeckten Skelettteile konnten nie eindeutig identifiziert werden. Auch die DNA-Analyse scheiterte, weil die Proben auf mysteriöse Weise verschwanden, was danach weitere Mutmaßungen und Gerüchte befeuerte. An ihren vermeintlichen Ober- und Unterschenkelknochen, die weit über die Südseeinsel verteilt waren, wurden jedoch charakteristische Spuren der kräftigen Scheren von Palmdieben gefunden. Mit hoher statistischer Signifikanz von linken Scheren.
Nach neuesten Erkenntnissen hatten Amelia Earhart und ihr Navigator Fred Noonan den Absturz überlebt. Sie konnten sich anscheinend auf eine der nicht von Menschen, aber reichlich Palmdieben bewohnten Inseln in der Südsee retten. Auch in diesem tragischen Fall scheint sich wieder eines der uralten Naturgesetze unserer Erde zu bestätigen. Ein Gesetz, das sich noch vor die von Charles Darwin postulierten Grundsätze der Evolutionstheorie einreiht: Esse mich, bevor ich dich esse.
All diese Gedanken schwirrten in meinem wahrlich angeschlagenen und mittlerweile erheblich schmerzenden Kopf herum. Da ich aufgrund der drückenden Kopfschmerzen bereits das kurze Stück zu Jinjins Wohnung mit dem Motorrad ohne Helm gefahren war, entschied ich nun nicht erneut dieses Risiko einzugehen. Daher nahm ich den roten Tantos aus dem Carsharing-Pool der Tongji-Universität, der auf der gegenüber-liegenden Straßenseite parkte. Ob ich überhaupt einen Helm über meinen Brummschädel bekommen hätte, war fraglich. Der Wagen war ein E-Mobil der vorletzten Generation. Er ließ sich aber problemlos mit dem neuen Servicechip in meinem Unterarm starten. Bis zu Weis Haus, der nur unweit seines Forschungsinstituts auf Xishan Island wohnte, war es jedoch ein ganzes Stück. Den Weg kannte ich gut, da ich ihn unzählige Male unautonom und eigenhändig mit meinem Motorrad gefahren war. Ich stellte aufgrund meiner zuvor exakt analysierten Verkehrstotenstatistik den Schalter an der Konsole von (i) – individual driving – auf (a) – autonomous driving – um. So ließ ich mich stressfrei im ferngesteuerten Fahrmodus von Shanghai in Richtung Suzhou chauffieren.
Auf der gesamten Fahrt ging mir die Geschichte von Jinjins Eltern nicht aus dem Kopf. Ihr Stiefvater war mehrere Jahre bei der brasilianischen Marine gewesen, bevor er desertierte und kurz darauf Jinjins Mutter heiratete. Er hatte die ersten beiden goldfarbenen und sehr giftigen Reptilien – Bothrops insularis – in den 70er Jahren auf dem Seeweg nach Shanghai geschmuggelt. Eine wirklich abenteuerliche Geschichte. Deren Enkel- oder gar Urenkelschlangenkinder saßen nun seit Jahren goldglänzend und hinter Glas gefangen in Jinjins Lalique Bonbonniere. Neben der Freiheitsberaubung kommt auch noch der Tatbestand des geduldeten Inzests der armen Tiere hinzu, hatte Stella einmal formaljuristisch korrekt angemerkt. Eigentlich eine schreckliche Familientragödie. Die Schlangenschmugglergeschichte erzählte Jinjins Mutter gerne. Je nachdem, wie viele Gläser Mao Tai sie getrunken hatte, änderten sich dementsprechend die Schiffsroute, die Windstärke sowie die Höhe der Wellen. Auch die Anzahl der auf dem Schiff versteckten Schlangen vermehrte sich proportional zu den bereits getrunkenen Schnapsgläsern. Mitunter wuchsen die Schlangenbabys sogar zu gigantischen Drachenmonstern heran, die während der langen Überfahrt die gesamte Crew fraßen, bis auf den Kapitän und Jinjins Vater. Echtes chinesisch-brasilianisches Seefahrergarn, aber immer wieder schön anzuhören.
Der Mao Tai, den sie in Unmengen trank, war ein schreckliches siebzigprozentiges alkoholisches Gift aus Weizen und roter Hirse gebrannt. Ich hatte stets die Assoziation auf der Stelle zu erblinden, noch bevor ich dieses chinesische Volksgetränk runterschlucken konnte. Mao Tai war aber schon jeher der Treibstoff für so manch mystische Geschichten dieses riesigen Landes.
Das aktuelle MR-Tomogramm des Schädels von Jinjins Mutter zeigte eine ausgeprägte vaskuläre Enzephalopathie und eine begleitende Hirnatrophie. Die radiologisch sichtbaren Veränderungen ihres Gehirns wurden durch den massiven Alkoholkonsum, aber auch durch ihren massiven Bluthochdruck verursacht. Ein Leiden, das sie aufgrund ihrer Nierenerkrankung bereits seit der Kindheit hatte. Der viel zu hohe Blutdruck und die mutwillige Vergiftung ihrer Nervenzellen waren eine äußerst schädliche Kombination. Erschwerend hinzu kam der immense Zigarettenkonsum. Es waren diese emotionalen Abende, an denen sie wild gestikulierend und mit rauchiger, lauter Stimme mit dem Mao-Tai-Glas in der einen Hand und der Zigarette in der anderen unglaubliche Seefahrergeschichten erzählte. Die Zigarettenspitze und ihr runder, hochroter Kopf glühten dabei um die Wette. Immer häufiger verlor sie an solchen Abenden durch die massive Erregung kurzzeitig das Bewusstsein und Jinjin war daher sehr besorgt um ihre Mutter. Durch den Schwund an Nervenzellen und Hirnmasse ging eine entsprechende Leistungsminderung ihrer Hirnfunktionen einher, verstärkt durch ihre innige und letztendlich täglich ausgelebte Liebe zum Mao Tai.
Die schleichende Hirnerkrankung machte sich bereits früh durch ihr immer schlechter werdendes Gedächtnis bemerkbar. Die meist erstaunlich gutwirksame traditionelle chinesische Medizin hatte in ihrem Fall kläglich versagt, oder die rezeptierten Kräutermischungen waren für diese gewaltige Frau einfach viel zu schwach dosiert worden. Sie hatte Blutdruckwerte, die über die Jahre hinweg so kontinuierlich und gigantisch stiegen, wie sich nicht einmal die kühnsten Wallstreet Broker einen sensationellen Aktienkurs erträumen. Natürlich hielt sie keinerlei ärztlich verordnete Diäten ein und akzeptierte auch keine noch so gut gemeinten medizinischen Ratschläge. Der katastrophale Befund der MR-Tomographie ihres Gehirns und die entsprechenden neurologischen Defizite waren somit die logische Konsequenz.
Es mutete daher nach ihrer Operation wie ein Wunder an: Die zwei implantierten modernen Neurochips augmentierten ihr vorgeschädigtes Gedächtnis ganz hervorragend und kaschierten ihre massiven Gedächtnislücken optimal. Die Operation war somit ihre temporäre Rettung. Von der zuvor rasch fortschreitenden Demenz durch ihre vaskuläre Enzephalopathie war danach eigentlich nichts mehr zu merken. Sie hatte durch die implantierten Neurochips der neuesten Generation wieder ein unglaubliches Kurzzeitgedächtnis, das auch weniger relevante Informationen über viele Monate detailliert und präzise speicherte und leider ihre rechthaberische Streitsucht immens befeuerte. Problematisch wurde es, als die Chips aufgrund des verlorenen Rechtsstreits gemäß der richterlichen Anordnung wieder entfernt werden mussten.
Ich hatte sie bereits im Vorfeld ausdrücklich gewarnt, dass sie die ziemlich hohen Geldbeträge sofort zurückgeben sollte. Sie hatte das Geld bei den beiden chinesischen Quizshows »1 vs. 100« und »The Brain« gewonnen, an denen sie kurz nach ihrer Operation teilgenommen hatte. Auch Jinjin hatte ihr mehrfach gesagt: »Dies ist nicht korrekt Mutter. Gib bitte das Geld zurück, bevor alles auffliegt.« Mir war klar, dass Sophie Turner Laing von Endemol sich diesen Betrug nicht bieten lassen würde, und wenn sie den Klageweg beschreitet sicherlich Recht bekommen würde. Genauso kam es dann auch. Die gerade abgeheilten Narben und die sichtbare Vorwölbung der Kopfhaut durch die beiden Neurochips wurden natürlich entdeckt. Das war auf den Videosequenzen, die mehrfach ihren Kopf in Großaufnahmen zeigten, eindeutig an ihrem Hinterkopf zu erkennen. Daher wurde dies zu Recht als illegales Hilfsmittel zur Beantwortung der Fragen bei den Quizshows klassifiziert.
Das Gesicht von Jinjins Mutter zierte mehrere Wochen die lokalen und auch überregionalen chinesischen Zeitungen. Darin war auf den Fotos stets mit einem roten Pfeil die Lokalisation ihrer Speicherchips am Hinterkopf markiert. Mit den entsprechenden Bildunterschriften, wobei »Betrug! Cybermutter gewinnt Millionen bei 1 vs. 100« oder »Lebendige Künstliche Intelligenz gewinnt The Brain« noch die harmlosesten waren. Jinjin riet ihrer Mutter danach eindringlich die mannigfaltigen Einladungen zu den Fernsehtalkshows nicht anzunehmen. Auch dies war vergebens.
Wie befürchtet erging nach dem kurzen Gerichtsverfahren dann die richterliche Anordnung, die Chips umgehend zu entfernen. Zudem musste das Preisgeld zuzüglich eines horrenden Zinssatzes sofort zurücküberwiesen werden. Wie zu erwarten weigerte sich Jinjins Mutter strikt. An diesem uneinsichtigen und absolut sturen Verhalten waren die Zeichen der vaskulären Demenz nun doch eindeutig erkennbar. Daraufhin kam, was kommen musste: Der Staatsapparat setzte den Beschluss des Mittleren Volksgerichtes von Shanghai ordnungsgemäß um. Nach der vollzogenen Zwangseinweisung in das III. Militärhospital wurde bereits am Folgetag die richterlich angeordnete Chipentfernung durchgeführt. In Lokalanästhesie, von einem mir persönlich nicht bekannten und auch wenig vertrauenerweckenden neurochirurgischen Kollegen. Danach wurde sie aus dem Krankenhaus, oder genauer gesagt aus der Haft, entlassen. Völlig dement und über Nacht geistig um viele Jahre gealtert. Sie war nun eine alte, verwirrte und orientierungslose Frau, die zudem ein leeres Bankkonto hatte und schon eine Woche später aus ihrer Wohnung ausziehen musste, da sie die stetig steigenden Mieten in dieser Gegend von Shanghai nicht mehr bezahlen konnte. Jinjins angebotene Hilfe lehnte sie kategorisch und stur ab. Sagte aber ihre Teilnahme an einer Talkshow im Vorabendprogramm zu. Glücklicherweise wurde diese nie gesendet.
Ihr Kurzzeitgedächtnis war nicht nur massiv beeinträchtigt, sondern eigentlich nicht mehr existent. Während eines banalen Gesprächs verlor sie den Faden und konnte sich selbst an kurz zuvor getroffene Absprachen nicht mehr erinnern. Durch den massiven arteriellen Hypertonus in ihrer Kindheit, die unstete Lebensführung und den Mao Tai, den sie bis heute in Unmengen trank, war es eine multifaktoriell bedingte und nicht heilbare Demenz. Dennoch fühlte ich mich in gewissem Maße dafür verantwortlich. Natürlich wäre der jetzige Zustand bereits viel früher eingetreten, aber dem geistigen Verfall innerhalb nur eines Tages beizuwohnen, war mehr als schrecklich.
Vor vielen Jahren wurde Jinjins Mutter von einer der damalig noch jungen, aber dennoch sehr giftigen Schlangen gebissen. Es war am Tag der Ankunft der Schmuggelware aus Brasilien, als sie, ein Geschenk von ihrem Mann erwartend, ungestüm die große Zigarrenkiste aufriss. Ein Gegengift für den Biss einer Insel-Lanzenotter gab es damals nicht und gibt es meines Wissens bis heute nicht. Nachdem sie zwei Nächte mit dem Tod gerungen hatte, war sie danach für über fünfzehn Jahre von ihrer arteriellen Hypertonie geheilt. In dieser Zeit hatte sie, wie durch ein Wunder, einen völlig normalen Blutdruck und musste keinerlei Medikamente einnehmen. Leider tat sie das auch später nie wieder. Auch nicht als der hohe Blutdruck wieder zurückkehrte und sie dadurch gesundheitlich massiv beeinträchtigt war. »Ich nehme keine dieser Schlangengiftpillen«, war ihre unumstößliche Aussage. Seitdem nahm sie auch kein anderes Medikament ein, das ihr zur Senkung ihres Blutdrucks verordnet wurde. So kam es dann im weiteren Krankheitsverlauf unweigerlich zu den Hirnschäden aufgrund des jahrelang unbehandelten massiven arteriellen Hypertonus.
Jinjins Stiefvater, der zuvor in São Paulo gelebt hatte und mit Sérgio H. Ferreira befreundet war, machte diese obskure Entdeckung mit der Spontanheilung des Bluthochdrucks nach dem Schlangenbiss seiner Frau zu barer Münze. Wie sich später bei wissenschaftlichen Analysen herausstellte, war dies kein Wunder und auch keine göttliche Fügung, wie dies in der Familie immer erzählt wurde. Nein, es war eine banale, aber bis dato noch unbekannte, aber äußerst wirksame pharmakologische Therapie der arteriellen Hypertonie. Das Gift der Insel-Lanzenotter enthält unter anderem aktive





























