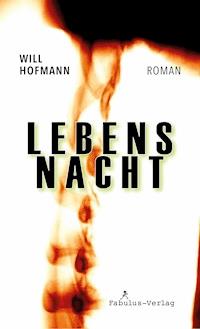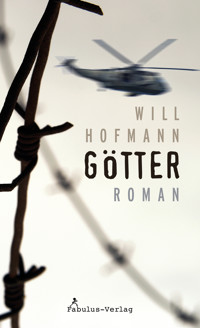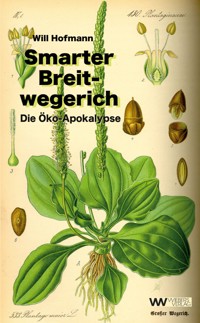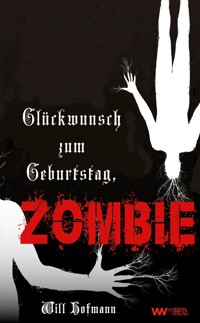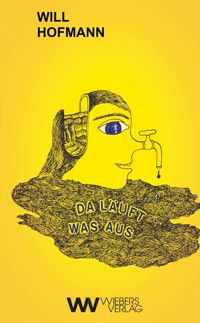
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wiebers Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Da läuft was aus« ist eine Sammlung skurriler, teilweise sehr skurriler Geschichten. Sie gliedert sich in einen wunderlichen, einen nachdenklichen, einen erotischen und einen gruseligen Teil, insgesamt 33 Kurzgeschichten. Der gruselige Teil erfordert Nervenstärke. Hier wird zerlegt, zerhackt, aufgefressen oder auf andere Art in den Tod befördert. Der Titel lässt Hirnsubstanz assozieren, die ausläuft wie Schnodder aus der Nase.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willi Hofmann,
Jahrgang 1949, bringt eine einzigartige Kombination aus naturwissenschaftlichem Wissen und literarischer Fantasie in seine Werke ein. Mit einem Hintergrund in Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, sowie einer langjährigen Tätigkeit als Dozent, verbindet er Fachwissen mit der Fähigkeit, komplexe Themen anschaulich und fesselnd zu erzählen.
Als Roman- und Kinerbuchautor hat Hofmann zahlreiche Bücher veröffentlicht, die Themen wie Menschlichkeit, Natur und die Grenzen des wissenschaftlichen Fortschritts beleuchten. Sein Stil ist geprägt von skurrilen Wendun- gen, tiefgründigen Figuren und einer besonders durchdachten Mischung aus Wissenschaft und Fiktion.
INHALT
Vorbemerkungen
Teil I
Wunderliches
Einmalig
Der Verdoppler
Frau Christine Colf
Der Gladiator
Im Wasser
Kurt Blum
Das Graben
Geräusche
Alter
Motorradfahrerhöflichkeit
Womboo
Teil II
Der nachdenkliche Teil
Vom Kommen und Gehen
Göttliche Vielfalt
Schatz
Urknallerei
Mensch und Aggregatzustände
Strafe
Teil III
Sinneslust
Die Götter
Die biologische Emanzipation
Der Zigaretten-Strich
Wasserblicke
Der Ziegenbock
Jodler
HALDOL –Liebe
Die Wohnung
Teil IV
Der Gruselteil
Die Leber
Der Makler
Amputationen
Die Therapie
Feuer
Grand Mal
Mahlzeit
VORBEMERKUNG 1979
zu Elmar Dalidahner
Was läuft da aus, bei meinem Freund Elmar? Man braucht ihn nur an der richtigen Stelle zu packen, dann beginnt es bei ihm zu fließen. Dann fließen die Laute, die Worte und die Sätze, die in seinem Gehirn schwimmen. Sie formen sich zu den erstaunlichsten und merkwürdigsten Geschichten. Was das ausfließt, war hier in dieses Buch hineinfloss, das ist schwer zu beschreiben, schwer einzuordnen. Es ist eine Mischung aus Horror, Krimi, Science-Fiction, Porno, Satire und Sadismus. Du wirst schon sehen. Die beste Charakterisierung ist – einfach – Dalinahnismus.
Auf jeden Fall, jetzt bist Du Besitzer des Werkes und wirst irritierter Leser und begeisterter Anhänger Elmar Dalidahners. Nach der Lektüre, wenn Du willst schon während des Lesens, empfiehlst Du das Büchlein Deinen Freunden, möglichst vielen – oder Du verschenkst es. Du musst für uns Reklame machen.
Und nun: Viel Spaß bei der Lektüre.
Falls Du ausflippst – ich kenne einen guten Psychiater!
Langenfeld/Rheinland, den 11. Oktober 1979
Will Hofmann
VORBEMERKUNG 2012
Was ist aus ihm geworden, meinem Freund Elmar? Es gibt ihn nicht mehr!
Es hat ihn nie gegeben. Seit 1979 hat die Welt sich weiter gedreht.
Damals hatte ich mir darin gefallen, in eine zweite Haut zu schlüpfen und einen Anklang von multipler Persönlichkeit zu kreieren. Parallel ein Leben als Arzt und ein Leben als Schriftsteller zu führen. Das sollte sich in einem Künstlernamen ausdrücken. Elmar – ein widerspenstiger, junger schizophrener Patient, der ganze Therapeutenteams zur Verzweiflung bringen konnte. Mir war es vergönnt, in einem Bereitschaftsdienst zu seiner Leiche, an einem Baum hängend, gerufen zu werden.
Dalidahner – ein hessisches Mantra mit dem Sinn: »Da liegt einer«. Und zwar ein Papierhaufen. Viele Papierhaufen, hingestreut als Wegweiser für eine Schnitzeljagt. Immer wieder ein neuer, den ich auf meinem Weg mit innerer Stimme als »Da lied aner« kommentiert hatte. Auf dem Weg vom Sterbebett meiner Mutter. Damals siebzehn. Der Name ist mit mir weitergewandert.
»Dalidahner« hat sich gewandelt, gekürzt in »Dahner«. Doch auch der hat seine Zeit hinter sich gelassen. Ich bin Will, und ich schreibe als Will. Die kurzen Geschichten erscheinen in diesem ›zweiten Buch‹, die langen bekommen extra Bände. Doch auch die kurzen sind nicht mehr die alten. Sie haben sich geändert. Sollte noch jemand den alten ›Dalidahner‹ aufgabeln, der wird das merken. Und erkennen: Das Warten hat gelohnt. Die Erzählungen sind gereift.
Nach der langen Zeit ärztlicher Tätigkeit widme ich mich jetzt diesem Teil meiner Leidenschaft. Ganz ordentlich – als Autor des Wiebers und des Fabulus-Verlags. Der ›Abenteuermond‹ ist schon erschienen, ausgelaufen. ›Oktan‹ und ›Das Licht‹ stehen an. Und selbstredend geht die Mondgeschichte weiter.
Berlin, 21. März 2012
Will Hofmann
VORBEMERKUNG 2025
Und wieder ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen. ›Abenenteuermars‹ und ›-Merkur‹ sind erschienen, ebenso ›Das Licht‹, ›Oktan‹ und einige weitere Bücher. Die ärztliche Tätigkeit ist weitgehend – noch nicht ganz – beendet. Schreiben, Inline-Skate-Hockey und 3D-Druck sind meine Leidenschaften. Alles sind Abenteuer mit der spannenden Frage, was in meiner verbleibenden Lebens- und Fitnesspanne noch möglich sein wird.
Die zwischenzeitliche Zusammenarbeit mit dem Verlag hat sich als Bruchlandung erwiesen. Die Rechte an meinen Werken habe ich zurückerworben. Das Abenteuer geht weiter, und das heißt für mich: »Wiebers Verlag«. Über diesen soll meine Prosa für den, der sie mag, erhältlich bleiben. So auch der Band
›Da läuft was aus‹.
Seine Geschichten hatten einen Entstehungszeitraum von über dreißig Jahren. Sie entstanden in einem Lebens-, Gesellschafts- und Arbeitsumfeld, das sich gewandelt hat. Trotzdem sind sie sicherlich nicht nur aus ihrem zeitlichen Kontex heraus verständlich, sondern haben etwas Beständiges. Die eine oder andere mag auch dann noch geheimnisvoll bleiben, wenn man sich in die Entstehungszeit zurückdenkt.
Berlin im März 2025
Will Hofmann
TEIL I
WUNDERLICHES
EINMALIG
Zwanzig Minuten musste ich auf die Straßenbahn warten. Einige Leute standen an der Haltestelle. Ich schaute sie mir in Ruhe an. Menschen gingen vorüber, über Gehwege und Zebrastreifen, mit irgendeinem Ziel. Ich betrachtete die Straßenzüge, den Verkehr, einzelne Häuser.
Feierabend – Feierabendlaune. Sonst brauste ich mit dem Wagen nach Hause. Der stand in der Werkstatt. Die Tram war eine Abwechslung – solange es bei Ausnahmen blieb.
Mein Blick fiel auf eine Imbissbude, die ich vom Wagen aus nie bemerkt hatte. ›Einmal-Imbiss‹ stand darüber. Und plötzlich gieperte ich nach Fast-Food.
Ich ging rüber und bestellte ein Schaschlik mit Kartoffelsalat, dazu einen Kaffee. Bald stellte ich fest, was es mit dem Namen auf sich hatte. Hier gab es nur Einmalartikel.
Das Essen bekam ich auf einem Plastiktellerchen, dazu Plastikbesteck mit einer Papierserviette, zusammen abgepackt in Zellophan wie im Flugzeug. Die Limo in einem Plastikbecher.
Ich nahm die Sachen, zahlte und setzte mich an einen Tisch. Der Stuhl war aus Pappe, der Tisch ebenso, bedeckt mit einer Papiertischdecke.
Während ich aß, schaute ich mich im Imbiss um. Es handelte sich um einen Einmann-Betrieb.
Der Wirt, oder wie man ihn nennen sollte, ging, wenn er gerade niemanden zu bedienen hatte, an die Tische und räumte das Geschirr weg. Das steckte er in einen Beutel, nahm auch die Alu-Aschenbecher vom Tisch und warf sie dazu. Den vollen Beutel steckte er in einen Müllschlucker hinter der Theke. Es gab einen kleinen Plumps. Die Sachen landeten wohl in einem Behälter im Keller.
Der Meister teilte neue Aschenbecher aus und wechselte hie und da eine Tischdecke.
Die leeren Bier-, Cola- und Limoflaschen wanderten ebenfalls in den Müllschlucker.
Alles fraß der Müllschlucker. Nichts wurde gespült, gesäubert oder gewaschen; der Müllschlucker war ein großes Maul, das das alles schluckte. Mich wunderte fast, wieso nicht auch die Einnahmen in den Müllschlucker wanderten.
Langsam leerte sich das Imbiss. Jedes Mal, wenn ein Gast den Raum verließ, räumte der Chef den Tisch ab. Zu meiner Verblüffung klappte er auch Tische und Stühle zusammen und warf sie in den Müllschlucker.
Mittlerweile war ich der Letzte im Raum. Der Wirt schaute überlegend in die Kasse, klappte dann auch diese zusammen. Sah jetzt aus wie eine Aktentasche.
Ich wischte mir die Schaschliksaucenreste aus den Mundwinkeln, stand auf und ging hinüber zur Haltestelle.
Der Wirt musste nur noch meinen Tisch beseitigen.
Gerade, als die Bahn sich näherte, verließ der er sein Imbiss. Beim Einsteigen sah ich, wie er mit wenigen geschickten Handgriffen das gesamte Häuschen zusammenlegte.
Von meinem Sitzplatz aus konnte ich beobachten, wie er alles zu einem kleinen, handlichen Paket faltete und zu einem Müllcontainer trug. Der stand hinter dem Platz, auf dem gerade noch die Imbissbude war. Darin lagen bereits mehrere von diesen Päckchen.
Das einzige, was noch aus dem Boden ragte, so stellte ich im Abfahren fest, das war der Müllschlucker.
DER VERDOPPLER
Spiekenagel staunte nicht schlecht, als Kocher ihm zwei Zwanzig-Euro-Scheine mit der gleichen Nummer zeigte. Mit seinen Methoden als Juwelier konnte er keinen Unterschied festzustellen. Er entnahm seiner Brieftasche einen dritten Schein und verglich ihn mit den beiden anderen. Im Mikroskop fand er schnell Unterschiede zwischen seinem echten und den beiden anderen. Diese jedoch waren an den entsprechenden Stellen identisch. Keine kleinste Nuance der Farbstärke – nicht einmal die Faserstruktur unterschied sich.
Langsam begriff er. Kocher hatte wieder etwas Neues fertiggebracht. Er konnte Geld vervielfältigen. Er konnte bedrucktes Papier identisch vervielfältigen. Ja, er konnte wohl alles vervielfältigen.
Anerkennend schaute er zu dem Wissenschaftler auf. Ein Pfiff entglitt seinen Lippen.
*
Ein langer Weg war es gewesen bis zu dieser Demonstration.
Professor Kocher war ein Eigenbrötler. An der Uni erledigte er seine Aufträge rechtzeitig und zufriedenstellend, aber sie schienen ihn nicht zu interessieren. Man merkte ihm nach der Auftragserteilung lange nicht an, dass er nur einen Finger für das neue Projekt rührte, obwohl er es beteuerte.
Erst in allerletzter Minute widmete er sich der Aufgabe, die er dank seiner Erfindungsgabe und Originalität verblüffend schnell und genial löste. Sein Herz aber musste an etwas anderem hängen. Seinen Kollegen und der Universitätsleitung war er suspekt.
Obwohl er eine Menge wissenschaftlicher Lorbeeren erntete, kümmerte ihn sein Erfolg in zweiter Linie. War ein Thema abgeschlossen, hatte er kein Interesse, es weiter auszubauen. Dies überließ er anderen. Der einzige Zweck, den er anstrebte, war der, durch seine Leistungen weiter am Institut arbeiten zu können.
In die Karten ließ er sich nicht schauen und redete nur das Nötigste. Trotzdem war er ein beliebter Lehrer. Seine Vorlesungen gestaltete er abwechslungsreich, lebendig und anschaulich. Hier vergaß er seine Schweigsamkeit.
Ihn über seine Anliegen zu befragen, das konnten selbst seine Lieblingsstudenten lassen. Sie erhielten ein paar belanglose Worte und abweisendes Gebrummel und verstanden: Die Fragerei war unerwünscht – so wie sie selbst.
Kein Wunder, dass über Professor Kochers Arbeit die wildesten Gerüchte existierten. Was man unternahm, hinter sein Geheimnis zu kommen, es war vergebens.vergebens. Kocher gab zu Versuchsanordnungen und Geräten eine Erklärung, die logisch schien. Der Neugierige fühlte sich trotzdem an der Nase herumgeführt. Die Apparaturen waren so komplex, dass selbst Fachleute sie nicht bewerten konnten.
Kocher war vielen ein Dorn im Auge. Dadurch aber, dass er immer wieder Erfolge erzielte und man ihn keiner strafbaren Tätigkeit überführen konnte, hatte er sich fest im Institut etabliert.
Sein Aufstieg, seine Karriere, waren beispiellos. Als hochbegabter Schüler erregte er Aufmerksamkeit. In Forschungswettbewerben für Jugendliche errang er erste Preise und eine USA-Reise. Dort knüpfte er Kontakte, die jahrelang bestehen blieben. Kocher studierte Physik und Chemie gleichzeitig. Dabei erarbeitete er den Lehrstoff nebenbei. Von Anfang an beschäftigte er sich mit Fragen, die weit über dem Niveau seines Semesters lagen. Schon vor seinem Examen war er weit über die Universität hinaus bekannt.
Im Studium gehörte er zu den Typen, für die nur die Wissenschaft zählte. Keine Politik keine Freundschaft und keine Drogen – weder Hasch noch Alkohol. Die Kommilitonen betrachteten teils mit Bewunderung, teils mit Abscheu.
Nach der Promotion zum Dr. rer. nat. bekam er einen Vertrag an einem Institut für Kernforschung in den USA. Nach einigen Jahren fruchtbaren Schaffens dort kehrte er nach Europa zurück. Wieder arbeitete er im nuklearen Bereich. Auf diesem Gebiet war Kocher zu Hause, dafür hatte er sich schon als Schüler interessiert. Die übrige Physik und Chemie schien ihm angeboren.
Ein wichtiger wissenschaftlichen Beitrag Kochers war eine beträchtliche Verkleinerung von Kernfusionsreaktoren. Er erreichte handliche Abmessungen, die man nie für möglich gehalten hätte.
Versuchsanlagen von Hochhausgröße passten jetzt in ein einziges Laboratorium.
Dieser Erfolg kam überraschend und schien aus den verborgenen Forschungen des egozentrischen Professors zu stammen. Als er ihn veröffentlichte, war das positive Echo in der Fachwelt groß. Doch Kocher hatte seine Erkenntnisse eher widerwillig veröffentlicht. Sein Erfolg war ihm nicht gleichgültig wie sonst; nein, er war ihm unangenehm. Denn damit lupfte er die Decke über seinem Geheimnis. Jetzt konnte man spekulieren, was er tat. Die grobe Richtung war erkannt. Vermutungen wurden angestellt, Möglichkeiten erwogen, Theorien erdacht.
Kocher war all das peinlich. Er musste mit seiner Erkenntnis herausrücken, damit er am eigenen Projekt weiterarbeiten konnte. Doch ließ man ihn nicht in Ruhe. Ein Fremdkörper wie er musste ausgemerzt werden. Dauernd frustrierte Neugierde schlägt um in Misstrauen, Misstrauen in Ablehnung.
*
Man suchte und fand! Kocher hatte eine Briefmarke aus Institutsbestand auf Privatpost geklebt. Dieser nichtige Anlass genügte, den Professor zu feuern. Und das störte ihn nicht. Keineswegs war er gebrochen, den Gefallen tat er ihnen nicht. Das war umso verwunderlicher, wenn man wusste, wie er arbeitete.
Er arbeitete wie besessen. Er kam meist um sechs Uhr morgens, lange vor offiziellem Dienstbeginn, und er ging nie vor zweiundzwanzig Uhr nach Hause. Oft blieb er weit bis über Mitternacht. Ein Privatleben kannte er nicht. Er war Junggeselle; hatte an nichts Interesse als an seiner Arbeit.
Er wohnte in einem großen, geräumigen Haus außerhalb der Stadt. Er hatte es geerbt. Man munkelte von einer umfassenden Bibliothek und einem vorzüglichen Labor. Wenige waren es, die ihn dort besuchen durften und berichten konnten.
Ein Arbeitstier war Kocher, wie es im Buche steht. Nimmermüde. Eines Tages hatte er Luftmatratze und Schlafsack mit ins Institut gebracht. Wenn sich der Nachhauseweg in der Nacht nicht mehr lohnte, legte er sich in seinem Arbeitszimmer zwei bis drei Stunden aufs Ohr. Oft genug kam es vor, dass er die ganze Nacht durcharbeitete.
Die einzige Leidenschaft war Geschwindigkeit. Kocher fuhr Flitzer, mit denen er sich selten an Geschwindigkeitsbeschränkungen hielt. Da er zu ungewöhnlichen Zeiten fuhr, geriet er selten in Polizeikontrollen. Auch die schnellen Wagen waren Mittel zum Zweck. Kocher wollte für den langen Weg von und zur Arbeit wenig Zeit verschwenden. Er besaß zwei Porsches – für den Fall einer Panne.
Der Forscher ließ sich bei seinem Rausschmiss kaum etwas anmerken und wehrte sich nicht dagegen. Die Erklärung für dieses Verhalten schien, dass Kocher sofort Rufe von verschiedenen Universitäten erhielt. Er lehnte allesamt ab und war verschwunden von der wissenschaftlichen Bildfläche.
Er saß in seinem Haus. Selten wurde er außerhalb gesehen. Sollte er etwa in seinem eigenen Laboratorium weiterarbeiten? Er konnte dort unmöglich mit nuklearen Prozessen experimentieren. Er hatte zwar die Anlagen wesentlich verkleinert, aber nicht so, dass man sie in einem Privathaus hätte unterbringen können.
Oder doch?
Kocher hatte es geschafft, die praktische Nutzanwendung aus der Formel E=m*c2 zu ziehen. Mit dieser Formel hatte Einstein bewiesen, dass in jeder Materie eine ungeheuere Energie steckt – nämlich die Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Und die beträgt 300.000 km pro Sekunde. Selbst Nuklearphysiker hatten es nicht erreicht, diese Energie annähernd zu nutzen. Ganz ausschöpfen konnte auch Kocher den Idealbetrag freier Energie nicht, er kam ihm aber beträchtlich nahe.
Hätte er seine Ergebnisse veröffentlicht, wären mit einem Schlag sämtliche Energieprobleme gelöst worden. Ein Kilogramm jeden beliebigen Materials hätte ausgereicht, die ganze Erde für Stunden mit Energie zu beliefern.
Kocher nutzte seine Entdeckung nur selbst. Sie war nicht das wichtigste Resultat seiner Arbeit, ermöglichte ihm aber weitere Ergebnisse.
Mit beliebigen Mengen an Energie konnte Kocher weiterarbeiten. Seinen nächsten Teilerfolg erreichte er noch im Institut: die Zerlegung jeder beliebigen Materie in ihre einzelnen Atombestandteile. Dieses Inferno von geballten rasenden Kernteilchen, unvorstellbaren Strahlenmengen und wahnwitziger Energie konnte keine Materie unter Kontrolle halten. Kocher entwickelte dazu spezielle energetische Felder. Sollte ein solches versagen, würde die Erde im Bruchteil einer Sekunde in einer Atomexplosion zerbersten.
Mit den energetischen Feldern erreichte Kocher zusätzlich, dass er atomare Reaktionen auf einem beliebig kleinen Raum ablaufen lassen konnte. Als er das Institut verlassen musste, benötigte er für seine Experimente nur den Platz eines gewöhnlichen Wohnzimmerschrankes.
Mit diesem Forschungsstand verließ Kocher die Universität. Er hatte genügend finanzielle Mittel und konnte ohne Unterstützung weiterarbeiten. Und bald würde er sich aller finanziellen Sorgen entledigen können.
Das war ihm nach einigen Monaten gelungen. Er konnte nicht mehr nur die Materie zerlegen in einen Brei von Protonen, Elektronen und Neutronen, er konnte diese Atombestandteile wieder zusammensetzen, zu jedem beliebigen Element. Er baute durch ein komplexes System von Sendern und spezifisch angeordneten Antennengeflechten innerhalb der schwirrenden Kernteilchen ein elektromagnetisches Mikrofeld auf, an dessen Knotenpunkten sich die gewünschten Elemente herauskristallisierten. Dieses Ergebnis war ein entscheidender Schritt in Kochers Arbeit. Er war ein Wendepunkt sowohl in seinen Forschungen als auch in seiner Arbeitsweise.
Kocher benötigte die Errungenschaft für seine Weiterarbeit. Er ging daran, sie auszuschöpfen.
Natürlich konnte er jetzt Gold herstellen. Aber er hatte nicht mehr die Zeit, es selbst zu verkaufen. Er brauchte Helfer, ohne dass er sich verdächtig machen durfte.
*
Seinen ersten Mitarbeiter fand er in einer Zeitungsanzeige. Ein Juwelier, Spiekenagel mit Namen, suchte einen Teilhaber. Kocher nahm Verbindung zu ihm auf und merkte schnell, dass das der richtige Mann war. Ein Mann mit ausgezeichneten Sachkenntnissen und ungewöhnlichem kaufmännischen Geschick. Geschäftliche Rückschläge zwangen ihn, sich nach einem Kompagnon umgesehen.
Kocher bot ihm an, Gold zu liefern. Er deutete halbgesetzliche Bezugsquellen an und garantierte Spiekenagel, dass er auf jeden Fall gedeckt wäre. Spiekenagel stimmte nach einigen Tagen zu, und es wurde ein simpler Vertrag geschlossen. Kocher musste Gold liefern und Spiekenagel es verkaufen. Der Erlös ging zu achtzig Prozent an den Professor, zu zwanzig an den Juwelier.
Das Geschäft klappte reibungslos. Kocher und Spiekenagel verstanden sich immer besser. Kocher produzierte unermüdlich Gold und Spiekenagel wunderte sich einstweilen, woher alles kam. So fragte er eines Tages danach und Kocher gestand ihm freimütig, dass er Kernforscher sei und eine Methode entwickelt hatte, es herzustellen.
Spiekenagel war beeindruckt, er sagte, soviel er wisse, sei dies noch niemandem gelungen. Er fügte hinzu, von Physik verstünde er nicht viel, aber alle Wissenschaften machten ja ungeheuere Fortschritte. Weiter schien er sich zur Erleichterung Kochers nicht dafür zu interessieren. Zu Beginn der Zusammenarbeit hatte Spiekenagel angenommen, dass er Diebesgut verhehlte. Daran hatte er zwar nach einigen Wochen nicht mehr gedacht, da er nichts über nennenswerte Golddiebstähle las. So war ihm wohler. Dass das Gold künstlich hergestellt wurde, schien ihm nicht ungesetzlich zu sein.
*
Der Juwelier hatte ein komplexes Verteilersystem entwickelt, er lieferte Gold zu den verschiedensten Zwecken in alle Welt. Das blieb nicht ohne Rückwirkung. Der Goldpreis begann zu sinken, und in verschiedenen Kreisen wurde man aufmerksam auf die Goldschwemme. Zum Glück war Spiekenagels Verteilersystem so umfangreich, dass auf ihn noch lange kein Verdacht fiel. Aber es konnte gefährlich werden, unbefangen Gold auf den Weltmarkt zu werfen.
Dies beriet er mit Kocher und fragte, ob er nur Gold herstellen könne. Natürlich nicht, jedes beliebige Element ließ sich erzeugen.
So gingen sie dazu über, Silber und Platin zu verkaufen. Spiekenagel baute den Handel weiter aus zu einem umfangreichen Rohstoffkonzern. Jeder Grundstoff, der sich finanziell lohnte, wurde hergestellt. So Metalle von Aluminium, Blei, Chrom über Eisen, Kupfer, Nickel, Osmium, Titan und Wolfram, die so genannten Seltenen Erden bis hin zu Zink und Zinn. Viele der Spurenelemente waren in der Computer-und Handy-Industrie heiß begehrt.
Auch Nichtmetalle wie Schwefel, Phosphor und Gase wurden verkauft. Spiekenagel musste sie nicht einmal unter Preis anbieten. Im Gegenteil, er konnte wegen der chemischen Reinheit höhere Gewinne erzielen.
Das Unternehmen nahm riesige Ausmaße an. Kocher konnte nicht mehr in seiner Villa produzieren. Spiekenagel baute einen Werkskomplex auf. Er verstand zwar nicht, weshalb Kocher seine Entdeckung nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellte, nahm aber an, er sei auf seine eigene Bereicherung aus. Ihm sollte das recht sein, solange er selbst daran teilhatte.
Er jedenfalls hatte eine wichtige Idee, das Unternehmen zu tarnen. Er nannte seine Firma »Pranalys« und warb damit, Stoffe chemisch rein, »pro analysi« zu verkaufen. So konnte er Rohstoffe einkaufen, die in der Fabrik angeblich gereinigt wurden. Dies wurden sie auch, wenn man davon absehen will, dass z.B. Schrott in Edelmetall verwandelt wurde oder Altpapier in hochwertigen Stahl, Kupfer oder Schwefel.
Die Firma verkaufte erheblich mehr, als sie einkaufte. Diesen Tatbestand vertuschte Spiekenagel damit, dass er Scheinkäufe tätigte bei einer Reihe von selbst gegründeten Scheinfirmen. Als Ausgangsmaterial dienten zwar auch die zur Tarnung gekauften Materialien, aber nur zu einem kleinen Teil. Rohmaterial waren Luft und Wasser – von beidem gibt es genügend auf der Erde.
»Pranalys«-Produkte errangen weltweite Anerkennung für ihrenie gekannte Reinheit. Über Absatz ließ sich nicht klagen. Trotzdem verkaufte Spiekenagel auch ungereinigten Rohstoff, um weitere Interessenten zu bedienen und den Gewinn zu steigern.
Mehrfach hatte Spiekenagel davon erfahren, dass Konkurrenzfirmen seinen Arbeitern und Angestellten enorme Summen geboten hatten, um das Geheimnis auszuspionieren. Sicherlich wäre mancher weich geworden, wenn er gewusst hätte, wie der Betrieb funktionierte. Aber dies wusste niemand. Das Werk war weitestgehend automatisiert. Einige wenige, technisch ausgebildete Angestellte kontrollierten die Steuerung. Fehler konnten allermeist durch Knopfdruck behoben werden. Wenn das nicht klappte, kümmerte sich Kocher persönlich um den Schaden. Die Arbeiter verstanden nicht, was sie taten. Die Leute in der Verwaltung, die 98% der Belegschaft ausmachten, hatten – wie auch sonst – keine Ahnung von der Produktion.
*
Auf diese Weise allen finanziellen Sorgen enthoben, arbeitete und forschte Kocher weiter. Keineswegs ruhte er aus. Lediglich anrüchige Kneipen, Anbagger-Treffpunkte, suchte er ab und zu auf, um sich eine Nacht lang zu vergnügen. Oder er zahlte für die Liebe. Eine Freundin hatte er nicht, wollte keine. Konnte keine Beziehung eingehen und machte sich keine Gedanken darüber. Kocher lebte, wie er leben wollte.
Sein nächster Schritt war das Herstellen ganzer Moleküle, nicht mehr nur Atome. Bei einfachsten Strukturen, wie Wasser, Salzen und Säuren fing er an, konnte nach und nach kompliziertere Moleküle herstellen, auch aus der organischen Chemie, der Kunststoff- und der Biochemie. Jeder beliebige Stoff war produzierbar. Das Angebot der Firma »Pranalys« wurde reichhaltiger, wurde zu einem Chemie- und Pharmakonzern. Und weiterhin übertrafen die Produkte alle Konkurrenten in ihrer Reinheit.
Kochers Apparatur war komplizierter geworden, arbeitete jedoch nach dem gleichen Prinzip. Ein Computer speicherte die Programme der elektromagnetischen Mikrofelder, nach denen die Atome und Moleküle aufgebaut wurden.
*