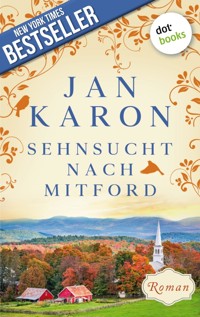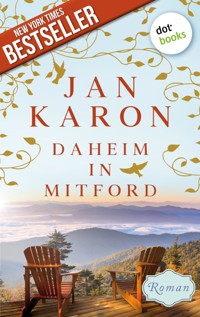
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mitford-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Dorf, die verflixte Liebe und das große Glück: der warmherzige Roman »Daheim in Mitford« von Bestseller-Autorin Jan Karon als eBook bei dotbooks. Im idyllischen Mitford ist die Welt noch in Ordnung … Das denkt zumindest Tim, der als Herz der kleinen Gemeinde gilt – bis das Chaos anklopft: Ein kleiner Junge und ein herrenloser Hund quartieren sich kurzerhand bei Tim ein, im Glockenturm der Kirche treibt ein Dieb sein Unwesen … und seine neue Nachbarin Cynthia ist in dem Trubel auch keine große Hilfe: Seit ihrer ersten Begegnung verspürt Tim so ein seltsames Kribbeln im Bauch, und es scheint ernst zu sein – die Diagnose lautet Liebe! Wie soll er bloß alles in dem Städtchen richten, wenn es in seinem eigenen Leben drunter und drüber geht? Heiter, beschwingt und so einladend wie ein gemütlicher Lesesessel – New-York-Times-Bestsellerautorin Jan Karon schreibt sich mit ihrer Mitford-Saga direkt in die Leserherzen: »Eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase« The Wall Street Journal Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der charmante Feelgood-Roman »Daheim in Mitford« von Jan Karon – Band 1 der Bestsellerreihe aus Mitford. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 816
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im idyllischen Mitford ist die Welt noch in Ordnung … Das denkt zumindest Tim, der als Herz der kleinen Gemeinde gilt – bis das Chaos anklopft: Ein kleiner Junge und ein herrenloser Hund quartieren sich kurzerhand bei Tim ein, im Glockenturm der Kirche treibt ein Dieb sein Unwesen … und seine neue Nachbarin Cynthia ist in dem Trubel auch keine große Hilfe: Seit ihrer ersten Begegnung verspürt Tim so ein seltsames Kribbeln im Bauch, und es scheint ernst zu sein – die Diagnose lautet Liebe! Wie soll er bloß alles in dem Städtchen richten, wenn es in seinem eigenen Leben drunter und drüber geht?
Heiter, beschwingt und so einladend wie ein gemütlicher Lesesessel – New-York-Times-Bestsellerautorin Jan Karon schreibt sich mit ihrer Mitford-Saga direkt in die Leserherzen: »Eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall Street Journal
Über die Autorin:
Jan Karon wurde 1937 in North Carolina geboren. Sie arbeitete in der Werbebranche, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Die Bände ihrer Mitford-Saga eroberten im Folgenden regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste. Heute lebt sie in Virginia, wo sie ein historisches Farmhaus aufwendig restaurierte und zu ihrem Zuhause machte.
Bei dotbooks erscheint in der »Mitford-Saga«:
»Daheim in Mitford«
»Der Himmel über Mitford«
»Die grünen Hügel von Mitford«
»Sehnsucht nach Mitford«
»Das Herz von Mitford«
***
eBook-Neuausgabe September 2019
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1994 by Jan Karon
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel »At home in Mitford« bei Knopf Doubleday Publishing Group, a division of Penguin Random House.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
This edition published by arrangement with Viking, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock/Zak Zeinert, Alessandro Cancian, Apostrophe und Gizele
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-797-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Daheim in Mitford« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jan Karon
Daheim in Mitford
Roman
Aus dem Amerikanischen von Michaela Link
dotbooks.
Für Candace Freeland, meine Tochter und Freundin
Kapitel 1Barnabas
Er verließ die kaffeeduftende Wärme der Grillstube an der Hauptstraße und blieb für einen Augenblick unter der grünen Markise stehen.
Die ehrliche Kälte eines noch jungen Bergfrühlings drang ihm bis auf die Knochen.
Wie oft hatte er das kleine Wunder erlebt, durch eine Tür in eine vollkommen andere Welt zu treten, mit anderen Gerüchen und anderen Reizen. Es half, sich der kleinen Dinge im Leben bewußt zu werden, sagte er sich und immer wieder auch seiner Gemeinde. Als er nun die zwei Blocks zum Pfarrbüro zurücklegte, stellte er fröhlich fest, daß er nicht ging, sondern schlenderte.
Dies war ein Vergnügen, das er sich nur selten gestattete. Immerhin konnte es so aussehen, als hätte er sonst nichts zu tun, wovon in Wahrheit keine Rede sein konnte.
Jetzt jedoch beschloß er, sich der verstohlenen Freude seines Tuns hinzugeben, so wie jemand ohne Reue auf einen Schlag eine halbe Schachtel Pralinen verzehrt.
Als er das Büro betrat, sprach er das Gebet, das ihm nun seit zwölf Jahren jeden Morgen an dieser Tür über die Lippen kam: »Vater, gib, daß ich heute irgendeinem Menschen zum Segen gereiche, durch Christus, unsern Herrn. Amen.«
Als er den Schlüssel aus seiner Tasche zog, spürte er etwas Warmes und abscheulich Feuchtes auf seinem Handrücken.
Er blickte hinunter in das Gesicht eines großen, schwarzen, schlammverkrusteten Hundes, dessen Schwanz wild gegen sein Hosenbein schlug.
»Allmächtiger!« rief er und wischte sich die Hand an der Windjacke ab.
Der Hund sprang an ihm hoch und leckte ihm das Gesicht, daß ihm der Speichel des Tieres bis ans rechte Ohr spritzte. »Laß das! Verschwinde!« rief er. Er versuchte, das Notizbuch in Sicherheit zu bringen, aber auch das bekam eine ausgiebige Portion Hundezärtlichkeit, bevor er es in seine Jackentasche stecken konnte.
Er erwog, die Flucht zu ergreifen, aber wenn jemand sah, wie er vor einem zotteligen, schlammbespritzten Hund davonlief, würde binnen einer halben Stunde die ganze Stadt davon wissen.
»Sitz!« befahl er scharf, woraufhin der Hund aufsprang und seinem Kinn eine Dusche verpaßte.
Er versuchte, das Tier mit dem Ellbogen abzuwehren, während er gleichzeitig den Schlüssel in die Bürotür schob. Hätte er von Natur aus dazu geneigt, wie ein Stallknecht zu fluchen, so wäre dies eine erstklassige Gelegenheit gewesen, dieser Neigung ausgiebig zu frönen.
»Laßt kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen ...«, zitierte er mit lauter Stimme aus dem Epheserbrief, »... sondern redet, was gut ist, was erbaut ...« Plötzlich setzte sich der Hund und blickte mit liebevoller Bewunderung zu seinem Opfer auf.
»Hm, tja«, sagte er gereizt und wischte das Notizbuch am Ärmel ab. »Ich hoffe, du hast diesen Unsinn jetzt hinter dir.« Woraufhin der Hund aufsprang, sich auf die Hinterbeine stellte und dem Herrn Pfarrer die mächtigen Pranken auf die Schultern legte.
»Pater Tim! Pater Tim!« Das war seine Teilzeitsekretärin Emma Garrett.
Er stand hilflos da, während seine Brillengläser unter einem Taifun feuchten Hundeatems beschlugen.
Wumm! Emma ließ ihre Handtasche auf den Kopf des Tieres niedersausen. Dann traf sie den Hund an der Kehrseite.
»Und komm ja nicht wieder!« rief sie, als der jaulende Hund sich in eine Rhododendronhecke flüchtete und verschwand.
Emma gab ihm ihr Taschentuch, das stark nach ›Meine Sünde‹ duftete. »Das war kein Hund«, sagte sie angewidert, »das war ein Buick!«
Im Pfarrbüro ging er direkt in das bescheidene Badezimmerchen und wusch sich Gesicht und Hände. Emma rief ihm durch die Tür zu: »Ihr Kaffee ist in einer Sekunde fertig!«
»Potz-Blitz! Machen Sie besser gleich zwei!« erwiderte er, während er sich die noch auf seinem Schädel verbliebenen Haare kämmte.
Als er das Badezimmer verließ, sah er sich seine Sekretärin zum erstenmal an diesem Morgen richtig an. Daß er sie überhaupt erkannte, war an sich schon bemerkenswert. Denn Emma Garrett hatte sich, erfüllt von den Verheißungen des Frühlings, ihr graues Haar rot gefärbt. »Emma!« rief er erstaunt. »Sind Sie das wirklich?«
»Das«, sagte sie mit tief empfundenem Gefühl, »bin ich mehr als die, die Sie seit Jahren gesehen haben. Diese alte, grauhaarige Eule, das war nicht ich!« Sie schüttelte den Kopf in beide Richtungen, damit er die Wirkung voll auskosten konnte.
Mit einer Mischung aus Entzücken und Verzweiflung stieß er einen tiefen Seufzer aus. Und er hatte gehofft, dies würde ein ganz gewöhnlicher Morgen.
Harold Newland hatte die Post früher als gewöhnlich gebracht und, da Emma zur Bank gegangen war, fein gestapelt dem Pfarrer auf den Schreibtisch gelegt. Ganz unten im Stapel lag, still und bescheiden, das allerwichtigste: der Brief vom Bischof.
Er hatte den Bischof gebeten, sich Zeit zu lassen, sich seine Antwort in Ruhe zu überlegen, und das hatte der Bischof auch wahrhaftig getan. Zwei ganze Monate waren verstrichen, seit er seinen eigenen Brief so bedächtig geschrieben und abgeschickt hatte.
Er blickte auf den elfenbeinfarbenen Umschlag herab. Es stand kein Absender drauf; dies war kein offizielles Kirchenschreiben. Wenn man diese typische, schwungvolle Handschrift nicht so genau kennen würde, käme man niemals auf den Absender.
Er wagte es nicht, ihn hier zu öffnen. Nein, er wollte ganz ungestört sein, wenn er ihn las. Ob der Bischof ihn eigenhändig geschrieben hatte? Wenn ja, würde er daran erkennen, wie ernst man seine Bemerkungen genommen hatte.
Vor Jahren, seinerzeit im Seminar, hatte seinen Freund die Bemerkung des Apostel Paulus stark beeindruckt, daß er den Brief an die Galater ›eigenhändig‹ niedergeschrieben habe – so als sei dies ein Akt großer persönlicher Opferbereitschaft. Als junger Seminarist hatte Stuart Gullen sich dies zu Herzen genommen. Seit seiner Einsetzung als Bischof war er dafür bekannt, alle Briefe, die für seine Diözese von wirklicher Bedeutung waren, eigenhändig niederzuschreiben. Woher er die Zeit dazu nahm, das war eine Frage, über die rege spekuliert wurde. Nun, das traf den Nagel auf den Kopf. Eben diese Zeit hatte er nicht. Was seine handgeschriebenen und nachdenklichen Briefe für alle Empfänger zu einer großen Kostbarkeit machte.
Nein, er würde ihn nicht öffnen, nicht einmal, um nachzusehen, ob ein Sekretär ihn für den Bischof getippt hatte. Er würde bis zum Abend warten, bis ihn die Abgeschiedenheit des Pfarrhauses und der Frieden seines frisch umgegrabenen Gartens umfingen.
Nach einem frühen Abendessen setzte er sich auf die halb mit feinem Moos überwachsene Steinbank unter den überhängenden Zweigen des Rhododendrons.
Dann las er den Brief, der tatsächlich in jener großzügigen, ausladenden Handschrift verfaßt war, die schier über die Seiten zu galoppieren schien.
Mein teuerster Timothy!
Es ist ein schöner Abend, um in diesem freundlichen Zimmer zu sitzen und einen Brief zu schreiben. Das Briefeschreiben ist für mich ein Luxus, der all meine Sinne anspricht, besonders, wenn ich einem alten Freund schreibe.
Ich glaube, es würde Dir gefallen, wie Martha meine unordentlichen Bücherregale umorganisiert und dieses Arbeitszimmer in einen benutzungsfähigen Zustand versetzt hat. Sie hat sogar Deinen Lieblingsläufer flicken lassen, so daß Du bei Deinem nächsten Besuch nicht über die zerschlissene Stelle stolpern und kopfüber in den Lehnsessel fliegen wirst!
Du fragst, ob ich jemals so etwas erlebt habe, wie Du es im Augenblick erlebst. Mein Freund, Erschöpfung und Müdigkeit sind die steten Gefährten eines hingebungsvollen Priesters. Es ist ein Problem von epidemischen Ausmaßen, und ich bitte Dich, tröste Dich damit, daß Du nicht allein bist. Manchmal, wenn man ganz allein in einer kleinen Pfarre sitzt wie Du jetzt – und wie ich früher –, glaubt man, die Dinge, die einen bedrängen, richten sich direkt gegen die eigene Person.
Ich versichere Dir, das ist nicht der Fall.
Ein alter Freund, der als Pastor in Atlanta tätig war, sagte einmal: »Ich habe keine Krise des Glaubens, sondern eine der Emotionen und der Energie. Für die führenden Persönlichkeiten einer Gemeinde ist es ein Ding der Unmöglichkeit, daß ihr Hüter behütet werden muß. Ich war zerschlagen, ausgebrannt, zornig und niedergedrückt.«
Der Ton Deines Briefs – und ich gehe davon aus, daß Du ganz offen mit mir warst, so wie immer – läßt, Gott sei's gedankt, nicht auf Niedergeschlagenheit oder Zorn schließen. Aber ich mache mir Sorgen um Dich, wenn ich darüber nachdenke, was geschehen könnte, wenn diese Sache nicht mit der notwendigen Behutsamkeit behandelt wird.
Hier einige Dinge, die Dir als Denkanstöße dienen mögen: Führe ein Tagebuch und laß ein wenig Dampf ab. Wenn das Deinen Neigungen nicht entspricht, suche Dir einen gottesfürchtigen Therapeuten und schicke mir die Rechnung, die die Diözese gern übernehmen wird.
Deine Mutter hat, so glaube ich, eine beträchtliche Summe hinterlassen, und vielleicht solltest Du einen Teil davon für Dich benutzen, für etwas anderes als das Kinderkrankenhaus, das Du all diese Jahre mit solcher Hingabe unterstützt hast. Ich kenne Dich gut genug, um zu glauben, daß ich Dich nicht ermuntern muß, zu beten. Du hattest in dieser Hinsicht immer einen gewaltigen Antrieb, und wenn sich daran etwas geändert haben sollte, nun, Timothy, dann bringe es wieder in Ordnung.
Du magst es vielleicht nicht wissen, aber Du bist eines der stärksten und festesten Glieder in der Kette dieser Diözese. Du bist mir sehr wichtig, und aus Erkundungen vor Ort weiß ich, daß Du auch für Deine Herde von allergrößter Bedeutung bist. Daran darfst Du niemals zweifeln.
Martha ist zu mir gekommen, um mir zu sagen, daß es Schlafenszeit ist. Ich kann nicht mit Worten ausdrücken, wie wunderbar es ist, manchmal selbst etwas gesagt zu bekommen, statt immer derjenige zu sein, der bestimmt.
Ich hätte mir niemals träumen lassen, daß ich jemals heiraten würde, und niemand hat mehr darüber gestaunt als ich selbst, als ich im Alter von neunundvierzig Jahren bereit und willens war, einen weiteren lebenslänglichen Schwur zu leisten. Anderen ist dieser Schritt ungewöhnlich erschienen, aber mir erschien er als das natürlichste auf Erden.
Ich kann Dir nicht raten, Dir ebenfalls eine Frau zu suchen, Timothy, aber ich möchte sagen, daß diese zehn Jahre mit Martha dem Druck, der auf meiner eigenen Seele lastete, große Linderung verschafft haben. Ich kann nicht sagen, daß das Arbeitstempo sich verringert hätte–es hat sich eher beschleunigt , aber ich stelle fest, daß meine Fähigkeit, dies zu ertragen, beträchtlich zugenommen hat.
Wie ich mich aus unserer Zeit im Seminar entsinne, hatten wir beide in bezug auf Frauen so ziemlich den gleichen Geschmack. Ich weiß noch, daß Du ganz hingerissen von Peggy Cramer warst, aber als Deine Gefühle für sie Deine Berufung zu stören begannen, hast Du die Verlobung gelöst. Bis auf den heutigen Tag glaube ich, daß es richtig war, Dir damals dazu zu raten. Dennoch frage ich mich manchmal – hast Du Dich jemals ganz mit Deinem Herzen ausgesöhnt?
Da ist sie wieder, mein Freund. Und glaube mir, meine Frau schätzt es gar nicht, wenn sie mich zweimal bitten muß. Daß sie meine Energie in geordnete Bahnen lenkt, ist eine gute Sache. Ansonsten würde ich alle Kraft für Ihn hingeben und hätte nichts mehr übrig, um mich morgens aus dem Bett zu erheben.
Ich kann Dich nur ermahnen, Deine Kraft ebenfalls in geordnete Bahnen zu lenken, wie Du es offensichtlich so dringend nötig hättest. Gib der Sache ein Jahr! Oder gib ihr allerhöchstens zwei. Wenn Du aber merkst, daß Du es nicht schaffst, wird Pater DeWilde ab dem Herbst zur Verfügung stehen und wäre dann meine Wahl für die Kapelle Unseres Herrn.
Timothy, wenn Du mit dieser einseitigen Unterhaltung nicht zurecht kommst, dann ruf mich an. Du kennst ja meine Telefonnummer. Ich schließe Dich täglich in meine Gebete ein.
Ich wünsche Dir Seinen Frieden alle Tage,
Stuart
Das Licht verdämmerte langsam, und die Kühle der Steinbank kroch in seine Knochen.
Er stand auf und sah sich in dem ergrünenden Garten um, als sehe er ihn zum erstenmal. Es lag ein merklicher, scharfer Geruch in den Schatten, die sich um das Rosenbeet schmiegten, das er zweimal umgegraben hatte – ein ähnlicher Duft, wie ihn die Blumenrabatten und der Hartriegel verströmten, den er eigenhändig gepflanzt hatte. Er fühlte sich zu Hause in Mitford, ganz und gar und ohne Vorbehalte. Das letzte, was er wollte, war, von hier fortzugehen. Und doch stand ganz oben auf der Liste der Dinge, die er wollte, der Wunsch, etwas anders zu machen, produktiv zu sein – und genau das war das Problem.
Fast jeden Wochentag machte er morgens um Viertel vor sieben Besuche im Krankenhaus, frühstückte dann in der Grillstube und ging hinüber zum Pfarrbüro. Während des restlichen Vormittags arbeitete er, schrieb Briefe, telefonierte und verwaltete seine Gemeinde von fast zweihundert Seelen.
Mittags ging er dann zum Essen wieder in die Grillstube oder aß, wenn es regnete, schneite oder hagelte, die Hälfte von Emmas werktäglichem Ei- und Salatsandwich und dazu einen Teil ihrer Schokoladenbonbons.
Nachmittags arbeitete er dann bis vier an seiner Predigt, erteilte Ratschläge und brachte ganz allgemein Ordnung in die Angelegenheit seiner Berufung. ›Ein Platz für ein jegliches Ding, und ein jegliches an seinem Platz‹, wie er gern aus den Sprüchen Salomos zitierte.
Gelegentlich stimmte es ihn traurig, daß er nie geheiratet und eine eigene Familie gegründet hatte. Aber als Junggeselle hatte man, das mußte er zugeben, viel mehr Zeit für seine Pfarrfamilie.
Am Donnerstagnachmittag ging er mit einem Korb, den ihm ein Mitglied der Altargilde überreicht hatte, nach Hause. Der Korb enthielt selbst eingemachte grüne Bohnen, einen Krug saure Gurken und einen Laib Bananenbrot. Er legte sein Notizbuch obenauf und deckte das Ganze mit einem Entwurf für den sonntäglichen Pfarrbrief zu.
›Wie Rotkäppchen‹, dachte er bei sich, während er den Schlüssel vom Haken nahm. Er trat ins Freie, verschloß die Tür hinter sich und ließ den schweren Schlüssel in seine Tasche gleiten. Dann drehte er sich um und riß ungläubig die Augen auf.
Was da mit erschreckender Geschwindigkeit auf ihn zuschoß, war etwas, das er nie wiederzusehen gehofft hatte.
Es war der große, springende, leckende, schlammbespritzte Hund.
Mehrere Tage lang schien der Hund aus dem Nichts plötzlich aufzutauchen: Einmal, als er die alte Kirchgasse hinunterging, um sich in der Kapelle Unseres Herrn mit dem Klempner zu treffen. Dann wieder, als er längs des Gehweges, der zum Pfarrhaus führte, ein Lavendelbeet anlegte. Ein weiteres Mal, als er zum Krämerladen ging, um Milch und Süßkartoffeln zu kaufen. Und zweimal, als er aus der Grillstube kam. Die Begegnung in der Kirchgasse war ziemlich ereignislos verlaufen. Nachdem sein Angreifer ihm enthusiastisch die Hand geleckt und ihn mit einem tüchtigen Sprung beinahe umgeworfen hätte, hatte der Pfarrer sich in der Lage gesehen, ihn mit einer lauten Rezitation seiner Wäscheliste zurückzuschlagen. Als er bei den Socken angekommen war – drei Paar weiße, vier Paar schwarze, ein Paar blaue –, war der Hund zum Friedhof hinter der Kirche geschlendert und verschwunden.
Am Lavendelbeet hatte die Sache jedoch ganz anders ausgesehen. Er kniete in ernster Konzentration auf einem Pflasterstein, als er plötzlich zwei große Pfoten auf seinen Schultern spürte. Einen Augenblick später wurde seinem linken Ohr ein so nasses Bad zuteil, daß er beinahe vor Überraschung ohnmächtig geworden wäre.
»Gütiger Gott!« rief der Pfarrer, der der Länge nach in einen flachen Korb mit Setzlingen gestürzt war. Der Sturz hatte ihn jedoch nicht seines Pflanzenhebers beraubt.
Er drehte sich um, hob diesen in die Höhe, als wolle er zu einem fürchterlichen Schlag ausholen, und stellte zu seiner Überraschung fest, daß der Hund mit einem Ausdruck glücklicher Erwartung auf den Hinterbeinen stand.
Getrieben von einem merkwürdigen Impuls, warf er den Pflanzenheber so weit weg, wie er konnte. Das aufgeregte Geschöpf sprang hinterher, stieß dabei einen freudigen Refrain wilden Gebells aus und kehrte prompt zurück, um dem Pfarrer den Pflanzenheber zu Füßen zu legen.
Der ob des Zwischenfalls sprachlose Pfarrer warf den Pflanzenheber noch einmal und schaute zu, wie der Hund ihn zurückbrachte. Er konnte nur darüber staunen, wie er es fertigbrachte, sich geschlagene zwanzig Minuten einer solch törichten Beschäftigung hinzugeben. Aber im Grunde genommen war ihm, das wußte er sehr wohl, nichts anderes eingefallen.
Eines Morgens hatte er sich bei den Gästen in der Grillstube erkundigt. »Hat jemand diesen großen, schwarzen Hund schon einmal gesehen?«
»Sie meinen das Vieh, das Sie so ins Herz geschlossen hat?« fragte Percy Mosley. »Den haben wir vor ein oder zwei Wochen das erste Mal gesehen. Ein paarmal ist er wie ein Frachtzug hier vorbeigesaust. Sobald jemand versucht, ihn einzufangen, ist er auf und davon wie ein geölter Blitz.«
»Wir haben versucht, ihm etwas zu Fressen zu geben«, sagte Percys Frau, Velma, »aber er scheint Percys Küche nicht zu mögen.«
»Haha«, sagte Percy, der an sechs Portionen Rösti arbeitete.
»Sie sollten ihn festhalten, wenn er das nächste Mal hinter Ihnen herjagt, und dann das Tierheim anrufen«, schlug Velma vor.
»Also erstens«, sagte Pfarrer Tim, »ist es unmöglich, diesen speziellen Hund festzuhalten. Und zweitens habe ich nicht die Absicht, ihn an einen Ort zu schicken, der seinen endgültigen Untergang bedeuten könnte.« Und drittens, dachte er, ist dieser Hund mir noch nie nachgejagt. Ich bin keinen Millimeter vor ihm zurückgewichen!
»Übrigens, er sitzt genau in diesem Augenblick da draußen und wartet auf Sie«, bemerkte Hessie Mayhew, die mit einem Arm voll überfälliger Bücher auf dem Weg zur Bibliothek war und nur kurz hereingeschaut hatte.
Der Pfarrer erhob sich von seinem Platz in der Nische und warf einen Blick durchs Fenster. Ja, tatsächlich. Jetzt sah auch er das Geschöpf, das so seelenvoll in die Grillstube blickte.
Er konnte nicht dagegen an; er fand es auf seltsame Weise schmeichelhaft, daß jemand auf ihn wartete, selbst wenn es sich um einen Hund handelte. Emma hatte schon vor Jahren gesagt, daß er einen Hund brauche, oder eine Katze, oder wenigstens einen Vogel. Aber nein, so etwas hatte er nicht ein einziges Mal auch nur in Erwägung gezogen.
»Wir sollten das Tierheim anrufen«, insistierte Percy, der fand, daß ein klein wenig Trubel den Morgen verschönern würde. »Die schnappen ihn, bevor Sie im Pfarrbüro angekommen sind.« Der Pfarrer packte verstohlen ein Stückchen gebutterten Toast in eine Serviette und ließ ihn in seine Tasche gleiten. »Warten wir damit noch ein Weilchen, Percy«, sagte er und ging zur Tür.
Dort blieb er einen Augenblick stehen, um sich zu sammeln. Dann öffnete er die Tür und trat hinaus auf den Gehsteig.
Das Dorf Mitford schmiegt sich behaglich in ein breites, sanft abfallendes und von steilen Bergen begrenztes Tal.
Wenn man einem dem Spazierengehen zugeneigten Mitglied der Gemeinde der Kapelle Unseres Herrn Glauben schenken durfte, maß Mitfords Geschäftsbezirk von einem Ende zum anderen exakt dreihundertzweiundvierzig Schritte.
Am nördlichen Ende stieg die Hauptstraße leicht an und beschrieb einen Kreis um eine runde Grünanlage mit einem Kriegerdenkmal in der Mitte, die von einer Hecke aus Hemlocktannen umsäumt wurde. Ringsum standen vier Bänke, von denen man das Ehrenmal und im Frühling ein schmuckes Beet von Stiefmütterchen betrachten konnte – eine gewisse Parteiung der Bürger erkannte dieser Pflanze den Rang einer offiziellen Stadtblume zu.
Nach Süden gewandt, gleich links vom Denkmal, stand das Rathaus, daneben die Erste Baptistenkirche. Mitten in der Gebüsch- und Blütenpracht von deren Frontbepflanzung erhob sich eine Straßenkanzel, die auf ewig den Bibelvers Johannes 3,16 trug, den die Kirchenmitglieder vor langen Zeiten als die zentrale Botschaft ihres Glaubens erachtet hatten.
Rechts vom Denkmal ragte mit Blick auf die Fliederstraße das einst so eindrucksvolle Heim von Miss Rose und Onkel Billy Watson auf, in deren überwuchertem Garten gegenwärtig zwei Eßstühle aus Chrom standen. Darauf saßen sie, wenn sie dem Verkehr rund um das Denkmal zuschauten. Auswärtige Besucher, die die zwei Blocks des Hauptgeschäftsbezirks entlanggingen, zeigten sich stets überrascht, daß die Geschäfte so weit auseinanderlagen, was an den großen Gartengrundstücken zwischen den Häusern lag. In den lehmigen, säuberlich voneinander abgegrenzten Beeten standen Holzschilder:
Gartenlust – Es grüßt Joes Friseurladen, oberes Stockwerk rechts.
Nimm Dir Zeit, die Rosen zu riechen – Mit besten Empfehlungen Oxford Antiquitäten.
Ein Garten für den Leser – Ihre Buchhandlung ›Happy-End‹.
›Mitford‹, stand einmal in einem Reiseartikel einer bekannten Zeitung zu lesen, ›ist ein Dorf, das sich vom übrigen zeitgenössischen Amerika so erfrischend unterscheidet. Hier, wo die Straßen nach Blumen benannt sind und die Dorfbewohner in einem Dutzend wohlduftender Rosenlauben Schatten suchen können, widmet sich im Frühjahr der größte Teil der Bürgerschaft einschließlich der Kaufleute der Gartenarbeit.
... und obwohl Mitfords an die Jahrhundertwende erinnernder Charme und seine Schönheit Besucher anziehen wie das Geißblatt die Bienen, bemüht sich die Stadt bewußt, sich den eigentlichen Tourismus vom Leib zu halten.‹
›Wir wollen, daß die Leute auf einen kurzen Besuch zu uns kommen‹, sagt Bürgermeisterin Esther Cunningham, ›aber wir sind im Grunde nicht daran interessiert, daß sie länger bleiben. Die Collegestadt Wesley, nur fünfzehn Meilen von uns entfernt, ist dafür besser geeignet. Dort gibt es Restaurants und Gasthäuser und alles, was der Tourist braucht. Mitford ist das Richtige für eine kurze Pause zur Erholung.‹
Geht man auf der Hauptstraße nach Süden, kommt man bis zur Kreuzung mit der Blauregengasse am Postamt, der Bibliothek, einer Bank, der Buchhandlung, Winnie Iveys Leckerbäckerei und einem neuen Laden für Herrenbekleidung vorüber.
Nicht zu vergessen den Lebensmittelladen, der für sein frisches Geflügel und sonstige Produkte einheimischer Herkunft berühmt war. Die meisten Leute nannten ihn einfach den ›Laden‹. Seit sechsunddreißig Jahren bot der ›Laden‹ Hühner und Kaninchen, Wurst, Käse, Butter, Kuchen, Pasteten, Eier von Freilandhühnern, Marmeladen und Gelees feil, die von einer Bauerngemeinschaft im Tal stammten, die zur entsprechenden Jahreszeit auch Gemüse und Beeren lieferte. Im Sommer wurden die Fässer auf dem Gehsteig unter der grünen Plane jeden Tag mit frischen Maiskolben der Sorte Silver Queen, die noch in ihren Lieschblättern steckten, gefüllt. Und im Juli fand man im Kühlbehälter Kübel mit dicken Brombeeren.
Die Blauregengasse schlängelte sich links von der Hauptstraße am Pfarrhaus der Episkopalkirche vorbei, dessen schwarze Haustür in die grüne Abgeschiedenheit des Baxter Parks führte, und stieg dann hügelaufwärts zu den Presbyterianern hinauf.
Rechts von der Hauptstraße führte die Blauregengasse lediglich zur Wesley-Kapelle, einer winzigen Methodistenkirche, die am Bachufer in einem Wäldchen von rosa blühendem Kirschlorbeer stand und für ihr besonders süßes Glockengeläut bekannt war.
Der zweite und einzige weitere Geschäftsblock auf der Hauptstraße bestand aus einer Handlung für Landwirtschafts- und Haushaltsbedarf, einem Café, einem Blumenladen, einem irischen Wollgeschäft und einem Antiquitätenladen, jeweils mit Gärten dazwischen.
Als nächstes kreuzte die Alte Kirchgasse die Hauptstraße; zur Linken führte sie steil zum Kirchbergweg hinauf, wo in der Nähe von Miss Sadie Baxters Fernbank die verfallenen Grundfesten von Mitfords erster Episkopalkirche im hohen Gras einer Wiese versanken.
Nach links führte die Alte Kirchgasse zur Kapelle Unseres Herrn, die zwischen zwei unbebauten Grundstücken stand. Jenseits der Kirche, die im übrigen für ihren schönen normannischen Turm und ihre prächtigen Gärten bekannt war, verengte die Gasse sich zwischen einigen wenigen anheimelnden Häusern am Ufer eines munteren Baches, wo angeblich der einblütige Fichtenspargel im Überfluß wuchs.
Wo die Straßen und Gassen talabwärts ins ländliche Umfeld führten, begann das gewellte Bauernland. Hier grasten Hereford- und Guernsey-Rinder auf den Weiden, ungezählte Forellen und rotbrüstige Sonnenfische tummelten sich in den Seen, und Schwanengänse stolzierten schnatternd zwischen den Scheunen umher. Und überall, im ganzen Tal, in der Stadt und außerhalb, war es den Regenwürmern die reinste Lust, sich durch den fruchtbaren schwarzen Lehmboden zu arbeiten.
In seltenen Fällen, und ohne daß er einen besonderen Grund dafür hätte angeben können, stellte er sich vor, in seinem Arbeitszimmer in Gesellschaft einer geselligen Ehefrau am Feuer zu sitzen. Er würde lesen, und sie würde ihm gegenüber in einem Ohrensessel sitzen.
In dieser Idylle konnte er zwar ihr Gesicht nicht sehen, aber wußte, daß es von mädchenhaftem Liebreiz war und daß sie pausenlos strickte. Stricken, fand er, war ein Trost für die Seele. Es hatte etwas Geordnetes. Etwas ewig Gleichbleibendes. Und am Ende kam etwas dabei heraus.
In diesem Traum stand auf dem Tisch neben seinem Sessel stets eine köstliche Überraschung, und fast immer handelte es sich um ein Stück Torte. In seinem tiefsten Junggesellenherzen liebte er Torte mit einer Leidenschaft, die ihn bestürzte. Und doch lehnte er, wenn man ihm ein zweites Stück anbot, für gewöhnlich ab. »Hätten Sie nicht gern noch ein Stück von dieser leckeren Kokostorte, Herr Pfarrer?« fragte man ihn. »Nein, ich glaube, mehr mag ich nicht«, sagte er dann. Eine glatte Lüge!
In dieser imaginären Kaminszene würde er nicht viel reden, dachte er. Aber hier und da würde er vielleicht auf Kirchenangelegenheiten zu sprechen kommen, laut eine Stelle aus Blake oder Wordsworth vorlesen und einen Entwurf für eine Predigt an seiner Gefährtin ausprobieren.
Das wäre ein Luxus, der jeder selbstgemachten Süßspeise bei weitem überlegen sein mußte – jemanden zu haben, der seinen Entwürfen lauschte und zustimmend nickte oder, wenn es denn unbedingt sein mußte, auch einmal sein Mißfallen kundtat.
Manchmal tauschte er sich mit seinem engen Freund Hal Owen, dem Tierarzt, aus, aber im wesentlichen, fand er, müsse sich ein Mann seine Theologie allein zusammenzimmern.
Über eben jenes Thema dachte er an diesem speziellen Abend nach, kurz nachdem er dem schwarzen Hund sein Abendessen in die Garage gestellt hatte, als er von einem lauten, kehligen Gähnen überrascht wurde, das von irgendwo in der Nähe seiner bestrumpften Füße herrührte.
Zu seinem Erstaunen stellte er fest, daß der streunende Hund neben seinem Sessel lag und zu ihm aufblickte.
»Verflixt!« rief er. »Ich muß die Garagentür offen gelassen haben.«
Der für gewöhnlich lebhafte Hund strahlte nicht nur eine besinnliche Gemütsruhe aus, sondern blickte mit einem Ausdruck ernsten Begreifens zu ihm auf. Wie seltsam, daß die braunen Augen seines Gefährten eine gewisse Ähnlichkeit mit denen eines alten Gemeindevorstehers aufwiesen, den er als junger Priester gekannt hatte.
Solchermaßen ermutigt, griff er nach einem Band von Wordsworth, der neben ihm auf dem Tisch lag.
»›Es ist ein wunderschöner Abend, ruhig und frei‹«, las er laut vor.
The holy time is quiet as a nunBreathless with adoration, the broad sunIs sinking down in its tranquillity;The gentleness of heaven broods o'er the sea:Listen! the mighty being is awake,And doth with his eternal motion makeA sound like thunder, everlastingly.
Der Hund schien mit ehrlichem Interesse zu lauschen. Und als der Pfarrer mit dem Gedicht, das Wortsworth für seine kleine Tochter geschrieben hatte, zu Ende war, ging er frohgemut zu einem Essay über.
›Das Leben und die Welt‹, begann der Aufsatz nicht besonders anspruchsvoll, ›sind zwei erstaunliche Dinge.‹
»Wie wahr, wie wahr«, murmelte er, während der Hund näher zu ihm rückte.
Barnabas! dachte er. So hatte der alte Gemeindevorsteher geheißen. »Barnabas«, sagte er laut in das stille, von einer Lampe erleuchtete Zimmer hinein.
Sein Gefährte hob aufmerksam und erwartungsvoll den Kopf.
»Barnabas?« Der Hund schien zustimmend zu blinzeln, und der Pfarrer bückte sich und tätschelte ihm den Kopf.
»Also gut, Barnabas!« sagte er mit der ganzen Autorität der Kanzel. Die Sache war entschieden, ein und für allemal.
Als er sich erhob, um die Lichter im Arbeitszimmer zu löschen, stand Barnabas ebenfalls auf und gab den Blick auf etwas frei, was den Pfarrer aufstöhnen ließ. Dort, auf dem abgetretenen Aubusson-Teppich, lagen seine Lieblingslederpantoffeln, die ihm zwanzig Jahre treue Dienste geleistet hatten, durchgekaut bis auf die Sohlen.
»Ein Welpe«, stellte Hal Owen fest, während er seine Pfeife entzündete. »Noch nicht ganz ausgewachsen.«
»Wie groß wird er denn noch, was meinst du? So groß?« Pater Tim streckte die Hände aus und hielt sie ein kleines Stück voneinander entfernt.
Hal Owen grinste und schüttelte den Kopf.
»So?« Er hielt die Hände noch weiter auseinander. »Hm, hm. Ungefähr so groß«, meinte Hal.
Barnabas hatte sich in der Ecke neben dem Schreibtisch des Pfarrers niedergelassen und klopfte glücklich mit dem Schwanz auf den Boden.
Während er gemächlich vor sich hin paffte, musterte Hal den Hund mit nüchterner Konzentration. »Eine Prise Schäferhund, würde ich meinen. Jede Menge frischer Wolfshund. Aber überwiegend Bouvier, wenn du mich fragst.«
Der Pfarrer seufzte tief.
»Er wird dir gut tun, Tim. Der Mensch braucht jemanden, mit dem er reden kann, jemanden, der sich seine Klagen anhört und seine Torheiten bestätigt. Und was seine Herkunft betrifft, halte ich es mit E. B. White: ›Ein wirklich umgänglicher und unentbehrlicher Hund ist ein Zufall der Natur. Man kann ihn nicht züchten, und man kann ihn nicht mit Geld kaufen. Er läuft einem einfach über den Weg.‹«
»Nun, er hat tatsächlich eine Vorliebe für die Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts.«
»Da siehst du's!« Hal setzte seine Tweedkappe auf. »Bring Barnabas mal mit raus nach Meadowgate, dann lassen wir ihn ordentlich über die Felder laufen. Oh, und March wird dir eine Hühnerpastete backen. Wie würde dir das gefallen?«
Es gefiel ihm besser, als er mit Worten ausdrücken konnte.
»So, jetzt muß ich los. Muß noch bei Tommy McGees Pferden das Gebiß nachsehen und das Hinterteil von Harold Newlands Färse.«
»Deinen Beruf möchte ich nicht haben, mein Freund.«
»Und ich nicht deinen«, entgegnete der Tierarzt fröhlich.
»Ah ... Was genau soll ich ihm zu fressen geben?«
»Geld«, sagte Hal ohne jedes Zögern. »Wirf es einfach zweimal täglich da rein, und er wird es verbrennen wie ein Ofen.«
»Das hatte ich schon befürchtet.«
»Ich sag dir was. Ich lasse dir das Futter en gros schicken, ordentliche Qualität. Und wird dich kaum was kosten. Etwa soviel, als hättest du dir eine Hauskatze angeschafft.«
»Gott segne dich.«
»Vielen Dank, Tim. Das kann ich brauchen.«
»Möge er sein Antlitz über dir scheinen lassen!« fügte er mit Inbrunst hinzu.
»Da hätte ich nichts dagegen«, sagte Hal, während er sich die Handschuhe überstreifte. »Ich werde mich morgen oder übermorgen auch um seine Impfungen kümmern.«
Genau in diesem Augenblick hörten sie Schritte – Emma Garretts Schuhe näherten sich der Bürotür. Barnabas hörte sie auch. Mit erstaunlicher Behendigkeit sprang er über den Schreibtischstuhl des Pfarrers, rutschte über den persischen Gebetsteppich zur Tür, stellte sich auf die Hinterbeine und machte sich bereit, Emma zu begrüßen.
»Die Altargilde hilft heute, den Stadtkern mit Stiefmütterchen zu bepflanzen«, sagte Emma, als er mit Barnabas an einer neuen, roten Leine hereinkam. »Und«, fügte sie strahlend hinzu, »es wäre schön, wenn Sie nachher auch kommen könnten und die Farben festlegen.« Es war gewiß nicht so, daß die Altargilde nicht allein mit den Farben zurechtkäme, dachte sie. Aber er hatte immerhin ein paar Preise für seine gärtnerischen Fähigkeiten gewonnen, und in einer Zeitschrift, die von der Elektro-Co-op herausgegeben wurde, hatte ein Artikel über ihn gestanden. Er bemerkte, daß Emma eindeutig so tat, als existiere Barnabas überhaupt nicht, was nicht gerade einfach war in einem Büro, das nur für zwei Schreibtische, zwei Stühle, eine Besucherbank, vier Kleiderhaken und einen gemeinsamen Abfallkorb Platz bot.
»Wie meinen Sie das, ich soll die Farben festlegen?« fragte er, während er seine Telefonnotizen durchging.
»Na ja, Sie wissen doch. Sollen die gelben in die Mitte oder an den Rand, oder was? Und wohin mit den blauen? Nicht neben die purpurnen!« sagte sie voller Überzeugung.
»Ich werde mich darum kümmern.«
Sie sah ihn über ihre Brillengläser hinweg an. »Es steht Ihnen gut, wenn Sie etwas braun werden, das muß ich schon sagen.«
»Vielen Dank, daß Sie es sagen. Verglichen mit der Bräune eines Golfspielers ist die eines Gärtners zwar weniger vornehm, aber sie hat ihre Vorzüge. Man braucht zum Beispiel keine blaßgrünen Golfhosen zu tragen, um sie zu erlangen.«
Emma brüllte vor Lachen. Wenn sie irgend etwas schätzte, dann war es ausgiebiges Gelächter. Und ehrlich, der Pfarrer mochte zwar für viele Dinge gut sein, aber er war nicht immer gut für ein Lachen.
»Sie sehen nicht mehr so schrecklich abgemüht aus wie noch vor einer Weile. Ein- oder zweimal dachte ich schon, wir müßten Sie bald vom Fußboden kratzen.«
»Der Frühling, Emma. Er kuriert die Knochen und läßt den Geist wieder aufleben.«
»Nun, hoffen wir, daß es so bleibt«, sagte sie und sah ihn an, als sei er eine gekochte Kartoffel.
Dann widmete sie sich wieder den Schecks vom Sonntag. »Es ärgert mich ziemlich, daß Petrey Bostic niemals seine Versprechen einhält«, brummte sie.
»Sie wissen, daß ich nichts davon hören will. Ich will nicht nur Dollarzeichen statt Seelen sehen, wenn ich vor meiner Gemeinde stehe.«
»Wissen Sie, was ich glaube?«
Er wußte es nicht.
»Ich glaube, Sie leben in einem Elfenbeinturm. Mir scheint, Sie wollen überhaupt nicht wissen, was wirklich passiert. Denken Sie nur an die Baptisten; die wissen immer über alles Bescheid.«
Emma sprach gern über die Baptisten, da sie früher selbst zu ihnen gehört hatte. »Ach, tatsächlich?« sagte er milde.
»Was reinkommt, was rausgeht, wer Spendenkönig ist. Es gibt nichts, worüber sie nicht Bescheid wissen wollen.«
»Aha«, sagte er. Seit dem Tag, an dem sie sich in einen Rotschopf verwandelt hatte, benahm sie sich entsprechend.
Er wandte sich seiner alten Schreibmaschine zu und tippte mit den Zeigefingern:
Lieber Walter,
Dk. f D.en Brief v. 12. März. Garten läuft gut, wenn auch immer noch kalt und viel Regen. Vorbereitungen für heilige Woche in vollem Gang.
Hoffe, die Stimmung hat sich gebessert. Weiß, daß Er Dich zu richtiger Entscheidung führen wird. Psalm 32,8 verspricht: »Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.« Daran zweifel nie!
D. zugetaner Vetter
PS: Hoffe, D. diesen Sommer zu sehen. Grüße an Katherine. Du bist immer in meinen Gebeten.
Als er von dieser kryptischen Botschaft an seinen Vetter und Kindheitsfreund aufblickte, sah er, daß es wieder angefangen hatte zu regnen. Den ganzen Morgen über hatte der Nebel so dick wie Suppe in einer Schale über dem Dorf gehangen, so daß er wieder einmal überlegt hatte, ob er sich nicht einen von diesen orangefarbenen Regenmänteln kaufen sollte, damit man ihn im Nebel sehen konnte.
»Sie haben keinen Wagen?« hatte sein früherer Bischof einmal ungläubig gefragt. Nun, warum sollte er wohl einen haben, bitte schön? Das Pfarrhaus lag zwei Minuten vom Büro entfernt und weniger als drei von der Kirche. Zum Krankenhaus hatte er es nur ein paar Häuserblocks weit, und einer der besten Lebensmittelläden überhaupt lag direkt auf der anderen Straßenseite.
Der alte Gospelprediger Vance Havner hatte genau dieses Phänomen beschrieben: »Wir leben in einer Zeit der Autofahrer, und jeder, der zu Fuß geht, wird mit Argwohn beäugt. Sie sehen einen Mann die Straße herunterkommen; er ist einfach nur in Gedanken versunken, und sie vermuten, daß er entweder verrückt geworden oder ihm das Benzin ausgegangen ist. Es ist eine solche Seltenheit, daß die Hunde anfangen zu bellen, als hätten sie einen Geist gesehen.«
Das Zufußgehen hielt ihn fit und zufrieden, auch wenn er nicht immer wie aus dem Ei gepellt aussah. Und wenn es hart auf hart kam, konnte er jederzeit die Batterie seines Buick Riviera aufladen lassen, den Wagen aus der Garage holen und losfahren.
Er hatte sogar schon ernsthaft daran gedacht, sich ein Fahrrad zu kaufen. Aber jetzt war da natürlich Barnabas. Und ein Pfarrer mit Priesterkragen auf einem Fahrrad, einen riesigen schwarzen Hund an einer roten Leine?
»Verflixt und zugenäht!« sagte Emma, als sie einen Fehler in ihrer Buchhaltung machte.
Barnabas sprang auf und sprang zu ihrem Schreibtisch, legte die Pfoten auf das Rechnungsbuch, beugte sich vor und hauchte ihre Brillengläser an.
»Mein Gott!« rief sie aus.
Warum sagte sie nur immer »Mein Gott«, wenn es um Dinge ging, die nicht das mindeste mit ihrem Gott zu tun hatten? Er packte Barnabas am Halsband und zog ihn in die Ecke neben seinem Stuhl.
»Ich mache keine Witze«, bemerkte Emma und blinzelte, während sie sich die Brille putzte. »Entweder er oder ich.« Sie griff nach ihrem Butterbrotbeutel, legte ihn in den Schreibtisch und knallte die Schublade zu.
»Sitz!« befahl er. Barnabas stand da und wackelte mit dem Schwanz.
»Bleib!« sagte er, während Barnabas gemächlich zur Tür schlenderte und schnupperte.
»Na gut, dann eben: Sitz!« Barnabas trabte zu seiner Wasserschüssel und genehmigte sich einen guten Schluck.
»Na ja, egal«, murmelte er und brachte es nicht fertig, Emma anzusehen.
Er setzte sich und wandte sich der Lesung aus dem Evangelium für den kommenden Sonntag zu. Bevor er sich anschickte, es übungshalber laut vorzulesen, wie es seinen Gewohnheiten entsprach, räusperte er sich.
Barnabas schien dies als Zeichen aufzufassen, an den Stuhl seines Herrn heranzutreten, seine Vorderpfoten auf dessen Schultern zu plazieren und als Dreingabe ausgiebig die Bibel zu belecken.
Er hatte gerade gelesen, daß es eine fruchtbringende Strategie sein könne, schlechtes Benehmen zu ignorieren und gutes zu loben. »Was Sie auch tun«, hatte der Artikel eindringlich gemahnt, »sehen Sie Ihrem Hund nicht in die Augen, wenn Sie seine Aufmerksamkeit nicht wecken wollen.«
»Und Jesus ging vorüber«, begann der Pfarrer, der den anklagenden Blick seines Hundes sorgsam mied, »und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind geboren ist?«
Barnabas seufzte und legte sich hin.
Ohne den Blick abzuwenden, fuhr er fort: »Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.«
Er las laut vor bis Vers 5. Dann hielt er inne und musterte Barnabas mit einiger Konzentration.
»Hm, also wirklich«, sagte er schließlich, »das ist sehr ungewöhnlich.«
»Wovon sprechen Sie?« fragte Emma.
»Der Hund scheint ...« – der Pfarrer räusperte sich – »... auf Bibelzitate zu hören.«
»Ganz bestimmt nicht!« entgegnete sie angewidert. »Dieser Hund hört auf gar nichts!«
Genau in diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und Miss Sadie Baxter trug dazu bei, die merkwürdige Vermutung zu bestätigen.
Bevor sie etwas sagen konnte, war Barnabas durch den Raum geschossen, um ihr seinen schönsten Gruß zuteil werden zu lassen, woraufhin der Pfarrer das erstbeste rief, was ihm einfiel – und das war, was Petrus den um ihn versammelten Menschen gesagt hatte: »Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen!« Barnabas legte sich der Länge nach auf den Boden und seufzte zufrieden.
»Ich bin schon getauft, vielen Dank«, sagte Miss Sadie und nahm ihren Regenhut ab.
Kapitel 2Eine zweifelhafte Gabe
Miss Sadie Baxter war das letzte noch lebende Mitglied einer der ältesten Familien Mitfords.
Im Alter von sechsundachtzig Jahren bewohnte sie das größte Haus im Dorf mit dem weitesten Ausblick. Und sie besaß das meiste Land, das zu einem großen Teil von einem alten, aber ertragreichen Apfelgarten beansprucht wurde. In der Tat behaupteten die Köche des Dorfs, daß man die besten Apfelkuchen nicht mit Granny Smiths machte, sondern mit den festen, leicht herben Sadie Baxters, wie man diese Apfelsorte mittlerweile nannte.
Soweit man wußte, hatte Miss Sadie niemals etwas von dem Geld weggegeben, das ihr Vater mit seinem Sägewerk im Tal verdient hatte. Aber sie gab von Herzen gern Äpfel weg – sackweise, scheffelweise, haufenweise. Der einzige Teil von Fernbank, für dessen Instandhaltung sie in den letzten Jahren wirklich etwas getan hatte, waren eindeutig die Obstgärten, denn, wie jeder von der Straße aus sehen konnte, hätte das Dach, das über den Bäumen sichtbar wurde, dringend einiger Reparaturen bedurft. Es wurde behauptet, daß sie bei Regen inmitten einer Reihe von Eimern in ihrem Wohnzimmer saß und daß das Geräusch der Regentropfen, die in die Kübel klatschten, so laut war, daß man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte.
Es goß übrigens gerade heftig, als sie an diesem Dienstagmorgen bei ihrem Pfarrer vorbeischaute. »Barmherziger Himmel!« sagte sie und schüttete ihren Regenhut aus. »Was für ein scheußlicher Tag!«
Pfarrer Tim eilte ihr entgegen, um ihr aus dem Regenmantel zu helfen und ihre feuchten Wangen zu küssen. »Was hat Sie denn um Himmels willen bei diesem Unwetter aus dem Haus getrieben?«
»Sie wissen doch, daß das Wetter mich noch nie an irgend etwas gehindert hat!« sagte sie mit einer Stimme, die so frisch klang wie die eines jungen Mädchens.
Und das stimmte. Jeder wußte, daß Sadie Baxter in ihrem 1958er Plymouth wie der Wind den Hügel hinunterkam – bei jedem Wetter. Nur bei Eis lagen die Dinge etwas anders. »Es ist unberechenbar«, pflegte sie zu diesem Thema zu sagen, »und ich liebe nun einmal das Berechenbare.« Also pflegte sie an eisigen Tagen zu lesen, Klavier zu spielen, die Familienalben durchzusehen oder Louella anzurufen, ihre ehemalige Hausangestellte und Gefährtin, die jetzt bei ihrem Enkel in Marietta, Georgia, lebte.
Pfarrer Tim sah, daß Miss Sadie wie gewöhnlich auf den Gehweg gefahren und ihren Wagen so dicht vor der Treppe geparkt hatte, daß er ihr die Farbe vom Kotflügel kratzen würde, wenn er die Tür des Pfarrhauses ganz aufmachte.
»Setzen Sie sich«, sagte Emma, »und trinken Sie eine Tasse Kaffee.«
»Sie wissen ja, wie ich ihn gern habe«, sagte sie und machte es sich bequem. »Also! Wissen Sie was?«
»Ich habe nicht den leisesten Schimmer«, sagte der Pfarrer.
»Ich wiege genausoviel Pfund, wie ich Jahre auf dem Buckel habe!«
»Nein!« rief Emma.
»O doch. Ich war bei Hoppy, um mich einmal gründlich untersuchen zu lassen, und die Waage zeigte genau sechsundachtzig Pfund an. Hätten Sie das gedacht?«
»Nie!« sagte der Pfarrer.
»Und wissen Sie noch was?« fragte sie, während sie wie ein Schulmädchen auf der Kante der Besucherbank hockte.
»Was denn?« fragte er.
»Louella kommt mich zu Ostern besuchen. Ihr Enkel fährt sie den ganzen Weg von Marietta hier herauf! Sie kann nicht mehr kochen, daher dachte ich, wir essen einfach tiefgefrorene Hühnchenpasteten. Glauben Sie, das ginge, Emma?«
»Aber natürlich. Und vielleicht etwas Obstsalat mit Wackelpudding.«
»Gute Idee! Und Tee. Ich kann immer noch Tee machen. Louella trinkt ihn gerne sehr süß. Was gäbe es sonst noch?«
Emma dachte nach und tippte mit ihrem Bleistift auf die Schreibmaschine. »Hm ...«
»Ich sage Ihnen was«, meldete sich der Pfarrer zu Wort. »Ich backe Ihnen einen Schinken.«
»Das würden Sie für mich tun? Oh, Herr Pfarrer, das wäre so ... Also wirklich, Gott segne Sie.«
»Das tue ich doch gern!« sagte er und fühlte sich bereits gesegnet.
»So, das wäre dann ja geregelt. Und Sie würden von selber nie drauf kommen, also erzähl ich es Ihnen. Gestern bin ich überhaupt nicht aus dem Haus gegangen. Also, ich sage es ja nur höchst ungern, aber ich habe mich nicht einmal angezogen, ist das nicht schrecklich? Ich bin einfach den ganzen lieben langen Tag im Morgenrock herumgelaufen. Meine Mama wäre in Ohnmacht gefallen. Und als nächstes habe ich auf dem Dachboden herumgestöbert und nach einer alten Babypuppe gesucht, die mir plötzlich wieder eingefallen war – eine Babypuppe, die mindestens achtzig Jahre alt sein muß. Aber wir werfen niemals etwas weg, daher wußte ich einfach, daß ich sie finden würde. Oh, und der Staub! Also wirklich, ich habe einen richtiggehenden Staubsturm aufgewirbelt!
Und die Hüte! Ach herrje, die Hüte, die ich gefunden habe! Unmengen schöner Hüte, die meine Mama getragen hat. Ich werde sie irgendwann mal morgens mit in die Sonntagsschule bringen, damit die Kinder sie anprobieren können. Oder wäre das allzu gotteslästerlich?«
Er lachte. »Ganz gewiß nicht!«
»Also, dann habe ich nach einem alten Bild von Papa gesucht, dem Bild mit dem Schnauzbart, und ich bin hinten in dem Teil des Dachbodens herumgekrochen, wo wir immer die Bilder in kleinen Regalen aufbewahrt haben. Und ich habe mal dies herausgezogen und mal das, und wissen Sie, was dann passiert ist? Nun ...« Miss Sadie machte eine Pause und sah ihre Zuhörer aufmerksam an.
»Nun, was?« fragte Emma und beugte sich vor.
»Nun, da war dieses alte Gemälde von der Heiligen Jungfrau und dem kleinen Jesus, das Papa aus Übersee mitgebracht hat.«
»Aha!« sagte der Pfarrer.
»Und ich möchte, daß Sie es für die Kirche nehmen, Herr Pfarrer«, fuhr sie fort, »und dort an die Wand hängen.«
Diese Sache konnte gefährlich werden. Er erinnerte sich an zwei oder drei andere Geschenke an die Kirche, die größte Bestürzung ausgelöst hatten. Eins war ein ausgestopfter Elchskopf gewesen, dessen Spender meinte, der Elch sei immerhin ein Geschöpf Gottes gewesen und daher durchaus passend für die Wand des Pfarrhauses, wenn schon nicht für das Kirchenschiff selbst.
»Vielleicht könnte ich eines Tages mal nach Fernbank raufkommen und einen Blick darauf werfen, und es dann ... holen.«
»Oh, nein. Das ist nicht nötig. Ich habe es gleich mitgebracht. Wenn Sie nur mit zum Wagen kommen würden ...«
»Es regnet in Strömen, Miss Sadie.«
»Oh, ich weiß, deshalb habe ich es ja auch in eine Decke gewickelt, und dann habe ich noch etwas Plastik drumherum gewickelt und mit einer Kordel verschnürt!«
Er stellte fest, daß er seine Bürotür genau bis zur Hälfte öffnen konnte, ohne den grünen Plymouth zu beschädigen. Dann bugsierte er einen Schirm vor sich hinaus ins Freie, spannte ihn vor der Tür auf, trat seitlich aus dem Zimmer heraus, hob den Regenschirm über den Kopf und öffnete zu dem trommelnden Geräusch eines heftigen Regengusses eine der hinteren Türen ihres Wagens. Er beugte sich über den Sitz, griff mit der rechten Hand nach dem schweren Gemälde und hielt mit der Linken seinen Schirm fest.
Es gelang ihm, sich das Gemälde unter den Arm zu klemmen, die Wagentür mit dem Absatz seines durchweichten Schuhs zuzuschlagen, die Bürotür mit der Kappe desselben Schuhs aufzustoßen, das Gemälde anschließend vor sich durch die Tür zu schieben, den Regenschirm zu senken, sich selbst durch die schmale Öffnung zu zwängen und tropfnaß auf den Teppich zu stellen.
»Da ist es!« sagte Miss Sadie beglückt, als hätte sie das Päckchen selbst aus dem Wagen geholt.
Er lehnte völlig erschöpft das schwere Bündel gegen die Wand. »Wenn Sie eine Schere hätten, Emma, würde ich alles weitere erledigen.« Miss Sadie schob sich die Ärmel ihrer Strickjacke hoch und machte sich daran, durch mehrere Schichten Kordel, Stoff und Plastik zu schneiden.
»Also«, sagte sie, »Sie beide sehen in die andere Richtung, und ich sage Ihnen, wann Sie wieder herschauen dürfen.«
Der Pfarrer drehte sich um und blickte aus dem Fenster hinter seinem Schreibtisch, während er sich mit einem Taschentuch sein regennasses Gesicht und die Hände trocken rieb. Emma heftete ihren Blick in stoischer Ruhe auf die Badezimmertür, an der an einem schwarzen Brett die Gemeindemitteilungen hingen.
Nun beeil dich schon, dachte Emma, die noch die Rechnungen für die Osterblumen vor sich hatte.
»Jetzt!« rief Miss Sadie.
Er drehte sich um und war von dem Anblick wie gelähmt.
Das Gemälde in dem breiten, vergoldeten, kunstvoll geschnitzten Rahmen war eine in rosigen Tönen gehaltene Darstellung von Mutter und Kind, die selbst unter dem Schmutz und Staub von Jahren geradezu glühte. Um den Kopf des Säuglings war ein schwacher Heiligenschein zu sehen, und die Mutter blickte mit versonnener Zärtlichkeit auf das Kind in ihren Armen hinab. Im Hintergrund sah man, abgesetzt vom Blau und Gold ihres Gewandes, eine Landschaft, die von einem leuchtenden Fluß durchschnitten wurde und darüber einen Himmel, der in den platin-, rosa- und lavendelfarbenen Tönen einer frühen Morgensonne erstrahlte.
»Nun, also«, sagte er und verspürte den plötzlichen Drang, sich zu bekreuzigen. »Dies ist ganz ... ganz und gar wunderschön. Ich habe nicht erwartet ...«
»Dann gefällt es Ihnen also?« Miss Sadies Augen tanzten.
»Ob es mir gefällt? Es gefällt mir ungeheuer gut! Es ist wunderschön anzusehen.«
»Ich habe es saubergemacht«, erklärte Miss Sadie stolz. »Zitronenseife.«
Er ging in die Hocke, um das Bild näher in Augenschein nehmen zu können. »Steht da irgendwo ein Name? Wissen wir, wer es gemalt hat?«
»Keine Spur von einem Namen. Ich habe mein Vergrößerungsglas hervorgeholt und es mir von vorn bis hinten angesehen.«
Plötzlich flog die Bürotür auf und wehte ihnen einen Regenschwall sowie einen tropfnassen Harry Nelson ins Zimmer.
»Der Aufenthalt von mehr als drei Personen gleichzeitig verstößt hier gegen das Gesetz«, sagte Emma schlecht gelaunt. Sie konnte den Anblick des ersten Gemeindevorstehers ohnehin nur schwer ertragen, und schon gar nicht in einem nassen Regenmantel, der den dünnen Teppich durchweichte.
»Wenn wir hier jemals richtig zu Geld kommen, reißen wir diese Mauern raus und bauen Ihnen ein paar hundert Quadratmeter an«, sagte Nelson selbstzufrieden.
Nur über meine Leiche, dachte der Pfarrer, der das winzig kleine Steingebäude, das die Gemeinde 1879 errichtet hatte, von Herzen liebte.
Harry Nelson legte seinen Regenmantel in die Ecke, schenkte sich eine Tasse Kaffee ein und setzte sich zu Miss Sadie auf die Besucherbank.
»Okay, Pater, hier ist mein Bericht. Wir haben uns die Sache angesehen und festgestellt, daß wir das Schränkchen unmöglich rausreißen können, weil dann der Altarraum mehr oder weniger zum Teufel gehen würde.«
Während Pfarrer Tim und Harry Nelson Kirchenangelegenheiten diskutierten, besprach Emma mit Miss Sadie das Ostermahl. Emma erbot sich sogar, eigenhändig kleeblattförmige Hefebrötchen zu backen, was sie nicht mehr getan hatte, seit Charly vor zehn Jahren gestorben war. Und Miss Sadie beschloß, mit Louella und ihrem Enkelsohn auf der Sonnenveranda zu speisen, falls sie schönes Wetter haben würden.
»Nun, nun, was ist denn das da?« wollte Harry wissen und deutete mit dem Kopf auf das Gemälde.
»Miss Sadie macht der Kapelle Unseres Herrn ein Geschenk«, sagte Pfarrer Tim stolz.
Harry beugte sich vor, um das Bild besser betrachten zu können. Da Emma direkt hinter ihm saß, kam ihr plötzlich eine so faszinierende Idee, daß ihr beinahe die Luft wegblieb. Harry stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Das sieht mir stark nach einem Vermeer aus«, informierte er die anderen.
»Also wirklich, Harry Nelson, ich hatte keine Ahnung, daß Sie sich mit Vermeer auskennen«, sagte Miss Sadie.
»Auskennen! Nun, das möchte ich doch behaupten! Shirley und ich haben alle möglichen Kurse besucht, um unser Kunstverständnis zu schulen. Wußten Sie, daß es nur fünfunddreißig Vermeers auf der Welt gab, bis ein paar Holländer im letzten Jahr einen ganzen Haufen davon gefälscht haben? Die haben die Bilder im Ofen gebacken, damit sie echt aussahen.«
Er nahm seine Brille ab und sah das Gemälde mit schmalen Augen an. »Haben Sie irgendwo eine Signatur gefunden?«
»Bisher nicht«, erwiderte der Pfarrer.
»Also, wenn der nicht echt ist, fresse ich meinen Hut. Verflixt, ich habe gehört, daß sogar die Fälschungen einen ganzen Batzen einbringen. Ich sag Ihnen was, ich habe einen Freund, der den Wert solcher Bilder schätzt, und den werde ich bitten, von Charlotte herüberzukommen, um es sich einmal anzusehen. Er sagt immer, daß ein paar der größten Kunstfunde in der Geschichte von irgend jemandes Dachboden stammen.«
»Genau daher kommt es auch«, gestand Miss Sadie.
»Nun, ich mache mich auf den Weg. Ich muß über den Berg rüber, um ein paar Kunden zu besuchen. Junge, Junge, dieser Kaffee haut einen aber aus den Socken.«
»Ah, Harry, was diesen Schätzer angeht, ich glaube nicht, daß wir es damit so eilig haben. Ich finde, wir sollten damit warten.«
»Warten? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.« Harry nahm seinen Regenmantel vom Haken, warf ihn sich über den Kopf, zwängte sich durch die Tür und rief ihnen über die Schulter zu: »Miss Sadie, Sie hätten diesen Plymouth auch gleich durch die Tür fahren können.«
Aus einem Grund, den er nicht näher bezeichnen konnte, fand Pfarrer Tim den Plan, einen Schätzer hinzuzuziehen, seltsam unangenehm. Aber gegen Mittag ereignete sich etwas noch Unangenehmeres.
Während er mit erwartungsvoller Vorfreude seinem gewohnten Regentaganteil cremegefüllter Törtchen aus Emmas Essenstute entgegensah, sagte sie leichthin: »Cremetörtchen? Auf die verzichte ich während der Fastenzeit.«
Als er eintrat und die Tweedkappe abnahm, die Hal Owen ihm einmal geschenkt hatte, wandte Percy Mosley sich kurz vom Grill ab und nickte ihm zu, um sich dann wieder seinen Würstchen zu widmen.
Seltsam, dachte Pfarrer Tim, nahm in seiner Lieblingsnische Platz und schlug seine Zeitung auf. »Percy«, sagte er, »ich glaube, ich nehme heute zwei mehr als sonst.« Velma kam zu seinem Platz und blickte ihn grinsend an. »Wir haben was zu feiern, wie? Ich hätte auch zwei Eier gegessen, wenn ich nicht an meinen Cholesterinspiegel denken müßte.«
Cholesterin, Cholesterin, dachte der Pfarrer. Er hatte mehr als genug über das Thema Cholesterin gehört. Genauso schlimm wie der Hula-Hoop-Fimmel.
Velma schenkte ihm Kaffee ein. Er war bei vielen Konferenzen, Exerzitien, Seminaren und Workshops gewesen, aber genau hier gab es den besten Kaffee, den er je getrunken hatte. »Wieso, was soll ich denn feiern?«
»Nun, das ganze Geld, das Ihre Kirche nun bekommt.«
»Von welchem Geld reden Sie?« fragte er verwirrt. »Das Kunstgeld. Also, ich habe gehört, Sie hätten da ein Gemälde, das mehr als zweihunderttausend Dollar wert ist.«
Er hatte gerade einen Schluck Kaffee genommen und bedauerte es zutiefst, daß er sich das braune Gebräu nun über die Brust spritzte.
»Meine Güte!« rief Velma und half ihm, den Kaffee abzutupfen.
»Velma, was auch immer Sie gehört haben, es entspricht absolut nicht der Wahrheit. Jemand hat der Kirche ein Gemälde gestiftet, und wir haben es noch nicht einmal schätzen lassen. Es ist ein hübsches Bild, das ist alles.«
»Wir haben gehört, es sei ein Veneer«, brüllte Percy vom Grill herüber.
»Jawohl, genau das haben wir gehört«, meldete sich Mule Skinner zu Wort, der Grundstücksmakler.
Verflixt! dachte er und verlor vollends den Appetit.
Miss Sadie hatte das Gemälde am Dienstag gebracht. Bis Donnerstagabend hatte er eine noch nie dagewesene Anzahl von Telefongesprächen entgegengenommen. Selbst Emma, die den Tag frei hatte, rief an.
Um acht Uhr hatte sich die Summe in der Grillstube auf zweihunderttausend belaufen. Gegen drei Uhr nachmittags hatte er einen Anruf von einem Architekten erhalten, der ihm Pläne für einen Anbau an die Kirche vorlegen wollte und ihm zu der Million Dollar gratulierte, die die Kapelle Unseres Herrn für den Verkauf des alten Meisterwerks erhalten würde. Um halb vier rief die Dorfzeitung an und bat ihn um eine Stellungnahme.
Um vier schmerzte sein Magen. Blutige Magengeschwüre! räsonierte er düster. Er schaltete den Anrufbeantworter ein und ging.
Um fünf nach vier wurde Walters Anruf folgendermaßen erwidert: »Behaftet mit wachem Geist und dankbarem Herzen im Gebet. Hier ist das Pfarrbüro der Kapelle Unseres Herrn. Bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht.«
An diesem Abend hängte Pfarrer Tim das Telefon aus, ließ Barnabas sein gewiß allererstes Bad zukommen, bereitete sich ein Abendessen aus gekochtem Huhn und Spinatsoufflé zu, trank ein Glas Sherry und ging zu Bett. Was war, wenn es sich bei dem Gemälde wirklich um einen Vermeer handelte? Er verstand nicht viel von Kunst, aber er wußte, daß das Werk eine gewisse Macht besaß, eine Vitalität, die nicht in jeder Darstellung der heiligen Jungfrau mit Kind zu finden war.
Er wußte auch um den Aufruhr, der folgen würde, wenn sie tatsächlich im Besitz eines so kostbaren Werks waren. Hatte er nicht schon genug Kopfschmerzen wegen des Wandbehangs aus dem siebzehnten Jahrhundert, der sich im Kirchenschiff befand? Nur um ihn zu versichern, hatte er Monate gebraucht, endlose, teure Telefongespräche und schlaflose Nächte. Zu guter Letzt waren sie gezwungen gewesen, die Kirchentüren verschlossen zu halten, etwas, das ihm zutiefst widerstrebte.
Aber schließlich lief alles auf eine ziemlich einfache Erkenntnis hinaus: Er konnte wie immer darauf vertrauen, daß Gott ihn leiten würde. Im Laufe des Abends wuchs seine Zuversicht, daß er mit Gottes Hilfe in der Lage sein würde, im besten Interesse aller Betroffenen zu handeln.
Als er am nächsten Morgen zum Pfarrbüro ging, hatte sein Schritt etwas Beschwingtes. Natürlich durfte er mit keiner Menschenseele darüber reden. Aber gestern nacht hatte er zum erstenmal in seinem Leben einem Hund erlaubt, am Fuß seines Bettes zu schlafen. Und es war eine Erfahrung gewesen, die ihm unvergleichliche Zufriedenheit beschert hatte.
»Da!« sagte Emma und stellte ihm schwungvoll eine Schachtel Cremetörtchen auf den Schreibtisch. »Sie haben schließlich nicht versprochen, während der Fastenzeit darauf zu verzichten. Sie können meinen Vorrat haben.« Sie hätte übrigens gern gewußt, worauf er während der Fastenzeit verzichten wollte, fand es aber ungehörig, ihn danach zu fragen.
Er schob die Schachtel in seine rechte obere Schreibtischschublade. »Sie«, sagte er mit echtem Gefühl, »sind ein unbezahlbares Juwel.«
»Was ist passiert?«
»Es war ein denkwürdiger Tag. Petrey Bostick hat angerufen, um zu sagen, daß wir einen Teil des Geldes darauf verwenden sollten, eine Klimaanlage in der Kirche einbauen zu lassen.«
Emma rollte mit den Augen. Das schon wieder! Welchen Sinn hatte es, in anderthalbtausend Meter Höhe zu leben, wenn man Klimaanlagen installieren wollte? Jedes Jahr brachten die Leute die alte Leier von der Klimaanlage wieder auf. Im Laufe des Vormittags rief ein Grundstücksmakler an, um ihnen vorzuschlagen, das Land zu beiden Seiten des Kirchhofs zu kaufen, das man ihnen, falls sie interessiert wären, in aller Stille verfügbar machen würde. Es überraschte den Pfarrer keineswegs, daß der Preis, seit der Gemeindevorstand sich vor zwei Jahren einmal danach erkundigt hatte, um fünfzig Prozent gestiegen war.
Von der Zeitung rief jemand an, um zu fragen, ob er ein Foto von dem Gemälde machen dürfe, mit Miss Sadie auf der einen Seite und Pfarrer Tim auf der anderen. Der Schätzer meldete sich und meinte, er werde am Montag um halb zehn zur Stelle sein. Und sie hörten, daß der Gemeindevorstand eine Versammlung angesetzt hatte, um über den Erwerb eines walnußfarben gestrichenen Taubenhauses aus Stahl zu reden, außerdem sollte die Frage erörtert werden, ob man für die Kollekte nicht Sammelteller aus Messing anschaffen wolle statt der traditionellen Körbe und außerdem ein Buntglasfenster für die innere Kirchenvorhalle, das vom Boden bis zur Decke reichen sollte.
Nachdem zwei Gemeindemitglieder erschienen waren, um ihn an die Hungernden überall auf der Welt zu erinnern, kam ein drittes herbei, um ihn an die Hungernden hier zu Hause zu erinnern.
Während einer kurzen Atempause wandte er sich an Emma und sagte schlicht: »Wir dürfen nicht zulassen, daß dies uns die Freude des Osterfests zerstört.«
»Amen«, sagte sie inbrünstig.
Da war nur ein Problem. Er hatte keine Ahnung, wie er verhindern sollte, daß genau das geschah.
Eine kanadische Kaltfront sandte eisige Luftströme über die Berge und in die Täler um Mitford herum.
Nachdem er Barnabas durch den Baxter-Park geführt hatte, seine Krankenhausrunde gemacht und einem Gemeindemitglied beim Frühstück in der Grillstube seinen Rat erteilt hatte, sah er mit Freuden einer friedlichen Zeit an seinem Schreibtisch entgegen. Jetzt mußte er noch die losen Enden der beiden bevorstehenden Ostergottesdienste zusammenknüpfen. Vielleicht, dachte er, würde ihm das nach dem Besuch des Schätzers um neun Uhr dreißig möglich sein. Wenn ihn Ängste über den Ausgang der Schätzung plagten, so waren sie ihm glücklicherweise nicht bewußt.