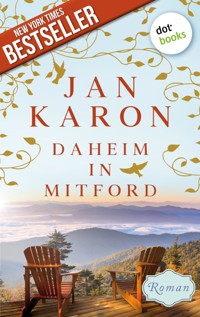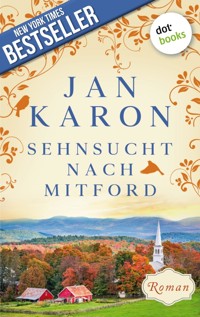Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mitford-Saga
- Sprache: Deutsch
Denn auf Regen folgt stets Sonnenschein: Der bezaubernde Roman »Der Himmel über Mitford« von Jan Karon jetzt als eBook bei dotbooks. Kann das Glück im Chaos liegen? Wenn Pfarrer Tim eins nicht mag, ist das Unruhe in seiner Heimatstadt, dem idyllischen Mitford inmitten grüner Hügel und bunter Blumenwiesen. Doch in letzter Zeit scheint ihn das Schicksal gern auszutricksen: Eine unbekannte Cousine taucht auf und sorgt für Trubel … und eine wohlhabende Witwe scheint Pfarrer Tim unbedingt für sich gewinnen zu wollen. Der Ärmste weiß weder ein noch aus – zumal er sich doch insgeheim zu seiner hübschen Nachbarin Cynthia hingezogen fühlt ... und jedes Mal verlegen wie ein kleiner Junge herumstammelt, wenn sie ihm ein strahlendes Lächeln schenkt. Kann er womöglich ihr Herz für sich erobern? Gemütlich wie eine Kuscheldecke: Die heiteren Geschichten aus Mitford sind so heimelig wie der erste Kaffeeduft am Morgen und ebenso zauberhaft wie die Romane der Bestsellerautorinnen Debbie Macomber und Inga Lindström. »Jan Karons Mitford-Romane sind eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall Street Journal Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der warmherzige Feelgood-Roman »Der Himmel über Mitford« von Jan Karon – Band 2 der großen Mitford-Saga. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kann das Glück im Chaos liegen? Wenn Pfarrer Tim eins nicht mag, ist das Unruhe in seiner Heimatstadt, dem idyllischen Mitford inmitten grüner Hügel und bunter Blumenwiesen. Doch in letzter Zeit scheint ihn das Schicksal gern auszutricksen: Eine unbekannte Cousine taucht auf und sorgt für Trubel … und eine wohlhabende Witwe scheint Pfarrer Tim unbedingt für sich gewinnen zu wollen. Der Ärmste weiß weder ein noch aus – zumal er sich doch insgeheim zu seiner hübschen Nachbarin Cynthia hingezogen fühlt... und jedes Mal verlegen wie ein kleiner Junge herumstammelt, wenn sie ihm ein strahlendes Lächeln schenkt. Kann er womöglich ihr Herz für sich erobern?
Gemütlich wie eine Kuscheldecke: Die heiteren Geschichten aus Mitford sind so heimelig wie der erste Kaffeeduft am Morgen und ebenso zauberhaft wie die Romane der Bestsellerautorinnen Debbie Macomber und Inga Lindström.
»Jan Karons Mitford-Romane sind eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall Street Journal
Über die Autorin:
Jan Karon wurde 1937 in North Carolina geboren. Sie arbeitete in der Werbebranche, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Die Bände ihrer Mitford-Saga eroberten im Folgenden regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste. Heute lebt sie in Virginia, wo sie ein historisches Farmhaus aufwendig restaurierte und zu ihrem Zuhause machte.
Bei dotbooks erscheint in der »Mitford-Saga«:
»Daheim in Mitford«
»Der Himmel über Mitford«
»Die grünen Hügel von Mitford«
»Sehnsucht nach Mitford«
»Das Herz von Mitford«
***
eBook-Neuausgabe November 2019
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1995 by Jan Karon
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel »A Light in the Window« bei Lion Publishing, Oxford, England, followed by © Copyright 1995 Lion Publishing
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe GmbH & Co., Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
This edition published by arrangement with Viking, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Nicholay Khoroshkov / Don Landwehrle / BitterHeart / gizele / K. 32 Stock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-798-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Himmel über Mitford« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jan Karon
Der Himmel über Mitford
Roman
Aus dem Amerikanischen von Michaela Link
dotbooks.
Für meine Mutter,Wanda Setzer,eine Mutmacherin
Kapitel 1Kurze Begegnungen
Es war nicht ratsam, hatte er einmal gesagt, die Straße zu überqueren und gleichzeitig angestrengt nachzudenken.
Der rote Pick-up hatte ihn schon beinahe erreicht, als er ihn bemerkte. Der Schock, den großen Wagen mit solch wilder Geschwindigkeit auf sich zujagen zu sehen, ließ ihn jäh zurückprallen, so daß er sich auf dem Gehsteig auf seine vier Buchstaben setzte. Er erhaschte noch einen flüchtigen Blick auf den Fahrer, der in ein Telefon sprach, während der Wagen auch schon um die Ecke schoß.
»Pater Tim! Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Winnie Ivey sah ihn so bekümmert an, daß er sicher war, schlimm verletzt zu sein. Er ließ sich von Winnie aufhelfen und verspürte ein taubes Gefühl im verlängerten Rücken.
Winnies breites Gesicht war zornesrot. »Dieser Irre! Wer war dieser Dummkopf überhaupt?«
»Keine Ahnung. Vielleicht bin ich der Dummkopf, weil ich nicht aufgepaßt habe, wo ich hinging.« Er lachte schwach.
»Sie sind nichts dergleichen! Ich habe nämlich die Ampel gesehen; es war immer noch Gelb, so daß Sie jede Menge Zeit hatten, rüberzugehen. Und da kommt dieser Wagen wie ein Güterzug auf Sie zugerast, und drin sitzt jemand, der munter vor sich hin telefoniert.«
Sie wandte sich der kleinen Menschenmenge zu, die aus der Grillstube gestürzt war. »Ein Telefon in einem Kleinlaster!« sagte sie voller Abscheu. »Ist das denn noch zu fassen? Ich hätte mir das Kennzeichen notieren sollen.«
»Vielen Dank, Winnie.« Er legte den Arm um die stämmigen Schultern der Bäckerin. »Sie haben ein besonderes Talent, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.«
Percy Mosley, der Besitzer der Grillstube, kam mitsamt seinem Pfannenheber angelaufen. »Ich an Ihrer Stelle würde den lieben Gott bitten, dem Burschen einen Tritt zu verpassen, daß er bis nach Wesley fliegt. Ihre pochierten Eier sind jetzt nämlich Matsch.«
Der Pfarrer klopfte seine Taschen nach dem schweren Büroschlüssel ab und überprüfte seine Brieftasche. Alles da. »Nichts passiert«, versicherte er seinen Freunden. Der Zwischenfall war einfach die bedauernswerte, dramatische Eröffnung seiner ersten Arbeitswoche nach seinem Irlandurlaub.
Obwohl er den Sommer in Sligo verbracht hatte, stellte er nach seiner Rückkehr fest, daß er den Sommer in Mitford keineswegs versäumt hatte. Seine Rosen blühten immer noch, das Gras lag wie Samt unter der kleinen Armee dörflicher Rasensprenger, und seine Gemeinde stellte ihm immer noch Körbe voller Tomaten auf seine Veranda.
Als er den Gehweg zum Pfarrhaus hinaufging, schlug ihm donnerndes Gebell aus der Garage entgegen. Dies war eine Begrüßung, die er jenseits des großen Teichs tagaus, tagein zutiefst vermißt hatte.
Seit seiner Heimkehr vor einer knappen Woche hatte jeden Morgen, wenn er erwachte, Barnabas vor seinem Bett gestanden und ihn einer ernsthaften Musterung unterzogen. Die Frage in den Augen seines schwarzen Gefährten, halb Bouvier, halb Schäferhund, war einfach: Bleibst du jetzt zu Hause, oder soll das ein Witz sein?
Er ging durch die Küche und öffnete die Garagentür, woraufhin Barnabas, der in der Abwesenheit seines Herrn Bärengröße erreicht hatte, freudig auf ihn zustürzte. Die Vorderpfoten auf die Schultern des Pfarrers gelegt, blickte er seelenvoll in die Augen seines Herrn, woraufhin dessen Brille unverzüglich beschlug.
»Na komm schon, alter Knabe. Immer mit der Ruhe!«
Barnabas sprang zurück, tanzte einen Augenblick lang auf den Hinterbeinen und stürzte dann wieder vor, um dem Pfarrer so ausgiebig das Gesicht zu lecken, daß dessen linkes Ohr mit einem Speichelschauer besprüht wurde.
Das Opfer duckte sich hinter dem Wagen in der Garage und krachte mit dem Ellbogen auf die Motorhaube. »Herr, du läßt mich fröhlich singen von deinen Werken«, zitierte er laut aus einem Psalm, »und ich rühme die Taten deiner Hände!«
Barnabas setzte sich augenblicklich hin, sah ihn an und fegte mit dem Schwanz über den Garagenboden.
Sein Hund war das einzige ihm bekannte Geschöpf, das sich unfehlbar zu benehmen wußte, sobald es ein Wort aus der Schrift hörte. Dies war ein Phänomen, von dem Walter im ganzen irischen Westen erzählt hatte.
»Gönnen wir uns mal was Besonderes, Freund. Und du«, sagte er zu Dooleys Kaninchen Jack, »du bekommst Rübenblätter.« Der Flämische Riese sah ihn mit Augen an, die die Farbe von Torf hatten.
Im Haus war es still. Es war einer der Tage, an denen Puny nicht zur Arbeit kam, und Dooley war beim Fußballtraining. Er hatte den Jungen furchtbar vermißt und die eine, eilig hingekritzelte Nachricht, die er in zwei langen Monaten von ihm erhalten hatte, wieder und wieder gelesen:
Mir geht's gut. Barnabas geht's gut. Ich reite diesem Pferd das Fell vom Rücken.
Er hatte auch das alte Pfarrhaus vermißt, mit seinem Lärm und seiner Ruhe, seinem Sonnenschein und seinem Schatten. Nie zuvor in seinem ganzen Leben als Pfarrer war ihm ein Haus so heimelig und behaglich erschienen wie dies in Mitford; es war eine Art Freund für ihn geworden.
Er entdeckte das Ding auf seiner Küchentheke sofort. Es war unverkennbar Edith Mallorys blaue Eintopfschüssel.
Genau so etwas hatte er befürchtet.
Kurz nachdem er in Irland eingetroffen war, hatte der Pfarrer einen Brief erhalten, in dem Emma ihm mitteilte, daß Pat Mallory soeben gestorben sei. Herzanfall. Ohne Vorwarnung. Pat, so schrieb Emma, habe einen ziehenden Schmerz in der Brust verspürt und sich auf die oberste Treppenstufe vor seinem Schlafzimmer gesetzt. Dort war er dann offensichtlich gestorben und die ganze Treppe hinuntergestürzt, wo das seit dreißig Jahren im Hause Mallory beschäftigte Dienstmädchen ihn kurz vor dem Abendessen fand.
»Oh, Mr. Mallory«, hatte sie Berichten zu folge gesagt, »das hätten Sie aber nicht tun sollen. Wo es heute abend doch Lasagne gibt.«
Und bereits bei der Lektüre von Emmas fünfseitigem Brief da am Fenster des irischen Bauernhauses hatte er gewußt, daß Edith Mallory nach seiner Rückkehr keine Zeit verschwenden würde.
Lange vor Pats Tod hatte es ihn jedesmal zutiefst aus der Fassung gebracht, wenn sie ihre Hand in die seine gleiten ließ oder sachte über seinen Arm strich. Irgendwann fing sie dann an, ihm während der Predigt zuzuzwinkern, was ihn derart ablenkte, daß er wieder in seine alte Gewohnheit zurückverfiel, buchstäblich über die Köpfe der Gemeinde hinweg zu predigen.
Bisher war er ihren gelegentlichen Fußangeln entkommen, aber einmal hatte er geträumt, er wäre mit ihr zusammen im Kleiderschrank des Gemeindehauses eingeschlossen, und er hatte verzweifelt an die Tür gehämmert und den Küster angefleht, ihn herauszulassen.
Jetzt lag Pat, die gute Seele, kalt in seinem Grab, und Ediths Eintopf stand heiß auf seiner Theke.
Eintöpfe! Mit ihrer Verführungskraft hatte man schon lange Männern von geistlichem Stand zugesetzt, oft mit überaus lohnenden Ergebnissen für die Köchin.
Eintöpfe waren schließlich eine Geste, der man oberflächlich nichts anderes unterstellen konnte als gutgemeinte Freundlichkeit. Und hatte man erst den einen verzehrt und sich für die Gabe bedankt, so kam auch gleich der nächste daherspaziert, bis der ledige Kurat ein verheirateter Kurat war oder der geschiedene Diakon so geschickt umgarnt, daß er später nicht mehr wußte, wie ihm geschah.
Kulinarisch ausgedrückt gab es also Eintöpfe – und Eintöpfe. Die meisten genügten ihrer Bestimmung, Kranke zu trösten oder Mutlose zu ermuntern. Aber gewisse andere Eintöpfe waren seiner langen Erfahrung nach gespickt mit Ködern und versteckten Andeutungen, so daß sie kein Brokkoli-Käse-Auflauf für den Magen mehr waren, sondern zu Pfeilen wurden, die direkt aufs Herz zielten.
Und was mache ich jetzt mit dieser Schüssel? fragte sich Pater Tim. Anständige Leute gaben sie mit etwas anderem gefüllt wieder zurück. Was bedeutete, daß die Person, die sie zurückbekam, irgendwann verpflichtet war, einem erneut etwas Eßbares zukommen zu lassen. Das Ganze artete dann in einen unvorstellbar lästigen Teufelskreis aus.
Von einem Geistlichen erwartete natürlich niemand, daß er die Schüssel füllte, bevor er sie zurückgab, aber zurückgeben mußte er sie selbstverständlich. Und genau da lag der Hase im Pfeffer.
Er näherte sich der unwillkommenen Überraschung, als könne sich eine zusammengerollte Schlange darin verbergen. Sein Dankesschreiben, das er morgen durch Puny überbringen lassen würde, würde kurz und prägnant sein:
Liebe Edith, es genügt wohl zu sagen, daß Sie nach wie vor eine der besten Köchinnen im Land sind.
Das war keine Lüge; es war unleugbar wahr.
Ihr Eintopf wird nur noch von Ihrer Großzügigkeit übertroffen. Tausend Dank. Sein Friede sei mit Ihnen, Pfarrer Tim.
Er hob den Deckel. Augenblicklich lief ihm das Wasser im Mund zusammen, und sein Herz machte einen kleinen Freudensprung.
Krabbenpastete! Eine seiner Lieblingsspeisen. Staunend betrachtete er das gute Dutzend blättriger, selbstgemachter Biskuits, das auf einem Bett frischen Krabbenfleisches und duftender Soße thronte.
Vielleicht, dachte er in einem Anfall jäher Hemmungslosigkeit, sollte er Edith Mallory augenblicklich anrufen und seinen Dank zum Ausdruck bringen.
Als er jedoch nach dem Telefon griff, ging ihm auf, was er da tat – er stellte seinen Fuß mitten in eine Bärenfalle.
Hastig stülpte er den Deckel über das dampfende Gericht. »Siehst du?« murmelte er düster. »So leicht passiert das.«
Wenn es um Eintöpfe ging, mußte man auf der Hut sein.
»Edith Mallory wird sich auf Sie stürzen wie ein Hund auf einen Knochen«, sagte Emma.
Bis zu dieser ungehörigen Bemerkung hatte in dem kleinen Büro friedliches Schweigen geherrscht. Die Fenster standen offen, um die von Vogelgezwitscher erfüllte Morgenluft einzulassen. Pater Tim Kavanagh kam mit der Vorbereitung gut voran. Und die vertraute Behaglichkeit seines alten Drehstuhls war ein wahrer Segen.
»Und was genau soll das bedeuten?«
Seine Teilzeitsekretärin blickte von ihrem Rechnungsbuch auf. »Es bedeutet, daß sie ihre Netze nach Ihnen auswerfen wird.«
Ihre Ausdrucksweise gefiel ihm nicht. »Ich bin einundsechzig Jahre alt und war mein Leben lang Junggeselle. Warum es irgend jemand auf mich abgesehen haben sollte ... Irgend jemand seine Netze ... Es ist undenkbar«, erklärte er kategorisch.
»Ich spüre, daß sie die ganze Zeit darüber nachdenkt. Außerdem erinnern Sie sich doch bestimmt an Pfarrer Appel, der mit fünfundsechzig geheiratet hat, gleich nachdem er seine ersten Pensionsbezüge erhielt? Und dann dieser Diakon, der neunundfünfzig war und die Rothaarige geheiratet hat, diese Frau, der die Taxigesellschaft in Wesley gehörte? Nicht zu vergessen dieser Vertreter, der im ›Kragenknopf‹ gearbeitet hat ...«
»Verschonen Sie mich mit Einzelheiten«, sagte er schroff, zog die Tischschublade auf und suchte nach dem Tipp-Ex.
Emma blickte ihn über ihre Brillengläser hinweg an. »Denken Sie bloß dran«, murmelte sie.
»Woran soll ich denken?«
»Gewappnet sein heißt gewarnt sein.«
»Nein, Emma. Gewarnt sein heißt gewappnet sein.«
»Verflixt. Kann ich mir nie richtig merken. Aber wenn ich Sie wäre, würde ich in Deckung gehen, sobald ich Edith kommen sähe.«
Ich bin schon seit zwölf Jahren in Deckung gegangen, wenn ich sie kommen sehe, dachte er.
»Eins muß man ihr allerdings lassen«, sagte Emma, während sie den nächsten Scheck eintrug, »sie ist eine großartige Gastgeberin. Wie Sie gewiß aus eigener Erfahrung wissen, kann ein Geistlicher so etwas gut gebrauchen. Einige Pfarrersfrauen haben überhaupt kein Händchen für solche Dinge, wenn Sie mich fragen. Wenn das mit Ihrer Nachbarin etwas wird, was ich, weiß Gott, hoffe – Sie sollten ihr übrigens endlich einen schönen Verlobungsring kaufen –, dann müßte Edith sich natürlich ein anderes Opfer suchen.«
»Emma«, sagte er und riß die Schutzhülle von der Schreibmaschine, »ich bekomme endlich die wichtigste Predigt in den Griff, die ich dieses Jahr geschrieben habe ...«
»Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt«, erwiderte sie und preßte die Lippen auf genau jene Art zusammen, die er besonders verabscheute.
Gegen Mittag stand plötzlich Ron Malcolm in der Tür, mit schlammverkrusteten Stiefeln und roter Baseballmütze.
Seine zweimonatige Abwesenheit hatte nicht nur Mitford, sondern auch den Menschen, die der Pfarrer kannte, eine frische, beinahe scharfe Realität verliehen. So war ihm zum Beispiel bisher kaum aufgefallen, daß Ron Malcolm ein Mann von aufmunternder Wesensart war. Aber vielleicht war es ja auch der Bau des Pflegeheims, der dem im Ruhestand befindlichen Bauunternehmer die frische Gesichtsfarbe und glänzenden Augen schenkte.
»Nun, Pater, die Sache läuft. Die Firma Jacobs hat ihren Baufaufseher geschickt. Er läßt heute einen Anhänger auf dem Bauplatz aufstellen.« Er schüttelte dem Pfarrer mit echter Herzlichkeit die Hand.
»Ich kann kaum glauben, daß es wirklich so weit sein soll.«
»Fünf Millionen Dollar!« sagte Ron. »Dieses Pflegeheim ist die größte Sache hier seit der Möbelfabrik in Wesley. Haben Sie schon Leeper kennengelernt?«
»Leeper?«
»Buck Leeper. Den Bauleiter. Wir haben über ihn gesprochen, bevor Sie nach Irland aufgebrochen sind. Er sagte, er würde versuchen, bei Ihnen im Büro vorbeizuschauen.«
»Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ich muß wohl mal raufgehen – vielleicht Mittwoch nachmittag.«
Ron setzte sich auf die Besucherbank und nahm die Mütze ab. »Emma in der Nähe?«
»Sie ist zur Post gegangen.«
»Ich glaube, es wäre nur fair, wenn ich Ihnen gleich zu Anfang reinen Wein einschenke wegen Buck Leeper. Vor einigen Monaten habe ich Ihnen erzählt, er wäre dickköpfig und grob. Ich weiß, um Ihretwillen brauche ich mir keine Sorgen zu machen, aber er ist die Art Mann, bei der man vom Glauben abfallen könnte.«
»Aha.«
»Sein Vater hieß Fane Leeper; diesen Namen gab man ihm, weil ein Prediger mal von ihm gesagt hatte, er sei der profanste Mann, den er je kennengelernt hätte. Fane Leeper war außerdem der beste Bauleiter an der Ostküste. Er hat drei Bauunternehmer zu reichen Männern gemacht, bis ihn der Alkohol holte, wie die Leute sagen.
Sie müssen wissen, daß Buck genauso ist wie sein Vater. Fluchen, saufen – er hat alles von Fane gelernt, und seine einzige Möglichkeit, aus dem Schatten seines Vaters rauszukommen, bestand darin, ihn in allen drei Punkten zu übertreffen.«
Ron hielt inne, als wolle er dem Pfarrer Zeit verschaffen, diese Information zu verdauen.
»Buck hat diesen Job erhalten, weil er uns Geld und eine Menge Kummer sparen wird. Er wird die Sache innerhalb der vorgegebenen Zeit und mit dem vorgegebenen Budget zu Ende bringen, darauf können Sie sich verlassen. Aus Respekt vor Ihnen, Herr Pfarrer, habe ich Jacobs gefragt, ob er uns nicht einen anderen Mann schicken könne, aber für einen Job von dieser Größenordnung wollen sie keinen anderen als Buck schicken.« Ron stand auf und zog den Reißverschluß seiner Jacke zu. »Am Anfang werden wir Jacobs dafür wahrscheinlich hassen, aber bevor die Sache vorbei ist, werden wir ihm dankbar sein.«
»Ich vertraue Ihrem Urteil.«
Ron öffnete die Tür und ging, den Hut in der Hand, rückwärts hinaus.
»Sie mögen zwar weichherzig aussehen, Pater, aber ich habe Sie ein- oder zweimal beobachtet, und ich weiß, daß Sie mit Buck fertig werden. Zeigen Sie ihm einfach, wo's langgeht.«
Der Pfarrer betrachtete den Ahornbaum auf der anderen Straßenseite, der seit gestern einen rostfarbenen Schimmer angenommen hatte. »Ich kann mir nicht vorstellen, daß Mr. Leeper uns irgendwelche Probleme bereiten wird«, sagte er.
»Timothy?«
Es war Cynthia, seine Nachbarin. Die Hände über die Augen gelegt, spähte sie durch die Fliegentür seiner Küche. Sie trug eine weiße Bluse, einen blauen Jeansrock und hatte ein Tuch um ihr blondes Haar geschlungen.
»Du sieht aus wie Heidi!« sagte er zu seiner Nachbarin. Obwohl sie jederzeit zugab, die Fünfzig überschritten zu haben, sah sie bisweilen wie ein junges Mädchen aus. Abermals staunte er über die frische, lebendige Art, wie er jetzt die Menschen betrachtete, gerade so, als sei er vor kurzem erst von den Toten auferstanden.
Sie schritt an ihm vorbei, und ein schwacher Hauch von Glyzinien umwehte sie. »Du hast gesagt, ich soll mir etwas einfallen lassen, womit wir deine Rückkehr feiern können.«
Sie trat an den Herd und hob den Deckel von dem Topf, in dem er eine Suppe kochte. »Köstlich«, sagte sie und atmete tief ein. Sie drehte sich lächelnd zu ihm um. Ihre Augen waren wie Saphire, rauchig und magnetisch mit diesem ins Violette spielenden Farbton, der ihn stets aus dem Gleichgewicht brachte.
»Und hast du dir etwas ausgedacht?« fragte er, obwohl er fürchtete, daß er wie ein Frosch krächzen würde, sobald er den Mund aufmachte.
»Es heißt, Wände hätten Ohren. Ich sollte es wohl besser flüstern.«
Er hatte ganz vergessen, wie mühelos seine Arme sie zu umfangen vermochten.
Der Besuch einer Stadtratssitzung war entschiedenermaßen nicht das, womit er diesen Abend hatte verbringen wollen. Nach zweimonatiger Abwesenheit wußte er kaum noch, was im Gange war. Außerdem hatte er immer noch den Zeitunterschied in den Knochen; gelegentlich schüttelte er heftig den Kopf in der Hoffnung, als könne er so wieder Klarheit gewinnen. Aber er würde hingehen; vielleicht würde er auf diese Weise erfahren, was in der Stadt lief, und offen gesagt war er neugierig, warum die Bürgermeisterin Esther Cunningham eine inoffizielle Versammlung einberufen hatte und warum die Sache ihn etwas angehen sollte.
»Essen Sie nichts«, hatte Esther ihm am Telefon geraten. »Ray bringt von zu Hause gebackene Bohnen, Kohlsalat und Rippchen mit. Er hat den ganzen Tag in der Küche gestanden.«
Vor dem Büro der Bürgermeisterin herrschte eine prickelnde Atmosphäre. Ray stellte sein selbst zubereitetes Abendessen auf den geräumigen Schreibtisch, hinter dem Fotos von ihren einundzwanzig Enkelkindern hingen.
»Bürgermeisterin«, sagte Leonard Bostick, »es ist eine himmelschreiende Schande, daß Sie nicht so gut kochen können wie Ray.«
»Ich habe Besseres zu tun«, fuhr sie ihn an. »Außerdem habe ich vierzig Jahre lang das Kochen besorgt. Jetzt ist er an der Reihe.«
Ray grinste. »Gib's ihnen, Schätzchen.«
»Hallo, Pfarrer Tim!« rief Paul Hartley und winkte ihm zu. »Kommen Sie zu uns rüber, und geben Sie uns ihren Segen.«
»Ach, kommt alle her!« rief die Bürgermeisterin den Leuten zu, die sich im Flur herumtrieben, »Zeit für ein Gebet!«
Esther Cunningham streckte die Hände aus, und die Wartenden stellten sich eifrig im Kreis auf.
»Allmächtiger Vater«, sagte der Pfarrer, »wir danken Dir, daß Du uns Freunde und Nachbarn schenkst und Menschen, die bereit sind, zum Wohlergehen dieses Ortes mit Hand anzulegen. Wir danken Dir für den Frieden in diesem Dorf und für Deine Gnade, daß wir die Arbeit tun dürfen, die nun vor uns liegt. Wir danken Dir auch für diese Speisen und bitten Dich um Deinen besonderen Segen für denjenigen, der sie zubereitet hat. Gelobt sei Gott der Herr.«
»Amen!« sagte die Gemeinde.
Die Bürgermeisterin stand als erste in der Schlange. »Du sollst deinen Segen haben, wahrhaftig«, sagte sie zu ihrem Mann. »Sieh dir nur diese Soße an! Du hast dich mal wieder selbst übertroffen, Liebster.«
Ray blinzelte dem Pfarrer zu. Er ist einer der glücklichsten Männer, die mir je über den Weg gelaufen sind, dachte Timothy.
»Was macht Ihr Diabetes, Herr Pfarrer?«
»Was Sie da in diesen Topf geschmuggelt haben, darf ich heute leider nicht würdigen.«
»Dann nehmen Sie eine doppelte Portion von meinem Kohlsalat«, sagte Ray und schaufelte reichlich davon auf den Teller des Pfarrers.
»Sie wissen, weshalb wir so zusammengekommen sind«, sagte die Bürgermeisterin.
Alle nickten, nur der Pfarrer nicht.
»Ich möchte nicht, daß bei der Stadtversammlung die Rede darauf kommt, und ich möchte auch nicht, daß offiziell darüber abgestimmt, dagegen gestimmt oder darüber getratscht wird. Wir werden hier heute abend einfach wie eine Familie einen gemeinsamen Beschluß fassen und es dabei bewenden lassen.«
Sie sah einen nach dem anderen an und beugte sich schließlich vor. »Kapiert?«
Der spindeldürre Linder Hayes stand auf, verschränkte die Hände bedächtig hinter dem Rücken, blickte auf seine Schuhe hinab und räusperte sich.
»Jetzt geht's los«, sagte Joe Ivey und stieß den Pfarrer in die Rippen.
»Euer Ehren«, sagte Linder.
»Komm mir nicht mit ›Euer Ehren‹. Das ist eine inoffizielle Versammlung.«
»Euer Ehren«, sagte Linder, der Rechtsanwalt war und von Hause aus Förmlichkeiten liebte, »ich möchte für die Kaufleute in dieser Stadt sprechen, die aus den Alltagsgeschäften ihren Lebensunterhalt beziehen.
Also, wir wissen, daß eine alte Frau, die ausgebeulte Hüte und Gummistiefel trägt und den Verkehr um das Denkmal herum regelt, nicht der richtige Anblick für Touristen ist, schon gar nicht, wenn der Herbst vor der Tür steht.
Sie sagen, Mrs. Watson sei harmlos, aber darum geht es gar nicht. Denken Sie nur, wie sie die Leute verschrecken würde mit ihren vorstehenden Schneidezähnen und den alten Armeeorden, wenn sie plötzlich aus dem Nebel käme und den Autofahrern zuwinkte. Sie würde die Touristen schneller von hier vertreiben, als wir gucken können.«
»Womit wir die verflixten Touristen ja sehr bequem los wären«, erwiderte die Bürgermeisterin gereizt.
»Frau Bürgermeisterin, wir fechten diese Touristenschlacht schon seit Jahren miteinander aus. Wir sind alle zur Seite getreten, um Ihnen reichlich Platz zu machen, damit Sie Ihre Arbeit erledigen können, und Sie haben sie getan. Ihre standfeste Verteidigung dessen, was gut und recht und dem Charakter dieser Stadt entsprechend ist, war ein starkes Bollwerk gegen die Zerstörungswut törichter Städteplaner und gegen ein ungesundes Wachstum.
Aber ...« Linder legte eine lange Pause ein und sah sich in dem Raum um. »Zwei Auszeichnungen für ›das vorbildliche Dorf‹ reichen nicht aus, um unseren Kaufleuten kaltes, hartes Bargeld einzubringen. Der Anblick dieser alten Frau da reicht aus, um Babys kreischen und erwachsene Männer den Schwanz einziehen zu lassen. Ich lebe nicht vom Geld der Touristen, aber meine Frau tut es – und zufälligerweise auch die Hälfte ihrer Enkelkinder.«
»Jetzt haben wir den Schlamassel«, murmelte Joe Ivey. »Ich hätte doch einen Schlafsack und eine Decke mitnehmen sollen.«
»Linder«, sagte Esther Cunningham, »setzen Sie sich und entlasten Sie Ihre Füße.«
»Euer Ehren ...«
»Vielen Dank, Linder«, sagte die Bürgermeisterin in einem Ton, als wäge sie jedes einzelne Wort genau ab.
Linder schien für einen Augenblick ins Flattern zu geraten wie ein Blatt, das von einer Brise gepackt wurde. Dann setzte er sich.
»Ich möchte, daß wir uns einige Dinge vor Augen führen, bevor wir eine kurze Diskussion eröffnen«, sagte die Bürgermeisterin. »Zuerst wollen wir uns mein Grundsatzprogramm ansehen. Es gibt da weder eine Mitte noch eine Linke oder eine Rechte. Es ist einfach ein klares Programm. Schluß, aus. Joe, warum rufst du uns nicht ins Gedächtnis, worin das Programm besteht?«
Joe stand auf. »Mitford kümmert sich um die Seinen!« Mit stolzgeröteten Wangen setzte er sich wieder hin.
»Mitford ... kümmert ... sich ... um ... die ... Seinen. Das ist seit vierzehn Jahren mein Programm, und solange ich Bürgermeisterin bin, wird es weiter das Programm unserer Stadt sein. Erstens: Mrs. Rose Watson mag schiefe Zähne haben, und sie mag verrückt sein, aber sie ist eine von uns. Zweitens: Auf Grund dessen werden wir uns um sie kümmern.
Drittens: Die Regelung des Verkehrs um das Denkmal herum ist das Beste, was ihr passiert ist, seit sie ein kleines Mädchen war und so normal wie Sie und ich. Onkel Billy sagt, sie schläft jetzt wie ein Baby, statt die ganze Nacht durch dieses alte Haus zu streifen, und sie ist in letzter Zeit so nett zu ihm, wie man sich das nur wünschen kann. Die Regelung des Verkehrs ist eine echte Verantwortung für sie. Sie ist stolz darauf.«
»Und sie macht ihre Sache wirklich gut«, sage Ernestine Ivory, die beim Klang ihrer eigenen Stimme blutrot anlief.
»Was war das, Ernestine?« fragte die Bürgermeisterin nach.
»Mrs. Rose macht das sehr gut, ich meine, den Verkehr regeln. Natürlich ist das bloß meine Meinung ...«
»Es ist bloß Ihre Meinung und die vieler anderer Leute, die dasselbe denken. Sie macht das sehr professionell. Ich weiß nicht, wo in aller Welt sie das gelernt hat.
Also, ich möchte folgenden Vorschlag machen, und ich möchte, daß Sie gut darüber nachdenken. Jeden Tag von zwölf bis ein Uhr flaut der Verkehr ab, und Mitford ißt zu Mittag. Mein Magen fängt genau wie bei allen anderen Menschen um Punkt zwölf an zu knurren.
Ich schlage vor, daß wir Mrs. Rose fünf Tage die Woche von zwölf bis eins den Verkehr regeln lassen, so daß sie gerade genug Autos hat, um glücklich zu sein.
Also. Linder, was diese hochgebogenen und schiefen Hüte und die merkwürdigen Kleider betrifft, muß ich Ihnen recht geben, daher schlage ich vor, ihr eine Uniform zu besorgen. Marineblauer Hut, Rock und eine Jacke aus meinen alten Tagen im Marinehilfskorps. Die Sachen würden ihr perfekt passen. Ich war damals so dünn wie eine Bohnenstange, nicht wahr, mein Allerliebster?«
Ray hob den Daumen.
»Ernestine, ich möchte, daß Sie morgens um zehn mit mir rübergehen, um sie anzuziehen, und Joe, wie wär's, wenn du ihr einen schönen Haarschnitt verpassen würdest. Wir bringen sie dann gegen elf in deinen Laden.«
»Wär' mir ein Vergnügen.«
»Herr Pfarrer, ich möchte, daß Sie die Aufgabe übernehmen, für das alles zu beten.«
»Geht klar«, sagte er.
»Und Linder, lieber Freund, ich bin Ihnen wirklich dankbar, daß Sie sich so gut um die Geschäftsleute kümmern. Gott weiß, daß irgend jemand das tun muß. Noch irgendwelche Fragen?«
Bevor jemand antworten konnte, schlug die Bürgermeisterin mit einem Hammer auf ihren Schreibtisch. »Die Sitzung ist geschlossen. Alle, die dafür sind, sagen ja.«
»Also wirklich«, sagte der Pfarrer, als er mit Joe Ivey nach Hause ging, »jedesmal, wenn ich eine Sitzung mit Esther Cunningham hinter mich gebracht habe, fühle ich mich wie nach einer Gehirnwäsche.«
Du wirst zu einem ganz neuen Dooley nach Hause kommen,hatte Marge geschrieben, kurz bevor er Irland verließ. Bei diesen Worten war ihm das Herz schwer geworden. Er hatte den alten Dooley nämlich lieb gewonnen.
Er lernt sogar Englisch,hatte seine alte Freundin von der Meadowgate Farm geschrieben. Wart's nur ab; du wirst begeistert sein.
Er konnte nicht sagen, daß er vor Begeisterung in die Luft gesprungen war, als er seinen zwölfjährigen Schützling wiedergesehen hatte. Erstens war die über der Stirn hochstehende Haarlocke auf wunderbare Weise verschwanden. Als er im Juli nach Sligo geflogen war, war dieser Haarwirbel für alle Augen sichtbar in die Höhe geschossen; jetzt war keine Spur mehr davon zu sehen, und offengestanden vermißte er ihn. Dann fiel ihm auf, daß nach und nach auch Dooleys Sommersprossen verschwanden, eine Veränderung, die er besonders bedauerte.
Außerdem entdeckte er in den Blicken und in dem ganzen Auftreten des Jungen eine neue Entschlossenheit. Noch schwerer aber wog der Umstand, daß Dooley neuerdings nach dem Essen wieder die Deckel auf Ketchup- und Mayonnaisegläser schraubte. Wie konnte sich in zwei kurzen Monaten nur so vieles verändern?
»Bei mir brauchst du dich dafür nicht zu bedanken«, hatte Marge am Morgen nach seiner Rückkehr während eines Telefongespräches zu ihm gesagt. »Das Verdienst liegt ganz allein bei dir und der ganzen Vorarbeit, die du geleistet hast. Hinzu kommt eine kräftige Dosis Kuhdung und frische Luft. Letztes Wochenende hat er geholfen, ein Hengstfohlen zur Welt zu bringen, woraufhin sein Selbstbewußtsein auf wundersame Weise in die Höhe geschnellt ist. Überdies muß ich dir, auch wenn ich immer noch ganz niedergeschmettert bin, erzählen, daß Rebecca Jane ihren ersten Schritt gemacht hat, und rate mal, auf wen sie zugegangen ist? Onkel Dools!«
Ich habe gesät, Apollo hat gegossen, aber Gott hat wachsen lassen,ging es dem Pfarrer durch den Kopf, als er sich nach der Stadtratssitzung auf den Heimweg machte. Joe Ivey hatte ihm ›ein Schlückchen Brandy‹ angeboten, falls er ihn in seinen Friseurladen begleiten wollte, aber er hatte abgesagt. Er konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und in den alten burgunderfarbenen Bademantel zu schlüpfen, den er in Irland schmerzlich vermißt hatte.
Nach einem schnellen Ausflug mit Barnabas um die Hecke des Baxter Parks nahm er eine Flasche Mineralwasser aus dem Schrank, und sie stiegen Seite an Seite die Treppe hinauf.
»Dooley!«
»Ja, Sir?«
Ja, Sir? Er ging den Flur hinunter zum Zimmer des Jungen, wo dieser gegen das Kopfbrett seines Bettes gelehnt saß, in einem Buch las und sich geistesabwesend die große Zehe kratzte. Das Zimmer wirkte bemerkenswert aufgeräumt.
»Wie geht's?«
Dooley blickte auf. »Super.«
»Toll.« Er stand in der Tür und verspürte eine verlegene Freude. »Was ist das für ein Buch?«
»Grundbegriffe der Tiermedizin.«
»Aha.«
»Sehen Sie das?« Dooley hielt ihm das Buch hin. »Es ist ein Foto von einem Hengstfohlen, das gerade auf die Welt kommt. Genauso ist es letztes Wochenende gewesen. Es ist das Wunderbarste, was ich je getan happ... habe. Ich möchte Tierarzt werden. Doc Owen sagte, ich könnt's schaffen.«
»Natürlich kannst du es schaffen. Du kannst alles werden, was du werden willst.« Er trat in das Zimmer.
»Ich wollte früher nie irgend etwas werden.«
»Vielleicht hattest du früher nie das Gefühl, eine Wahl zu haben.«
»Ich wollte nie Astronaut werden oder Rockstar oder irgendwas anderes, so wie Buster Austin.«
»Das ist okay. Man soll nichts überstürzen!« Er setzte sich auf Dooleys Bett.
»Das habe ich mir auch gedacht.« Der Junge wandte sich wieder seinem Buch zu und ignorierte ihn, schien aber nichts dagegen zu haben, daß er da war.
»Und? Wie geht es Buster?« Vor nur wenigen Monaten waren Dooley und Buster Austin erbitterte Gegner gewesen, und Dooley hatte ihm zweimal die Jacke vollgehauen.
»Cool. Wir haben heute unser Mittagsbrot getauscht. Er steht auf Fleischklopse, besonders die, die Sie immer machen. Ich habe seine Mortadella gekriegt.«
»Hausaufgaben fertig?«
»Ja, Sir.«
Ja, Sir. Die beiden Worte hallten in seinen Ohren wider, als gehörten sie einer fremden Sprache an. »Wie läuft das Bioprojekt? Werden wir es Samstag abend fertig bekommen?«
»Jawohl. Wird Ihnen gefallen. Es ist klasse.«
Seit er von Irland zurückgekehrt war, hatte er immer wieder in Dooleys Gesicht geforscht, als suche er etwas. Es hatte sich etwas geändert. Vielleicht war eine Wunde geheilt; er sah jetzt mehr wie ein Junge aus und nicht mehr wie jemand, der vor der Zeit gealtert war.
Es war fast ein Jahr her, seit Russell Jacks, der Küster der Kirche und Dooleys Großvater, an Lungenentzündung erkrankt und auf die Intensivstation gekommen war. Pater Timothy hatte den Jungen vom Krankenhaus mit nach Hause genommen, und dort wohnte er seither.
Dooley Barlowe mit nach Hause zu nehmen war eine der besten Entscheidungen gewesen, die er jemals gefällt hatte. Der Bursche hatte Schwierigkeiten und Unheil gestiftet, und zwar reichlich – aber das war es wert gewesen.
»Ich höre, du hast jede Woche deinen Großvater besucht. Eine gute Medizin.«
»Jawohl.«
»Wie geht es ihm?«
»Diese Frau, die sich um ihn kümmert, sie sagt, es ginge ihm gut, aber er hatte seit Ihrer Abreise keinen Leberkäse mehr ...«
»Oh – oh.«
»Und das ärgert ihn natürlich.«
»Wir werden ihm etwas bringen. Und dich sehe ich dann beim Frühstück. War Jenny übrigens mal da?«
»Diesen ganzen Scheiß brauch' ich nich' mehr.«
Der Pfarrer grinste. So! dachte er. Das ist mein alter Dooley.
In seinem Zimmer sprang Barnabas auf die Decke am Fußende des Bettes und legte sich dann mit einem Gähnen nieder, während der Pfarrer unter die Dusche trat. Obwohl er sich in dem Dachstübchen in dem irischen Bauernhaus in Sligo absolut wohl gefühlt hatte, war der lange Weg den Flur hinunter zu einer dürftigen Dusche doch eine Strapaze gewesen. Soweit er sehen konnte, könnten wohl noch Monate vergehen, bevor der Reiz seines eigenen Badezimmers direkt nebenan zu schwinden beginnen würde.
Als er sich auf sein Bett setzte und seine Nachbarin anrief, war er so unbekümmert und zufrieden wie eine gedünstete Muschel.
»Hallo?«
»Selber hallo.«
»Timothy!« sagte Cynthia. »Ich habe gerade an dich gedacht.«
»Na, da hast du doch bestimmt Besseres zu tun.«
»Ich habe gedacht, daß meine Idee, deine Rückkehr zu feiern, einfach zu blöd ist.«
»Blöd, ja, aber nicht zu blöd«, sagte er. »Genaugenommen habe ich überlegt – wann wollen wir's machen?«
»Hmm ...«
»Samstag abend?« fragte er hoffnungsvoll.
»O Mist. Mein Neffe kommt. Ich meine, ich freue mich natürlich, daß er kommt. Du mußt ihn kennenlernen. Er ist wirklich ein Schatz. Samstag hätte so gut gepaßt. Könnten wir es auf Montag abend verschieben?«
»Kirchenvorstandssitzung«, sagte er.
»Dienstag muß ich eine Illustration fertig machen, und FedEx ist gleich als erstes am Mittwochmorgen dran. Könnten wir sagen, Mittwoch gegen halb sieben?«
»Bauausschußsitzung um sieben.«
»Verflixt.«
»Bei mir ginge Freitag«, sagte er.
»Wunderbar!«
»Nein. Nein, warte, Freitag war doch irgend etwas«, sagte er und dehnte die Telefonschnur bis zur Kommode, wo er sein schwarzes Notizbuch aufschlug. »Ja, das war's. Das Krankenhaus gibt ein Personalessen für Hopp und ich spreche das Gebet. Hättest du Lust, hinzukommen?«
»Ein Essen im Krankenhaus? Das ist Selbstmord! Außerdem kann ich Krankenhäuser nicht ausstehen. Ich wäre nämlich mal fast in einem gestorben, weißt du.«
»Nein, wußte ich nicht.«
»Und ich weiß nicht, wie du diese Dinge jemals in Erfahrung bringen willst, wenn wir nicht irgendeine Möglichkeit finden, uns zu treffen. Wie wär's mit Sonntag abend? Da hast du doch normalerweise Zeit. Sonntag wäre schön.«
»Da helfe ich Dooley, sein Bioprojekt fertig zu machen. Er muß es Montag morgen abgeben.« Eine namenlose Verzweiflung raubte ihm die Zufriedenheit, die er noch kurz zuvor verspürt hatte.
»Wir könnten uns morgen um sechs auf der Bank neben deinen deutschen Rosen treffen. Dann könnten wir da unsere Feier veranstalten und die Sache hinter uns bringen.«
Aber er wollte die Sache gar nicht hinter sich bringen. Er wollte sich Zeit lassen damit, es auskosten.
»Du seufzt«, sagte sie.
»Es ist nur so, daß ich so viel zu tun habe, nachdem ich zwei Monate fort war.«
»Ich verstehe«, sagte sie schlicht.
»Wirklich? Das tust du?«
»Natürlich.«
»Ich rufe dich morgen an. Verschwenden wir unsere Wiedersehensfeier nicht auf der Gartenbank.«
»All dieses klebrige, nasse Moos«, sagte sie lachend.
»All dieser kalte, feuchte Beton«, sagte er unglücklich.
»Ich hoffe, du schläfst gut.« Er konnte die Zärtlichkeit in ihrer Stimme hören. »Die Zeitverschiebung nimmt einen wirklich tagelang mit.«
»Ja. Hm. Also«, sagte er und fühlte sich unaussprechlich töricht, »knips dein Schlafzimmerlicht an und aus, um mir eine gute Nacht zu wünschen.«
»Ich tu's, wenn du's tust.«
»Cynthia?«
»Ja?«
»Ich ...« Er räusperte sich. »Du ...«
»Spuck's aus«, sagte sie.
Er hatte angefangen zu krächzen; er hätte kein einziges Wort mehr über die Lippen bekommen, und wenn sein Leben davon abgehangen hätte.
»Ich werde mir keine Gedanken mehr darum machen, ob ich vielleicht zu dumm bin. Du bist es, Timothy, der hier viel zu dumm ist!«
Mit hämmerndem Herzen legte er den Hörer auf. Er hätte ihr beinahe gesagt, daß er sie liebte, daß sie wunderbar sei; er wäre beinahe über den Klippenrand gesprungen, ohne irgendwelche Felsvorsprünge, die seinen Sturz gebremst hätten.
Er trat ans Fenster und blickte auf ihr winziges Haus hinab. Er sah, wie das Licht in den Fenstern ihres Schlafzimmers unter dem Dachgesims zweimal an- und ausging. Einen Augenblick später stürzte er um das Bett herum und knipste seinen eigenen Lichtschalter aus, dann wieder an und wieder aus.
»Lieber Gott«, sagte er atemlos, während er in der Dunkelheit stand. »Wer ist eigentlich in diesem Haus der Zwölfjährige?«
Als er gegen Mittag anrief, stieß ihr Anrufbeantworter eine Reihe von Pieptönen aus, denen der Wählton folgte.
Kurz nachdem er aufgelegt hatte, klingelte das Telefon.
»Pfarrer Tim!« Es war Absalom Greer, der Landprediger.
»Bruder Greer! Ich wollte Sie gerade heute nachmittag anrufen.«
»Nun, Sir, wie schlimm ist das Chaos, das ich Ihnen hinterlassen habe?«
»Die Leute erzählen mir immer noch, wie sehr ihnen Ihre zusätzlichen Predigten in der Kapelle Unseres Herrn gefallen haben. Sie haben sie kalt erwischt, wissen Sie. Ich hoffe nur, es war am Anfang nicht allzu hart für Sie.«
»Der erste Sonntag war ganz schön mager. Ihre Schäfchen waren nicht allzu begeistert davon, daß Sie ihnen einen alten Evangelisten aufgehalst haben. Am nächsten Sonntag war es dann ungefähr halb voll, würde ich sagen. Am dritten Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt. Und so ging's weiter, bis die Leute schließlich auf der Treppe standen.«
Pater Tim lachte. »Wird bestimmt nicht leicht sein, wieder in Ihre Fußstapfen zu treten, mein Freund.«
»Ich habe auch versucht, Feuer und Schwefel aus dem Spiel zu lassen, es ist mir aber nicht immer gelungen. ›Tut Buße, und ihr werdet erlöst werden!‹ sagte Johannes. ›Bereut, und ihr werdet erlöst werden‹, sagte Jesus. Das ist der springende Punkt. Wenn man nicht bereut, wird man nicht gerettet. Also muß man sich diese Alternative einmal näher ansehen; aber davon wollen die Leute heutzutage ja nichts mehr hören.«
»Hoffentlich bereiten Sie Ihre Gemeinde gut vor, wenn ich zu Ihnen aufs Land komme.«
Absalom lachte herzlich. »Da verlangen Sie vielleicht etwas Unmögliches von mir!« Er konnte die Gesichter seiner ländlichen Baptistengemeinde vor sich sehen, wenn sie es mit einem Prediger in einem langen Gewand zu tun bekamen.
»Ich habe etwas für Sie«, sagte der Pfarrer. »Ich würde es Ihnen gern eines Tages vorbeibringen und mir bei der Gelegenheit auch mal erzählen lassen, was ein anderer hinter den Kulissen meiner Kanzel gesehen hat.«
»Lassen Sie uns nur wissen, wann Sie kommen. Dann werden wir Ihnen auch etwas Ordentliches kochen.«
»Gern! Und Gott segne Sie für all die Mühe, die Sie auf uns hier verwendet haben. Sie haben durchaus etwas bewirkt. Ron Malcolm sagte, wenn Sie das Evangelium ausgelegt hätten, wären Ihre Worte so klar wie das Licht an einem hellen Tag gewesen.«
»Man darf sich dem Evangelium nicht in den Weg stellen, und das ist es, was unsere Worte klar und schlicht hält, wenn wir es nur zulassen.«
Nachdem er aufgelegt hatte, saß der Pfarrer noch eine Weile lächelnd da. In Wirklichkeit war nichts Schlichtes an dem alten Mann mit den zottigen Augenbrauen und der silbernen Mähne. Der große, hagere Mann sei ein atemberaubender Anblick in der Kanzel gewesen, sagte Cynthia, mit seinen blauen Augen, die wie Zündsteine blitzten, und dem Lorbeerzweiglein, das er stets im Knopfloch trug.
Greer trug er für die dritte Oktoberwoche in seinen Kalender ein.
Während der Pfarrer den Weg vom Büro nach Hause zurücklegte, wurde aus dem leichten Nieselregen ein gewaltiger Regenguß.
Augenblicklich war er naß bis auf die Haut. Er stürmte auf den Handarbeitsladen zu, stellte sich unter die Markise, auf die der Regen trommelte, und überdachte erst einmal seine nächsten Schritte. Hazel Bailey winkte ihm aus dem Laden zu und bedeutete ihm, daß er eintreten und bei ihr Zuflucht suchen dürfe. Da er ohnehin durchnäßt war, beschloß er, die Sache im Laufschritt anzugehen.
Er beschirmte sich mit seiner Zeitung und wollte gerade zur nächsten Markise weiterrennen, als er eine Autohupe hörte. Es war Edith Mallorys schwarzer Lincoln, der ungefähr die Größe einer Eigentumswohnung hatte.
Das Fenster glitt wie geölt hinunter, und der Fahrer beugte sich über den Beifahrersitz. »Herr Pfarrer«, rief Ed Coffey. »Miz Mallory sagt, Sie sollen einsteigen. Wir fahren Sie nach Hause.«
Das Wasser jagte bereits wie ein Sturzbach den Rinnstein entlang.
Er stieg ein.
Edith Mallory hätte Kleopatra auf ihrer Barkasse sein können, solchen Luxus verströmten ihre Limousine, der seidene Regenmantel, der sie auf dem weichen Lederpolster umfloß, und die kleine Mahagonibar, die aus der Armlehne hervortrat.
»Sherry?« fragte sie und lächelte dabei dieses geheimnisvolle Lächeln, das sein Adrenalin in Wallung brachte. Wobei es sich jedoch um sein Fluchtadrenalin handelte.
»Nein, danke!« rief er, während er gleichzeitig zu verhindern versuchte, daß die durchweichte Zeitung auf die Polster tropfte. Das warme Wageninnere war von einer Parfümwolke erfüllt, und er fühlte sich augenblicklich benommen, betäubt wie ein Kind von vier Jahren, das sich gleich zu einem Mittagsschläfchen niederlegen würde.
So erging es einem immer mit Edith; man verlor seine Wachsamkeit, wenn man sie am dringendsten brauchte.
»Scheußliches Wetter, und Sie vor allen anderen müssen auf ihre Gesundheit achten ...«
Warum ich vor allen anderen, fragte er sich gereizt.
»... weil Sie unser Hirte sind, natürlich, und weil Ihre kleine Herde Sie braucht.« Edith sah ihn mit den großen braunen Augen an, die ihre scharfen Gesichtszüge vollkommen beherrschten, etwa so, wie man es von den kleinen Kobolden von auf Samt gemalten Bildern kannte.
»Hm, na ja, da haben Sie nicht unrecht«, sagte er steif. Bei diesen Worten sah er Ed Coffeys Augen im Rückspiegel; sie schienen sich an den Ecken zusammenzuziehen, als versuche er, ein breites Grinsen zu unterdrücken.
»Wir wollen doch, daß Sie stark bleiben«, gurrte sie, »für all die Witwen und Waisen, die Sie brauchen.«
Er blickte gedankenlos aus dem Fenster. Die Markise über der Grillstube hatte sich an einer Ecke gelockert, und der Regen strömte wie ein Wasserfall auf den Gehsteig.
»Aber einen winzigen Sherry könnten Sie doch trinken«, sagte sie und füllte ein kleines Glas aus einer Karaffe, die wie ein Ei im Nest in der zur Mahagonibar ausgebauten Armlehne ruhte.
»Ich glaube wirklich nicht ...«, sagte er, aber da hielt er das Glas bereits in der Hand.
»Aber, aber!« sagte sie. »Das wird Ihnen bestimmt guttun!« Sie lächelte, wobei ihr breiter Mund die Wangen, die sich wie Kreppapier in Falten legten, in die Höhe drückte. Es gab Leute, die sie tatsächlich attraktiv fanden, rief er sich ins Gedächtnis – warum konnte er das nicht auch tun?
Er würgte den Sherry hinunter, gab ihr das Glas zurück und fühlte sich dabei wie ein Kind, das seine Hustenmedizin geschluckt hatte.
»Braver Junge«, sagte sie.
Wo waren sie überhaupt? Der Regen strömte über die Fenster, und das Licht der Autoscheinwerfer drang nicht weit genug vor, um ihm zu zeigen, wo er sich befand. Sie waren gerade an der Grillstube vorbeigefahren, aber er konnte sich gar nicht daran erinnern, daß sie um eine Ecke gebogen waren. Vielleicht waren sie am Denkmal vorbei Richtung Wesley gefahren.
»Ah ... Warum sind wir nicht zum Pfarrhaus gefahren?« Er verspürte einen Anflug von Panik.
»Nur noch ein winziges Momentchen, dann bringen wir Sie hin«, sagte sie und zwinkerte ihm zu. Er konnte nicht glauben, daß ihre Hand sich über den Sitz geschoben hatte, um die seine zu suchen. Er erinnerte sich an den Traum mit dem Wandschrank und daran, wie er an die Tür gehämmert und nach Russell Jacks geschrien hatte.
Er zog die Hand – unauffällig, wie er meinte – zurück und kratzte sich an der Nase. Der Sherry hatte in einem fernen Winkel seines Denkens ein kleines Licht entzündet. Vielleicht glaubte sie, daß er wegen der neuen Räume für die Sonntagsschule hinter ihrem Geld her war und bereit wäre, dafür ein wenig Händchen zu halten. Es würde glatte zweihunderttausend kosten, um diese endlose Landebahn von einem Dachboden in die Art Sonntagsschule zu verwandeln, wie sie Josiah Baxter vorgeschwebt hatte. Aber seine Hand war gewiß nicht die, die die milchgebende Kuh dafür melken würde. Bei einem offiziellen Treffen mit dem Kirchenvorstand hatte er eine Liste von all den Dingen präsentiert, die nicht in Frage kamen, so daß sich niemand ungerecht behandelt fühlen konnte.
So würde er sich zum Beispiel außerhalb der Kanzel nicht an den Bemühungen beteiligen, die notwendigen Gelder aufzutreiben. Basta! Er würde weder werben noch schmeicheln, noch predigen oder Süßholz raspeln oder jemanden um Geld angehen.
»Ah, Timothy«, seufzte Edith Mallory und rieb über den Tweed seines Ärmels, als wäre er eine Katze, »Irland hat bei Ihnen wahre Wunder gewirkt, wie ich sehe.« Sie rückte ein wenig näher. »Man ist so einsam als Witwe«, seufzte sie. »Manchmal schmerzt es mich ... am ganzen Leib.«
Als man ihn endlich bis auf die Haut durchnäßt vorm Pfarrhaus absetzte, schickte Puny sich gerade an, fortzugehen. Während sie in ihren Mantel schlüpfte, sah sie ihn erschrocken an.
»Sie sehen aus, als hätten Sie etwas Furchtbares durchgemacht!«
»Zum Teufel!« rief er.
Einen solchen Ausdruck aus seinem Mund zu hören schockierte sie zutiefst.
Als er am Montag ins Büro ging, stand ein roter Pick-up davor. Im Wagen saß jemand, der in ein Autotelefon zu reden schien.
Gerade als der Mann ausstieg und die Tür hinter sich zuschlug, angelte der Pfarrer den Schlüssel aus seiner Tasche. Der Mann warf eine Zigarette auf den Gehsteig und trat sie mit einer schnellen Drehung seines Absatzes aus.
Er war groß und korpulent, und er trug in hohe Stiefel gestopfte Pluderhosen, ein Flanellhemd, eine Steppweste sowie einen steifen Hut.
»Sind Sie der Pastor hier?«
»Ja. Was kann ich für Sie tun?«
Der Mann zog ein Päckchen Lucky Strikes aus seiner Hemdtasche, schüttelte eine Zigarette hinaus, zündete sie an und inhalierte tief.
»Buck Leeper«, sagte er, während er mit ausgestreckter Hand auf den Pfarrer zuging. Sie schüttelten einander nur kurz die Hände, aber in dieser Sekunde verspürte der Pfarrer einen merkwürdigen Schock. Die Hand seines Besuchers schien gewaltig geschwollen und rot zu sein, als könne das Fleisch jederzeit aus der Haut platzen.
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, log er; die Worte formten sich automatisch und sprachen sich auch wie von selbst aus. Auf gewisse Weise war es ja tatsächlich froh, den Mann kennengelernt zu haben; jetzt hatte er es wenigstens hinter sich. »Treten Sie doch ein, Mr. Leeper, und trinken Sie eine Tasse Kaffee mit mir.«
»Keinen Kaffee«, sagte er, zwängte sich aber noch vor dem Pfarrer durch die Tür. Der Pfarrer hängte seine Jacke an den Haken und staunte darüber, wie die Gegenwart dieses Mannes den Raum plötzlich kleiner machte.
»Malcolm sagte, ich soll Sie wegen der Gartenstatuen fragen.«
»Gartenstatuen?«
»Liegen da einfach rum. Wir haben alle auf einen Haufen gepackt. Vielleicht ein Dutzend davon, ein paar kaputt, ein paar nicht. Ich habe keine Zeit, mich damit zu befassen.« Er stieß eine Rauchwolke aus.
»Wie ungewöhnlich. Natürlich. Ich komme sofort. Geben Sie mir nur eine Stunde Zeit.«
Der Bauleiter nahm noch einen schnellen, tiefen Zug von seiner Zigarette. »Bei fünfzig Mäusen die Stunde für die Bulldozer habe ich keine Stunde.«
»Na schön. Was soll ich dann Ihrer Meinung nach tun?«
Leepers Tonfall war hart und unverschämt. »Mir sagen, daß ich den ganzen Mist zum Berg karren lassen kann.«
Der Pfarrer spürte Eiswasser durch seine Venen laufen. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden«, sagte er mit ruhiger Stimme, »wenn Sie Ihre Zigarette ausmachen würden. In diesem kleinen Raum ist Rauch nicht besonders angenehm.«
Der Bauleiter sah ihn einige Sekunden lang durchdringend an, ließ seine Zigarette auf den Boden fallen und trat sie mit dem Absatz aus.
Er öffnete die Tür. »Ich habe keine Zeit, den Laufjungen für Ihren Bauausschuß zu machen. Wenn Sie die Statuen wollen, kommen Sie und holen Sie sie sich«, sagte er und war auch schon wieder verschwunden.
»Gütiger Himmel«, stöhnte Ron Malcolm mit gesenktem Kopf.
»Nun, ich kann nicht behaupten, daß Sie mich nicht gewarnt hätten.«
»Ja, aber ich glaube, keine Warnung ist stark genug, um einen wirklich auf Buck Leeper vorzubereiten. Ich habe darauf bestanden, daß er zu Ihnen fuhr, Ihnen guten Tag sagte, sich vorstellte und Sie wegen der Statuen fragte. Ich dachte, daß Sie sie vielleicht behalten wollen, aber ich wußte es nicht genau. Ich schätze, ich bin schuld an der ganzen Sache. Ich hätte es selbst regeln sollen.«
»Nun machen Sie aber mal einen Punkt. Sie trifft keine Schuld an der ganzen Geschichte. Wenn dieser Morgen ein Beispiel dafür war, wie der Mann sich in Zukunft benehmen wird, steht uns noch allerhand bevor. Dieser Leeper ist offensichtlich eine wandelnde Zeitbombe. Ich habe nur den einen Wunsch, mich aus allem herauszuhalten und ihn seine Arbeit machen zu lassen.«
»Gut«, sagte Ron.
Der Vorsitzende seines Bauausschusses machte ein so verzweifeltes Gesicht, daß der Pfarrer ihm einen Arm um die Schultern legte und ihm Mut machte, obwohl ihm beileibe nicht danach zumute war.
»Da haben wir den Salat«, sagte Emma verdrossen, als sie ihm den Hörer reichte.
»Ich habe den Bauausschuß für Mittwochabend zu einem Treffen hierher eingeladen.« Edith Mallory klang, als sei sie außerordentlich zufrieden mit sich. »Die Leute fanden die Idee natürlich wunderbar. Magdolen wird ihren berühmten Auflauf machen, aber die Lendchen, die mache ich.«
Lendchen!
»Ich weiß doch, wie gern Sie Lendchen essen. Ich habe mir extra welche aus New York kommen lassen.«
»Wie großzügig von Ihnen. Es ist natürlich überhaupt nicht nötig, daß Sie sich solche Mühe machen ...«
»Aber das Leben ist so kurz«, sagte sie und zog die Nase hoch. »Warum sollte man sich mit einer stumpfsinnigen Versammlung abquälen, wenn man statt dessen eine Dinnerparty haben kann?«
Er wußte nicht, warum. Tatsächlich – warum eigentlich?
»Sie können sich im Arbeitszimmer das Stilleben ansehen, das ich habe malen lassen. Bücher. Sieht wirklich echt aus, als stände da eine Reihe Bücher auf dem Regal.«
»Aha.«
»Ich sage Ed, daß er Sie um Viertel vor abholen soll«, fuhr sie fort. Während sie sprach, konnte er die leisen, saugenden Geräusche hören, die sie mit ihrer verwünschten Zigarette machte.
»Nein!« hätte er um ein Haar geschrien. Sein Wagen stand immer noch mit leerer Batterie in der Garage. »Ah, nein danke. Ich komme mit Ron. Wir haben noch viel zu bereden ...«
»Aber Ron kommt doch mit Tad Sherrill, sagte er, weil sein Pick-up ... Was sagte er noch gleich ... Ich glaube, ein Dichtungsring ist kaputt.«
»Hm, na dann quetsche ich mich einfach dazu. Aber trotzdem, vielen Dank, Edith. Ihr Angebot ist wirklich mehr als freundlich.« Er legte den Hörer auf und war keineswegs überrascht, festzustellen, daß seine Stirn leicht feucht geworden war.
»Juni«, sagte Puny.
»Nein«, seufzte der Pfarrer.
»Am vierzehnten.«
»Wie soll ich nur ohne Sie zurechtkommen? Diesen Tag habe ich schon lange gefürchtet.«
»Sie werden gar nicht lange ohne mich zurechtkommen müssen«, tröstete sie ihn. »Nach unserer Hochzeitsreise komme ich ja wieder. Das habe ich Ihnen doch versprochen.«
»Ja, aber sollten Sie und Joe nicht erst mal ans Kinderkriegen denken oder ... an was auch immer?«
»Noch nicht gleich, wenn Sie nichts dagegen haben«, sagte sie schelmisch und stellte den Putzeimer mitten ins Zimmer. Dem Pfarrer kam der Gedanke, daß er seine Haushaltshilfe nie zauberhafter gesehen hatte. Ihr rotes Haar schien eine Art Leuchten zu versprühen; ja, ihr ganzes Wesen verströmte Glück. Es war, als hätte man eine wunderbare Lampe in seinem Haus entzündet, und er wünschte gewiß nicht, daß das Licht erlosch.
»Natürlich«, sagte sie, während sie die Putzbürste in das Seifenwasser tauchte, »natürlich lassen wir Sie nicht hängen. Während ich fort bin, wird man Ihnen eine andere Hilfe schicken.«
»Ich will aber keine andere Hilfe«, sagte er und fühlte sich verdrießlich.
»Ach, papperlapapp, essen Sie lieber Ihre Möhren. Ich habe sie genauso gemacht, wie mein Opa sie gerne hatte, mit Butter und ein wenig braunem Zucker. Und mehr Süßigkeiten bekommen Sie heute nicht.«
»Vielen Dank, Puny«, sagte er. Er konnte nicht umhin zu bemerken, daß sie neuerdings immer lächelte, wenn sie ihn auszankte. Und während er nun zusah, wie sie auf Händen und Knien den Küchenboden putzte, ging es ihm durch den Kopf, wie sehr er Puny Bradshaw zu lieben gelernt hatte, ganz als wäre sie sein eigenes Fleisch und Blut.
Er fragte sich, ob sie ihre Illustration wohl fertig hatte, die, die in aller Eile zu ihrem Verleger geschickt werden mußte. Als er anrief, drangen nur die letzten Worte ihrer aufgezeichneten Stimme an sein Ohr: »... den Piepton, vielen Dank«, und danach eine Art Knistern. Es klang wie ein Lastwagen, der über die Autobahn rollte.
Nachdem er aufgelegt hatte, saß er einen Augenblick lang da und betrachtete den Regen, der gegen die Bürofenster peitschte. Er stellte fest, daß er eigentlich gar nicht mit ihr reden wollte. Die Wahrheit war wohl eher, daß er sich danach sehnte, sie zu sehen.
Als er in Regenmantel und Regenhut aufs Pfarrhaus zuschlich, schwor er sich, gleich morgen früh Lew Boyd kommen zu lassen, damit der seine Batterie wieder auflud. Bevor er auf seine eigene Tür zuging, klopfte er bei Cynthia an.
Das Dach über der flachen Veranda hinterm Haus bot kaum Schutz. Wind und Regen droschen heftig auf ihn ein.
»Cynthia!« rief er über das Tosen der Elemente. Sie hielt die Fliegentür stets verschlossen, damit der Wind sich nicht im Gitter verfing und es aus den Angeln riß.
Noch einmal rief er ihren Namen. Im Treppenhaus brannte ein schwaches Licht, sonst war es dunkel.
Er rüttelte an der Fliegentür und hämmerte aus Leibeskräften dagegen. Schließlich sah er Violet auf die Küchentheke springen, von wo aus sie ihn anschaute, als sei er der Müllmann.
»Wahnsinn!« murmelte er zu guter Letzt und flüchtete durch die durchnäßte Hecke in die warme Küche nebenan.
Magdolen hieß sie in Clear Day, ›Strahlender Tag‹, dem großen, modernen Haus der Mallorys willkommen, das auf einem Hügel lag und den Blick aufs Tal freigab. »Oh, gut! Hier kommt der Herr Pfarrer!« sagte sie fröhlich, während sie Timothy aus seinem Regenmantel half. »Wir sind ja so froh, daß Sie aus Irland zurück sind. Da drüben kann man sich seines Lebens ja nie ganz sicher sein. Wirklich tragisch, die Verhältnisse dort.«
Tad und Ron ließen ihre tropfnassen Anoraks in der Diele und stapften in die Bibliothek, wo ihre Gastgeberin gerade Appetithäppchen servierte.
»Wir haben Sie sehr vermißt, während der ganzen ... na, Sie wissen ja«, seufzte Magdolen. »Ein schwerer Schlag für Miss Edith, noch dazu, wo sie keine Kinder hat, die sie trösten könnten. Ich dachte, Sie würden vielleicht gern sehen, wo ich Mr. Pat gefunden habe.« Sie führte ihn zur Treppe.
»Genau da«, sagte sie und zeigte auf die dritte Stufe von unten. »Da ist er gelandet. Hat mit dem Rücken zum Geländer gesessen. Als ich in den Flur kam, standen seine Augen weit offen und starrten mich direkt an. Ich dachte, der sieht ein bißchen blaß aus. Also sagte ich: ›Mr. Pat, ich habe Ihnen eine schöne, große Schüssel Lasagne gemacht, also kommen Sie und setzen Sie sich an den Tisch, bevor sie kalt wird.«‹
Sie schauderte und hielt sich an seinem Arm fest. »Und in dem Augenblick ist er dann ... die restlichen Stufen hinuntergerollt«
»Magdolen!« sagte Edith Mallory scharf. Sie griff sich den anderen Arm des Pfarrers und zog ihn auf die Bibliothek zu. Fünf durchweichte Ausschußmitglieder hockten um ein Feuer herum, das im Kamin knackte und prasselte.
»Schlamm und noch mehr Schlamm«, sagte Ron Malcolm gerade. »Ganze Flüsse aus Schlamm.« Tad Sherrill ächzte. »Ozeane aus Schlamm.«
»Und wenn der Wetterbericht stimmt, steht uns noch mehr Schlamm bevor«, meldete sich Winona Presley zu Wort. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, klopfte sie mit ihrem Kugelschreiber auf ihren Sekretärinnenblock.
Gewärmt von einem Cabernet aus dem Keller der Mallorys, stürzten sich die Gäste kopfüber in eine lebhafte Diskussion über Wetterkatastrophen, die ihnen im Laufe ihres Lebens begegnet waren.
»Ich habe mal einen Job in Kentucky gemacht«, sagte Ron, »da hat es ganze vierundzwanzig Stunden pausenlos geregnet.« Dabei stellte er zu seiner Freude fest, daß er das Lendchen mit der Gabel zerteilen konnte. »Als alles vorbei war, hatte ich vier große Raupen bis zum Fahrerhäuschen im Schlamm stecken.«
»Was ich in meinem Leben, weiß Gott, nicht noch einmal erleben möchte«, sagte Tad, »ist eine Schlammlawine. Haben Sie jemals Schlamm in Fahrt kommen sehen? Es ist genauso schlimm wie Lava bei einem Vulkan. Ich habe mitangesehen, wie der Schlamm Häuser bis übers Dach bedeckte ...«
»Wissen Sie, was mir an den Franzosen so gefällt?« fragte ihre Gastgeberin.
In der großen Pause, die sie dieser Frage folgen ließ, richteten sich alle Blicke auf sie.
»Wenn sie speisen, reden sie nur vom Essen. Die Mahlzeit vor ihnen ist der Gegenstand ihrer ernsthaftesten Gespräche. Niemals würde es ihnen einfallen, sich ihre Verdauung zu ruinieren, indem sie von Politik sprächen, und ganz bestimmt würden sie nicht über ... Schlamm reden«, sagte sie eisig.
»Aber Edith, Schatz«, sagte Tad, »Schlamm ist eines der Themen, um die es bei dieser Versammlung geht.«
Pater Tim fand den Blick, mit dem sie ihren leutseligen Gast bedachte, unnötig herablassend. »Dies«, informierte ihre Gastgeberin sie alle, »ist ein Dinner. Die Versammlung wegen Schlamms wird in der Bibliothek am Kamin stattfinden, bei einem Glas Brandy.« Sie trommelte sachte mit den Fingern auf den Tisch und lächelte.
Der Pfarrer konnte sich eines ganz bestimmten Gedankens nicht mehr erwehren. Des Gedankens nämlich, daß Pat Mallory sich wahrscheinlich mit Absicht die Treppe hinuntergestürzt hatte.
Nach dem Dessert, Orangenmokkakuchen mit frischer Sahne, das er zur Enttäuschung seiner Gastgeberin nur mit den Augen würdigen durfte, entschuldigte Timothy sich, um seinen Zucker zu überprüfen. Diabetes war die jämmerlichste Krankheit, die man auf eine Dinnerparty mitnehmen konnte.
In der Gästetoilette, die den Benutzer mit hagebuttenfarbenem Chintz und schwarzem Marmor zu erschlagen drohte, tat er, was er zu tun hatte, klappte dann den Kornmodenstuhl herunter und setzte sich müde hin. Um die Wahrheit zu sagen, wäre ihm eine Versammlung im Gemeindehaus, bei der sie alle ihren Kaffee aus Styroporbechern getrunken hätten, bei weitem lieber gewesen.
Was, wenn es noch eine Woche weiterregnete? Oder schlimmer, zwei oder drei Wochen lang? So etwas war in Mitford durchaus schon vorgekommen, da die Stadt über ihr eigenes exklusives Wettersystem verfügte. Da sich auf dem Bauplatz für das Pflegeheim nichts ausrichten ließ, sollte Buck Leeper mit seiner Mannschaft sich um den Dachstuhl der Kirche kümmern.
Das würde ein hübsches Sümmchen verschlingen, das nicht das mindeste mit dem Baubudget für das Haus der Hoffnung zu tun hatte, und bisher war dafür noch kein einziger Cent gesammelt worden. Außerdem konnte es jederzeit aufhören zu regnen, und dann würde der Bautrupp wieder auf den Hügel ziehen und die Arbeit am Dachstuhl zum Erliegen kommen, so daß die Sakristei unter Bergen von Staub zurückblieb.
Die Sonntagsschule hatte im Augenblick absolute Priorität, dachte er. Ja, seine Gedanken nahmen in dieser Hinsicht langsam klare Formen an. Schlamm war kein vernünftiges Argument, um das Dachstuhlprojekt ins Rollen zu bringen.
Er stand auf, trat in den Flur hinaus und steuerte auf die Bibliothek zu. Abgesehen von dem Regen, der auf die Oberlichter prasselte, herrschte eine seltsame Stille im Haus.
»Wo sind denn die anderen alle?« fragte er Edith, die ihm entgegenkam.
»Sie wollten lieber nach Hause gehen, bevor es wieder anfing zu gießen, und das haben sie dann auch getan. Ich habe gesagt, daß sie unbesorgt gehen können – Ed würde Sie nach Hause bringen.«
»Ich dachte, wir wollten uns noch alle ihr Stilleben im Arbeitszimmer ansehen.«
Er hatte das Gefühl, als hätte ihm jemand eine Schlinge um den Hals gelegt. Verzweifelt hielt er Ausschau nach Magdolen. Hatte sie nicht in der Nähe der Tür zum Speisezimmer gestanden, als er den Flur hinunterkam? Wenn ja, mußte sie sich in Luft aufgelöst haben.
Edith zog ihn am Arm weiter. »Wir werden es uns später ansehen, nur wir zwei beide.«