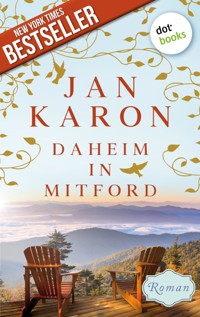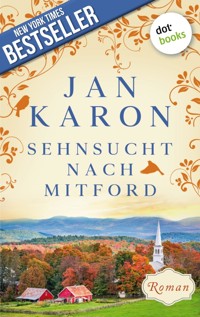Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mitford-Saga
- Sprache: Deutsch
Eine eingeschworene kleine Gemeinde und die Suche nach dem ganz großen Glück: Der berührende Roman »Das Herz von Mitford« von Jan Karon als eBook bei dotbooks. Endlich Zeit für den wohlverdienten Ruhestand! Eigentlich könnte sich Pfarrer Tim entspannt in seinem Lesesessel zurücklehnen und alles in Mitford seinen gewohnten Gang gehen lassen … doch Ruhe wird schrecklich überwertet, stellt er plötzlich fest. Kann es denn sein, dass seine einzige Beschäftigung eine Maulwurfplage ist, die seinen gepflegten Garten bedroht? Seine Frau Cynthia hat dazu jedenfalls eine klare Meinung – und schon haben sie eine Idee: Auch außerhalb von Mitford gibt es bestimmt genug Menschen, die Hilfe bei der Suche nach dem Glück gebrauchen können … Ein Ort, wo Träumen Flügel wachsen, und schon in den morgendlichen Kaffee eine ordentliche Prise Glück gemischt wird: so zartschmelzend und zauberhaft wie die Romane der Bestsellerautorinnen Debbie Macomber und Inga Lindström. »Jan Karons Mitford-Romane sind eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall Street Journal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Endlich Zeit für den wohlverdienten Ruhestand! Eigentlich könnte sich Pfarrer Tim entspannt in seinem Lesesessel zurücklehnen und alles in Mitford seinen gewohnten Gang gehen lassen … doch Ruhe wird schrecklich überwertet, stellt er plötzlich fest. Kann es denn sein, dass seine einzige Beschäftigung eine Maulwurfplage ist, die seinen gepflegten Garten bedroht? Seine Frau Cynthia hat dazu jedenfalls eine klare Meinung – und schon haben sie eine Idee: Auch außerhalb von Mitford gibt es bestimmt genug Menschen, die Hilfe bei der Suche nach dem Glück gebrauchen können …
Ein Ort, wo Träumen Flügel wachsen, und schon in den morgendlichen Kaffee eine ordentliche Prise Glück gemischt wird: so zartschmelzend und zauberhaft wie die Romane der Bestsellerautorinnen Debbie Macomber und Inga Lindström.
»Jan Karons Mitford-Romane sind eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall Street Journal
Über die Autorin:
Jan Karon wurde 1937 in North Carolina geboren. Sie arbeitete in der Werbebranche, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Die Bände ihrer Mitford-Saga eroberten im Folgenden regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste. Heute lebt sie in Virginia, wo sie ein historisches Farmhaus aufwendig restaurierte und zu ihrem Zuhause machte.
Bei dotbooks erscheint in der »Mitford-Saga«:
»Daheim in Mitford«
»Der Himmel über Mitford«
»Die grünen Hügel von Mitford«
»Sehnsucht nach Mitford«
»Das Herz von Mitford«
***
eBook-Neuausgabe September 2019
Dieses Buch erschien bereits 2007 unter dem Titel »Flucht in die Berge« bei Weltbild.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2002 by Jan Karon
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »In This Mountain« bei Viking/Penguin Putnam Inc., New York.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt 67, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
This edition published by arrangement with Viking, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Dave Allen Photography / anthony heflin / realist2000 / gizele / K. 32 Stock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-801-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Herz von Mitford« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jan Karon
Das Herz von Mitford
Roman
Aus dem Amerikanischen von Michaela Link
dotbooks.
Soli deo Gloria
Ehre sei Gott allein
***
Der Herr der Heere wird auf diesem Bergfür alle Völker ein Festmahl gebenmit den feinsten Speisen,ein Gelage mit erlesenen Weinen,mit den besten und feinsten Speisen,mit besten, erlesenen Weinen.
Jesaja 25,6
Kapitel 1Geht und sagt es allen Leuten
Schon wieder Maulwürfe! Father Tim Kavanagh stand auf der Treppe des gelben Hauses und blickte voller Unbehagen auf seinen Garten.
Der Rasen war mit Löchern übersät und ähnelte einer Mondlandschaft; flache Erdwälle liefen kreuz und quer durch den Garten, wie die niedrigen Mauern durch die irische Landschaft.
Er sah zu der Einfahrt des Pfarrhauses hinüber, das einst sein Heim gewesen und jetzt sein vermietetes Eigentum war. Dort schienen die verflixten Talpidae sich genauso wohl zu fühlen. Tatsächlich hatten sie Hélène Pringles bescheidenes Schild Klavierunterricht, Informationen im Haus beinahe entwurzelt, sodass es jetzt Schlagseite hatte wie ein Betrunkener.
Jahr um Jahr hatte er sich an den unterschiedlichsten Gegenmitteln versucht, aber die Halunken hatten ihm wiederholt ein Schnippchen geschlagen; in Wahrheit gefielen sie sich darin, zurückzukommen – und das in immer größeren Zahlen.
Er ging in den Garten hinaus und versetzte dem nächstgelegenen Hügel einen schnellen Tritt. Zum Mond sollte man sie schießen, diese Maulwürfe. Aber seine liebe Frau fand, dass sie in Fallen gefangen und aufs Land verfrachtet werden sollten, wo sie es sich auf einer Wiese zwischen Butterblumen und Blauglöckchen gut gehen lassen könnten.
Und wer sollte das Fangen und Verfrachten übernehmen? Der liebe Tim.
Er ging in sein Arbeitszimmer und rief die Eisenwarenhandlung in Wesley an, denn er war seit Kindheitstagen fest davon überzeugt, dass solche Läden die Lösung aller lästigeren Probleme des Lebens bereithielten.
»Wühlmäuse!«, rief der Geschäftsinhaber. »Was die meisten Leute haben, sind Wühlmäuse – sie glauben nur, es wären Maulwürfe!«
»Aha.«
»Wühlmäuse fressen Wurzeln und zernagen Pflanzenzwiebeln und alles. Haben Ihre Zwiebelpflanzen in den letzten Jahren geblüht?«
»Hm, ja. Ja, sie haben geblüht.«
Der Eisenwarenhändler seufzte. »Dann sind es vielleicht doch Maulwürfe. Tja, die sind hinter Würmern her und hinter anderem Getier in der Erde. Was Sie tun müssen, ist also ganz einfach: Sie müssen die Würmer ausrotten.«
»Ich hatte eher daran gedacht ... äh, die Maulwürfe zu entfernen.«
»Das dürfen wir nicht mehr. Gesetzlich verboten.« Selbst die Regierung hatte sich also auf die Seite der Maulwürfe geschlagen und damit einmal mehr demonstriert, wie weit es mit der Politik in diesem Land gekommen war. »Aha. Und wie wird man die Würmer los?«
»Gift.«
»Verstehe.«
»Allerdings meinen manche Leute, man solle es besser nicht benutzen, wenn man Hunde und Katzen hat. Haben Sie Hunde und Katzen?«
»Haben wir.«
Er rief Dora Pugh vom Haushaltswarenladen in der Main Street an.
»Windräder«, sagte Dora. »Sie wissen schon, diese kleinen Holzdinger auf einem Stock, die aussehen wie Propeller. Der alte Mueller hat doch immer welche gemacht. Sie werden bunt bemalt, so dass sie aussehen wie Enten und Gänse und was weiß ich alles. Wenn der Wind weht, flattern ihre Flügel – das sind die Propeller –, und die Vibrationen sind überall im Boden zu spüren und vertreiben sie. Aber dazu müssten Sie ziemlich viele Windräder haben.«
Er glaubte nicht, dass es seiner Frau gefallen würde, ihren Rasen mit Windrädern zu spicken.
»Außerdem gibt es noch etwas, das mit Batterien funktioniert und das man in den Boden steckt. Die Sache ist nur, ich müsste es eigens bestellen, das dauert dann sechs Wochen, und bis dahin ...«
»... sind sie wahrscheinlich sowieso weg.«
»Genau«, sagte Dora und klemmte sich das Telefon zwischen ihr linkes Ohr und die Schulter, während sie Saatkörner abfüllte.
Er befragte auch Percy Mosley, den langjährigen Besitzer des Main Street Grills. »Was kann man tun, um Maulwürfe loszuwerden?«
Eine dumme Frage, befand Percy. »Fangen Sie sie, dann halten Sie sie am Schwanz fest und beißen ihnen den Kopf ab. So mache ich es jedenfalls.«
Auf dem Weg zur Post begegnete er Gene Bolick, der gerade vom alljährlich stattfindenden Ausverkauf von Walkware im Irischen Wollladen kam.
Gene litt an einem Gehirntumor, der aufgrund seiner Lage in der Nähe des Hirnstamms nicht operiert werden konnte, sodass er jetzt beim Gehen deutlich schwankte.
Es gefiel Father Tim ganz und gar nicht, seinen alten Freund so zu sehen.
»Sehen Sie nur!« Gene hielt ein Päckchen in die Höhe. »Eine Strickjacke mit Lederknöpfen, um fünfzig Prozent reduziert. Und heute gibt es noch einmal zwanzig Prozent obendrauf. Sie sollten zuschlagen, solange die Auswahl noch groß ist.«
»Nein danke, mir haben die fleißigen Finger in Whitecap eine Strickjacke gemacht, die selbst die Sphinx überleben wird. Aber etwas ganz anderes, lieber Freund – haben Sie eine Ahnung, wie man Maulwürfe los wird?«
»Maulwürfe? Mein Daddy hat immer etwas in ihre Löcher gebrüllt, und dann sind sie in alle Richtungen auf und davon.«
»Was hat er denn gebrüllt?«
Gene räusperte sich, beugte sich dicht an Father Tims rechtes Ohr und wiederholte die kurze, aber inbrünstige Litanei.
»Meine Güte!«, sagte der beflissene Gärtner und errötete bis zu den Wurzeln der wenigen ihm noch verbliebenen Haare.
Er hörte, wie die Sekretärin des Bischofs den Hörer an ihren üppigen Busen presste, dann folgte ein gedämpftes Gespräch. Er fand es unbedingt entzückend, nicht in eine Warteschleife gelegt und mit Musik attackiert zu werden, die er überhaupt nicht hören wollte.
»Timothy! Gesegnete Ostern!«
»Danke gleichfalls, Stuart!«
»Ich habe erst heute Morgen an dich gedacht.«
»Weshalb denn? Eine Pfarrstellenvertretung in der Äußeren Mongolei?«
»Nein, ich habe lediglich daran gedacht, dass wir keinen ordentlichen Schwatz mehr miteinander gehalten haben, seit – gütiger Himmel – seit du in Whitecap warst.«
»Seit einer Ewigkeit nicht mehr, um präzise zu sein.«
»Nun ja, jedenfalls seit einigen Jahren nicht mehr.«
»Komm doch mal zum Mittagessen rüber«, schlug der Bischof vor. Er klang ... ja, wie denn? Nachdenklich? Sehnsüchtig?
»Abgemacht!«, sagte Father Tim. Nach dem letzten Ostersonntagsgottesdienst war ihm nach Abwechslung zumute. »Ich wollte dich schon lange einmal besuchen, denn es gibt da etwas, über das ich gern mit dir reden würde. Vielleicht habe ich dann auch eine ganze Kiste Maulwürfe, die aufs Land hinausverfrachtet werden müssen. Ich kann sie auf dem Weg zu dir freilassen.«
»Eine Kiste ... Maulwürfe?«
»Ja.« Er wollte die Angelegenheit nicht näher erörtern.
Er bekam die verwünschten Viecher einfach nicht zu fassen. Er stocherte, einen Jutesack neben sich, mit Stöcken in ihren Schächten und Gängen herum; er rief in ihre Löcher, was ihm Gene empfohlen hatte, allerdings mit gedämpfter Stimme; er blies mit seiner Ehrentrainerpfeife der Mitford Reds; er stampfte auf dem Rasen herum, dass es wie Donner klang.
»Ich geb's auf«, erklärte er seiner Frau mit vor Kälte klappernden Zähnen.
Dann bemerkte er den Tupfer blauer Wasserfarbe auf ihrem Kinn, ein sicheres Zeichen dafür, dass sie an ihrem Kinderbuch arbeitete, dessen Hauptrolle Violet spielte, die Katze aus Fleisch und Blut, die normalerweise auf ihrem Kühlschrank residierte.
»Aber du hast doch gerade erst angefangen!«
»Angefangen! Ich bin schon seit einer geschlagenen halben Stunde zugange.«
»Höchstens zehn Minuten«, widersprach Cynthia. »Ich habe dich beobachtet, und ich muss sagen, ich habe noch nie davon gehört, dass man Maulwürfe los wird, indem man mit ihnen spricht.«
Er streifte die Handschuhe von den kältestarren Fingern und setzte sich enttäuscht auf einen Küchenhocker. Sein Hund legte sich zu seinen Füßen nieder und gähnte.
»Was hast du ihnen denn gesagt?«
Er hatte nicht die geringste Absicht, es ihr zu verraten. »Wenn du immer noch willst, dass sie eingefangen und in eine Kiste gesteckt werden sollen, dann wirst du das Fangen und Einsperren selbst übernehmen müssen, und ich schaffe die Viecher dann aufs Land. Eine faire Arbeitsteilung.« Er hatte die ganze Angelegenheit gründlich satt.
Cynthia funkelte ihn an, als sei sie seine Grundschullehrerin und er ein kleiner Dummkopf auf seinem Hocker. »Warum hörst du nicht einfach auf, dich damit verrückt zu machen, Timothy? Lass ihnen doch ihre Freude!«
Ihnen ihre Freude lassen! Das war mal wieder typisch Künstlerseele. »Aber sie ruinieren den Rasen, für den ich jahrelang geschuftet habe, den Rasen, den du dir erträumt und ersehnt hast, damit du barfuß darauf herumspazieren kannst – ich zitiere – ›wie auf frisch ausgerolltem Samt‹.«
»Um Himmels willen, habe ich tatsächlich etwas so Dummes von mir gegeben?«
Er verdrehte die Augen.
»Timothy, du weißt, dass du lediglich für eine Weile den Kopf abwenden musst, dann werden die Haufen verschwinden, die Löcher werden sich wieder schließen, und im Mai oder Juni wird der Rasen genauso sein, wie du ihn haben willst.«
Sie hatte natürlich recht, aber darum ging es nicht.
»Ich liebe euch«, fügte sie wohlgelaunt hinzu und machte sich auf den Weg in ihr Atelier.
Mit dem Eifer eines Kindes, das am Tag einer Prüfung, für die es nicht gelernt hat, sein warmes Bett verlassen soll, zog er sich seinen Jogginganzug an.
Bewegung war eine gute Medizin bei Diabetes, aber deshalb brauchte er sich noch lange nicht dafür zu begeistern. In Wahrheit fragte er sich, warum ihm das Laufen keinen Spaß mehr machte. Früher hatte er es ungeheuer genossen.
»Gipfel und Talsohlen«, murmelte er. Seine halbjährliche Kontrolluntersuchung stand unmittelbar bevor, und er hatte die Absicht, einen guten Eindruck zu machen, wenn er Hoppy Harper unter die Augen trat.
Als die Glocken der Lord's Chapel den Mittag einläuteten, flitzte er zum Main Street Grill, wo am hinteren Tisch ein Geburtstagslunch für J.C. Hogan stattfinden sollte. Pfeilschnell kam er aus der Tür der Mitforder Buchhandlung, Happy Endings, geflogen, bog scharf nach links und prallte mit voller Wucht mit jemandem zusammen.
Edith Mallory taumelte rückwärts, fand das Gleichgewicht wieder und warf ihm einen Blick zu, bei dem ihm das Blut in den Adern gefror.
»Edith! Es tut mir furchtbar leid.«
»Warum passen Sie nicht auf, wo Sie hinrennen?« Sie zog den breiten Kragen ihres Nerzmantels fester um sich.
»Geistliche«, sagte sie mit unverkennbarem Widerwillen.
»Sie sind ständig mit irgendwelchen hehren Gedanken beschäftigt, nicht wahr?«
Ohne auf eine Antwort zu warten, rauschte sie an ihm vorbei in die Buchhandlung, wo die Glocke über der Tür ein wildes Geklimper anstimmte.
»Vor einer Minute sind Ihro Gnaden hier vorbeigekommen«, bemerkte Percy Mosley, während er den Tisch in der hinteren Sitznische abwischte.
Father Tim bemerkte, dass ein Hauch von ihrem Parfüm auf seiner Kleidung zurückgeblieben war. »Ich bin gerade mit ihr zusammengestoßen.«
»Mit der würde ich auch gern mal zusammenstoßen«, sagte der Besitzer der Grillstube, »und zwar am Steuer eines Dreißigtonners.«
Wenn es irgendjemanden in der Stadt gab, der Edith Mallory noch weniger mochte als er selbst, dann war es Percy Mosley, der vor einigen Jahren mit seinem Geschäft um ein Haar ihrer hinterhältigen Strategie als Vermieterin zum Opfer gefallen wäre.
Nur dank der Hilfe der Geistlichkeit, namentlich ihm selbst, waren ihre schändlichen Pläne restlos durchkreuzt worden.
Wenn Edith Mallory also irgendjemanden in der Stadt gründlicher verabscheuen sollte als Tim Kavanagh, so hatte er keinen Schimmer, wer das sein mochte.
»Immer wenn ich denke, ich hätte diese alte Hexe zum letzten Mal von hinten gesehen, kommt sie wieder zurück, wie ein Hund zu seinem Erbrochenen.«
»Immer mit der Ruhe, Percy, denken Sie an Ihren Blutdruck ...«
»Und Ed Coffey chauffiert sie immer noch in diesem Lincoln herum wie die Königin von England. Er sollte sich schämen, dieser jämmerliche Tropf, er hat Schande über die ganze Familie Coffey gebracht.«
J.C. Hogan, Herausgeber der Muse und Stammgast der Grillstube, ließ seine überquellende Aktentasche auf die Sitzbank knallen und schob sich hinter den Tisch. »Ihr werdet nie erraten, was gerade auf der Main Street los ist.«
Percy blickte grimmig drein. »Wagen Sie es nicht, in meinem Lokal auch nur ihren Namen zu erwähnen.«
»Joe Ivey und Fancy Skinner führen einen erbitterten Preiskrieg.« J.C. nahm ein großes Taschentuch aus seiner Hüfttasche und wischte sich das Gesicht ab.
»Ein Preiskrieg?«, fragte Father Tim.
»Kopf an Kopf, könnte man sagen. Fancy hat sich ein großes Schild malen lassen und es in ihrem Fenster im oberen Stock aufgestellt. Darauf steht: Jeder Haarschnitt zwölf Dollar – alle sind willkommen. Und was glauben Sie, was als Nächstes passiert? Joe hängt unten ein Schild auf, mit der Aufschrift: Haare schneiden elf Dollar.
Joe Iveys nur aus einem einzigen Stuhl bestehender Friseursalon befand sich in einem ehemaligen Lagerraum hinter der Küche der Bäckerei seiner Schwester, der Leckerbäckerei. Joes einzige Konkurrenz in der Stadt war Fancy Skinners Unisex-Friseursalon Ein Schnitt höher, dessen gemietete Räume in dem Stockwerk über der Bäckerei lagen. »Poetische Ironie«, hatte ein Gast der Grillstube das Arrangement einmal genannt.
»Also geht Fancy mit ihrem Preis auf zehn Dollar runter und lässt sich ein neues Schild malen. Dann senkt Joe seinerseits den Preis, wechselt sein Schild aus und gibt mir eine Annonce mit dem Text: ›Haare schneiden neun fünfzig. Kostenloser Schokoladenkeks für jeden Kunden.«
»Preisdumping«, bemerkte Percy.
»Ich habe keine Ahnung, wo das enden wird«, sagte J.C., »aber wenn Sie einen Haarschnitt brauchen, ist dies genau der richtige Zeitpunkt dafür.«
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!« Father Tim fand, dass sie langsam zur Sache kommen sollten.
»Klar. Alles Gute zum Geburtstag«, sagte Percy. »Sie sind der Erste, der etwas von meiner neuen Speisekarte bestellt.«
J. C. blickte finster drein. »Ich hatte mich so an die alte Speisekarte gewöhnt.«
»Das ist für meine Velma das letzte Jahr in dieser Bruchbude, und ich wollte mit Pauken und Trompeten hier weggehen.« Percy trat vor die Theke, griff stolz nach drei Speisekarten, auf denen die Tinte kaum getrocknet war, und verteilte sie. Er fand, dass die Druckerei in Wesley ein großartiges Konzept für diese neuen Karten entwickelt hatte – auf dem Einband stand in grünen Lettern, die sich wie Dampf über einem Kaffeebecher erhoben, das Motto der Grillstube zu lesen: Einmal Main Street Grill, immer Main Street Grill!
»Wo steckt eigentlich Mule?«, fragte Percy.
»Keine Ahnung«, antwortete Father Tim. »Lässt sich wahrscheinlich die Haare schneiden.«
»Also, wie alt sind Sie jetzt?«, wollte Percy wissen.
J. C. grinste. »Wenn Sie Adele fragen, ich gehe auf die Fünfzehn zu.«
»Kitzel mich doch mal jemand, damit ich mitlachen kann«, bemerkte Mule, der gerade an den Tisch trat. »Er ist keinen Tag jünger als sechsundfünfzig, das weiß ich, weil ich seinen Führerschein gesehen habe, als er bei Shoe Barn einen Scheck ausgestellt hat.«
»Also, geben Sie Ihre Bestellung auf, und fackeln sie nicht lange. Velma ist zu Fancy rüber und lässt sich eine Dauerwelle machen, und ich habe zu wenig Personal. Der Kaffee an diesem Tisch geht aufs Haus, aber nur heute.«
»Ich will keinen Kaffee«, erwiderte Mule. »Ich hatte eher an gesüßten Eistee gedacht.«
»Kaffee geht aufs Haus, Tee ist was anderes.«
J. C. schlug mit grimmiger Miene seine Speisekarte auf. »Sie haben Kartoffel falsch geschrieben!«, erklärte er.
»Wo?«, fragte Percy.
»Hier unten, wo es heißt ›Thunfisch-Croissant mit Kartofelchips.‹ Kartoffel schreibt man mit zwei F.«
»Seit wann?«
»Seit eh und je.«
Das sagt der Richtige, dachte Father Tim.
»Verflixt und zugenäht«, bemerkte Mule. »Taco-Salat! Werden Sie in dieser Stadt Taco-Salat los?«
»Taco-Salat«, murmelte Percy und machte sich eine Notiz auf seinem Bestellblock.
»Moment mal, ich habe nicht gesagt, dass ich Taco-Salat nehme, ich wollte bloß drüber diskutieren.«
»Ich hab keine Zeit für Diskussionen«, sagte Percy. »Ich muss mich um meine Mittagskundschaft kümmern.«
Father Tim bemerkte, dass Percys Gesicht dunkelrot anlief. Hoher Blutdruck, der Stress mit der neuen Speisekarte ...
»Was ist Taco-Salat überhaupt?«, erkundigte sich Mule.
Der Redakteur der Muse blickte erstaunt auf. »Haben Sie die letzten Jahre in einem Bunker verbracht? Um Himmels willen, Taco-Salat ist Salat in einem Taco.«
»Nein, ist er nicht«, widersprach Percy. »Es ist Salat in einer Schüssel mit Taco-Chips obendrauf.«
Mule ließ sich mit resigniertem Blick auf einen Stuhl sinken. »Ich nehme, was ich immer genommen habe: einen gegrillten Pimientokäse auf Weißbrot ohne Majo.«
»Sehen Sie auf dieser Speisekarte irgendetwas mit Pimientokäse? Auf dieser Speisekarte führen wir keinen Pimientokäse, und wir werden auch keinen Pimientokäse mehr führen, und damit basta.« Der Besitzer der Grillstube stürmte mit angewiderter Miene zum Tresen.
»Sie haben ihn verärgert«, bemerkte J.C., der sich das Gesicht mit dem Taschentuch abtupfte.
»Wovon lebt der Mann, wenn er keinen Pimientokäse auf seiner Speisekarte hat?«, wollte Mule wissen.
»Wenn Sie nicht runter in die Teestube laufen und sich zu den Frauen setzen wollen, gibt es in dieser Stadt kein anderes Restaurant, in dem man zu Mittag essen kann ...« J.C. tippte mit dem Zeigefinger auf die Speisekarte. »Also nehmen Sie besser irgendetwas, das hier angeboten wird. Wie wär's mit einem Fishburger! Sehen Sie mal, ›Vier Unzen paniertes und frittiertes Schellfischfilet, serviert auf einem gegrillten Brötchen mit Salat, Tomate und Remoulade‹.«
»Ich mag keine Remoulade.«
Father Tim hätte am liebsten laut geschrien. »Ich nehme den Chefsalat«, erklärte er und hoffte, damit ein Beispiel zu geben.
Mule wirkte erleichtert. »Schön, den nehme ich auch.« Er trommelte mit den Fingern auf den Tisch. »Andererseits, man kann nie wissen, was in einen Chefsalat alles hineinkommt, wenn man es mit diesem Chef zu tun hat.«
»Ich nehme ein überbackenes Thunfischbrötchen«, sagte J.C., »und dazu den Fishburger und gefüllte Ofenkartoffeln!«
»Nur zu«, erklärte Mule. »Nehmen Sie, so viel Sie wollen, wir laden Sie ein.« Dann unterzog er die Speisekarte noch einmal einer gründlichen Musterung. »›Chili mit Tortilla-Chips und Käse‹, das könnte genießbar sein.«
»Da kommt er, entscheidet euch«, warnte J.C.
»Ich nehme das Chilizeugs«, sagte Mule und vermied dabei jeden Blickkontakt mit Percy. »Aber nur, wenn keine Bohnen drin sind.«
Percy warf ihm einen eisigen Blick zu. »Wo gibt es Chili ohne Bohnen? Das ist wie ein Cheeseburger ohne Käse.«
»Klar«, meinte J.C. »Oder ein Schinkenbrot ohne Schinken.«
Father Tim schloss die Augen wie zum Gebet, während er spürte, dass ihm der Blutzucker bis in die Slipper rutschte.
Also, was treiben Sie denn jetzt so?
Es war eine beiläufige und ganz und gar harmlose Frage, die Art Frage, die jeder einem Pensionär stellen konnte. Aber er hasste sie. Und jetzt, nachdem erst gestern ein ehemaliges Gemeindemitglied eben dieselbe Frage gestellt hatte ...
»Also, was zum Kuckuck tun Sie denn jetzt so den ganzen Tag lang?«
Mule war bereits gegangen, um einem Kunden ein Haus zu zeigen, J.C. war ins obere Stockwerk hinaufgetrottet, um an der Montagsausgabe zu arbeiten, und Percy stand an ihrem angestammten Tisch und sah Father Tim an wie einen aufgespießten Käfer.
Warum hatte er in den fast vier Jahren seit seiner Pensionierung noch immer keine Standardantwort auf diese Frage gefunden? Normalerweise erzählte er, dass er in verschiedenen Kirchen hie und da aushalf, was natürlich der Wahrheit entsprach, aber das klang furchtbar antriebslos. Tatsächlich hatte er einmal, ohne viel nachzudenken, gesagt: »Oh, nichts Besonderes.« Nachdem er eine solche Narretei aus seinem eigenen Mund gehört hatte, hatte er sich in Grund und Boden geschämt.
Seiner Meinung nach hatte Gott niemanden auf die Erde geschickt, um ›nichts Besonderes‹ zu tun. Daher hatte er im ersten Jahr nach seiner Vertretungszeit in Whitecap im Kinderkrankenhaus von Wesley, seiner zweitliebsten Wohltätigkeitsorganisation nach der Kirche, ungezählte Unterrichtsstunden gegeben. Er hatte sich sogar bereitgefunden, etwas zu tun, das er von Herzen verabscheute: Spendengelder auftreiben. Zu seinem Erstaunen hatte er auch eine gewisse Summe zusammenbekommen.
Außerdem hatte er im Garten des Pfarrhauses und des direkt benachbarten gelben Hauses gearbeitet, bis es schließlich so weit gekommen war, dass manche Leute im Vorbeifahren das Tempo ihrer Autos drosselten, um ihn anzustarren. Gelegentlich hatten sogar wildfremde Menschen angehalten und gefragt, ob sie ihn fotografieren dürften.
Während des zweiten Jahres hatte er Andrew Gregory, dem neuen Bürgermeister, ausgeholfen und außerdem kurze Vertretungen in Wesley, Holding, Charlotte, Asheville, Morganton, Johnson City und eine von mehreren Monaten in Hickory gemacht. Irgendwie war das genug gewesen. Fast. Ihm war zu, jeder Zeit bewusst, dass etwas an ihm nagte, auch wenn er nicht sagen konnte, was.
Vielleicht brauchte einfach nur sein männliches Ego irgendeine Selbstbestätigung; in jedem Falle verspürte er eine gewisse Rastlosigkeit des Geistes, ein Gefühl, unwürdig und den Dingen nicht mehr ganz gewachsen zu sein.
Seine Frau schlug eine Reise in die Dordogne oder sogar nach Afrika vor, und er hatte versucht, ein wenig Begeisterung für das Reisen an ferne Orte aufzubringen, doch vergeblich.
Kurzum, wozu lange um den heißen Brei herumreden? Eine Kirche! Das war es, was er brauchte. Er hatte Sehnsucht nach einer eigenen Herde, die geweidet und geleitet werden musste.
Gelegentlich vermisste er sogar die einfache Tätigkeit, das Pfarrblättchen tippen zu müssen, obwohl er eine derartige Absonderlichkeit niemals einer anderen Menschenseele anvertraut hätte.
Warum war er überhaupt in Pension gegangen? Er hätte bis in alle Ewigkeit Pfarrer in der Gemeinde der Lord's Chapel bleiben können. Als er zu guter Letzt dieses behagliche Band durchtrennt hatte, hatte ihm der Sinn ganz und gar nach Freiheit und Abenteuer gestanden, aber jetzt fragte er sich, was er sich dabei nur gedacht haben mochte.
Irgendwann im Winter war ihm ein überaus reizvoller Gedanke gekommen, etwas, für das er und Cynthia seither Gottes Rat und Weisheit gesucht hatten. Da er nicht genau wusste, wie er die Sache angehen sollte, beschloss er, mit Stuart darüber zu sprechen. Das würde ihm helfen, eine Lösung zu finden.
In der Zwischenzeit hatte er mit dem begonnen, was jeder pensionierte Geistliche mit einem Funken Selbstachtung im Leib tun sollte: Er schrieb ein Buch. Es sollte eine lockere Sammlung von Essays werden, von Betrachtungen, und am ersten Tag des neuen Jahres hatte er damit angefangen.
Das Problem war nur, dass er niemandem davon erzählen konnte.
Percy beugte sich über den Tisch und blinzelte mit gerunzelten Brauen auf ihn hinab. Father Tim konnte seinen heißen Atem förmlich spüren. »Dann bleiben Sie morgens einfach im Bett liegen – oder was?«
Percy hätte ohnehin nicht gewusst, was ein Essay war; daher ratterte er jetzt eine Liste von Aktivitäten herunter, die so lang war, dass Percy ihm unverhohlen ins Gesicht gähnte. Später wünschte er, er hätte die Entfernung von Stockflecken aus seinen alten Schuhen und das Sortieren seiner Socken nach Farben weggelassen. Außerdem hatte er das Gefühl, dass ein Geständnis, er koche und spüle fast jeden Abend, ein wenig übertrieben war – und außerdem unter Garantie dem Klatsch und Tratsch im Städtchen ungeahnten Auftrieb geben würde.
Etwas anderes, das an ihm nagte, war der Verdacht, dass es zügellos und egozentrisch sei, Essays zu verfassen. Aus diesem Grund beschloss er, im Galopp die Pferde zu wechseln und seine Memoiren zu schreiben.
Genoss das Schreiben von Memoiren heutzutage nicht ein gewisses Ansehen? In manchen Kreisen waren sie geradezu der letzte Schrei. Er konnte sich jedoch nicht vorstellen, irgendjemandem zu sagen: Ich schreibe meine Memoiren. Wenn man von seinem Leben erzählte, setzte das voraus, dass man ein Leben geführt hatte, über das zu schreiben sich lohnte. Das traf natürlich auf ihn zu, aber erst, seit er mit zweiundsechzig Jahren seine Nachbarin geheiratet hatte. Das war tatsächlich ein denkwürdiges Ereignis gewesen.
Aber nein, er war nicht der Typ für Memoiren; wenn es hart auf hart kam, war er wohl eher der Typ für Essays. Er hatte schon lange den ziemlich kindischen Wunsch verspürt, irgendjemandem sein Geheimnis zu offenbaren; schließlich hatte er schon mehr als neunzig Seiten geschafft und war zunehmend in Schwung gekommen, was ihm sehr gefiel.
Als Mule am nächsten Morgen wegen einer Routineuntersuchung im Krankenhaus nicht zum gemeinsamen Frühstück erschien, beschloss Father Tim kurzerhand, seinen persönlichen Leckerbissen J.C. Hogan anzuvertrauen, der einem Literaten näher kam als alles andere, was Mitford wohl jemals hervorbringen würde.
»Sagen Sie das noch mal«, sagte J.C. und legte eine Hand ans Ohr, als hätte er nicht richtig gehört.
»Essays!«, wiederholte er und kam sich plötzlich wie ein kompletter Idiot vor. »Ich ... ah, schreibe eine Essaysammlung.«
Der Reporter der Muse spießte mit verständnislosem Gesichtsausdruck ein Stück Wurst auf. »Ich habe mal ein paar Essays gelesen«, sagte er, schob sich die Wurst in den Mund und ließ ihr eine halbe Scheibe gebuttertes Toastbrot folgen. »Zu kleinkariert für mich. Zu weitschweifig.«
Father Tim seufzte. »So kann man das auch sehen.«
»Also«, sagte J.C., »was glauben Sie, was für einen Laden Edith Mallory hier unterbringen wird, wenn Percy in den Ruhestand geht?«
»Das weiß nur der Himmel. Da kann man nur raten.«
»Ich könnte mich für einen Schuster erwärmen«, meinte J. C., während er den letzten Rest Traubenmarmelade überlistete, aus ihrem Glas zu kommen. »Oder eine Reinigung. Ich muss bis nach Wesley fahren, um meine Hosen bügeln zu lassen.«
»Sie müssten Sie nicht bügeln lassen, wenn Sie sie nicht einfach auf den Boden werfen würden«, meinte Percy. Percy hatte die Junggesellenbude des Redakteurs vor seiner Heirat mit Adele besucht und war wie vom Donner gerührt gewesen.
Wie sehr er sich auch bemühte, Father Tim konnte es sich nicht vorstellen, sich in der Teestube mit J. C. und Mule zu treffen. Es wäre nicht mehr dasselbe. Außerdem hatte Percy erklärt, dass man ihn nur mit den Füßen voran in das mit lavendelfarbenen Vergissmeinnicht tapezierte Lokal bekommen würde.
»Percy«, schrie J.C. zum Grill hinüber, »was glaubst du, wen Godzilla hier reinnehmen wird, wenn du in Ruhestand gehst?«
Percy machte ein angewidertes Gesicht. »Ron Malcolm meinte, hier käme eine Tierhandlung rein.« Allein der Gedanke an diesen Gestank, der dann auf die Main Street hinauswehte, genügte, um das Bedürfnis zu entwickeln, sein Frühstück wieder auszuspucken.
»Auf keinen Fall!«, sagte J. C. »Die Leute in Mitford kaufen ihre Haustiere nicht in einer Tierhandlung. Sie warten, bis irgendetwas an ihrer Gartentür auftaucht. Habe ich nicht recht?«, fragte er Father Tim, der es schließlich wissen sollte.
»Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher ...‹«
Er sprach die Verse zusammen mit Cynthia und der Gemeinde von St. Paul's in Wesley aus dem Gedächtnis.
»Du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht.‹«
Cynthia legte ihren Arm um ihn, während sie den Psalm sprachen. »Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele; auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis; du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.‹«
Die vertrauten Worte wärmten ihm das Herz, Worte, die er – vor wie langer Zeit? – auswendig gelernt hatte. War er zehn Jahre alt gewesen oder zwölf? Er sah seine Frau an und wurde von einem Gefühl großer Zärtlichkeit überschwemmt. Der Junge, der diese Worte in Holly Springs in Mississippi vor einer verstummten Sonntagsschulklasse aufgesagt hatte – was für ein Wunder, dass er jetzt, mehr als ein halbes Jahrhundert später, in dieser Kirche in Wesley in North Carolina stand, den Arm seiner Frau um seine Taille spürte und erfüllt war von einem Glück, das zu erleben er niemals geglaubt hatte.
Stuart Cullen machte ganz und gar nicht den Eindruck eines würdigen, allseits hochgeschätzten Bischofs. Tatsächlich sah er mit seinen einundsiebzig Jahren aus wie ein Mann, der gerade von einem Fußballspiel auf einem Parkplatz zurückkam.
Father Tim war seltsam stolz darauf, dass sein Bischof und bester Freund aus Seminartagen jung und kräftig wirkte und nicht die geringsten Allüren hatte, und so trat er mit stolzgeschwellter Brust und eingezogenem Bauch in das bischöfliche Arbeitszimmer. Stuart blickte bei seinem Eintritt lächelnd von seinem antiken Nussbaumschreibtisch auf, erhob sich und kam ihm entgegen.
»Mein Freund!«
Sie umarmten einander. Der Bischof hegte große Zuneigung zu seinem langjährigen Lieblingspfarrer, und der Pfarrer war dankbar dafür, dass er nie den Ehrgeiz gehabt hatte, es bis an die Spitze zu bringen. In Wahrheit war er froh darüber, dass jemand anderer bereit war, die niederdrückende Last des höheren Kirchenlebens zu schultern und ihn in Frieden zu lassen.
»Du siehst großartig aus«, sagte Father Tim aufrichtig
»Und alt«, erwiderte Stuart.
»Alt? Was ist Alter? Alter ist eine Frage von ...«
Stuart kicherte. »Bitte, Timothy, halt mir keine Predigt. Setz dich lieber.«
Er nahm Platz und stellte zu seiner Erheiterung fest, dass er und Stuart beinahe gleich gekleidet waren; beide trugen sie Khakihosen, Sporthemd und Priesterkragen. »Wie Zwillinge im Partnerlook.«
»Nur dass du nicht alt bist, Timothy.«
»Was soll dieses Gerede über das Alter? Meine Gelenke knirschen wie die Achsen eines Heuwagens.«
»Mir haben deine Metaphern aus dem Leben der Landbevölkerung schon immer gefallen«, sagte Stuart.
»Zu viel Wordsworth in jungen Jahren«, erwiderte Father Tim.
»Wo wir gerade vom Landleben sprechen – hast du deine Maulwürfe irgendwo auf dem Land abgesetzt?«
»Eine gescheiterte Mission«, gestand er. »Wir konnten keinen fangen, den wir hätten aussetzen können.«
»Ich verabscheue Maulwürfe. Oder waren es Wühlmäuse? Und wo liegt da eigentlich der Unterschied?«
»Das willst du gar nicht wissen«, sagte Father Tim. »Jetzt erzähl mir, was eigentlich los ist. Du wirkst so neugierig. Oder vielleicht eher philosophisch.«
Stuart setzte sich in einen ledernen Armsessel seinem pensionierten Pfarrer gegenüber und blickte durch das Fenster in den Garten hinaus, den seine Frau pflegte und in dem er selbst gern herumwerkelte. Ein rosafarbener Hartriegel in früher Blüte bog sich im Wind. Schließlich drehte der Bischof sich wieder zu seinem Besucher um.
»Ich möchte eine Kathedrale bauen.«
»Ahhh.« Father Tim dachte einen Moment lang über diese verblüffende Ankündigung nach. »Der Bau von Kathedralen ist keine passende Aufgabe für die ältere Generation.«
»Der Gedanke ist mir auch gekommen; mir ist klar, dass ich vielleicht nicht lange genug leben werde, um den fertigen Bau noch zu sehen. Bei der Summe an Spendengeldern, die wir werden aufbringen müssen, und angesichts der Zeit, die allein so etwas dauert, werde ich vielleicht nicht einmal die Grundsteinlegung erleben. Wir werden uns nämlich keinen Cent für dieses Projekt leihen.«
»Hm, dann werden wir vielleicht beide tot und begraben sein.«
»Ich werde in elf Monaten zweiundsiebzig, und wie du weißt, wird man mich dann in Pension schicken. Die starren Grenzen für unsere Pensionierung haben mir noch nie gefallen. Ich habe mich nämlich noch nie im Leben besser gefühlt als jetzt. Warum sollte ich gezwungen werden, mit zweiundsiebzig in den Ruhestand zu treten?«
»Keine Ahnung«, sagte Father Tim.
»Wie dem auch sei, ich fange sehr spät damit an, eine Kathedrale zu bauen!«
»Wenn du mir die Plattitüde verzeihst: Es ist niemals zu spät.«
»Außerdem frage ich mich, ob die ganze Idee nicht vielleicht auf dem eigensüchtigen Wunsch nach Unsterblichkeit beruht.«
Schweigend dachten sie eine Weile darüber nach. Die Uhr auf dem Kaminsims tickte. »Meinst du«, fragte Father Tim, »dass das Streben nach Unsterblichkeit die treibende Kraft hinter Michelangelos David oder da Vincis Mona Lisa war?«
Der Bischof schlug die Beine übereinander und richtete seinen Blick auf die Zehenspitze seines Schuhs.
»Oder hinter, sagen wir, Händels Messias?« – »Ich behaupte nicht, zu wissen, was hinter irgendetwas steht, das wir Menschen tun. An manchen Tagen scheint es so, als geschehe alles, was wir tun, aus unaussprechlich egoistischen Gründen, dann wieder kommen die Tage auf dem Berggipfel, an denen wir die elektrisierende Wahrheit noch einmal ganz neu erfahren können, die Wahrheit, dass wir ernsthaft danach trachten, alles zum Ruhme Gottes zu tun.«
»Was hat Gott dir denn zu deinem Plan gesagt?«
»Eine ganze Menge. Genau genommen glaube ich, dass es eigentlich seine Idee war. Ich bin wahrscheinlich recht klug, aber nicht klug genug, um die ... Einzelheiten für diese Idee zu ersinnen. Ich muss gestehen, als mir diese Dinge plötzlich zufielen, habe ich geweint.«
»Dann geht es dir also nicht darum, deinen Namen über die Tür gemeißelt zu sehen? St. Stuart on the Hill?«
Stuart lachte. Ah, wie gern Father Tim seinen Bischof lachen hörte!
Stuarts Sekretärin öffnete die Tür und schob den Kopf in den Raum. »Ich gehe mittagessen. Sie beide werden wohl nichts benötigen?«
»Nur ein wenig Demut, gewürzt mit Geduld und Glück«, erwiderte der Bischof.
»Auf Vollkornweizen oder auf Roggen?«, fragte seine Sekretärin und schloss die Tür.
»Einige von uns«, sagte Stuart, »interessieren sich nur dafür, solche Dinge in Gang zu setzen, deren Erfüllung sie eines Tages miterleben werden, aber ich habe immer über die Gegenwart, über den Tag hinausgeblickt, eine Neigung, die gleichzeitig ein Segen und ein Fluch ist.«
»Das hat Niebuhr gesagt«, warf Father Tim ein.
»Allerdings. Er hat gesagt: ›Nichts, das es wert ist, getan zu werden, lässt sich in einem Menschenleben erreichen; daher kann uns nur die Hoffnung retten. Nichts, das wahr, schön oder gut ist, kommt in seinem eigenen historischen Kontext voll zur Geltung; daher kann uns nur der Glaube retten.‹«
»›Und nichts, das wir tun, wie tüchtig wir auch sein mögen‹«, vollendete Father Tim das Zitat, »›können wir allein vollenden; deshalb kann uns nur die Liebe retten.‹«
Stuart beugte sich auf dem Sessel vor. »Ich habe Feinde, musst du wissen.«
Father Tim sprach es nicht aus, aber natürlich wusste er davon.
»Wie dir bewusst ist, ist unsere Diözese die ärmste im ganzen Südosten. Bisher hat man die Idee einer Kathedrale im Allgemeinen als protzig und selbstsüchtig abgetan, als eine Zurschaustellung spirituellen Stolzes und eine schamlose Verschwendung von Geldern, die für höhere Zwecke genutzt werden könnten.«
»Und ich bin davon überzeugt, dass das lediglich der Anfang ist.«
»Die Diözese ist umgeben von einer Kultur, in der eine Kathedrale nach europäischer Dekadenz stinkt, obwohl die Baptisten unten an der Straße gerade eben eine Kirche gebaut haben, in der zweitausend Menschen Platz haben, und dabei hat sich niemand etwas gedacht, nicht das Geringste.«
»Wo wird die Kathedrale erbaut werden?«, fragte Father Tim, der beschlossen hatte, die Dinge von der positiven Seite zu betrachten.
Stuart erhob sich aus dem Sessel, grinste und knöpfte sich das Jackett zu. »Komm mit. Ich werde es dir auf dem Weg zum Mittagessen zeigen.«
»Das ist eine Kuhweide, Stuart!« Er wusste mit Sicherheit, dass er soeben in etwas hineingetreten war.
»Ah, Timothy, mach die Augen auf! Eine Kuhweide, ja, aber eine, von der aus man einen prachtvollen Blick auf die Stadt hat! Sieh dir nur an, wo wir stehen, um Himmels willen! Das ist ein Platz für Engel!«
Der Wind riss ihnen die Worte aus dem Mund; ihre Mäntel blähten sich auf und flatterten wie Segel.
»... Querschiff«, brüllte Stuart und zeigte auf die Kuppe des Hügels. »... kreuzförmig!«, rief er und fuchtelte mit ausgestreckten Armen herum. Obwohl es fast unmöglich war, zu verstehen, was Stuart sagte, sprach der Gesichtsausdruck seines Bischofs Bände; er war so lebendig und strahlend wie der des jungen Mannes, den Father Tim vor all den Jahren im Predigerseminar kennengelernt hatte.
Sie eilten zum Wagen zurück, vorangetrieben von dem kühlen Wind in ihrem Rücken.
»Jetzt zu den Einzelheiten«, sagte Stuart, der darüber vergaß, den Schlüssel in das Zündschloss des Wagens zu stecken. »Wir werden unsere Kathedrale aus Baumstämmen bauen.«
»Aus Baumstämmen.«
»Ja! Ein ehrliches Baumaterial direkt aus unseren Bergwäldern, mit Scherenbindern aus gelber Sumpfkiefer als Dachstuhl, Holzschindeln, von unseren einzigartigen Handwerkern geschreinerte Kirchenbänke aus Eiche ... Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich das begeistert, Timothy! Und außerdem ...«
In den Augen seines Bischofs stand ein regelrechtes Funkeln. »... außerdem sind diese Materialien extrem kostengünstig!«
»Aha.«
»Wir denken, dass wir es für sechs Millionen schaffen können«, sagte Stuart. »Alles in allem spottbillig. Endlich werden wir das haben, was wir schon seit so vielen Jahren brauchen – einen Treffpunkt für unsere zerstreute Diözese, ein Zentrum der Gelehrsamkeit, und eines Tages, dessen bin ich gewiss, eine großartige Chorschule.«
Der Bischof ließ den Wagen an, und sie rollten langsam über die von Bäumen gesäumte Straße den Hügel hinunter. »Bete für mich«, sagte er leise.
»Ich bete seit mehr als vierzig Jahren für dich, mein Freund.«
»Dann hör jetzt nicht damit auf. Du weißt natürlich, dass auch du getreulich in meinen Gebeten bist und es immer sein wirst.«
»Ja«, antwortete Father Tim. »Und ich bin sehr dankbar dafür.«
»Aber ich habe viel zu viel von meinen eigenen Interessen geredet. Verzeih mir, Timothy. Erzähl mir, was dich heute hierhergeführt hat, was du auf dem Herzen hast.«
Nach der Diskussion über eine große Kathedrale war es nicht leicht, ein neues Thema anzuschneiden, aber zwischen der Frage und seiner Antwort lag kaum mehr als ein Herzschlag.
»Die Mission.«
Stuart zuckte sichtlich zusammen. »Du hast nicht genug zu tun; die Pensionierung verschafft den Menschen im Allgemeinen zu viel Zeit zum Nachdenken.«
»Komm mir nicht so von oben herab, Stuart.« Er hatte Stuarts Traum nicht auf die leichte Schulter genommen, und er sah es nicht gern, dass sein eigener Traum so achtlos abgetan wurde.
»Natürlich, du hast recht.«
»Das ist sehr wichtig für mich und für Cynthia. Außerdem lautet der Auftrag, in die Welt hinauszugehen und die frohe Botschaft weiterzutragen, nicht zu Hause zu sitzen und zum Fossil zu werden.«
»Ich habe deshalb so reagiert, weil du Diabetes hast. Es wäre nicht gut, wenn du ohne medizinische Hilfe auf irgendeinem trostlosen Außenposten festsitzen würdest.«
»Ich spritze mir zweimal am Tag Insulin, überwache meinen Zucker mit großer Genauigkeit, esse in regelmäßigen Abständen, mache zweimal die Woche Sport – keine große Sache. Genau genommen würde mein Arzt mir allerdings einen trostlosen Außenposten verbieten; wir werden nicht weit von zu Hause fortgehen.«
»Hast du schon eine Ahnung, wohin?« – »An irgendeinen Ort in den Appalachen«, antwortete er. »Dahin, wo die Dooley Barlowes und Lace Harpers herkommen.«
»Wer ist Lace Harper?«
»Eine außerordentliche junge Frau, Adoptivtochter meines Arztes und seiner Frau, die in diesem Herbst ihr erstes Jahr am College beginnen wird. Vor nicht allzu langer Zeit hat sie noch im Schmutz unter ihrem Haus gelebt.«
»Weshalb denn das?«
»Um vor einem trunksüchtigen Vater zu fliehen, der sie besinnungslos zu schlagen pflegte.«
»Lieber Gott.«
»Bevor die Harpers sie aufgenommen haben, hat sie sich ihr Wissen mithilfe des Bücherbusses fast zur Gänze allein angeeignet. Jetzt ist sie einer der hellsten Sterne, die ihre Privatschule je gesehen hat. Wir haben Lace ungeheuer gern, und wir hegen die Hoffnung, dass sie und Dooley eines Tages ... nun ja, du verstehst.«
»Aha. Und dein Junge, Dooley, er macht sich gut, ja?«
»Beginnt gerade an der University of Georgia sein Studium der Tiermedizin. Wie du dich vielleicht erinnerst, ist Dooley der Sohn eines gewalttätigen Vaters, den er kaum kannte, und einer ehemals alkoholkranken Mutter, die ihre Kinder weggegeben hat. Mittlerweile hat Pauline Christus kennengelernt und einen gläubigen Christen geheiratet; die Verwandlung ist ein wahres Wunder. Mit alledem will ich lediglich sagen, dass ich erlebt habe, welchen Unterschied es für Kinder wie Dooley und Lace machen kann, wenn man sie aus diesen Verhältnissen herausholt, wenn man ihnen Liebe schenkt. In Wahrheit macht es den alles entscheidenden Unterschied!«
Stuart bremste, weil er links abbiegen wollte, und sah seinen alten Freund an.
»Ein englischer Missionar hat einmal gesagt: ›Manche Menschen wollen in Hörweite der Kirchenglocken leben; ich möchte im Vorhof der Hölle eine Rettungsstation bemannen.‹ Du hast meinen Segen.« Von all seinen Geistlichen war Timothy Kavanagh immer derjenige gewesen, auf den er sich vollkommen verlassen konnte, derjenige, dessen theologische Ansichten niemals ins Wanken geraten waren und dessen Freundschaft wirklich zählte.
»Ich werde deine Hilfe brauchen, Stuart, deine Meinung, welches Kirchenamt dafür in Frage käme.«
Der Bischof fuhr auf den Parkplatz des Restaurants und schaltete die Zündung aus. Er sah Father Tim an und nickte zustimmend. »Auch die wirst du bekommen«, versprach er.
Kapitel 2Zweifelhafte Vergnügen
KEINE GEGENLIEBE FÜR JUNGFER FRÜHLINGS ZARTEN FLIRT
Von Hessie Mayhew
Mitte Februar lockte Jungfer Frühling unsere winterlichen Geister drei Tage lang mit Winden, so lau, dass wir der Täuschung restlos erlagen, weil wir Jahr um Jahr vergessen, dass diese frivole und unbußfertige Dame uns regelmäßig zu verraten pflegt.
Im März wurde unser Stromnetz von Eisstürmen lahmgelegt! Im April waren unsere Dächer beladen mit Schnee! Am 1. Mai peitschten bitterkalte Winde durch unsere Fliederbüsche! Nur mit Schaudern mag man daran denken, was der Juni bringen wird, der gute Juni, der uns einst Rosen und Klematis schenkte!
An den Südhängen des Gebirges, wo die japanischen Kirschen schon lange ihre purpurroten Blütenblätter haben fallen lassen, müssen wir Stiefkinder des Glücks unsere karge Freude darin finden, unsere Häuser mit Zweigen voller welker Beeren zu schmücken!
Doch wie sehr sich das Herz nach dem jugendlichen Hauch Jungfer Frühlings verzehren mag, so hört diese meine inständige Bitte, auf den einen Rat, der euch, was euch in diesem irdischen Leben auch widerfahren mag, niemals im Stich lassen wird:
PFLANZT NICHT VOR DEM 15. MAI!
Hessie Mayhews alljährliche Frühlingsfurcht ... Er seufzte und warf die Zeitung auf den Boden.
Früher hatte er die Mitford Muse in zwanzig, höchstens dreißig Minuten durchgeblättert. Als er jetzt auf seine Armbanduhr sah, stellte er zu seinem Unwillen fest, dass er anderthalb Stunden auf das verflixte Ding verwandt hatte, so gefesselt von der Lektüre, als handle es sich um die Chicago Tribune.
Er hatte sogar die Annoncen studiert, etwas, das er nur selten in seinem Leben getan hatte, und sich ernsthaft für eine Kommode aus Walnussholz interessiert, die auf einem Flohmarkt in Wesley feilgeboten werden sollte.
Die Pensionierung. Das war der Bösewicht.
Er griff sich die jüngste Ausgabe des Anglican Digest von dem Tisch neben seinem Sessel und machte sich mit gesenktem Kopf darüber her.
»Die Post!«, gurrte seine Frau, die niemals glücklicher war als in dem Moment, in dem die Post durch den Schlitz in der Haustür geworfen wurde.
Und wer wäre an ihrer Stelle nicht aus dem Häuschen gewesen vor Begeisterung?, fragte er sich. Kaum ein Tag verstrich, an dem ihre treuen Leser nicht von ihrem Talent, ihrer Schönheit, ihrem Scharfsinn, ihrer Intelligenz und ihrem allgemeinen Beitrag zum Wohl der Menschheit schwärmten.
Sie setzte sich neben ihn auf das Sofa im Arbeitszimmer und machte sich an das Sortieren.
»Fanpost, Fanpost, Fanpost, Rechnung ... Rechnung, Rechnung, Fanpost, Müll, Rechnung ...« – sie stapelte, wie er bemerkte, die Rechnungen auf seinem Schoß, nicht auf ihrem – »Müll, Müll, Fanpost, Rechnung ...«
»Ta-dam, ta-dam.«
Sie hörte auf zu sortieren und riss einen Umschlag auf.
»Oh, wie schön, das ist keine Fanpost, der Brief kommt von Marion!« Marion war ihre liebe, treue Freundin aus ihrer Vertretungszeit auf Whitecap Island; Marions lange, von Neuigkeiten nur so strotzende Briefe waren stets ein Genuss für ihn.
»Ach, du meine Güte!« Sie brach in Gelächter aus.
»Was?«, fragte er.
»Ellas Bridgewaters Vogel, Louise ... erinnerst du dich an den Kanarienvogel, der dir immer ein Ständchen gehalten hat? Nun, es ist am Ende doch keine Louise, es ist ein Louis! Marion hat nicht den blassesten Schimmer, wie Ella diese überraschende Tatsache entdeckt hat, aber es ist das Gesprächsthema Nummer eins in St. John's.«
»Aha.«
»Marion geht jetzt online und möchte unsere E-Mail-Adresse haben.«
»Da kann sie lange warten.«
»Und sie und Sam lassen dich grüßen.«
»Das ist alles? Louise ist Louis, und sie lassen grüßen?«
»Das ist alles, mein Liebster, es ist diesmal nur ein sehr kurzer Brief.«
»Oh«, sagte er enttäuscht. Seine Frau nahm sich eilends anderer Dinge an und schlitzte mit ihrem Brieföffner die Lasche eines weißen Umschlags auf.
»Ach, du meine Güte«, murmelte sie, während sie las. »Hm, na ja ...« Einen Moment lang wirkte sie ein wenig traurig, dann sah sie ihn an und lächelte.
»Was ist los?«
»Man fragt mich, ob ich zusammen mit vier anderen Kinderbuchautoren und Illustratoren eine Lesereise durchs Land machen möchte.«
»Eine Lesereise durch das Land?« Bei dem Gedanken gefror ihm das Blut. Er erinnerte sich noch gut an ihre Reise nach Lansing vor einigen Jahren, wo sie in einer Schule gelesen hatte. Sie war sehr spät nach Hause gekommen, gerade als er die Polizei anrief, um eine landesweite Suche zu veranlassen.
»Innerhalb eines Programms namens READ«, sagte sie und warf noch einen Blick auf den Brief, »ein Akronym für Readers Earn Author's Day. Mal sehen ... hm ... was für eine großartige Idee. Mehrere Schulen veranstalten einen Wettbewerb, bei dem es darum geht, viele Bücher zu lesen, und diejenigen, die das Ziel erreichen oder übertreffen, werden zu einer Lesung von Davant-Preisträgern eingeladen. Die Einnahmen daraus sollen einem Alphabetisierungsprojekt vor Ort zugute kommen, und sieh nur ... die anderen Autoren sind meine Lieblingsautoren!«
Ihr Strahlen machte ihm Angst.
»Aber ...«
»Aber ich kann natürlich nicht mitfahren«, sagte sie.
»Und warum nicht?«
»Weil die Reise am 1. August beginnt und wir zu diesem Zeitpunkt in Tennessee sein werden.«
»Richtig!« Eine Woge der Erleichterung durchflutete ihn. »Natürlich!« In weniger als zwei Monaten würden sie nach Tennessee fahren, um zu der Gruppe Our Own Backyard – Im eigenen Hinterhof – zu stoßen, dem Missionsprojekt, um das sie lange gebetet hatten. Dooley wollte dann nach dem ersten Jahr am College einige Tage bei ihnen in Mitford verbringen, bevor er für den Rest des Sommers nach Meadowgate fuhr, um in Hal Owens Tierarztpraxis zu arbeiten.
Anschließend würden Father Tim und Cynthia ihren einjährigen Dienst bei OOB antreten. Die Idee zu diesem Projekt, das von Stuart Cullen herzlich unterstützt wurde, war von Pfarrer Roland entwickelt worden, dessen Nachforschungen verblüffende Wahrheiten über das Ausmaß von Armut und Not in dem Gebiet um Jessop in Tennessee aufgedeckt hatten. Dort würden sie Alkohol- und Drogenmissbrauch vorfinden, Gewalttätigkeit, schwerwiegende medizinische und zahnmedizinische Probleme, nichtmotorisierte Familien, ungepflasterte Straßen und eine hohe Rate von vorzeitigen Schulabgängern – kurzum, es war ein Gebiet, das starke Ähnlichkeit mit Mitfords Creek-Siedlung vor der Umwandlung zu einem Einkaufszentrum aufwies.
Es würde ein einfacher Dienst sein, und was ihn betraf, gehörte das zu den wesentlichen Anreizen dort. Zusammen mit Pfarrer Roland und einem jungen Priester aus Kentucky sowie dessen Frau würden sie in der abgelegenen Gemeinde unter ganz ähnlichen Bedingungen leben wie die anderen Bergfamilien; nur dass sie jeden Nachmittag die Türen ihrer Häuser allen jungen Leuten öffnen würden, die kommen wollten. Es würde Kunst und Gesangskurse geben, biblische Geschichten und Bücher, Essen und Spiele – ein sicherer Ort, ein guter Ort; und sonntags würden er und zwei andere Pfarrer in verschiedene, weit auseinanderliegende Missionskirchen gehen, die während des letzten Jahrhunderts von engagierten anglikanischen Bischöfen gegründet worden waren. Und dort würden sie dann die Messe lesen und predigen.
Der Umzug selbst sollte der Inbegriff der Schlichtheit werden: Sie würden Küchengeräte, eine Rolle Moskitonetze, fünf Koffer, vier Kissen und einen Haufen Decken in den Mustang laden. Sechsunddreißig Pfund Künstlerutensilien und zweihundert Bücher wollten sie sich von einer Spedition bringen lassen. Bei ihrer Ankunft würden sie es sich in einer spärlich möblierten Blechhütte mit betoniertem Boden gemütlich machen.
Seine Frau war erbleicht, als er ihr von der Blechbaracke erzählt hatte, und als die Rede auf die Betonfußböden kam, hätte sie das Ganze um ein Haar abgeblasen.
»Aber«, hatte sie gesagt, »es geht nicht um Betonböden.«
Er tätschelte ihre Hand, in der sie den Brief hielt. Es tut mir leid, hätte er gern gesagt, sagte es jedoch nicht. Und es tat ihm wirklich leid, denn es gab für ihn nichts Schöneres, als mit anzusehen, wie seine Frau auf ihre eigene Art dem Leben etwas zurückgab, eine Art, die nichts damit zu tun hatte, dass sie die Frau eines Pfarrers war.
Er blickte in ihr ernstes Gesicht und schämte sich seiner Gefühle. Er war unaussprechlich eigensüchtig; tief in seinem Innern wusste er es, und nein, er würde ihr das niemals gestehen können, nicht in tausend Jahren.
Im Blumenladen von Mitford bat er Jena Ivey um ein Dutzend Rosen; langstielig, ohne Drähte, Farn oder Schleierkraut, in einer mit grünem Papier ausgelegten Schachtel und mit einem rosafarbenen Seidenband drum herum.
»Oh, ich erinnere mich, wie sie ihre Rosen am liebsten mag!« Jena sah ihm lächelnd in die Augen. »Und es ist eine Ewigkeit her, seit Sie es das letzte Mal getan haben.«
Er errötete. Er litt noch immer an der dunklen Erkenntnis, dass er eine verzweifelte Angst davor hatte, von seiner Frau getrennt zu sein. Diese Angst machte ihn plötzlich schwach und zerbrechlich wie ein Kind. All die Jahre allein, ein Junggeselle, der sich nur selten nach der wärmenden Liebe einer Frau gesehnt hatte, und jetzt ... er war ein Mann, besessen von einer furchtbaren Mischung aus Angst und Demütigung angesichts des Ausmaßes seiner Zuneigung.
»Machen Sie ...« Er hatte einen großen Frosch im Hals. »Machen Sie zwei Dutzend draus!«
Jena blinzelte ungläubig. Nur ein einziger Mann in Mitford hatte je zwei Dutzend Rosen auf einen Schlag gekauft, und das war Andrew Gregory, der Bürgermeister. Wann immer er und seine Frau Hochzeitstag hatten, eilte Mr Gregory in den Blumenladen und legte das Geld auf den Tisch, ganz gleich, wie hoch der Tagespreis war.
»Aber Reverend! Cynthia wird denken ... sie wird denken, Sie wären übergeschnappt!«
Er zwang sich zu einem Grinsen. »Und sie hätte recht damit«, sagte er.
»Tim?«
Es war John Brewster, der Direktor des Kinderkrankenhauses in Wesley.
»Am Apparat. Wie geht es Ihnen denn so?« – »Es könnte mir überhaupt nicht besser gehen. Ich habe nämlich ganz großartige Neuigkeiten.«
»Ich kann gar nicht genug bekommen von großartigen Neuigkeiten!«
»Wir haben endlich die Mittel aufgetrieben, um jemanden einstellen zu können, jemanden, der stark und clever ist und der sich außerdem darauf versteht, unsere Spender zum Spenden zu ermuntern – die Art Person, die hier in der Gegend wirklich etwas ausrichten kann.«
»Wunderbar! Das ist schon lange fällig.«
»Sehr lange, und ich möchte Sie bitten, die Position in Erwägung zu ziehen.«
Ein kurzes Schweigen folgte.
»Die Einzelheiten können wir später besprechen. Sie sind genau der Richtige für den Job. Tim – Sie sind ein Geschenk des Himmels, wenn Sie mich fragen. Ich hoffe, Sie werden ja sagen.«
»Ah.« Er war seltsam erschüttert. Ja, das war etwas, das er gern getan hätte und das zu tun sehr lohnend gewesen wäre. Aber ...
»Es ist zu spät«, antwortete er dem Direktor. »Ich bin kürzlich eine Verpflichtung eingegangen; Cynthia und ich werden nach Tennessee fahren, um dort an einem Kinderhilfsprogramm mitzuarbeiten. An den Wochenenden werden wir zwar meistens nach Mitford zurückkommen, aber ...«
»Es ist mir grässlich, das zu hören.«
Er fand, dass John so klang, als würde er gleich in Tränen ausbrechen.
»Ich bin furchtbar enttäuscht. Wir waren uns alle einig, dass ich Sie sofort anrufen soll. Besteht auch nur die geringste Chance, dass diese andere Geschichte ... dass sie sich zerschlagen könnte?«
»Ich glaube nicht. Es tut mir auch sehr leid, ich hätte gern ...«
John seufzte. »Hm, dann müssen wir eben noch einmal ganz von vorn anfangen und überlegen, wer sonst noch für die Position geeignet sein könnte. Ah, nun ja. Verflixt.«
Der Direktor wirkte ehrlich erschüttert.
Das ist doch kein Weltuntergang, hätte er gern gesagt.
»Es war sehr freundlich von Ihnen, mir das Angebot zu machen, John, ich fühle mich wirklich geschmeichelt.«
Und das war die Wahrheit. Als er den Flur hinunter zu Cynthias Atelier ging, federte sein Schritt wie nur selten. Dann setzte er sich auf ihr kleines Sofa und erzählte ihr, was sie soeben abgelehnt hatten.
Sie setzte sich auf seinen Schoß, küsste ihn auf den Kopf und umarmte ihn wortlos.
Lieber Stuart,
mir ist soeben etwas eingefallen, das Mahatma Gandhi einmal gesagt hat: »Zuerst lachen sie dich aus, dann kämpfen sie gegen dich, dann siegst du.«
Mit brüderlichem Gruß,
Timothy
»Reverend!«
Hélène Pringle kam über die Einfahrt in den Garten des gelben Hauses geflitzt. Er bemerkte mit einiger Zuneigung, dass sie auf und ab hüpfte, wenn sie flitzte, ähnlich einem jungen Hasen auf offenem Feld.
Sie hielt ein Päckchen in Händen, das sie ihm nunmehr in die Hände legte. »Brot!«, rief sie, ein wenig außer Atem. »Frisch gebacken. Ich hoffe, es wird Ihnen und Cynthia schmecken.«
»Vielen Dank, Hélène!«
Die verlockende Wärme des Brotlaibs drang durch die braune Tüte.
»Ich hätte gute Lust, es auf der Stelle aufzuessen!«
Seine Nachbarin lachte mit kindlicher Erheiterung. Was für eine Verwandlung diese zierliche, einst so zaghafte Französin durchgemacht hatte, die vor zwei oder drei Jahren von Boston hergekommen und in das Haus nebenan gezogen war. Er dachte inzwischen kaum noch daran, aber ihre Bekanntschaft hatte einen ausgesprochen ungünstigen Anfang genommen – Hélène hatte nicht nur eine wertvolle Bronzestatue von seinem Kaminsims gestohlen, sondern ihn auch auf eine große Summe Geldes verklagt –, und das alles, während sie in seinem Haus gewohnt hatte. Gott sei Dank hatte er seine Anklagen fallen lassen, auch sie hatte von einem Prozess abgesehen, und jetzt hatten er und Cynthia die beste Nachbarin auf Gottes grüner Erde. Ja, Hélène Pringle hatte ihre Flügel gespreizt und sich zu einer anmutigen Frau gemausert.
»Es wird langsam wärmer!«, bemerkte er im Hinblick auf das Wetter und war dankbar, solche Worte aus seinem Mund zu hören.
»Oui! J'adore le printemps! Oh, entschuldigen Sie bitte, Reverend. Wenn ich aufgeregt bin, spreche ich immer französisch!«
»Ich habe gestern Françoise besucht, sie wirkt stark und glücklich.« Es war Hélène gelungen, ihre Mutter aus Boston herzuholen und im Haus der Hoffnung unterzubringen, wo sie, obwohl es wegen ihrer Herzkrankheit verschiedentlich Komplikationen gegeben hatte, langsam aufblühte.
»Mutter freut sich immer so über Ihre Besuche, Reverend, und ich kann Ihnen gar nicht genug danken für all das, was Sie und Cynthia für uns tun. Eines Tages, das verspreche ich, werde ich es Ihnen mit irgendetwas wiedergutmachen, das mehr ist als nur eine Kleinigkeit. Absolument!«
»Verschwenden Sie keinen Gedanken daran! Uns ist es mehr als genug Lohn, Ihr Glück beobachten zu dürfen.«
»Drei neue Schüler, Reverend! Das macht jetzt fünfzehn, und ich glaube, mehr darf ich nicht annehmen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so etwas sagen würde.« Hélène warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Ça, par exemple! Es ist fast schon Zeit für Sophie Horthornes Klavierstunde, die um elf beginnt.«
Hélènes Klavierunterricht hatte Mitford eine angenehme neue Dimension geschenkt. Er war persönlich stolz auf ihren Erfolg, obwohl er nicht das Geringste damit zu tun gehabt hatte.
»Bitte, holen Sie sich Ihre Rosen, wenn sie blühen, Reverend. Ich muss Ihnen noch einmal sagen, wie dankbar ich dafür bin, im Haus eines Gärtners leben zu dürfen! Nun, à bientôt!«
»Au revoir, Hélène! Oh, und merci!« Er schätzte, dass sein französischer Wortschatz jetzt sagenhafte zehn oder zwölf Vokabeln umfasste.
Sie winkte ihm noch einmal fröhlich zu, dann flitzte sie zurück über die Einfahrt, den Rasen des Pfarrhauses und dann ihre Treppe hinauf.
Er lächelte. Wirklich wie ein Hase!
Als er durch die Haustür in den Flur trat, bemerkte er, dass seine Frau am Wohnzimmerfenster stand.
»Ich habe dich mit Hélène reden sehen. Es sah aus, als wollte sie dich am liebsten an Ort und Stelle mit Haut und Haaren auffressen!«
»Du hast mir nachspioniert!«, rief er.
»Stimmt, Liebling, aber nur, weil ich gerade einen Fleck von der Fensterscheibe gewischt hatte. Ich glaube, sie ist verrückt nach dir, aber das bewegt sich natürlich alles innerhalb der Grenzen des Anstands.«
Er fand, dass Cynthias Augen genau die Farbe der Wegwarte hatten, die jetzt bald überall um Mitford herum blühen würden. Er legte das Brot auf einen Stuhl, lief auf sie zu und nahm sie in die Arme. »Warum um Himmels willen solltest du eifersüchtig sein?«
Er lachte, als er das sagte, aber er wollte es wirklich wissen, musste es wissen; plötzlich wünschte er sich nichts sehnlicher, als dass sie etwas sagte, was ihn aus den Socken hauen würde. Sie verstand sich sehr gut auf dergleichen ...
»Aber ich bin doch überhaupt nicht eifersüchtig!«
»Ach nein?«
»Natürlich nicht. Hélène ist eine zauberhafte Frau, die kaum je einen anständigen Mann kennengelernt hat, bevor sie ihrem Nachbarn begegnete. Genauso habe ich empfunden, als ich anfing, durch die Hecke zu huschen.«
Ah. Durch die Hecke huschen. Das war der modus operandi in der Zeit ihrer Werbung gewesen; allein bei der Erwähnung der Hecke stiegen ausgesprochen wehmütige Erinnerungen in ihm auf.
»Außerdem, Timothy, weiß ich ja, dass du mich lieben wirst, bis dass der Tod uns scheidet – und danach bis in alle Ewigkeit.«
Sie schlang ihm die Arme um den Hals, und er küsste sie zärtlich und sog ihren warmen Duft ein.
Aber seit sie das Thema aufgebracht hatte, wünschte er sich doch, sie wäre eifersüchtig – wenn auch nur ein ganz klein wenig.
Er rückte mit seinen Neuigkeiten heraus, als sie am Küchentisch saßen.
»Nicht schon wieder!«, jammerte Puny. »Sie sind doch gerade erst weg gewesen, ich mag nicht einmal darüber nachdenken, dass Sie schon wieder weggehen!«
»Es ist doch nur für ein Jahr«, sagte er und kam sich vor wie ein Verräter.
»Ja, Sir, mir kommt's so vor, als hätten wir uns grad erst wieder berappelt, seit Sie das letzte Mal auf und davon sind«, sagte Harley. Harley Welch war sein Freund, sein Faktotum, sein Bruder im Herrn und sein Nachbar, der in Hélènes Kellerwohnung lebte.
»Wir werden mit Kindern arbeiten, die durch ihre Lebensumstände furchtbar verletzt wurden«, erklärte Cynthia. »Es ist ein wunderbares Programm, das Familien helfen wird, Heilung zu finden.«
»Aber Sie haben doch auch hier in Mitford Kinder«, sagte Puny, die sichtlich Mühe hatte, sie zu verstehen. »Ich meine, sie sind natürlich nicht wirklich verletzt oder irgendetwas, selbst wenn ich Sassy neulich furchtbar verhauen habe, weil sie mit Streichhölzern gespielt hat.«
Punys rothaarige Zwillinge, Sissy und Sassy, waren seit ihrer Geburt ein Teil des Kavanaghschen Haushalts gewesen. Jetzt kamen sie für gewöhnlich jeden Tag auf dem Heimweg von der zweiten Klasse der Mitforder Schule in das gelbe Haus zurück.
Father Tim sah zu Cynthia hinüber, die die niedergeschlagene Reaktion auf ihre Neuigkeiten offenkundig ernüchtert hatte. Hatten sie nicht jedes Recht, zu tun, was immer sie wollten? Hatten sie nicht die Freiheit verdient, Gottes Plan für ihr Leben zu verfolgen? Und hier hingen nun zwei Unterlippen förmlich bis zum Fußboden hinunter.
Harley schüttelte den Kopf und seufzte.
»Also, hört zu!«, sagte Father Tim mit seiner Kanzelstimme.
Aha! Das war der richtige Ansatz, damit zog er ihre Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt hieß es verkünden, nicht bitten oder verhandeln.