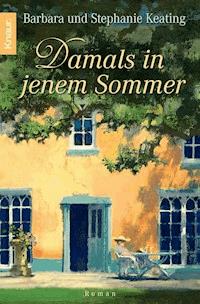
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Tochter entdeckt das Geheimnis im Leben ihres verstorbenen Vaters und stößt dabei auf eine Liebe, die keine Grenzen kannte ... Bei der Testamentseröffnung von Richard Kirwan erfahren seine drei Kinder, dass sie eine Halbschwester, Solange, in Frankreich haben. Diese reagiert auf die Mitteilung ebenso entsetzt wie die Kirwan-Geschwister. Ihr bisher klares Leben mit dem Mann, den sie voller Liebe 'Papa'; nennt, ist plötzlich voller Ungewissheiten. Sie beschließt, ihre Halbgeschwister in Irland einfach zu vergessen. Doch so einfach läßt sich das alles nicht beiseite schieben. Vor allem Richards älteste Tochter Eleanor will wissen, warum der Vater diese Seite seines Lebens verheimlicht hat. Dabei erfährt sie von Schicksalen voller Leidenschaft und Entsagung und davon, dass Liebe oft von Grenzen, Krieg, Frieden und Zeit unberührt bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Barbara Keating / Stephanie Keating
Damals in jenem Sommer
Roman
Aus dem Englischen vonKarin Dufner
Knaur e-books
Über dieses Buch
Bei der Testamentseröffnung von Richard Kirwan erfahren seine drei Kinder, dass sie eine Halbschwester, Solange, in Frankreich haben. Schockiert und verletzt, reagieren sie abweisend auf die schwerwiegende Neuigkeit. Doch dann entschließt sich Eleanor, die Älteste, dazu, mit der unbekannten Schwester Kontakt aufzunehmen. Solange ist ebenso entsetzt wie die Kirwan-Geschwister. Ihr bisher klares Leben mit dem Mann, den sie liebevoll »Papa« nennt, ist plötzlich voller Ungewissheiten. Sie beschließt, ihre Halbgeschwister in Irland einfach zu vergessen. Doch so einfach lässt sich das alles nicht beiseite schieben. Denn Eleanor bohrt weiter; sie will wissen, warum der geliebte Vater diese Seite seines Lebens verheimlicht hat. Sie bedrängt ihre Mutter Helena, befragt den Onkel Seamus, reist zu Solanges Großmutter nach Frankreich – und erfährt dabei von Schicksalen voller Leidenschaft und Entsagung, voller Trauer, Entbehrungen und Unmenschlichkeit, voller Mut und Mitmenschlichkeit. Vor allem aber lernt sie, dass die Liebe Grenzen, Krieg, Frieden und Zeit überwinden kann.
Mit Damals in jenem Sommer
Inhaltsübersicht
Für Rory und Norman
Kapitel 1
Dublin, 1970
Glenveigh Lodge,
Killiney, Dublin
20. Februar 1970
Liebe Solange de Valnay,
da wir uns nicht kennen, bin ich unsicher, wie ich Sie ansprechen soll; ich halte es jedoch für meine Pflicht, mich persönlich an Sie zu wenden. Ich heiße Eleanor Kirwan und bin die älteste Tochter von Richard und Helena Kirwan, falls Ihnen diese Namen etwas sagen.
In dieser Woche ist mein Vater nach langer Krankheit verstorben. Es war ein Schock für mich, bei der Testamentseröffnung erfahren zu müssen, dass er außer den zu erwartenden Hinterlassenschaften an seine Witwe, seine beiden Töchter und seinen Sohn zwei Wochen vor seinem Tod einen Passus hat hinzufügen lassen:
»Meiner Tochter in Frankreich, Solange de Valnay, Domaine de Valnay, St. Joseph de Caune, Languedoc, vermache ich den Rest meines Vermögens.« Meiner Tochter in Frankreich – eine weitere Erklärung fehlte.
Verzeihen Sie, Solange, dass ich auf diese Weise mit der Tür ins Haus falle, aber bis heute ahnten wir alle nichts von Ihrer Existenz und sind noch immer ziemlich bestürzt. Ich weiß nicht, ob Sie über die Krankheit Ihres – oder unseres – Vaters beziehungsweise seinen Tod im Bilde waren. Zunächst wollten wir Sie durch unsere Anwälte verständigen lassen, doch dann erschien es uns grausam, Ihnen auf diesem unpersönlichen Weg Bescheid zu geben.
Mein Zwillingsbruder James wies auf die gesetzliche Möglichkeit hin, dieses Testament anzufechten. Da er Anwalt ist, war das in dieser Situation natürlich sein erster Gedanke. Elizabeth, meine jüngere Schwester, ist erschüttert und kann es nicht fassen, dass Vater Sie uns all die Jahre verheimlicht hat. Sie wird eine Weile brauchen, die Enttäuschung zu verarbeiten, schließlich ist sie erst neunzehn.
Wie lange hat er dieses Geheimnis bewahrt? In seinem Testament erwähnt er weder Ihr Alter noch spricht er von Ihrer Mutter. Doch als ich hörte, wie Ihr Name vorgelesen wurde, kam er mir seltsam vertraut vor, so als würde ich Sie bereits kennen. Klingt das nicht merkwürdig? Ich habe versucht, Sie mir vorzustellen und mir auszumalen, was für ein Mensch Sie sind und wie Sie aussehen.
Anfangs war ich, wie ich zugeben muss, ebenso schockiert wie meine Geschwister. Unsere Blicke ruhten gespannt auf Mutter, doch sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, der uns immer wieder in Erstaunen versetzt. Mutter ist eine landesweit und international bekannte Malerin. Ohne mit der Wimper zu zucken, bedankte sie sich bei dem Anwalt und wartete, bis er gegangen war. Sie war es auch, die mir den Vorschlag machte, Ihnen zu schreiben, und ich frage mich, ob sie vielleicht all die Jahre Bescheid wusste oder Sie sogar kennt. Doch das kann ich nicht sagen. Mutter hat sich in ihr Atelier zurückgezogen und möchte nicht gestört werden.
Den ganzen Abend sitze ich schon in Vaters Arbeitszimmer an seinem Schreibtisch und grüble darüber nach, was ich Ihnen schreiben soll. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob ich diesen Brief überhaupt abschicken werde. Oder ob Sie, wenn er bei Ihnen eintrifft, wünschen werden, Sie hätten ihn nie erhalten. Möglicherweise sprechen Sie ja gar kein Englisch. Ich kann nur hoffen, dass Sie nicht gezwungen sein werden, jemanden zu bitten, Ihnen den Brief zu übersetzen. Wahrscheinlich möchte ich trotz meiner Trauer und Ratlosigkeit am liebsten die Hand ausstrecken und eine mir bislang unbekannte Welt entdecken. Mein Vater war ein komplizierter Mensch und konnte manchmal recht rätselhaft sein. Aber ich liebte ihn sehr, und vielleicht haben Sie ihn ja auch geliebt.
Deshalb, Solange de Valnay, werde ich diesen Brief zur Post bringen, in der Hoffnung, dass Sie dadurch etwas über einen Teil seines Lebens erfahren, den Sie bis jetzt nicht kannten. Falls Sie beschließen, mir nicht zu antworten, werde ich mich damit abfinden müssen. Aber Sie sind meine unbekannte Schwester – zumindest meine Halbschwester –, und darüber kann man nicht einfach hinweggehen.
Ich lege eine Kopie des Testaments bei. Mit allen guten Wünschen, herzlichem Beileid und
freundlichen Grüßen
Eleanor Kirwan
Eleanor las den Brief noch einmal durch. Es war ihr fünfter Versuch. War das Schreiben im Ton zu vertraulich? Handelte es sich bei Solange de Valnay um eine erwachsene Frau oder um ein Kind? Und warum wurde nirgendwo die Mutter erwähnt? Eleanor lehnte sich in dem Ledersessel am Schreibtisch ihres Vaters zurück, der aus Walnussholz bestand. Sie hatte die Maserung dieses Holzes und seinen warmen, goldenen Schimmer schon immer geliebt. Jeder Kratzer hatte eine Geschichte – die Geschichte ihrer Familie. Die Szene, die sich vorhin im Arbeitszimmer abgespielt hatte, stand Eleanor noch deutlich vor Augen. Mr. McCann, der Familienanwalt, hatte stirnrunzelnd und mit finsterer Miene den Zusatz zu dem Testament verlesen. Elizabeth war leichenblass geworden und hatte zu zittern begonnen, während James empört aufgesprungen war. Er hatte versucht zu verbergen, wie gekränkt er sich fühlte.
»Es ist eine Schande! Das kommt überhaupt nicht in Frage!«, hatte er gebrüllt. »Mein Vater kann kein weiteres Kind gehabt haben, ohne dass wir je davon gehört hätten! Wo sind die Beweise? So etwas lässt sich vor Gericht anfechten!«
In dem beklommenen Schweigen, das darauf folgte, starrte Mr. McCann auf die Schreibtischplatte; das steife Papier des Testaments knisterte zwischen seinen Fingern. Helena Kirwan saß stocksteif und mit gesenktem Kopf da. Als sie den Blick hob, zeigten sich Schmerz und Mitgefühl in ihrem Gesicht, und da war auch noch ein anderer Ausdruck, den Eleanor nicht deuten konnte. »Du musst ihr schreiben, Liebes.«
Dann hatte sie auf dem Absatz kehrt gemacht und darauf vertraut, dass Eleanor für Ruhe und Vernunft sorgen würde. Durch die Tür ihres Ateliers klang Beethoven. Arbeitete sie? Oder schwelgte sie nur in Erinnerungen?
Die Erkenntnis ließ Eleanor zusammenfahren. Ihre Mutter war zwar traurig, aber nicht überrascht gewesen. Sie hatte es gewusst, da war Eleanor sich inzwischen ganz sicher. Helena hatte von der Existenz dieses Kindes, dieser »Tochter in Frankreich« gewusst – auch wenn sie über den Zusatz zum Testament nicht im Bilde gewesen sein mochte. Aber warum hatte sie ihre Kinder nicht auf diese Enthüllung vorbereitet? Und warum war sie danach einfach hinausgegangen und hatte sie mit der bestürzenden Erkenntnis allein gelassen, dass ihr Vater ein Doppelleben geführt hatte?
Nun hatte Eleanor die schier unüberwindliche Hürde bezwungen, sich mit Solange in Verbindung zu setzen. Die ersten Wörter waren die schwierigsten gewesen. »Liebe Solange de Valnay«. Eleanor zog eine Schublade auf, entnahm ihr einen Umschlag und suchte nach einer Briefmarke. Sie würde den Brief so abschicken, wie er war; es war zwecklos, noch weiter daran herumzufeilen. Solange würde sie alle früh genug kennen lernen. Sie steckte den Brief und die Kopie des Testaments in den Umschlag, stand auf und ließ den Brief auf dem Schreibtisch liegen. Dann ging sie zum Fenster, öffnete die Vorhänge und lehnte den Kopf gegen die kühle Scheibe. Autoscheinwerfer krochen unter ihr die schmale Bergstraße entlang, Straßenlaternen erstreckten sich wie leuchtende Nadelstiche von Howth Head bis zum dunklen Kegel des Sugar Loaf Mountain. Die Nacht war frostig kalt; der Mond schwebte tief über dem Meer und tauchte die Wellen, die an den steinigen Strand schlugen, in silbriges Licht. Eleanor erinnerte sich, wie sie mit ihrem Vater in so einer Nacht vor nicht allzu langer Zeit über die glatten, rund geschliffenen Steine gewandert war.
»Wo bist du in all den Jahren wirklich gewesen, Vater?«, flüsterte sie. »Wer warst du? Haben wir dich eigentlich gekannt?«
Trauer ergriff sie, und sie ertappte sich dabei, wie sie mit den Fingernägeln über die Scheibe fuhr. Sie sehnte sich nach Beistand von Seamus, dem Zwillingsbruder ihrer Mutter, der sie durch dieses Minenfeld hätte führen können. Doch der war weit weg in den Bergen von Nepal und wusste nicht einmal von Richards Tod.
»Oh, Vater, Vater! Warum hast du uns das angetan? Wie konntest du nur?«
Kapitel 2
St. Joseph de Caune, 1970
Solange de Valnay durchquerte lautlos die Vorhalle und öffnete die Tür der Bibliothek. Das Gesicht warm von der Wintersonne, döste ihr Vater in einem Sessel. Lächelnd schlich Solange hinaus und trat in den hellen Nachmittag. Die Hunde kamen angelaufen und tollten voran, um im Gebüsch und am Flussufer nach Beute zu jagen. Die lange Auffahrt wurde von alten Platanen gesäumt, deren Winterzweige verglichen mit ihren dicken Stämmen noch dürrer und kahler wirkten. Braune, unbelaubte Weinberge erstreckten sich in alle Richtungen bis zum Gebirge. Solange atmete die kalte Luft und den Geruch von Holzfeuern und Pinien ein. Als sie innehielt, um die kunstvoll verschlungenen Weinreben zu betrachten, blieben die Hunde ebenfalls stehen und blickten sich ungeduldig nach ihr um. Solange ging am Briefkasten vorbei und schlenderte den Fluss entlang. In den Weinbergen waren einige Arbeiter damit beschäftigt, die Zweige zu beschneiden und hochzubinden.
Sie setzte sich auf einen Baumstamm neben dem Wasserfall und empfand eine Zufriedenheit, die fast ein wenig schlechtes Gewissen in ihr auslöste. Bald würde Guy nach Hause kommen, und dann würden sie einen Termin für ihre Hochzeit festsetzen müssen. Das hieß nicht, dass Solange ihn nicht vermisste. Schließlich teilten sie beide die tiefe Zuneigung zu diesem Haus, das Zeuge ihrer ersten Liebesschwüre geworden war. Doch in Wahrheit genügte es ihr völlig, hier mit ihrem Vater allein zu sein, ihm bei seiner Korrespondenz zu helfen, mit Joël die Weinreben zu pflegen und die Hunde auszuführen. Ihr Leben verlief in einer gemächlichen Gleichförmigkeit, an der sich eigentlich nichts zu ändern brauchte. Solange grübelte darüber nach, warum sie ihren Verlobten vermisste und sich gleichzeitig wohl fühlte, wenn er abwesend war. Sie betrachtete das rasch dahinströmende Wasser und hatte den Eindruck, dass ihre Kindheit in Windeseile den Fluss hinabgetragen wurde und sich ihrem Zugriff für immer entzog. Der Nachmittag schien plötzlich kalt geworden zu sein. Schaudernd stand sie auf, zog die Jacke enger um sich und rief nach den Hunden. Am Tor des alten Hauses öffnete sie den Briefkasten und nahm die Post heraus.
Domaine de Valnay,St. Joseph de Caune, Frankreich20. März 1970
Liebe Eleanor,ich habe Ihren Brief vom 20. Februar schon vor einer Weile erhalten; es folgte ein formelles Schreiben Ihres Anwalts. Die Erbschaft hat mich bestürzt und ratlos gemacht, auch deshalb, weil ich mit den Menschen, die mir am meisten bedeuten, nicht darüber sprechen kann. Seitdem versuche ich zu begreifen, dass ein völlig Fremder namens Richard Kirwan mein Vater gewesen ist.Meine erste Reaktion war, mich zu fragen, wie ein Mensch so selbstsüchtig sein kann, das Leben zweier Familien auf den Kopf zu stellen, ja, sogar zu zerstören, und in dem Wissen, dass er die Folgen nie zu spüren bekommen wird. Bis zu jenem Nachmittag im Februar wusste ich fast nichts über Richard Kirwan, obwohl meine Mutter erwähnte, sie habe ihn während des Krieges in Paris kennen gelernt. Sie sagte, es sei seinem Einfluss zu verdanken, dass sie fest entschlossen gewesen sei, mich Englisch lernen zu lassen. Außerdem habe er sie angeregt, viele literarische Werke in englischer und französischer Sprache zu lesen. Als ich ein Kind war, schenkte sie mir Bücher in beiden Sprachen.Es war nicht leicht, in unserer Gegend jemanden zu finden, der mir Englisch beibringen konnte. Doch meine Mutter trieb einen englischen Schriftsteller auf, der in der Nähe wohnte, und überredete ihn, mich zu unterrichten, auch wenn er nicht sehr begeistert von der Vorstellung war, ein widerspenstiges Kind als Schülerin in seinem Haus zu empfangen. Doch durch Cedric Swann lernte ich, Englisch zu lesen und zu schreiben wie meine zweite Muttersprache.Da Sie in Ihrem Brief nach meiner Mutter fragen, möchte ich Ihnen ein wenig über sie und den Mann, den ich bis vor kurzem für meinen Vater gehalten habe, erzählen. Es ist seltsam, dass ich über meine Eltern in einem Moment schreibe, in dem mir klar geworden ist, wie wenig ich eigentlich über sie weiß.Meine Mutter wurde als Celine Marie France de Savoie im April 1916 in Paris geboren. Mein Großvater, ein Arzt und Dozent an der medizinischen Fakultät, starb 1941. Nach ihrem Schulabschluss studierte meine Mutter Medizin an der Sorbonne. Im Winter 1945 heiratete Celine de Savoie in Paris Henri de Valnay, und im folgenden Jahr zog das junge Paar nach Languedoc. Die Ehe zwischen der schönen, gebildeten Braut und dem angesehenen jungen Mann aus guter Familie, die über Immobilienbesitz in Paris und große Weingüter im Süden verfügte, galt als ausgezeichnete Partie. Ich wurde nach einer schwierigen Schwangerschaft zu früh geboren und blieb ein Einzelkind. Und wenn Sie nachrechnen, werden Sie wissen, dass ich inzwischen vierundzwanzig bin. Meine Mutter praktizierte in unserem Dorf als Ärztin und war sehr beliebt. Vielleicht wurde sie in Richard Kirwans Testament nicht erwähnt, da er wusste, dass sie Anfang letzten Jahres verstorben ist. Papa vermisst sie sehr. Er ist seit vielen Jahren blind.Nun verstehen Sie vermutlich, in was für einer unangenehmen Lage ich mich befinde. Ich habe keine Ahnung, ob Papa über Richard Kirwan Bescheid weiß, und ich bin völlig ratlos, wie ich dieses Thema ihm gegenüber zur Sprache bringen soll. Er vergötterte meine Mutter, und ich möchte nicht, dass sein Andenken an sie Schaden nimmt. Falls er ahnte, dass ich nicht seine leibliche Tochter bin, hat er sich das nie anmerken lassen und war mir stets ein ausgesprochen liebevoller Vater. Meine Großmutter, Charlotte de Savoie, lebt noch in Paris. Ich kann nicht sagen, ob sie all die Jahre lang über das Geheimnis meiner Mutter informiert war. Was meine eigenen Gefühle für meine Mutter angeht, muss ich zugeben, dass sie ziemlich durcheinander geraten sind.Ich bin nicht sicher, was jetzt von mir erwartet wird, und ich bin immer noch dankbar, dass ich allein war, als ich diese Nachricht erhielt. Allerdings ändert das nichts an meiner Wut und dem Unwohlsein, mit dem ich jeden Morgen aufwache. Bis jetzt habe ich ein geregeltes Leben geführt, und nun steht alles Kopf. Ich werde bald heiraten, doch mein Verlobter hält sich zurzeit in Übersee auf, und ich weiß nicht, wie ich ihm diese Situation erklären soll. Ich habe nicht den Wunsch, Ihre Familie persönlich kennen zu lernen, zudem zweifle ich an dem Sinn eines solchen Unternehmens.Ich weiß den Mut und die Freundlichkeit, die Sie mir – einer unbekannten und sicher auch unerwünschten Halbschwester – in Ihrem Schreiben entgegengebracht haben, zu schätzen. Allerdings halte ich es für wenig ergiebig, unseren Briefkontakt fortzusetzen, obwohl ich nicht leugnen kann, dass zwischen uns eine Verbindung besteht. Vielleicht werde ich meine Großmutter in Paris besuchen, um mit ihr darüber zu sprechen. Doch im Augenblick möchte ich dieses unglückselige Geheimnis ruhen lassen. Noch einmal vielen Dank für Ihren Brief. Bitte lassen Sie mich Ihnen und Ihrer Familie in dieser schweren Zeit alles Gute wünschen. Er hatte großes Glück, dass er so geliebt wurde.
Solange de Valnay
Solange schloss die Augen. Sie fühlte sich müde und ausgelaugt. So oft hatte sie den Brief gelesen, dass sie ihn inzwischen fast auswendig aufsagen konnte. Natürlich hätte sie noch einiges daran verbessern können, aber sie hatte mittlerweile weder den Mut noch das Bedürnis, länger darüber nachzugrübeln. Dass sie das Schreiben überhaupt beantwortete, erschien ihr wie Verrat, wie Komplizenschaft am Betrug ihrer Mutter. Sie hatte die bekritzelten Seiten einige Male zerrissen. Dann aber hatte sie daran gedacht, welchen Mut Eleanor mit ihrem Brief bewiesen hatte, und auch an die Trauer der Familie in Irland. Eigentlich hatte Solange nicht so viel über ihre eigenen Familienverhältnisse erzählen wollen. Doch dann hatte ihr Stolz die Oberhand gewonnen. Anstatt Eleanor in ein paar knappen Zeilen zu danken, war ihr der eigentliche Zweck ihres Briefes bewusst geworden, nämlich, den Kirwans klar zu machen, dass sie dieses plumpe Geldgeschenk gar nicht nötig hatte.
Sie hatte schon lange nicht mehr an die Unterrichtsstunden bei Cedric Swann gedacht, und nun fragte sie sich, ob er der Vertraute ihrer Mutter gewesen war. Hatte er den wahren Grund für die Englischstunden gekannt? Solange erinnerte sich an seine Trauer bei der Beerdigung ihrer Mutter, daran, wie er stumm und bedrückt die Hände ineinander gekrampft hatte, als der Sarg, zur ewigen Ruhe gebettet, in der Erde versank, und an die Tränen, die ihm über die Wangen geflossen waren.
Dann grübelte sie wieder über die Fragen nach, die sie am allermeisten beschäftigten: Hatte sie selbst ihre Existenz nur einem unglücklichen Zufall zu verdanken? Hatte Henri de Valnay schon immer gewusst, dass sie nicht seine leibliche Tochter war? Warum hatte ihre Mutter, als sie während der langen Monate ihrer Krankheit zusammengesessen und über alle Einzelheiten ihres Lebens gesprochen hatten, sie nicht auf Richard Kirwans letzten Willen vorbereitet? Es war unvorstellbar, dass Celine nichts davon gewusst haben sollte. Solange wischte die Tränen weg, die ihr in die Augen zu steigen drohten, und stand auf. Sie war fest entschlossen, die ohnmächtige Wut abzuschütteln, mit dem Grübeln aufzuhören und etwas Sinnvolles zu tun. Also lief sie die Haupttreppe hinunter und griff nach ihren Autoschlüsseln. Im Dorf schickte sie den Brief an Eleanor Kirwan ab, indem sie ihn mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Angst in den Postkasten stopfte.
Gleich nach dem Abendessen mit Henri, das ihr endlos erschien, behauptete sie, von der Arbeit in den Weinbergen müde zu sein, und floh in ihr Zimmer. Lange lag sie in ihrem gemütlichen Bett wach und war wütend auf die heißen Tränen, die auf das Kopfkissen tropften. Endlich fiel sie in einen unruhigen Schlaf, dessen Träume von innerer Anspannung und Angst geprägt waren.
Kapitel 3
Dublin, 1970
Eleanor reichte James den Brief. Nachdem dieser ihn gelesen hatte, ging er zu dem hohen Fenster, von dem aus man Blick auf den Garten hatte. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, stand er da und starrte nach draußen auf den Rasen und die mit Kies bestreute Auffahrt. Als Eleanor ihn betrachtete, regten sich Erinnerungen. Er war das Ebenbild ihres Vaters – dieselbe Körperhaltung und derselbe Neigungswinkel des Kopfes.
»Siehst du, Jamie! Sie hat es nicht auf das Vermögen der Kirwans abgesehen, falls man es als solches bezeichnen kann. Außerdem hört es sich nicht an, als brauchte sie Geld. Offenbar ist sie ebenso gekränkt und bestürzt wie wir.«
James’ Stimme klang gedämpft, und ihr wurde klar, warum er vom Tisch aufgestanden war. Er zog ein makellos sauberes Leinentaschentuch heraus und putzte sich lautstark die Nase. »Vielleicht stimmt es gar nicht«, erwiderte er. »Sie weiß es ebenso wenig wie wir. Es könnte ja sein …«
»Ein Irrtum? Ach, das glaube ich nicht. Welchen Grund hätte er …«
»Sie ist ihm nie begegnet! Sie kennt ihn nicht.«
»Und was soll ich jetzt tun? Wir sind alle nicht besser informiert als sie.«
»Oh, da gäbe es schon jemanden, der uns weiterhelfen könnte. Warum macht sie den Mund nicht auf und verbunkert sich stattdessen den ganzen Tag in ihrem dämlichen Atelier? Kannst du sie nicht dazu bringen, mit uns zu reden und uns alles zu erklären?«
»Weshalb muss eigentlich immer ich die Kastanien aus dem Feuer holen?« Eleanor schob quietschend ihren Stuhl zurück und stand auf. »Frag sie doch selbst. Du bist genauso ihr Kind wie ich. Warum, zum Teufel, wird ständig alles auf mich abgewälzt?«
Er legte den Arm um sie und hielt ihr das Taschentuch hin. »Weil du es am besten kannst, El. Das weißt du ganz genau. Ich wirke immer so hochmütig, du weißt schon. Und Lizzie gerät ins Stottern, wenn sie einfühlsam oder diplomatisch sein soll. Mutter braucht dich. Mit dir spricht sie und dir vertraut sie. Es tut mir wirklich Leid; ich will mich nicht einfach nur vor einer schwierigen Aufgabe drücken.«
»Schon gut.« Sie war zu erschöpft, um ihm zu widersprechen. »Ich versuche, mit ihr zu reden. Bevor ich zur Arbeit gehe, muss ich ihr sowieso das Frühstückstablett bringen. Rufst du Lizzie? Sie hat um zehn Uhr Vorlesung. Vielleicht könntest du sie mit dem Auto mitnehmen.«
»Tja, ich darf nicht zu spät kommen, und sie braucht eine Ewigkeit, um sich für einen Besuch im Hörsaal so aufzutakeln, dass alle Kommilitonen ins Sabbern geraten.« Er verzog lüstern das Gesicht und lachte dann auf.
»Ach, komm schon, tu deine Pflicht. Du weißt, wie gern sie sich in deinem MG herumfahren lässt. Allein dafür wird sie sich bestimmt beeilen.« Als er etwas brummelte, ließ sie ihn stehen. Sie war froh, dass er sie zum Lächeln gebracht hatte.
Während Eleanor mit dem Tablett die Treppe hinaufging, fragte sie sich, wie sie die Sache mit dem Brief ansprechen sollte. Sie hatte ihre Mutter angefleht, den Hausarzt aufzusuchen, doch Helena hatte sich rundheraus geweigert. Sie sagte, sie brauche Zeit zum Nachdenken, und das könne sie beim Malen am besten. Ihr Gesicht war eingefallen, und sie hatte dunkle Ringe unter den Augen. Außerdem war sie noch magerer geworden, und Eleanor hatte den Eindruck, dass viel mehr graue Strähnen ihr rotes Haar durchzogen. Konnte man durch Schock und Trauer wirklich über Nacht ergrauen? Sie klopfte an die Schlafzimmertür. Helena lag zusammengekrümmt auf dem Bett und trug noch die Kleider vom Vortag. Richard Kirwans alter Morgenmantel bedeckte ihre Füße. Ein Fenster stand offen, und ein eisiger Luftzug ließ die Tür zufallen.
»Mutter! Das Bett ist ja gar nicht aufgedeckt. Hast du denn nicht geschlafen? So kann das nicht weitergehen.« Eleanor stellte das Tablett auf den Nachttisch, setzte sich aufs Bett und streichelte die kalten Hände ihrer Mutter
»Du bist ganz durchgefroren. Hier, ich habe dir Orangensaft, Kaffee und Toast gebracht, und ich bleibe hier sitzen, bis du etwas gegessen hast. Bitte …« Sie legte Helena einen Kaschmirschal um die Schultern und reichte ihr die Kaffeetasse. Ihre Mutter starrte mit ausdrucksloser Miene in die schwarze Flüssigkeit.
»Mutter, wir müssen miteinander sprechen. Wir dürfen nicht länger den Kopf in den Sand stecken, sondern müssen etwas tun. Ich habe einen Brief bekommen, und zwar von Solange de Valnay.«
»Du kommst zu spät zur Arbeit.« Helenas Stimme klang brüchig und gepresst.
»Das ist mir egal. Ich möchte, dass du dir das ansiehst.« Eleanor nahm den Brief aus der Tasche. Wortlos schüttelte Helena den Kopf. »Gut, dann lese ich ihn dir eben vor.«
Ohne aufzublicken, trank Helena den Kaffee. Nachdem Eleanor zu Ende gelesen hatte, saß sie schweigend da und hoffte, dass der Damm nun brechen würde. Alles, was ihre Mutter bis jetzt gelähmt hatte, würde sich jetzt vielleicht endlich mit heilsamen Tränen Luft machen. Doch stattdessen kauerte Helena sich zusammen, kuschelte sich in den Morgenmantel ihres toten Mannes und zog ihn sich übers Gesicht. Die Stille dauerte an. »Ich habe deinen Vater im April 1939 kennen gelernt«, sagte sie schließlich. »Und zwar vor der Ecole de Louvre in Paris.«
Glenveigh Lodge,Killiney, Dublin30. März 1970
Liebe Solange,trotz unserer augenblicklichen Situation war ich überglücklich, als gestern Ihr Brief eintraf. Ich bedauere es wirklich sehr, dass Sie mit dem Schock und dem Schmerz ganz allein fertig werden mussten, nachdem Sie meine Nachricht erhalten hatten. Aber wenn wir uns weiter schreiben, könnten wir wenigstens versuchen, einander zu helfen. Eigentlich hatte ich angenommen, dass Sie meinen Vater kannten, auch wenn Sie ihn vielleicht nur hin und wieder gesehen oder mit ihm gesprochen haben. Aber dass Sie ihm noch nie begegnet sind und nichts von seiner Existenz ahnten … Und dennoch drückte er sich in seinem Testament sehr eindeutig aus, und die Worte lassen keinen Raum für Zweifel offen: »Meiner Tochter in Frankreich …«Richard Kirwan war ein vorsichtiger Mann, Solange, und er hätte diese Worte nie geschrieben, wenn er sich seiner Sache nicht sicher gewesen wäre. Ich habe versucht, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, aber sie trauert wegen des Verlusts und vielleicht noch wegen anderer Dinge, die sie jedoch nicht äußert. Für sie war es schon immer schwierig, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Sie tut das lieber mit Blicken und durch ihre Bilder. Meine Mutter ist sehr zierlich, sie hat einen tizianroten Wuschelkopf und große braune Augen. Sie ist keine Schönheit, wirkt aber sehr auffällig und hinterlässt stets einen bleibenden Eindruck. Beim Sprechen zeichnen ihre Hände Formen in die Luft. Und sie kleidet sich mit dem für Künstler typischen Desinteresse an Ordnung oder Mode – dennoch stehen ihr ihre Kleider immer großartig.Ich weiß, dass sie Vater leidenschaftlich liebte und unter seiner Krankheit genauso litt wie er. Gegen Ende ging es ihm sehr schlecht, aber sie bestand darauf, ihn aus dem Krankenhaus nach Hause zu holen und ihn bis zum letzten Atemzug selbst zu pflegen. Er hatte Krankenhäuser schon immer gehasst – das hat mit dem Krieg zu tun, sagt sie. Wir wussten, dass er damals schwer erkrankt und deshalb nicht bei meiner Mutter war, als James und ich geboren wurden. Über diese Jahre wurde bei uns nie gesprochen, und selbst als Kinder ahnten wir, dass sie beide nicht daran erinnert werden wollten. Meine Mutter war die Einzige, die seine Schmerzen wirklich lindern konnte – mit Ausnahme meiner jüngeren Schwester Elizabeth, die er sehr liebte. Ich muss zugeben, dass sie sein Lieblingskind war, vielleicht, weil sie meiner Mutter so ähnlich sieht.Gestern haben James und ich beschlossen, Mutter Ihren Brief zu zeigen und herauszufinden, was sie über die Angelegenheit weiß. Nach einigen Stunden erzählte sie mir etwas, das vielleicht erklärt, wie mein Vater und Ihre Mutter sich kennen lernten.Richard Kirwan wurde als Sohn einer einflussreichen Verlegerfamilie geboren, die in Dublin etliche Häuser besaß. Er studierte an der dortigen Universität und machte einen hervorragenden Abschluss in Französisch und Geschichte. Jedes Jahre reiste er nach Frankreich, wo er, besonders in Paris, viele Freunde hatte. Nach dem Examen setzte er seine Studien an der Cambridge University fort. Als drei Jahre später an seinem alten College in Dublin eine Stelle frei wurde, kehrte er nach Hause zurück und wurde Professor. Mein Vater war ein beeindruckender Mann und sehr charmant. Doch seine ganze Liebe galt der Wissenschaft, und er hatte eine Menge Ehrgeiz. 1938 erhielt er eine Einladung nach Frankreich, um eine Reihe von Gastvorlesungen an der Sorbonne zu halten. Also ließ er sich in Dublin für zwei Jahre beurlauben. Damals war er sechsunddreißig.Helena, meine Mutter, stammt aus dem Westen von Irland und wurde als Helena O’Riordan geboren. Sie ist das einzige Mädchen in der Familie, hat aber drei Brüder, von denen einer ihr Zwilling ist. Ihre Familie waren Fischer und Schiffsbauer, hatten also nicht viel Geld. Als Kind spielte Helena nur mit ihren Brüdern, vor allem mit ihrem Zwillingsbruder Seamus. Die beiden galten als sehr ungebärdig. Als sie älter wurde, schickte man sie schließlich auf ein von Nonnen geleitetes Internat. Musik und Malerei wurden ihre Leidenschaften, und im Alter von achtzehn Jahren bestand sie die Aufnahmeprüfung am National Art College. Nachdem sie einen ausgezeichneten Abschlusss gemacht hatte, war sie fest dazu entschlossen, in Paris Malerei zu studieren. Sie nahm verschiedene Arbeiten an, sparte das Geld, brachte sich selbst Französisch bei und bewarb sich 1937 um ein zweijähriges Studium an der Ecole de Louvre.Dort lernte sie eines Nachmittags im Jahr 1939 Richard Kirwan kennen, als sie, beladen mit einer großen Mappe und verschiedenen Kartons voller Gerätschaften, vor dem Gebäude auf einen Bus wartete. Da es plötzlich zu regnen begann, liefen alle los, um sich unterzustellen, und in der Eile ließ Mutter einen Teil ihrer Sachen fallen. Richard Kirwan, der gerade vorbeikam, blieb stehen und half ihr beim Aufheben. Das Komische war, dass beide dachten, einen Franzosen vor sich zu haben. Erst später, bei einer Tasse Kaffee in einem Lokal, stellten sie fest, dass sie aus Irland stammten. Das Kaffeetrinken dauerte zwei Stunden. Dann gingen sie Abendessen, fanden heraus, dass sie beide Opern liebten, und besorgten sich für den folgenden Abend Karten für La Bohème. Anschließend machten sie einen Spaziergang an der Seine. Helena war fünfundzwanzig, Richard elf Jahre älter als sie.Meine Mutter brauchte sehr lang, mir das zu erzählen. Vielleicht wird sie im Laufe der nächsten Tage noch mehr offenbaren, doch ich darf sie nicht drängen. Jedenfalls ergibt sich daraus, dass mein Vater zur gleichen Zeit in Paris war wie Celine de Valnay und meine Mutter. Vielleicht kannten sie sich ja alle drei. Soweit sich feststellen lässt, führten meine Eltern eine gute Ehe. Mein Vater war ein integrer und prinzipientreuer Mann. So merkwürdig und schwer verständlich unsere augenblickliche Lage auch sein mag, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Vater immer versucht hat, das Richtige zu tun.Ich möchte Ihnen zu Ihrer Verlobung gratulieren. Ich selbst bin weder verheiratet noch verlobt, trotz meiner achtundzwanzig Jahre, auch wenn ich dem gern ein »noch nicht« hinzufügen würde. Einmal dachte ich, den Partner fürs Leben gefunden zu haben, und ich verbrachte fast ein Jahr mit ihm. Ich bereue keinen einzigen Moment – bis auf den letzten. Allerdings denke ich, dass die Zeit solche Wunden heilt. Er ist inzwischen sehr glücklich mit seiner Frau und hat mich sogar zur Hochzeit eingeladen. Ich bin hingegangen, schließlich waren wir nicht nur Liebende, sondern auch Freunde.In meinem letzten Brief habe ich möglicherweise ein negatives Bild von meinen Geschwistern vermittelt, aber sie sind nicht immer so, wie ich sie beschrieben habe. James, mein Zwillingsbruder, ist mir manchmal rätselhaft. Nach außen hin wirkt er kühl und selbstbewusst; er ist ein tüchtiger und erfolgreicher Anwalt – sehr ehrgeizig, wie man es als Jurist nun einmal sein muss, doch er kann auch sehr romantisch und einfühlsam sein. Wir stehen uns ziemlich nah, wie es für Zwillinge typisch ist. Meine Schwester Elizabeth zieht Bewunderer hinter sich her wie ein Komet seinen Schweif. Sie hat die leuchtend roten Haare und die haselnussbraunen Augen meiner Mutter sowie ihren zierlichen Körperbau geerbt. Doch damit endet die Ähnlichkeit schon. Sie hat viel von unserem Vater – seine Energie, seinen Ehrgeiz und seine Kraft –, studiert Geschichte und Philosphie und wird wie er eine anerkannte Wissenschaftlerin werden. Wenn sie endlich den Richtigen kennen lernt, sollte der Gute eine gefestigte Persönlichkeit haben.Ich glaube, ich habe ein wenig von der Kreativität meiner Mutter mitbekommen, obwohl sich das bei mir eher beim Schreiben als in der Malerei äußert. Ich habe Englisch und Philosophie studiert und bin in der Literaturszene von Dublin nicht gänzlich unbekannt. Inzwischen arbeite ich im Verlag unserer Familie, um meine schriftstellerische Tätigkeit zu finanzieren, und habe große Freude an meinem Beruf.Ich stehe meiner Mutter schon immer recht nah, denn wir sind einander sehr ähnlich. Mein Vater hingegen hat mich aus Gründen, die ich mir nie erklären konnte, stets auf Distanz gehalten, obwohl ich ihm sicher etwas bedeutet habe und er nur mein Bestes wollte. Vielleicht hat diese Entfernung etwas damit zu tun, dass er bei meiner Geburt nicht anwesend war. Ich habe mich oft gefragt, ob ich ihn an eine schmerzliche Erfahrung erinnerte, der er sich nicht stellen wollte. Als ich ein kleines Kind war, hatte er schwere gesundheitliche Probleme und war häufig bettlägrig. Wenn ich ihn manchmal ansah, stellte ich fest, dass er mich mit tiefer Trauer in den Augen musterte. Dann lief ich auf ihn zu, umarmte ihn und versuchte, ihn in seinem Schmerz zu trösten. Später wurde mir klar, dass er nicht mich betrachtete, sondern etwas, das überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Und nun komme ich einer Erklärung vielleicht ein bisschen näher.Ich frage mich, ob Sie etwas über Richard Kirwans Leben in Frankreich herausfinden konnten. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn Sie dieses Wissen mit mir teilen würden, da Sie ja sonst niemanden haben, dem Sie sich anvertrauen können. Hoffentlich helfen Ihnen die Informationen weiter, die ich Ihnen gegeben habe. Womöglich empfinden Sie es als seltsam, Solange, dass ich Ihnen so ausführlich schreibe. Ich habe selbst keine Antwort darauf, denn eigentlich fällt es mir sehr schwer, anderen Menschen meine Gefühle zu offenbaren. Falls es Ihnen jedoch lieber ist, lediglich Fakten auszutauschen, brauchen Sie es mir nur zu sagen.Jetzt muss ich los, aber ich schicke Ihnen die herzlichsten Grüße.
Eleanor Kirwan
Kapitel 4
St. Joseph de Caune, 1970
Solange lag da und sah zu, wie sich der kühle Morgennebel jenseits der Musselinvorhänge langsam verzog. Unter ihrem Fenster strömte der Fluss über die Felsen, die düster und unverrückbar unter der glitzernden Wasseroberfläche ruhten. Immer noch schläfrig, kuschelte sie sich wohlig ins Bett. Doch das Gefühl der Entspannung kurz nach dem Erwachen war nicht von langer Dauer. Schon im nächsten Moment folgten der Stich im Magen und ein quälendes Gefühl von Benommenheit. Das schleichende, von Eleanor Kirwans Brief ausgelöste Unbehagen bemächtigte sich der ersten Augenblicke des Tages und hing lautlos und bedrohlich über ihr.
Solange stand auf und ging zum Fenster, lehnte den Kopf gegen die alte Steinmauer. Um sie herum schliefen die Berge des Haut Languedoc in der Morgendämmerung. Hin und wieder streifte ein Strahl fahlen Sonnenlichts die gefältelten Abhänge. Es klopfte an der Tür, und Lorette, die Haushälterin der Familie, die auch Solanges Kindermädchen gewesen war, kam herein. Auf dem kleinen Tablett, neben der Kaffeetasse, lagen zwei Briefe. Auf dem oberen war Guy St. Jorres saubere, geschwungene Handschrift zu erkennen. Als Solange ihn nahm, erkannte sie sofort den irischen Poststempel auf dem Kuvert darunter. Furcht ergriff sie, während sie in nervöser Anspannung abwartete, bis Lorettes Schritte auf der Treppe verklungen waren. Dann legte sie das Schreiben ihres Verlobten weg und öffnete den zweiten Brief, der von Eleanor stammte. Anfangs empfand sie noch Mitleid, doch als sie die Worte ein zweites Mal las, wurden ihre freundschaftlichen Gefühle von Gereiztheit und schließlich von heftiger Wut abgelöst. Warum beharrte diese fremde Frau nur so krampfhaft darauf, in der Vergangenheit herumzustochern und Nachforschungen über eine längst vergessene Angelegenheit voranzutreiben, die man besser auf sich beruhen lassen sollte? Eleanor lebte in Irland, im Kreise ihrer Familie, und konnte also ihren Schmerz mit ihrem Bruder und ihrer Schwester teilen und bei ihnen Trost suchen.
»Richard Kirwan war ein vorsichtiger Mann«, hatte Eleanor geschrieben. Aber offenbar doch nicht vorsichtig genug, so war zumindest Solanges Eindruck. Schließlich hatte er als verheirateter Mann eine Affäre gehabt und ein Kind gezeugt. Wie hatte ihre Mutter eine so klassische Dummheit begehen können? War es ein letzter Ausbruchsversuch vor ihrer Hochzeit mit Henri de Valnay gewesen? Hatte Richard Kirwan ihr vielleicht seine Ehe verschwiegen oder ihr versprochen, sich ihretwegen von seiner Frau zu trennen? Die Vorstellung, die Schwangerschaft könne ein Unfall und sie selbst ungewollt gewesen sein, machte Solange besonders zu schaffen. Anscheinend gehörte Eleanor zu den Menschen, die es immer nur gut meinten und sich für andere aufopferten, vermutlich hatte sie sich nie von der strengen religiösen Erziehung gelöst, der man irische Mädchen offenbar von frühester Kindheit an unterwarf. Sie klang, als lebte sie noch im letzten Jahrhundert, auch wenn sie bereits eine Liebesbeziehung gehabt hatte. Der Bruder schien ein ziemlich aufgeblasener Kerl zu sein, und die jüngere Schwester machte einen eitlen und verwöhnten Eindruck. Nur Helena Kirwan tat Solange Leid. Allerdings wurde sie von Wut ergriffen, wenn sie daran dachte, dass diese Leute einfach den Namen ihrer Mutter in den Mund nahmen, obwohl sie nicht das Geringste über sie wussten. Nicht einmal sie selbst hatte sie wohl richtig gekannt.
»Kann es denn wahr sein?«, fragte sich Solange und rechnete den Hochzeitstag ihrer Mutter und ihr Geburtsdatum nach. »Hatte sie wirklich Papa geheiratet, während sie das Kind eines anderen Mannes erwartete? Und hatte die Affäre danach vielleicht noch jahrelang angedauert? Wusste Papa davon? Oh, Gott, Papa, hast du es all die Jahre lang gewusst?«
Sie erinnerte sich an die letzten schrecklichen Wochen, das hohlwangige Gesicht ihrer Mutter und ihre eingesunkenen, glanzlosen Augen. Celines Körper schien geschrumpft, ihre einst glatte Haut hing schlaff, gelblich und faltig um die vorstehenden Knochen, während die Krankheit sie gnadenlos aufzehrte. Wenn Solange sie in eine bequemere Lage gebettet hatte, hatte sie befürchtet, die brüchigen Knochen könnten ihr unter den Händen zerfallen. Hatte Celine damals gewusst, was ihr ehemaliger Liebhaber ihnen allen anzutun plante?
»Oh, Mama«, murmelte Solange. »So etwas kommt bei normalen Menschen wie uns doch nicht vor. Was für ein Mann würde nach so vielen Jahren einen solchen Schritt unternehmen? Du hättest es mir sagen müssen – wenigstens, damit ich Papa beschützen kann. Wie konntest du mich so im Stich lassen und mir die alleinige Verantwortung aufbürden?«
Vielleicht hatte ihre Mutter ja nie aufgehört, Richard Kirwan zu lieben. Solange war froh, dass sie den Mann nie kennen gelernt, ihn nie zu Gesicht bekommen hatte. Diese Leute in Irland waren offenbar felsenfest davon überzeugt, dass er Solanges Vater war. Besaßen sie vielleicht zusätzliche Informationen, die sie für sich behielten? Solange war sich darüber im Klaren, dass Männer und Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten heimliche Liebesaffären hatten. Aber dennoch vergoss sie nachts Tränen des Verlusts und der ohnmächtigen Wut, und die tiefe Abneigung hinterließ in ihrem Mund einen bitteren Nachgeschmack.
Wahrscheinlich nahm die fremde Frau in Irland an, Französinnen hätten, was Liebesaffären anging, eine eher gleichgültige und zynische Einstellung. Aber Solange wusste, dass das eine dumme Verallgemeinerung war. Kein Mensch nahm es auf die leichte Schulter, wenn er betrogen wurde, und sie hatte häufig Freundinnen ihrer Mutter bitterlich weinen sehen, weil sie ihre Männer bei einem Seitensprung ertappt hatten. Celine hatte diese Frauen ermutigt, entweder allein weiterzuleben und einen Neuanfang zu wagen oder zu bleiben und ihre Position entschlossen zu verteidigen. Und nun war die weise, mitfühlende Ärztin nicht mehr da und konnte nicht mehr erklären, was sie selbst zu einem so unfassbaren Betrug veranlasst hatte. Solange wusste nicht, wem sie das Geheimnis ihrer unehelichen Geburt und der unwillkommenen Erbschaft anvertrauen sollte.
Sie legte Eleanors Brief in die Schreibtischschublade und drehte sich, den Tränen nah, um. Wie sollte sie ihrem Verlobten erklären, was während seiner Abwesenheit vorgefallen war? Seine Familie mit ihrem uralten Stammbaum würde ganz sicher kein Verständnis dafür haben. Auf Solange wirkte Guys Vater stets ein wenig abweisend, und seine Mutter war eine große Dame – eingeschnürt in die Zwangsjacke altmodischer Konventionen. Und wie würde Guy selbst ihre Eltern beurteilen? Den Vater, der gar nicht ihr Vater war, und die Mutter, die ihren Mann betrogen und dann nicht den Mut gefunden hatte, ihren Fehltritt – selbst im Angesicht des Todes – ihrer eigenen Tochter zu gestehen? War es besser, Guy die ganze unschöne Angelegenheit zu verheimlichen und zuzulassen, dass die Lügen ihrer Mutter auch in die nächste Generation hineinreichten?
»Mein Gott, womit habe ich das verdient? Was habe ich falsch gemacht? Und warum habe ich überhaupt an diese Frau geschrieben?« Das warme, duftende Badewasser, das sie umspülte, konnte ihr keinen Trost spenden. Solange scheuerte an ihrer Haut herum, bis rote, hässliche Flecken an ihren Armen erschienen. »Das meiste davon habe ich selbst verschuldet. Sie hätte nie etwas über meine Familie zu erfahren brauchen. Ebenso wenig gehen mich ihre Probleme an. Ich hätte nur den Empfang des Briefes bestätigen und die Sache dann auf sich beruhen lassen sollen. Warum habe ich es nicht den Anwälten übertragen, alles zu regeln?«
Solange war überzeugt, dass sie in ihrem ersten Brief viel zu offenherzig gewesen war. Sie hatte einen weltgewandten und unabhängigen Eindruck vermitteln und verdeutlichen wollen, dass ihre Familie über Vermögen verfügte und sie selbst Bildung und finanzielle Absicherung besaß, das Geld der Kirwans also gar nicht brauchte.
Solange kletterte aus der Wanne und griff nach einem Handtuch. Sie hatte einen wohlgeformten Körper mit schlanker Taille, schmalen Hüften und üppigen Brüsten. Sie mochte ihre olivfarbene Haut, die rasch braun wurde und eine glatte, reine Beschaffenheit hatte. Ihr Haar war goldblond, schwer und dick, ganz anders als die hellen, schimmernden Locken ihrer Mutter. Früher hatte sie stets angenommen, dass sie die grauen Augen und die Adlernase von Henri de Valnay geerbt hatte. Nun schnitt sie eine spöttische Grimasse. Offenbar war es naiv von ihr gewesen, irgendwelche Familienähnlichkeiten feststellen zu wollen. Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie hatte Halsschmerzen und empfand eine dumpfe, drückende Wut auf sich selbst. Schließlich tupfte sie sich die Augen ab und schminkte sich leicht, hauptsächlich, um sich ein wenig aufzumuntern.
Im Schlafzimmer stach ihr Guys Brief ins Auge, der immer noch ungeöffnet auf dem Tablett lag. Endlich etwas, das sie an diesem sonnigen Morgen zum Lächeln bringen würde. Sie schlüpfte in einen Morgenmantel und setzte sich in den Sessel am Fenster. Ein Familienstreit wegen der Anteile an einer riesigen Zuckerplantage hatte ihn nach Guadalupe geführt, wo er einem der Seniorpartner seiner Anwaltskanzlei unter die Arme greifen musste. Guy schrieb wunderschöne Briefe, und in seinen Worten schwangen Zärtlichkeit und Begierde mit. Solange spürte, wie sehr er sich nach ihr sehnte. Sie legte eine Hand an den Haaransatz im Nacken, wo er sie so gerne berührte, und spürte erleichtert, wie ein Gefühl der Zuneigung zu ihm sie ergriff. Nachdem sie die Seiten noch einmal gelesen hatte, legte sie sie ordentlich zu seinen übrigen Briefen. Als sie sich schließlich anzog, war sie so zuversichtlich wie schon seit Tagen nicht mehr.
Beim Frühstück las sie Henri die Zeitung vor und erörterte mit ihm die Pläne für den Tag. Rasch hatte er sich die Liste der anstehenden Aufgaben und der Korrespondenz gemerkt, die sie für ihn vorbereitet hatte. Um diese Jahreszeit brauchten die Weinberge viel Pflege, denn Insekten und Unkraut schienen sich tagtäglich und unablässig zu vermehren. Als Henri in die Bibliothek ging, um seine morgendlichen Anrufe zu erledigen, blickte Solange ihm nach und fragte sich plötzlich, wie lange jedes Möbelstück schon unverrückbar an seinem Platz stand, so dass er sich völlig mühelos in seinem Haus bewegen konnte. Sie war so unaufmerksam gewesen und hatte vieles für selbstverständlich gehalten. Und sie nahm sich fest vor, von nun an nicht mehr so übertrieben emotional zu reagieren. Papa durfte nichts von diesem rasenden Moment der Leidenschaft erfahren und auch nichts davon, dass ihre Mutter von einem anderen Mann ein Kind empfangen hatte. Das war das Wichtigste an der Erbschaft, die ihr gerade in den Schoß gefallen war.
Solange stieg die Treppe zu ihrem Schlafzimmer hinauf, wo einige ihrer Lieblingsfotos auf einer blitzblank gewachsten Tischplatte standen. Eines zeigte Celine de Valnay, die gelassen und glücklich ihren Mann anlächelte, während ihre Hand auf der Schulter ihrer kleinen Tochter ruhte. Solange zog sich einen Stuhl heran und blieb eine Weile reglos sitzen, bis sie sich wieder gefangen hatte. Sie spürte, wie die beschützenden Mauern ihres Geburtshauses sie umfingen, und beschloss in diesem Augenblick, ihrem Verlobten zu verheimlichen, dass ihre Familienverhältnisse sich geändert hatten. Dabei sagte sie sich – obwohl sie wusste, dass es nicht stimmte –, dass sie es ihrem Papa zuliebe tat. Schließlich war er der Vater, den sie liebte und achtete. Sie war derselbe Mensch wie zuvor, selbst wenn sie aus einer anderen Verbindung entstanden war, als sie gedacht hatte. Und sie würde nicht dulden, dass die ungebetenen Geister einer weit zurückliegenden Vergangenheit in ihrer Zukunft herumspukten.
Sie waren beide tot, die schöne Ärztin und ihr unbekannter Liebhaber, und es musste verhindert werden, dass sie die Fundamente von Solanges wohl geordneter, abgesicherter Welt erschütterten. Gewiss war es nur der erste Schrecken gewesen, der sie mit feinen Nadelstichen aus ihrer Ruhe aufgerüttelt hatte – so wie damals, wenn sie von ihrer Mutter eine Spritze bekam: Zuerst spürte man stets ein schmerzhaftes Piksen, Anspannung, Angst, und es tat ein bisschen weh. Doch schon kurz darauf war die Stelle des Eindringens in die Haut nicht mehr zu erkennen, und alles war wieder wie zuvor. Solange griff nach einem Stift und begann zu schreiben.
Domaine de ValnaySt. Joseph de Caune, Frankreich4. April 1970
Liebe Eleanor,vielen Dank für Ihren Brief vom 30. März. Es war sehr nett von Ihnen, mir noch einmal zu schreiben und mir Ihre Familie zu schildern. Ich weiß, dass Sie zu ergründen versuchen, wie meine Mutter und ich in Richard Kirwans Leben treten konnten. Sicher ist das alles sehr schwer für Sie und für Ihre Geschwister. Ihr Brief ist anrührend, ebenso das Porträt Ihrer Mutter. Offenbar sind Sie auch eine Künstlerin, wenn auch nicht mit Farbe und Pinsel, sondern mit Worten.Was mich angeht, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es uns allen keine Vorteile bringt, wenn wir weiter in der Beziehung Ihres Vaters mit meiner Mutter herumstochern. Das, was sich zwischen ihnen abgespielt hat, war vermutlich nichts weiter als ein zufälliges Ergebnis ihrer Gefühle, und man sollte es darauf beruhen lassen. Sie leben in Irland im Kreise Ihrer Familie und werden sich eines Tages von dem Schock erholen. Irgendwann werden wir vielleicht alle begreifen, dass Richard Kirwan auf seine Weise versucht hat, gerecht zu sein. Möglicherweise wollte er sein Gewissen um eine Last erleichtern, die es viele Jahre lang getragen hat, auch wenn uns die Art und Weise momentan grausam und übertrieben dramatisch erscheinen mag. Dass wir diesen Vorgang jemals gleich beurteilen werden, ist höchst unwahrscheinlich.Meiner Ansicht nach sollten wir die Vergangenheit jetzt ad acta legen und für die Gegenwart und die Zukunft leben. Unsere Eltern – alle vier Elternteile, denn Henri de Valnay war mir seit meiner Geburt ein wirklicher Vater – haben sicher unzählige Geheimnisse, und wir sollten diesen Teil ihrer Vergangenheit am besten vergessen. Ihre Mutter hat bereits sehr gelitten, und es kommt für mich nicht in Frage, meinen Vater mit einer Wahrheit zu konfrontieren, die fatale Folgen für ihn haben könnte. Richard Kirwans Vermächtnis an mich bringt mich in eine arge Zwickmühle und ist mir darüber hinaus rätselhaft; außerdem bedauere ich es sehr, dass ich Ihnen in dieser Zeit der Trauer zusätzlich Schmerz zugefügt habe. Hoffentlich wird es Ihnen und Ihren Geschwistern gelingen, einander die Liebe zu geben, die Sie jetzt brauchen, um ein neues Kapitel im Buch des Lebens aufzuschlagen. Wenigstens haben Sie eine große Familie, bei der Sie Trost finden können.Mir erscheint es überflüssig, unseren Briefwechsel fortzusetzen, denn ich sehe keinen Vorteil darin, weiter in einem längst vergangenen Drama herumzuwühlen. Wir sind nur Statisten in einem Stück, das wir nicht verstehen können, weil die beiden Hauptdarsteller inzwischen verstorben sind. Lassen Sie die Toten ruhen, damit wir uns so an sie erinnern, wie wir sie am meisten geliebt haben.Noch einmal vielen Dank für Ihre Bemühungen, mir Ihr Mitgefühl zu zeigen. Ich respektiere Ihren Wunsch, mehr über das Leben Ihres Vaters herauszufinden, doch ich möchte mich nicht an derartigen Entdeckungen beteiligen. Meiner Ansicht nach ist es das Beste, wenn wir uns darauf besinnen, wer wir vor dieser unschönen Enthüllung waren. Ich wünsche Ihnen ein erfülltes und glückliches Leben sowie Anerkennung für Ihr literarisches Schaffen. Schon früh habe ich von meiner Mutter und von allen Menschen, die mir wirklich etwas bedeuten, gelernt, dass die Schönheit des menschlichen Gedankens auf einer gedruckten Seite, häufig unter Mühen und nach jahrelanger Anstrengung zu Papier gebracht, vielleicht das größte Geschenk ist, das uns gewährt wird, um unser Leben und Lieben zu leiten.Mit den besten Wünschen
Solange de Valnay
Solange unterzeichnete den Brief mit Nachdruck. Das Schreiben verlieh ihren Gefühlen Ausdruck, ohne in überflüssiger Emotionalität zu zerfließen. Auch wenn Eleanor Kirwan ihre Halbschwester sein mochte, war sie dennoch eine Fremde. Sie griff nach dem Foto ihrer Mutter, betrachtete noch einmal das schöne, lachende Gesicht und knallte den Silberrahmen plötzlich so heftig auf den Schreibtisch, dass das Glas einen Sprung bekam. Dann lief sie nach unten zu Henri de Valnay ins Arbeitszimmer. Sie war froh über die vertrauten Aufgaben, die sie erwarteten.
Kapitel 5
St. Joseph de Caune, 1970
Solange, Liebes, ich möchte, dass gegen sechs in der Bibliothek Aperitifs und ein Imbiss serviert werden.« Henri de Valnay stand zur Terrasse gewandt da; die Hände hatte er hinter dem Rücken verschränkt. »Ein junger Mann will mich aufsuchen, um etwas mit mir zu besprechen. Offenbar hat er ein paar radikale Vorschläge zum Ausbau der Weine in dieser Gegend.«
»Ach, wirklich? Dieses Thema liegt dir ja besonders am Herzen. Wer ist denn dein Gast? Die meisten jungen Männer in dieser Gegend sind doch nur daran interessiert, ihre Ernte für den höchstmöglichen Preis an die Genossenschaft zu verkaufen.«
Schon so oft hatte Henri versucht, die Besitzer der benachbarten Weingüter und die hiesige Genossenschaft für Modernisierungen und die Herstellung besserer Weine zu begeistern. Doch irgendwann hatte er entmutigt aufgegeben, da sie einfach nicht begreifen wollten, dass ein Umdenken in der Branche dringend notwendig war. »Es ist Edouard Ollivier von Roucas Blancs.« Henri runzelte die Stirn. »Er ist vor kurzem nach einigen Jahren Ausbildung in Bordeaux hierher zurückgekehrt. Ich glaube, er war auch eine Zeit lang in Übersee. Sicher erinnerst du dich von den Sommerferien vor vielen Jahren noch an ihn.«
Als Solange an Paul Olliviers schlaksigen Sohn dachte, musste sie schmunzeln. Er war der erste Junge, der sie – kurz nach ihrem dreizehnten Geburtstag – geküsst hatte, worauf sie, kichernd und verängstigt, vor ihm davongelaufen war. Die Familie Ollivier war der Anlass für eine der seltenen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihren Eltern gewesen. Eine Auseinandersetzung um ein Stück Land zwischen den de Valnays und Paul Ollivier war nach vielen Jahren erbitterten Rechtsstreits zu Henris Gunsten entschieden worden, seitdem war das Verhältnis zwischen den Familien gespannt. Solange war sicher, dass die beiden Männer nach dem Urteil kein Wort mehr miteinander gewechselt hatten. Doch als Paul Ollivier einen Herzinfarkt erlitt, hatte Celine de Valnay darauf bestanden, ihn zu behandeln – das erste Mal, dass Henri gegen eines ihrer Vorhaben heftigen Widerspruch erhoben hatte.
»Ja, ich erinnere mich, dass er nach der Scheidung seiner Eltern mit seiner Mutter auf ein großes Gut in Bordeaux zog«, sagte Solange. »Und jetzt will er mit dir über Wein sprechen? Das wundert mich wirklich.«
»Ich muss zugeben, dass ich seinen Vorschlag zuerst am liebsten abgelehnt hätte.«
Die Aussicht auf den Besuch war Henri sichtlich unangenehm. Er hatte keine Lust auf weitere Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarn oder das Aufwärmen alter Feindschaften. Solange sah, dass er sich Stirn und Nasenrücken rieb, ein Versuch, die heftigen Kopfschmerzen zu lindern, an denen er so häufig litt.
»Ich glaube nicht, dass du dich gut mit Charles Edouard vertragen wirst«, meinte sie. »Vermutlich kommst du genauso schlecht mit ihm aus wie mit seinem Vater. Bei unserer letzten Begegnung hat er abfällige Bemerkungen über unsere Weinberge fallen gelassen. Tja, nicht nur über unsere, sondern über die gesamte Weinproduktion des Midi.«
»Das kannst du ihm nicht zum Vorwurf machen, Kind. Keiner hier stellt einen Wein her, den man auch nur als anständigen vin de pays bezeichnen könnte, ganz zu schweigen von einem Qualitätswein mit festgelegtem Anbaugebiet oder einen, den man in Paris für trinkbar halten würde. Außerdem entstammt Charles Edouard mütterlicherseits einer alten Familie aus Bordeaux, wo man etwas vom Weinbau versteht.«
»Stimmt, aber ich finde es trotzdem seltsam, dass er herkommt. Ob sein Vater wohl davon weiß? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paul einen Besuch seines Sohnes im feindlichen Lager gutheißen würde.«
»Tja, auf einen weiteren fruchtlosen Streit mit Paul möchte ich es wirklich nicht ankommen lassen. Den jungen Mann habe ich, wie ich glaube, seit zehn Jahren nicht mehr gesehen.«
»Er war aufgeblasen und arrogant, hatte langes Haar, das ihm über die Augen fiel, und dazu eine ziemlich große Nase – ein bisschen schief war sie auch, weil er sie sich einmal gebrochen hat. Vielleicht hat ihm ja jemand eine verpasst, was ich für sehr wahrscheinlich halte. Außerdem war er ziemlich groß und mager, redete ohne Punkt und Komma und musste ständig das letzte Wort haben.«
»Klingt, als hätte er einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen, Kind.« Henri lachte.
»Ach, nicht nur bei mir. Eigentlich konnten wir ihn alle nicht leiden, obwohl er gut aussah und außerdem recht klug war. Er tat uns Leid, als seine Mutter davonlief und den armen, alten Paul verließ. Damals fanden wir sie sehr verrucht und mondän.« Wieder schmunzelte sie, als sie an den schlaksigen Jungen dachte, der sie geküsst hatte. »Charles Edouard konnte sehr nett sein, wenn er ein bisschen lockerer wurde. Doch das kam nicht sehr häufig vor.«
»Wenn ich dir so zuhöre, kriege ich richtig Mitleid mit dem armen Jungen«, kicherte Henri in Antwort auf ihre wenig schmeichelhafte Schilderung. »Aber vielleicht ist er, wie die Weine seiner Familie in Bordeaux, mit dem Alter ein wenig gereift. Schließlich muss er inzwischen knapp dreißig sein. Er hat gesagt, er wolle zurückkehren, um seinem Vater auf dem Weingut zu helfen.«
»Es würde mich wundern, wenn er länger als eine Woche bleiben würde. Er ist sich vermutlich wie seine Mutter viel zu fein für unser einfaches Landleben.«
»Wenn es ihn wirklich interessiert, wird er das Weingut bald leiten, denn Paul Ollivier schafft es offensichtlich nicht mehr. Es wäre ihm vermutlich recht, sich zur Ruhe zu setzen oder wenigstens ein bisschen kürzer zu treten.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem beantwortet es noch nicht meine Frage, warum Charles Edouard mit dir sprechen möchte. Ich finde es ziemlich anmaßend, dass er sich einfach selbst eingeladen hat. Darf ich bei dem Gespräch dabei sein? Eigentlich wollte ich den heutigen Abend mit Chloë und Tante Jeanette verbringen, aber das hier klingt viel interessanter.«
»Wenn du das wirklich möchtest, könnte eine offenere Haltung recht hilfreich sein.« Henri lachte immer noch. »Du darfst andere Menschen nicht so abtun, Kind. Versuch es mal mit dem britischen Grundsatz, dass jeder unschuldig ist, bis man ihm das Gegenteil nachweist. Manchmal befürchte ich, du könntest die gesamte unvollkommene Menschheit verstoßen, bevor jemand auch nur die Chance erhält, sich dir von seiner Schokoladenseite zu zeigen. Natürlich kannst du dich gern zu uns setzen. Wenn ich an mein Verhältnis zu seinem starrsinnigen alten Vater denke, brauche ich vielleicht einen Verbündeten.«
»Es hat ganz sicher nichts mit eurem Rechtsstreit zu tun, das ist doch schon so lange her.«
»Tja, ganz gleich, was Charles Edouard Ollivier über unsere Zukunft hier zu sagen hat, viel schlimmer als die Gegenwart kann es nicht werden.« Henri setzte sich unvermittelt und wirkte auf einmal erschöpft. »Nachdem er weg ist, können wir ja ein einfaches Abendessen vor dem Kamin zu uns nehmen. Oder möchtest du dann noch Chloë und ihre Mutter besuchen?«
»Eigentlich hatte ich vor, zum Abendessen zurück zu sein«, log Solange. »Und vielleicht möchte unser Gast ja bleiben.« Sie stand auf und küsste Henri auf den Scheitel. »Ich rufe Chloë an und verschiebe unsere Verabredung.«
»Oh, Solange, wie kannst du mich im Stich lassen?« Ihre Cousine klang enttäuscht. »Ich hatte mich so darauf gefreut. Mama hat sogar aufgehört, in meinen Angelegenheiten herumzustochern, um sich ein paar Stunden lang einzig und allein mit deinen zu beschäftigen. Außerdem hast du versprochen, zum Essen zu bleiben. Ich ertrage einen weiteren Abend allein mit meinen Eltern nicht, und während der Woche gibt es hier ja nichts anderes zu tun.«
»Die Besprechung scheint Papa sehr wichtig zu sein.«
»Warum können sich dein Vater und dieser Soundso nicht allein die Köpfe heiß reden? Du gluckst viel zu viel mit Henri zusammen und solltest öfter ausgehen, damit er sich ans Alleinsein gewöhnt. Sonst kriegt er einen Schock, wenn du heiratest und nach Montpellier ziehst.«
Solange wich einem Gespräch über Henri und ihre anstehende Hochzeit aus und flüchtete sich in die Zusage, später in der Woche eine neue Verabredung zu treffen. Nachdem sie aufgelegt hatte, ging sie die Treppe hinunter in die Küche, wo Madame Prunier die Aufsicht über den wichtigsten Bereich des Haushalts führte. Mehrere große Fenster, die auf den Fluss hinausblickten, machten den Raum sehr hell. An schweren Balken hingen Töpfe, Pfannen, Büschel getrockneter Kräuter und dicke Knoblauchzöpfe.
»Ach, Solange, du siehst so blass aus. Und dein junger Mann wird finden, dass du viel zu dünn bist.« Die ausladenden Formen der Köchin verkörperten in ihren eigenen Augen das Sinnbild vollkommener Weiblichkeit. Solange zuckte zusammen, doch Madame Prunier war noch längst nicht fertig und erwärmte sich für ihr Thema. »Da drüben steht etwas frisch gebackenes Brot und etwas Käse. Versuch ein Stück von dem Cantal. Los, Kind, iss etwas! Du musst etwas essen!«
»Prunie, können Sie den Ablauf des heutigen Abends ein bisschen ändern? Charles Edouard Ollivier aus Roucas Blancs kommt, um Papa zu besuchen. Würden Sie uns gegen sechs einen kleinen Imbiss und Aperitifs servieren? Und vielleicht sind wir zu dritt beim Abendessen.«
»Mein Gott! Der junge Ollivier kommt her? Vielleicht hat ihn ja sein Vater geschickt, um endlich Frieden zu schließen. Er wird langsam alt, und mit seiner Gesundheit steht es auch nicht zum Besten.« Madame Prunier rümpfte die Nase. »Aber dein Papa sollte nicht zu vertrauensselig sein. Paul Ollivier ist ein schlauer Fuchs.«
Sie griff zum Schneebesen und begann, eine goldfarbene Mischung cremig zu schlagen. Solange stibitzte einen Löffel voll.
»Ich habe gehört, dass der Junge wieder zu Hause ist, gerade noch rechtzeitig, wenn du mich fragst. Ich habe Paul Ollivier am letzten Wochenende gesehen, und er wird sich nicht mehr lange um das Gut kümmern können. Er war schon immer ein knurriger alter Kauz, aber er saß nie auf dem hohen Ross wie seine feine Gattin, die nichts als Schwierigkeiten gemacht und mit Geld um sich geworfen hat.«
»Es muss hart für sie gewesen sein, von einem großen Gut in Bordeaux hierher nach Roucas Blanc überzusiedeln.«
»Papperlapapp! Das hätte sie sich überlegen sollen, bevor sie ihn geheiratet und wieder sitzen gelassen hat. Ein Jammer, dass er sich nicht wieder eine Frau genommen hat, dann wäre er vielleicht nicht so verbittert geworden.«
»Wen hätte er nach diesem Fehler denn heiraten sollen?«
»Damals war er noch jung genug. Und da er viel Land besitzt, war er eine gute Partie. Für den Jungen wäre es auch besser gewesen. Gut, dass er wieder hier ist, schließlich ist er jung und stark. Jeder weiß, dass der alte Mann zu stolz ist, um ihn auch nur um einen Besuch zu bitten.«
Solange unterdrückte ein Grinsen. Sie hätte wissen müssen, dass bereits das ganze Dorf über die Rückkehr von Ollivier junior sprach. »Tja, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. So gegen eins hätten wir gerne nur einen Salat. Im Büro stapelt sich heute der Papierkram, und Papa befürchtet, nach einem richtigen Mittagessen nachmittags einzuschlafen.«
Beim Gedanken an eine so kärgliche Mahlzeit schnalzte Madame Prunier missbilligend mit der Zunge. Solange griff nach einem frisch gebackenen Brötchen, belegte es mit einem dicken Streifen Butter und einem Stück Käse und verließ die Küche.
Charles Edouard Ollivier erschien pünktlich um sechs Uhr. Solange musterte ihn verstohlen. Er war so groß, wie sie ihn in Erinnerung hatte, aber nicht mehr mager. Seine Nase sah immer noch aus, als wäre sie gebrochen, und sein Haar und seine Augen wirkten dunkler als früher. Er trug eine ausgewaschene Jeans und ein dunkelblaues Hemd mit einer abgetragenen, aber gut geschnittenen Jacke, die ihm eine lässige Ausstrahlung verlieh. Da er sonnengebräunt und muskulös war, arbeitete er vermutlich viel im Freien. Seine zurückhaltende Miene wurde von einem Lächeln abgelöst, als er Solange guten Tag sagte, ihre Hand ergriff und sich in einer übertriebenen Geste darüber beugte. Sie wusste, dass er versuchte, sie um den Finger zu wickeln. Als er Henri de Valnay begrüßte, stand er kerzengerade da und hielt die Fäuste an die Seiten gepresst.





























