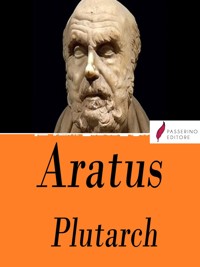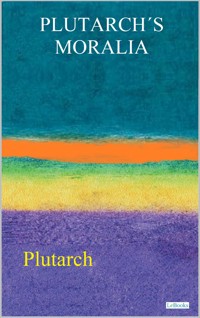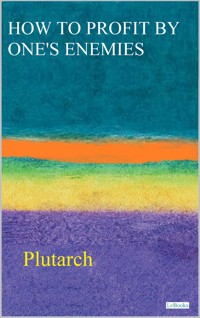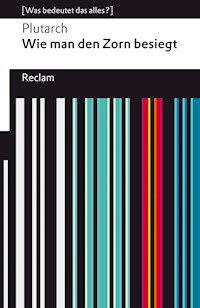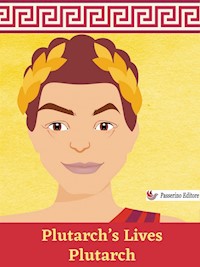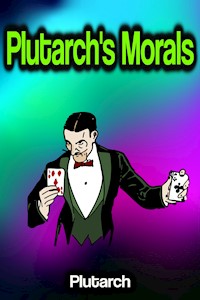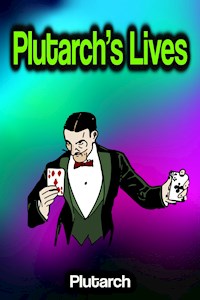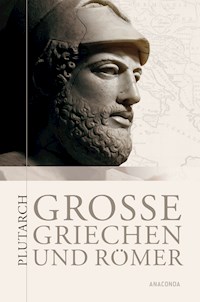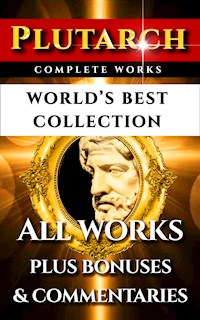5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek – [Was bedeutet das alles?]
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der Mensch ist kein Fleischfresser: Schließlich muss er Fleisch erst künstlich zubereiten, damit es überhaupt bekömmlich ist. Vegetarier leben gesünder und fühlen sich leichter und freier. Zeilen aus dem Vorwort eines vegetarischen Kochbuchs? Nein: Schon Plutarch dachte so, vor beinahe 2000 Jahren. Dabei fragte er auch nach dem rechten Umgang mit Tieren: Schädliche Tiere dürfe man töten, unschädliche zähmen und sie ihrer natürlichen Eignung gemäß rücksichtsvoll zum eigenen Nutzen einsetzen. Aber man brauche keine Gänseleberpastete und schon gar keine mit Grausamkeit verbundenen Spektakel!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Ähnliche
Plutarch
Darf man Tiere essen?
Gedanken aus der Antike
Aus dem Griechischen von Marion Giebel
Reclam
Alle Rechte vorbehalten
© 2015 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2015
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMSUNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960836-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019313-6
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
Odysseus vergießt Tränen beim Anblick seines alten Hundes, Zeus bemitleidet die Pferde auf dem Schlachtfeld, die unschuldig leiden müssen, ängstlich flattert die Sperlingsmutter um ihr Nest, während eine große Schlange den Baum hinaufkriecht: In Homers Epen, besonders auch in seinen Tiergleichnissen, ist das Mitgefühl mit Tieren allenthalben spürbar. Der epische Dichter Hesiod, einige Zeit nach Homer, zeigt eine düstere Welt, in der das Recht des Stärkeren herrscht: Fressen und Gefressenwerden, so sagt es der Habicht der klagenden Nachtigall, die er in den Fängen hält (Erga202 ff.). Doch eigentlich sollte wenigstens in der Menschenwelt Recht und Gesetz gelten. Diese Ordnung hat Zeus nämlich den Menschen gegeben: Fische und wildes Getier und geflügelte Vögel sollen einander verzehren, denn es gibt kein Recht unter ihnen, aber den Menschen hat er das Recht verliehen, was sich als weitaus das Beste erweist (Erga276 ff.).
Es gibt kein Recht unter den Tieren – folglich haben sie auch keinen Rechtsanspruch den Menschen gegenüber. Oder gibt es Tierrechte? Die Frage zieht sich durch die Geschichte bis in unsere Zeit, und der Grieche Plutarch hat sich ihr gestellt und eine Antwort darauf zu geben versucht.
Plutarch (45–120 n. Chr.) wurde in Chaironeia in Böotien (Mittelgriechenland) geboren, einem geschichtsträchtigen Ort, wo die Griechen 338 v. Chr. von Philipp und Alexander von Makedonien vernichtend geschlagen worden waren: das Ende der politischen Autonomie Griechenlands. Hellas wurde nach der Alexanderzeit römische Provinz, spielte aber eine bedeutende Rolle als Vermittlerin der Paideia, griechischer Kultur. Gewissermaßen als ein »Kulturbotschafter« kommt Plutarch nach Rom. Er gewinnt Freunde, wie Sosius Senecio, einen Vertrauten Kaiser Trajans, dem er seine Parallelbiographien widmete, in denen er jeweils einen Griechen und einen Römer einander gegenüberstellte, wie Alexander und Caesar. Doch kehrt er wieder in seine Heimatstadt zurück, wo er eine »Privatakademie« gründet, mit interessierten, vor allem jungen Hörern, mit denen er in Lehrvorträgen und Diskussionen wissenschaftliche Fragen im weitesten Sinne behandelt, die er später in einer Sammlung, Moralia genannt, veröffentlicht. Die Dialogform erlaubt ihm, gegensätzliche Argumente vorzuführen.
So erleben wir eine Diskussion über die Frage, ob die Wasser- oder die Landtiere klüger sind. Schüler Plutarchs, junge Leute, die als Jäger und Fischer Erfahrung besitzen, sollen ihre Argumente vortragen. Als Diskussionsleiter fungieren Autobulos, der Vater Plutarchs, und Soklaros, ein Freund des Hauses. Gestern hat man über die Jagd gesprochen, die insofern eine pädagogische Wirkung habe, als sie die Lust am Blutvergießen auf ein sozusagen harmloses Gebiet ablenke. Autobulos widerspricht: Man gewöhnt sich dabei eher an das Töten und die Zufügung von Schmerzen, und diese Abstumpfung des Gefühls überträgt sich auch auf den Umgang mit Menschen. Man kann hier an die Zirkusspiele denken, bei denen Mensch und Tier gleichermaßen zum Ergötzen der Zuschauermenge abgeschlachtet wurden. Pythagoras wird als Autorität angeführt: Er hat in der Haltung gegenüber Tieren eine Übung der Menschlichkeit gesehen: Wer sich daran gewöhne, Tieren gegenüber milde und freundlich zu sein, der werde sich Menschen gegenüber ebenso verhalten. Das gilt auch umgekehrt (das sog. Verrohungsargument findet sich noch bei Kant und Schopenhauer).
Doch zunächst geht es ja um den Wettstreit zwischen den Sympathisanten der Landtiere und denen der Wassertiere und grundsätzlich um die Frage: Haben die Tiere überhaupt Verstand? Da gibt es verschiedene Ansichten. Aristoteles, mit seiner umfangreichen Tierkunde der Hauptgewährsmann, hat gesagt, die Tiere seien phrónimoi, sie besäßen eine praktische Intelligenz, mit der sie ihr Leben meisterten, wofür er zahllose Beispiele bringt. Doch schöpferische Intelligenz, Erkenntnis der göttlichen Ordnung des Kosmos, das Streben nach der Tugend, das ist nur dem Menschen eigen. Diese Sicht ist in der Philosophie verbreitet, vor allem die Stoa betont, dass das Weltall und alles darin, auch die Tiere, von den Göttern zum Nutzen der Menschen geschaffen ist. Nur sie besitzen Vernunft (ratio) und leben nach Recht und Gesetz. Andere Philosophenschulen trieben den Anthropozentrismus nicht gar so weit. Akademiker und Peripatetiker, die Nachfahren Platons und des Aristoteles, billigten den Tieren gewisse Verstandeskräfte und eine eigene Existenzberechtigung zu. Ihnen folgt Plutarch, der den Tieren phrónesis und aísthesis, verstandesmäßige Überlegung, Wahrnehmung und Empfindung, zuspricht, also Bewusstsein im heutigen Sinn.1 Er bezieht sich auf Pythagoras, wenn er die Tiere als émpsycha ansieht, als beseelte, belebte Wesen, Mitgeschöpfe des Menschen.
Wieweit richten sich nun die Tiere nur nach ihrem Instinkt, wieweit kann man von Intelligenz sprechen? Plutarch sieht bei den Tieren einerseits instinktive Anlagen, die ihnen von der Natur (phýsis) mitgegeben wurden. Doch wie sie diese anwenden, an die jeweilige Situation anpassen, das setzt andererseits kognitive Fähigkeiten voraus: Überlegung, eine Prüfung der Wahrnehmungen und ein daraus abgeleitetes Handeln. Das gilt vor allem für Situationen, in die Lebewesen erst durch veränderte Lebensumstände geraten sind, mit denen umgehen zu können also nicht in ihrem Erbgut verankert ist. Situationen also, die vor allem durch den – meist feindlichen – Kontakt mit dem Menschen entstanden sind. Plutarch schildert, wie Fische gelernt haben, sich der Angel und den Netzen zu entziehen. Hirschkühe bringen ihre Jungen in unmittelbarer Nähe von Fernstraßen zur Welt, da sich dort keine großen Raubtiere aufhalten. Sie verbergen sie wohl in den zur Entwässerung angelegten Gräben. Erworbenes Erbgut, sagt man dazu heute. Doch muss das erste Tier, das die Idee zu einer solchen Verhaltensweise gehabt hat, Überlegung angewandt haben. Man billigte den Tieren in neuerer Zeit ein Verfahren des Ausprobierens zu, trial and error, bei dem sie mehr zufällig auf das Rechte gekommen seien. War es so bei den Raben, von denen Plutarch berichtet, dass sie Steinchen in einen Krug warfen, um den Wasserspiegel auf Trinkhöhe anzuheben? Im Experiment zeigt sich, dass die Krähe kein bereitliegendes Material ausprobiert, sondern sogleich zu den Steinen greift und sie in das Wasserglas wirft, bis sie trinken kann. Schon Alfred Brehm hat gesagt: »Wer Tieren den Verstand nicht zuerkennen will, braucht nur längere Zeit einen Raben zu beobachten.« Heute kann man auch sehen, wie die Rabenvögel Nüsse auf die Fahrbahn werfen, damit Autos darüberfahren und sie knacken. Die Gehirnforschung hat gezeigt, dass die neurobiologischen Prozesse, die zu einer Aktion führen, bei den höher entwickelten Tieren gar nicht so sehr verschieden sind von denen des Menschen: Instinkt und Intelligenz.
Plutarch plädiert für Verständnis und Respekt gegenüber den Tieren. Viele handeln über ihre genetisch programmierten Regungen hinaus. Die Hunde, die unter Lebensgefahr bei ihren Herren ausharren (als einzige), sie selbst im Tod nicht verlassen, ja mit ihnen sterben – wie kann man ihnen moralische Rücksicht versagen? Und so gibt es bei dem Wettbewerb darum, welche Tierart schlauer ist, auch keine Sieger und Verlierer: Die Vertreter beider Seiten sollen ihre Ergebnisse zusammentun und damit denen entgegentreten, die den Tieren Vernunft und Erkenntnisvermögen absprechen.
Eine Krähe wirft Steinchen in das Wasserglas, um den Wasserspiegel auf Trinkhöhe anzuheben (© picture-alliance / dpa).
Und wie steht es mit den Rechten gegenüber den Tieren? Darf man denn, wenn man sie als mit Verstand begabte Lebewesen ansieht, überhaupt Gebrauch von ihnen machen? Oder, wenn wir das nicht dürfen, müssen wir uns sozusagen in die Steinzeit zurückversetzt sehen? Ein Problem, für das Plutarch in der Nachfolge des Pythagoras einen goldenen Mittelweg anzeigt. Man kann die schädlichen Tiere töten (wie etwa damals Giftschlangen, heute die Malariamücke) und unschädliche zähmen und sie ihrer natürlichen Eignung gemäß zum eigenen Nutzen einsetzen. So wird man Hunde zum Wachdienst abrichten, Ziegen melken, denen man dafür Pflege und Weide gibt. So heißt es heute: »Es kann keine moralischen Einwände gegen Mensch-Tier-Beziehungen geben, die dem gegenseitigen Nutzen dienen und ökologisch vertretbar sind. Milch und Eier können gegen Schutz, Nahrung und Fürsorge eingetauscht werden.« (So bei Wolf, S. 307) Aber, sagt Plutarch, man braucht keine Gänseleberpastete und erst recht keine mit Grausamkeit verbundenen Spektakel, wie in der Zirkusarena, und auch kein Jagdvergnügen, wobei man sich an den Qualen und dem Tod der Opfer weidet. »Unrecht begeht nicht, wer von den Tieren Gebrauch macht, sondern wer mit ihnen rücksichtslos und grausam umgeht.« (I, Kap. 7)
Plutarch geht auf eine weitere ernste Frage ein: Darf man denn Tiere, wenn man sie als beseelte Mitgeschöpfe ansieht, töten und ihr Fleisch essen? In seiner zweiteiligen Abhandlung über, d. h. gegen das Fleischessen bezieht er sich auf Argumente, wie sie in seiner Zeit ein neuerstandenes Pythagoreertum vertrat. Es war eine Bewegung, wie sie auch heute wieder auftritt, als Reaktion auf übertriebenen Luxus und Konsum und die damit verbundene Umweltzerstörung. Hier galt: Vegetarismus statt Fleischgenuss. Im strengen Sinne wurde diese Forderung mit der Lehre von der Seelenwanderung begründet, wie sie schon der Philosoph Empedokles und dann Pythagoras vertreten hatten. Die Menschen gehen im Kreislauf der Natur von menschlichen in tierische Gestalten über, und so essen wir womöglich unsere Voreltern, wenn wir geschlachtete Tiere verspeisen. Plutarch greift zwar dieses Horrorszenarium auf, man merkt jedoch, dass dies nicht sein Hauptargument gegen das Fleischessen ist. Vielmehr empört ihn die Grausamkeit und Gefühllosigkeit, mit der man ein lebendiges Geschöpf ums Leben bringt – nicht damit ein Hungriger satt wird, sondern um es bei den Schlemmermählern der Reichen aufzutischen und vielfach ungegessen wieder abzutragen. Außerdem ist der Mensch, so meint er, kein Fleischfresser, er muss ja diese Nahrung erst künstlich zubereiten, damit sie überhaupt bekömmlich ist. Und sie belastet den Körper und führt zu mancherlei gesundheitlichen Störungen. Ohne Fleischgenuss fühlt sich auch der Geist leichter und freier. Das bezeugt ebenfalls Seneca, der in seinen jungen Jahren Vegetarier war und nur davon abging, weil die Vegetarier zu staatsgefährdenden Sektierern gezählt und beargwöhnt wurden (Epistulae morales ad Lucilium108). Der Mensch hat auch ohne Blutvergießen heutzutage genügend abwechslungsreiche Nahrung und kann auf unnötigen Fleischkonsum verzichten, zumal da dieser, wofür Seneca wie Plutarch abschreckende Beispiele bringen, mit grausamen Methoden des Fangs und der Tötung von Tieren als bloßen Delikatessenlieferanten verbunden ist.
Auch in seiner Schrift zur gesunden Lebensweise (Gesundheitsregeln) meint Plutarch, es sei das Beste, sich erst gar nicht an das Fleischessen zu gewöhnen. »Da aber nun einmal in unserer Gesellschaft Sitte und Gewohnheit eine Art von zweiter, unnatürlicher Natur geschaffen haben, sollte unser Genuss von Fleisch doch nicht zur Stillung unseres Hungers dienen, wie bei Wölfen und Löwen. Besser ist es, wir geben es nur dazu, als Ergänzung und Zukost unserer Nahrung, zu anderen Hauptspeisen und Beilagen, wie Obst und Gemüse, die unserem Körper und Geist eher gemäß sind und sie in Schwung halten.«
Heute sagt man: »Da der Verzehr von Pflanzen eine Alternative ist, und da diese Alternative zu Gaumenfreuden, bester Gesundheit und keinem unnötigen Tierleiden führt, würde folglich eine Person, wenn sie versucht, nicht zu unnötigem Leiden auf der Welt beizutragen, keine Tiere essen, die zur Nahrungsgewinnung gezüchtet und geschlachtet werden« (bei Wolf, S. 291).
Auf der Theaterbühne folgt auf Dramen ernsten Inhalts ein Satyrspiel. Zu den Schriften zur Tierethik Plutarchs gehört auch sein Dialog Gryllos, in dem die Mensch-Tier-Problematik in Form eines Sketchs abgehandelt wird. Der Mensch als »Krone der Schöpfung« wird hier in satirischer Form demontiert: »eine der schönsten Geschichten gegen den Anthropozentrismus« (P. Münch in Mensch und Tier, S. 23). Plutarch begibt sich in die Nachfolge der Kyniker, der Philosophen um Diogenes, die das naturgemäße Leben der Tiere für erstrebenswerter hielten als das des Menschen, der seinen Begierden und Konventionen unterworfen ist. Schon der Titel ist ironisch: »Darüber dass die unvernünftigen Tiere Vernunft gebrauchen.« Man wird sehen, wer »vernünftig« ist.
Wir befinden uns auf der Insel der Zauberin Kirke (10. Buch der Odyssee). Kirke verwandelt Fremde, die bei ihr landen, in wilde Tiere. Die Gefährten des Odysseus hat sie in Schweine verwandelt. Odysseus bittet, sie möge ihnen ihre menschliche Gestalt zurückgeben, worauf Kirke meint, er solle sie zuerst fragen, ob sie das überhaupt wollen. In einem Dialog mit Gryllos, »Grunzer«, einem Schwein, erfährt Odysseus zu seinem Erstaunen, dass dieser und seine Gefährten das eben nicht wollen. Tiere sind doch die besseren Menschen, ergibt sich schließlich, und Gryllos zerpflückt genüsslich das Image des Odysseus, des »Vielklugen«, des hochberühmten Städtezerstörers. Und was sich die Menschen so einbilden auf ihre Tugenden und Fertigkeiten – das haben die Tiere alles von Natur aus! Mit ihren Begierden und Leidenschaften aber müssen die Menschen sich ja schämen gegenüber den Tieren, die nur das naturgemäße Leben kennen.
Odysseus fühlt sich ziemlich in die Enge getrieben und will schließlich die letzte Bastion des Homo sapiens retten: Aber wie kann man Lebewesen Vernunft zusprechen, die keine Beziehung zu den Göttern haben? Gryllos kontert mit dem Hinweis auf die Abstammung des Odysseus. Gilt nicht Sisyphos, der Überschlaue, als sein Vorfahr? Und der sagte, ein schlauer Kopf habe für die Menschen die Götter und die Furcht vor ihnen erfunden, um sie dadurch in Schach zu halten.
Ist der Dialog hier zu Ende, oder fehlt das Schlussstück? Darüber besteht keine Einigkeit. Es gibt mehrere Lücken in den Dialogen, so auch am Ende des zweiten Teils von Über das Fleischessen. Doch wäre es nicht äußerst passend, hier ein Ende zu sehen – Odysseus, der kluge Redner, bleibt sprachlos zurück. Und der Leser kann sich über die Argumente des Gryllos seine Gedanken machen. Der Mensch ist jedenfalls entthront als die Krone der Schöpfung.
Plutarch gönnt sich auch noch einen besonderen Spaß: Seine Landsleute, die Böotier, galten vielfach als rechte Hinterwäldler und Vielfraße. Er selbst führt den Spruch an: die Schweine von Böotien, und in seiner Demosthenesbiographie (11,5) das Sprichwort: Will die Sau die Athene belehren? Nun belehrt in der Tat ein Schwein den Schützling der Athene, Odysseus. Und dazu alle, die immer noch den Menschen seiner ratio wegen hoch über die Tiere erheben.
Er nennt’s Vernunft und braucht’s allein,
nur tierischer als jedes Tier zu sein.
[Goethe, Faust]
Marion Giebel
I Land- oder Wassertiere – Wer ist klüger?
[Teilnehmer des Dialogs: Autobulos, der Vater Plutarchs, Soklaros, ein Freund des Hauses, Aristotimos, Phaidimos und andere, Schüler Plutarchs]
1.AUTOBULOS: Als Leonidas2 gefragt wurde, was er von Tyrtaios3 hielte, sagte er: »Ein guter Dichter, er versteht es, die Gemüter der jungen Leute anzuheizen«, das heißt, er weckt durch seine Verse in den jungen Männern Kampflust mit Mut und Energie, so dass sie sich in der Schlacht nicht schonen. So befürchte ich, liebe Freunde, dass die Lobrede auf die Jagd, die uns gestern vorgetragen wurde, unsere jungen Leute, die ja Jagdliebhaber sind, übers Maß angefeuert hat, so dass sie alles andere für zweitrangig oder gar für nichts achten und sich nur darauf konzentrieren. Ich kam mir wahrhaftig selbst so vor, als ob ich trotz meines Alters wieder von neuem das Jagdfieber spürte und mich sehnte, wie die Phaedra des Euripides mit den Hunden zu hetzen, die Hirsche mit scheckigem Fell zu jagen [Hippolytos218 f.] – so war ich gepackt von dieser Rede mit ihrer Fülle überzeugender Argumente.
SOKLAROS: Ja wahrhaftig, Autobulos. Der Vortragende schien mir wieder einmal seine ganze Beredsamkeit aufzubieten, um den jungen Leuten zu gefallen und ihre jugendliche Begeisterung zu teilen. Besonders angetan war ich davon, wie er die Gladiatoren anführte mit dem Argument, die Jagd sei nicht zum wenigsten deshalb zu loben, weil sie unser angeborenes oder angewöhntes Vergnügen an bewaffneten Kämpfen zwischen Menschen ablenkt auf ein reines Schauspiel von Geschicklichkeit und Mut gegenüber vernunftloser Kraft und Gewalt, womit die Verse des Euripides bestätigt werden:
Gering ist die Stärke des Menschen,
aber mit vielfältigen Listen zähmt er
die Ungeheuer des Meeres und
alles Getier auf dem Land und in den Lüften.
[Aiolos frg. 27]
2.AUTOBULOS: Und doch sagt man, mein lieber Soklaros, eben daher sei die Gefühllosigkeit und die wilde Mordlust bei den Menschen aufgekommen, dass sie nämlich auf der Jagd sozusagen auf den Geschmack des Tötens gekommen sind und sich daran gewöhnt haben, keinen Widerwillen zu empfinden bei dem Blut und den Wunden der Tiere, ja noch Freude daran zu haben, sie hinzuschlachten und zu töten. Das geht dann wie damals in Athen: Als die Dreißig Tyrannen4 den ersten der Sykophanten, der üblen Denunzianten, hinrichten ließen, da sagte man: Der hat’s verdient. Und so hieß es auch beim zweiten und dritten. Von da an gingen sie immer weiter, Schritt für Schritt, legten Hand auch an rechtschaffene Männer und verschonten schließlich auch die besten Bürger nicht. Ebenso hat der erste, der einen Bär oder Wolf erlegte, Ruhm gewonnen; ein Stier oder ein Schwein, das man beschuldigte, von den ausgelegten Opfergaben gefressen zu haben, wurde als zu Recht getötet angesehen. In der Folge aber, als man dazu überging, das Fleisch von Hirschen, Hasen und Rehen zu essen, da führte das dann auch dazu, Schafe und mancherorts auch Hunde- und Pferdefleisch zu verzehren. »Die zahme Gans aber und die Taube, die Hausgenossin«, wie Sophokles sagt, die dienten nicht, wie bei Wieseln und Katzen, zur Nahrung aus Hunger, nein, zur Lust und Leckerei zerreißt und zerstückelt man sie. So verstärkte sich die in der Natur des Menschen liegende Neigung zum Töten und zur Grausamkeit, machte sie unempfindlich für das Gefühl des Mitleids und stumpfte sie großenteils ab für eine sanftere Regung. Im Gegensatz dazu aber machten die Pythagoreer die Milde gegen Tiere zu einer Übung der Menschenfreundlichkeit und des Mitgefühls. Die Gewohnheit übt ja eine starke Wirkung aus, um den Menschen durch allmähliche Einflussnahme auf seine Gefühlswelt zu fördern.
Aber irgendwie sind wir unversehens auf ein Thema gekommen, das gar nicht so weit entfernt liegt von dem, was wir gestern behandelt haben und worüber wir vielleicht auch heute bald wieder sprechen werden. Gestern gaben wir ja, wie du weißt, durch unsere These, dass alle Tiere einen gewissen Grad von Intelligenz aufweisen, unseren jungen Jagdfreunden das Feld frei für einen durchaus geistreichen und amüsanten Wettstreit: nämlich, ob Wasser- oder Landtiere mehr Intelligenz besitzen. Das werden wir heute, wie es scheint, zur Entscheidung bringen, wenn denn Aristotimos, Phaidimos und ihre Mitstreiter bei ihren Argumenten bleiben. Von ihnen versprach jedenfalls Aristotimos seinen Freunden, er wolle beweisen, dass das Land Lebewesen von höherer Intelligenz hervorbringe, Phaidimos aber plädierte für das Meer.
SOKLAROS: Sie bleiben bei ihrer Ansicht, Autobulos, und sie werden gleich hier sein. Ich sah sie heute morgen ihre Vorbereitungen treffen. Doch bevor der Wettstreit beginnt, wollen wir, wenn es dir recht ist, uns das vor Augen stellen, was zu unserem Thema gehört, wozu aber gestern die Zeit nicht reichte, oder was beim Wein und beim Trinken nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt wurde. Es schien doch ein bedeutsamer Satz zu sein, der da aus der Stoa herüberklang, nämlich wie dem Sterblichen das Unsterbliche, so müsste auch dem Vergänglichen das Unvergängliche und dem Körperlichen das Unkörperliche gegenüberstehen. Gleichermaßen müsste dann auch dem Vernunftgemäßen das Vernunftlose entgegengesetzt sein. Und es dürfte dieser Gegensatz nicht allein unter all den vielen Paarungen unvollständig und zu wenig berücksichtigt bleiben.
3.AUTOBULOS