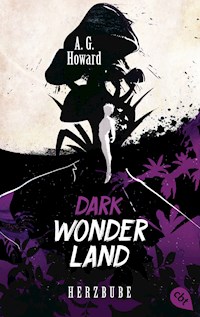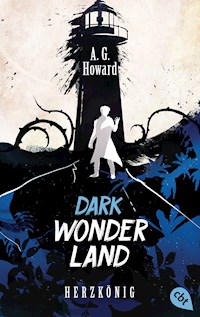9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dark Wonderland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Folge dem Flüstern … in das Reich hinter dem Spiegel
Alyssa kann Blumen und Insekten flüstern hören, eine Gabe, die schon ihre Mutter um den Verstand brachte. Denn sie sind die Nachfahrinnen von Alice Liddell – besser bekannt als Alice im Wunderland. Als sich der Zustand ihrer Mutter verschlechtert, kann Alyssa ihr Erbe nicht mehr leugnen, sie muss jenen Fluch brechen, den Alice damals verschuldet hat. Durch einen Riss im Spiegel gelangt sie in das Reich, das so viel finsterer ist, als sie es aus den Büchern kennt, und zieht dabei ihren besten Freund und geheime Liebe Jeb mit sich. Auf der anderen Seite erwartet sie jedoch schon der zwielichtige und verführerische Morpheus, der sie auf ihrer Suche leitet. Aber wem kann sie wirklich trauen?
Alle Bände der "Dark Wonderland"-Trilogie:
1. Herzkönigin
2. Herzbube
3. Herzkönig
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
A. G. Howard
DARK
WONDERLAND
HERZKÖNIGIN
Aus dem Englischen
von Michaela Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem
Titel »Splintered« bei
Amulet Books, an imprint of ABRAMS, New York
© 2013 by A.G. Howard
Published by Arrangement with A.G. Howard
© 2014 für die deutschsprachige Ausgabe by cbt Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück, 30287 Garbsen.
Aus dem Englischen von Michaela Link
Lektorat: Catherine Beck
Covergestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung eines Bildes von © Shutterstock (ivangal)
MG · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-14246-9V002
www.cbj-verlag.de
1
Einfache Fahrt ins Unterland
Seit meinem zehnten Lebensjahr sammle ich Insekten, nur so kann ich ihrem Geflüster ein Ende machen. Wenn ich einem Insekt eine Nadel durch die Eingeweide stoße, verstummt es ziemlich schnell.
Einige meiner Opfer hängen in Schaukästen an der Wand, während andere in Einweckgläsern auf einem Bücherregal ihrer späteren Bestimmung harren. Grillen, Käfer, Spinnen … auch Bienen und Schmetterlinge. Ich bin nicht wählerisch. Sobald sie gesprächig werden, sind sie Freiwild.
Sie sind leicht zu fangen. Man braucht nur einen Plastikeimer mit Deckel, Katzenstreu und Bananenschalen. Bohr ein Loch in den Deckel, schieb ein PVC-Rohr hindurch, und du hast eine Insektenfalle. Die Obstschalen locken sie an, der Deckel fängt sie, und im Ammoniak des Katzenstreus ersticken sie und werden konserviert.
Die Insekten sterben nicht umsonst. Ich benutze sie für meine Kunst, ihre Leichen sind Bestandteil meiner Collagen. Getrocknete Blumen, Blätter und Glasstückchen sorgen für Farbe und Struktur der Muster, die auf Gipsunterlagen entstehen. Sie sind meine Meisterwerke … meine morbiden Mosaike.
Für die Oberstufe war die Schule heute schon mittags aus und ich habe die letzte Stunde meinem neuesten Projekt gewidmet. Auf meinem Schreibtisch steht ein Glas mit Spinnen. Daneben liegt all das Werkzeug, das ich für meine Kunst brauche.
Der süße Duft von Goldrute weht durch mein Schlafzimmerfenster. An unserer Doppelhaushälfte liegt eine Kräuterwiese, auf der die Veränderliche Krabbenspinne ziemlich häufig vorkommt. Sie wechselt öfter die Farbe – wie ein achtbeiniges Chamäleon –, um sich unter den gelben und weißen Blüten unsichtbar zu machen.
Ich drehe den Deckel des Eimers auf und kippe fünfunddreißig kleine weiße Spinnen mit langen Scheren aus; aber vorsichtig, damit ich ihnen die Bäuche nicht zerquetsche oder die Beine zerbreche. Mit winzigen, geraden Nadeln fixiere ich sie auf einer schwarz gefärbten Gipsunterlage, die bereits mit Käfern bedeckt ist. Die Käfer habe ich wegen ihres changierenden Nachthimmelschimmers ausgewählt. Was ich mir vorstelle, ist kein typischer Sternenhaufen; es ist ein Sternbild, das sich entfaltet wie federige Blitze. Ich habe Hunderte ebenso merkwürdiger Bilder im Kopf und keine Ahnung, woher sie kommen. Meine Mosaike sind die einzige Möglichkeit für mich, sie loszuwerden.
Ich lehne mich im Stuhl zurück und betrachte mein Werk. Sobald der Gips trocknet, werden die Insekten dauerhaft fixiert sein, wenn ich also noch irgendwas ändern will, muss es schnell gehen.
Nachdem ich einen Blick auf die Digitaluhr neben meinem Bett geworfen habe, beiße ich mir auf die Unterlippe. Keine zwei Stunden mehr, dann treffe ich mich mit Dad in der Irrenanstalt. Seit Kindergartenzeiten ist es bei uns Tradition, freitags bei Scoopin’ Stop Schokoladenkäsekucheneis zu kaufen und damit in die Irrenanstalt zu gehen, um es mit Alison zusammen zu essen.
Kältekopfschmerz und ein fast erstarrtes Herz sind nicht gerade das, was ich mir unter Spaß vorstelle, aber Dad beharrt darauf, dass es für uns alle heilsam sei. Vielleicht denkt er, wenn ich meine Mutter in der Irrenanstalt treffe, schaffe ich es gegen alle Wahrscheinlichkeit, nicht eines Tages selbst dort zu landen.
Ein Jammer, dass er sich irrt.
Zumindest ein Gutes hat mein ererbter Wahnsinn. Ohne die Wahnvorstellungen hätte ich vielleicht niemals meine künstlerische Sprache gefunden.
Die Macke mit den Insekten fing an einem Freitag in der fünften Klasse an. Der Tag war hart gewesen. Taelor Tremont hatte herumerzählt, dass ich mit Alice Liddell verwandt sei, dem Mädchen, das Lewis Carrol zu seinem Roman Alice im Wunderland inspiriert hatte.
Alice war tatsächlich meine Urururgroßmutter und deshalb zogen meine Klassenkameraden mich in der Pause mit Haselmäusen und Teegesellschaften auf. Ich dachte schon, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, bis ich etwas in meinen Jeans spürte und entsetzt begriff, dass ich zum ersten Mal meine Periode bekommen hatte, und zwar vollkommen unvorbereitet. Den Tränen nahe nahm ich einen Pullover aus der Fundkiste am Haupteingang und schlang ihn mir für den kurzen Weg zum Sekretariat um die Taille. Ich hielt den Kopf gesenkt, außerstande, irgendjemandem in die Augen zu sehen.
Ich tat so, als sei mir übel, und rief meinen Dad an, damit er mich abholte. Während ich im Zimmer der Schulschwester auf ihn wartete, stellte ich mir eine hitzige Debatte zwischen der Blumenvase auf dem Schreibtisch und der Hummel vor, die emsig um die Blüten summte. Es war eine starke Wahnvorstellung, weil ich die Debatte wirklich hörte, so deutlich, wie ich durch die geschlossene Tür die anderen Schüler hören konnte, die in ihre Klassenzimmer gingen.
Alison hatte mich vor dem Tag gewarnt, an dem ich »eine Frau werden« würde. Vor den Stimmen, die folgen würden. Ich hatte natürlich gedacht, es sei ihr Wahnsinn, der sie so etwas sagen ließ …
Aber das Geflüster zwischen Blumenvase und Hummel war unmöglich zu ignorieren, ebenso wenig wie das Schluchzen, das sich in meiner Kehle staute. Also tat ich das Einzige, was mir blieb: Ich leugnete, was mit mir geschah. Ich rollte ein Poster mit den vier Hauptgruppen von Nahrungsmitteln zusammen und versetzte der Hummel damit einen so kräftigen Schlag, dass sie betäubt liegen blieb. Dann riss ich die Blumen aus dem Wasser, presste sie zwischen die Seiten eines Spiralblocks und brachte ihre schwatzhaften Blütenblätter damit endgültig zum Schweigen.
Als wir nach Hause kamen, fragte mich mein armer, ahnungsloser Dad, ob er mir eine Hühnersuppe machen solle. Ich tat sein Angebot mit einem Achselzucken ab und ging in mein Zimmer.
»Fühlst du dich wohl genug, um heute Abend Mom zu besuchen?«, fragte er aus dem Flur. Es widerstrebte ihm immer, Alisons empfindlichen Sinn für das Regelmäßige zu stören.
Ich machte die Tür hinter mir zu, ohne zu antworten. Mir zitterten die Hände und ich hörte das Blut in meinen Adern brausen. Für das, was im Büro der Krankenschwester geschehen war, musste es eine Erklärung geben. Die blöden Wunderlandscherze hatten mich gestresst, und als meine Hormone verrücktspielten, hatte ich eine Panikattacke. Ja. Das klang schlüssig.
Aber tief im Innern wusste ich, dass ich mir selbst etwas vormachte, und der letzte Ort, an den ich mich begeben wollte, war eine Irrenanstalt. Einige Minuten später ging ich zurück ins Wohnzimmer.
Dad saß in seinem Lieblingssessel – einem abgenutzten Haufen Cord, der mit einem Gänseblümchenmuster verziert war. Während einem ihrer »Anfälle« hatte Alison den ganzen Sessel mit den Stoffblumen benäht. Er würde sich nie mehr von ihm trennen.
»Fühlst du dich besser, Schmetterling?«, fragte er und schaute von seiner Anglerzeitschrift auf.
Modrige Feuchtigkeit wehte mir von der Klimaanlage ins Gesicht, während ich mich gegen die nächste holzvertäfelte Wand lehnte. Unsere Doppelhaushälfte mit nur zwei Schlafzimmern hat nie viel Privatsphäre geboten und an diesem Tag erschien mir das Haus kleiner als je zuvor. Der Luftzug der ratternden Klimaanlage legte Dads dunkles Haar in Wellen.
Ich war verlegen. Aber ich hatte niemanden außer Dad, dem ich mich anvertrauen konnte. »Ich brauche mehr von dem Zeug. Sie haben uns nur eine Probe gegeben.«
Seine Augen waren verständnislos, wie die eines Hirschs, der während der morgendlichen Rushhour in den Verkehr geraten ist.
»Im Sonderunterricht in der Schule«, sagte ich. Mein Magen fühlte sich an wie ein Stein. »Der, an dem die Jungen nicht teilnehmen.« Ich ließ das purpurne Pamphlet aufblitzen, das sie in der dritten Klasse an alle Mädchen verteilt hatten. Es war zerknittert, weil ich es zusammen mit der Damenbinde in eine Schublade unter meine Socken gestopft hatte.
Nach einer unbehaglichen Pause lief Dads Gesicht rot an. »Oh. Deshalb bist du also …« Plötzlich interessierte er sich sehr für eine bunte Ansammlung von Salzwasserködern. Es war ihm peinlich, oder er machte sich Sorgen oder beides, denn im Umkreis von fünfhundert Meilen um Pleasance, Texas, gab es kein Salzwasser.
»Du weißt, was das bedeutet, ja?«, drängte ich. »Alison wird mir wieder den Pubertätsvortrag halten.«
Die Röte breitete sich von seinem Gesicht bis zu seinen Ohren aus. Er blätterte einige Seiten um und starrte mit leerem Blick auf die Bilder. »Nun, wer könnte dir besser von den Vögeln und den Bienen erzählen als deine Mom. Stimmt’s?«
Eine unausgesprochene Antwort hallte in meinem Kopf wider: Wer wäre dazu besser geeignet als die Bienen selbst?
Ich räusperte mich. »Nicht diesen Vortrag, Dad. Den Wahnsinnsvortrag. ›Man kann es nicht aufhalten. Du kannst den Stimmen ebenso wenig entfliehen, wie ich es konnte. Urururoma hätte niemals in das Kaninchenloch steigen sollen.‹«
Es spielte keine Rolle, dass Alison vielleicht doch recht hatte, was die Stimmen betraf. Ich war nicht bereit, es Dad oder mir selbst einzugestehen.
Er saß so starr da, als hätte die Klimaanlage sein Rückgrat vereist.
Ich betrachtete die Schraffur der Narben auf meinen Handflächen. Wir wussten beide, dass es weniger um das ging, was Alison sagte, sondern vielmehr um das, was sie vielleicht tat. Wenn sie noch einen Zusammenbruch hatte, würden sie sie in die Zwangsjacke stecken.
Ich habe früh gelernt, warum es Zwangsjacke heißt. Es kommt von einzwängen. Eingezwängt genug, um dafür zu sorgen, dass sich das Blut in den Ellbogen staut und die Hände taub werden. Eingezwängt genug, damit es kein Entkommen gibt, ganz gleich, wie laut der Patient schreit. Eingezwängt genug, dass es die Herzen derjenigen gefrieren lässt, die den Menschen in der Zwangsjacke lieben.
Meine Augen fühlten sich so geschwollen an, als würden sie gleich platzen. »Hör mal, Dad, mein Tag war wirklich ätzend genug. Bitte, können wir heute einfach nicht hingehen? Nur dieses eine Mal?«
Dad seufzte. »Ich werde in der Anstalt anrufen und Bescheid geben, dass wir Mom stattdessen morgen besuchen kommen. Aber du wirst es ihr am Ende doch erzählen müssen. Du weißt doch, dass es wichtig für sie ist, an deinem Leben beteiligt zu bleiben.«
Ich nickte. Vielleicht musste ich ihr erzählen, dass ich zur Frau geworden war, aber ich musste ihr nicht erzählen, dass ich wurde wie sie.
Ich hakte einen Finger in den fuchsienroten Schal, den ich um meine Jeansshorts gebunden hatte, und schaute auf meine Füße hinab. Glänzende, rosa lackierte Zehennägel reflektierten das Nachmittagslicht, das durchs Fenster fiel. Rosa war immer Alisons Lieblingsfarbe gewesen. Das war der Grund, warum ich es trug.
»Dad«, murmelte ich, laut genug, damit er es hören konnte. »Was ist, wenn Alison recht hat? Mir sind heute einige Dinge aufgefallen. Dinge, die einfach nicht … normal sind. Ich bin nicht normal.«
»Normal.« Er zog die Lippen hoch wie Elvis. Er hatte mir einmal erzählt, dass er Alison mit seinem Grinsen für sich gewonnen habe. Ich glaube, es waren seine Sanftheit und sein Sinn für Humor. Beides sorgte dafür, dass ich nicht jeden Abend weinte, seit sie eingewiesen worden war.
Er rollte seine Zeitschrift zusammen und schob sie zwischen Sitzkissen und Armlehne des Sessels. Dann stand er mit seinen einsdreiundachtzig vor mir und tippte das Grübchen in meinem Kinn an – das eine Merkmal, das ich von ihm hatte, nicht von Alison. »Also, jetzt hörst du mir mal zu, Alyssa Victoria Gardner. Normal ist subjektiv. Lass dir niemals von irgendjemandem einreden, du seist nicht normal. Denn für mich bist du es. Und meine Meinung ist alles, was zählt. Kapiert?«
»Kapiert«, flüsterte ich.
»Gut.« Er drückte meine Schulter, seine Finger waren warm und stark. Ein Jammer, dass das Zucken in seinem linken Augenlid ihn verriet. Er machte sich Sorgen, und dabei hatte ich ihm praktisch noch gar nichts erzählt.
In dieser Nacht wälzte ich mich im Bett hin und her. Als ich endlich einschlief, hatte ich zum ersten Mal den Alice-Albtraum, und seither verfolgt er mich.
In dem Traum stolpere ich über ein Schachbrett im Wunderland, über schartige schwarze und weiße Quadrate. Nur bin ich nicht ich. Ich bin Alice in einem blauen Kleid und einer Spitzenschürze, und ich versuche, dem Ticktack der Taschenuhr des Weißen Kaninchens zu entfliehen. Es sieht aus, als sei es bei lebendigem Leibe gehäutet worden – nichts als Knochen und Häschenohren.
Die Herzkönigin hat befohlen, dass mir der Kopf abgeschlagen und in ein Glas mit Formaldehyd gesteckt wird. Ich habe das königliche Schwert gestohlen, bin auf der Flucht und versuche verzweifelt, die Raupe und die Grinsekatze zu finden. Sie sind die einzigen Verbündeten, die ich noch habe.
Ich tauche im Wald unter und schlage mit dem Schwert nach Ranken, die mir im Weg hängen. Ein Dornendickicht sprießt aus dem Boden. Die Dornen verfangen sich in meiner Schürze und reißen mir die Haut auf wie zornige Krallen. Löwenzahnbäume ragen in allen Richtungen auf. Ich habe die Größe einer Grille, ebenso wie alle anderen.
Muss wohl etwas gewesen sein, das wir gegessen haben …
Nah hinter mir tickt die Taschenuhr des Weißen Kaninchens lauter, hörbar selbst über dem Gleichschritt von tausend Spielkartensoldaten. Eine Staubwolke bringt mich zum Würgen, und ich stürze mich in das Versteck der Raupe, wo Pilze mit Kappen so groß wie Lkw-Reifen aufragen. Es ist eine Sackgasse.
Ein Blick auf den größten Pilz, und mir bleibt das Herz stehen. Der Ort, an dem einst die Raupe saß, um Rat und Freundschaft anzubieten, besteht aus einem dicken weißen Netzwerk. In der Mitte bewegt sich etwas, ein Gesicht, das gegen das duftige Gewebe gedrückt ist und sich gerade genug bewegt, dass ich grobe Züge ausmachen kann, ohne Einzelheiten zu erkennen. Ich rücke näher heran und versuche verzweifelt zu erkennen, wer oder was sich darin verbirgt … Aber die Schnauze der Grinsekatze treibt vorbei und schreit, sie habe ihren Körper verloren, was mich ablenkt.
Die Kartenarmee erscheint. Im Nu bin ich umzingelt. Blindlings werfe ich das Schwert weg, aber die Herzkönigin tritt vor und schnappt es sich aus der Luft. Nachdem ich mich vor der Armee auf die Knie habe fallen lassen, flehe ich um mein Leben.
Aber es ist sinnlos. Karten haben keine Ohren. Und ich habe keinen Kopf mehr.
Nachdem ich mein Spinnensternmosaik mit einem schützenden Tuch bedeckt habe, solange der Gips trocknet, schnappe ich mir ein paar Nachos und mache mich auf den Weg zu Pleasances unterirdischem Skaterpark, um mir die Zeit zu vertreiben, bis ich mich in der Irrenanstalt mit Dad treffe.
Hier in dieser Schattenwelt habe ich mich immer zu Hause gefühlt. Der Park liegt in einem alten, verlassenen Salzstock, einer riesigen unterirdischen Höhle mit einer Decke, die an manchen Stellen bis zu sieben Meter hoch ist. Vor dem Umbau wurde der Salzstock benutzt, um die Massengüter einer Militärbasis zu lagern.
Die neuen Besitzer haben die normale Beleuchtung entfernt und mit etwas Leuchtfarbe und Schwarzlicht den Traum eines jeden Teenagers erschaffen – ein dunkler und atmosphärischer ultravioletter Spielplatz samt Skateboardpark, im Dunkeln leuchtendem Minigolf, Einkaufszentrum und Café.
Mit ihrem zitrusgrünen Neonanstrich sticht die gigantische Bowl für Skateboarder wie ein grünes Signal heraus. Alle Skater müssen eine Einverständniserklärung unterzeichnen und orangefarbenes fluoreszierendes Klebeband auf ihren Skateboards anbringen, um Zusammenstöße in der Dunkelheit zu vermeiden. Aus der Ferne sehen wir aus, als flögen wir wie Libellen über Nordlichter, als sausten wir durch den leuchtenden Strahlenstrom des jeweils anderen.
Mit vierzehn habe ich mit dem Skateboardfahren angefangen. Ich brauchte einen Sport, bei dem ich meinen iPod und Ohrhörer tragen konnte, um das Wispern der verirrten Insekten und Blumen zu dämpfen. Im Großen und Ganzen habe ich gelernt, meine Wahnvorstellungen zu ignorieren. Die Sachen, die ich höre, sind gewöhnlich unsinnig und zufällig und vermischen sich zu einem einheitlichen Knistern und Summen. Die meiste Zeit kann ich mich selbst davon überzeugen, dass es nicht mehr ist als weißes Rauschen.
Trotzdem kommt es vor, dass ein Insekt oder eine Blume ein wenig lauter spricht als die anderen – etwas, das genau passt, das persönlich oder wichtig ist – und mich damit restlos aus dem Konzept bringt. Wenn ich also schlafe oder mit etwas beschäftigt bin, das intensive Konzentration verlangt, ist mein iPod ungemein wichtig.
Im Skaterpark dröhnt aus den Lautsprechern alles, angefangen von Musik aus den Achtzigern bis hin zu Indie Rock. Ich brauche nicht mal meine Ohrhörer. Der einzige Nachteil ist, dass das Ganze Taelor Tremonts Familie gehört.
Vor der großen Eröffnung vor zwei Jahren rief sie an. »Ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren, dass wir das Zentrum taufen«, sagte sie, und ihre Stimme troff von Sarkasmus.
»Ja, warum?« Ich versuchte, höflich zu sein, weil ihr Vater, Mr Tremont, mit dem Sportwarenladen meines Dads einen Exklusivvertrag für die Belieferung des Megazentrums abgeschlossen hatte. Und das war gut so, vor allem, wenn man bedachte, dass wir wegen Alisons Arztrechnungen am Rand des Bankrotts standen. Außerdem bekam ich als zusätzlichen Bonus lebenslang freie Mitgliedschaft.
»Nun …« Taelor kicherte leise. Ich hörte ihre Freundinnen im Hintergrund lachen. Sie hatte wohl den Lautsprecher eingeschaltet. »Dad will es Wunderland nennen.« Gekicher drang durch die Leitung. »Ich dachte, das würde dir gefallen, weil ich doch weiß, wie stolz du auf dein Urururgroßkaninchen bist.«
Der Seitenhieb schmerzte mehr, als er das hätte tun sollen. Ich muss wohl zu lange still gewesen sein, denn Taelors Gekicher verstummte.
»In Wirklichkeit« – fast hustete sie das Wort – »finde ich, dass das total abgenutzt ist. Unterland ist besser. Du weißt schon, weil es unter der Erde ist. Wie klingt das, Alyssa?«
Ich muss an diesen seltenen Ausdruck des Bedauerns von Taelor denken, während ich mitten in der Bowl unter dem Neonschild mit der Aufschrift UNTERLAND durchskate. Es ist schön, daran erinnert zu werden, dass sie eine menschliche Seite hat. Aus den Lautsprechern dudelt ein Rocksong. Als ich durch die untere Hälfte der Bowl fahre, schwirren vor dem Neonhintergrund dunkle Schemen um mich herum.
Während ich meinen hinteren Fuß auf den Teil des Bretts schiebe, mache ich mich bereit, die Nase mit dem vorderen hochzuziehen. Der Versuch eines Ollies hat mir vor ein paar Wochen ein geprelltes Steißbein eingebracht. Inzwischen habe ich irrsinnige Angst vor dem Sprung, aber irgendetwas in mir will nicht aufgeben.
Ich muss es weiter versuchen, denn dieser einfache Sprung – ohne das Brett mit der Hand festzuhalten – ist die Grundlage fast aller anderen Skatertricks. Aber meine Entschlossenheit hat noch tiefere Wurzeln. Sie durchdringt meine Gedanken und Nerven und mischt sie auf, bis ich meine Angst überwunden habe. Manchmal denke ich, dass ich in meinem eigenen Kopf nicht allein bin, dass da ein Teil von jemand anderem drin ist, jemandem, der mich antreibt, über meine Grenzen zu gehen.
Ich nutze den Adrenalinstoß und springe los. Neugierig darauf, wie hoch ich komme, reiße ich die Augen auf. Ich bin mitten im Sprung und der Betonboden kommt schnell näher. Mir läuft ein Schauder über den Rücken. Ich verliere die Nerven, mein vorderer Fuß rutscht weg, und es geht ohne Skateboard weiter abwärts.
Ich schlage mit dem linken Bein und Arm auf. Der Schmerz schießt mir durch den ganzen Leib, der Aufprall nimmt mir den Atem. Ich rutsche bis zum Grund der Bowl. Mein Brett kommt hinter mir hergerollt wie ein treuer Hund und stupst mich in die Rippen, als es stehen bleibt.
Ich ringe nach Luft und wälze mich auf den Rücken. Mein Knie und mein Knöchel sind ein einziger Schmerz. Das Klettband des Knieschoners hat sich losgerissen; in den schwarzen Leggins, die ich unter meinen lila Fahrradshorts trage, klafft ein Loch. Auf der neongrünen Schräge neben mir ist ein dunkler Fleck. Blut …
Ich ziehe mein aufgeschlagenes Knie an und atme tief durch. Sekunden nach meiner Bruchlandung blasen drei Mitarbeiter ihre Trillerpfeifen und kommen auf Rollerblades durch die Reihen der langsamer werdenden Skater. Sie tragen Grubenhelme mit Lampen, aber sie sind eher Ersthelfer, die so stationiert sind, dass sie schnell überallhin kommen.
Mit ihren leuchtenden Sicherheitswesten bilden sie eine lebende Barriere, damit uns die anderen Skater nicht über den Haufen fahren, während sie mich verbinden und mit Desinfektionsmittel mein Blut vom Beton wischen.
Ein vierter Mitarbeiter in Managerweste kommt herangerollt. Ausgerechnet Jebediah Holt.
»Ich hätte den Versuch abbrechen sollen«, murmele ich widerstrebend.
»Machst du Witze? Niemand hätte ahnen können, dass es schiefgeht.« Seine tiefe Stimme ist besänftigend, während er sich neben mich kniet. »Und ich bin froh, dass du wieder mit mir sprichst.« Er trägt Cargoshorts und ein dunkles T-Shirt unter seiner Weste. Das Schwarzlicht lässt mit bläulichen Blitzen seine gebräunten Arme aufleuchten.
Ich ziehe an den Riemen meines Helms. Im Licht seiner Grubenlampe fühle ich mich wie unter einem Scheinwerfer. »Hilfst du mir, das Ding abzunehmen?«, frage ich.
Jeb beugt sich vor, um mich trotz der lauten Musik zu verstehen. Sein Rasierwasser – ein Mix aus Schokolade und Lavendel – vermischt sich mit seinem Schweiß zu einem Duft, der so vertraut und verlockend ist wie Zuckerwatte für ein Kind auf dem Jahrmarkt.
Er legt mir die Finger unters Kinn und öffnet die Schnalle. Als er mir hilft, den Helm abzunehmen, streift sein Daumen mein Ohrläppchen, sodass es kribbelt. Der grelle Schein seiner Lampe blendet mich. Ich kann nur die dunklen Stoppeln auf seinem Kinn ausmachen, diese geraden weißen Zähne (mit Ausnahme des linken Eckzahns, der leicht schief vor dem Schneidezahn steht) und den kleinen Eisenstachel unter seiner Unterlippe.
Taelor hat wegen seines Piercings lange auf ihn eingeredet, aber er weigert sich, es loszuwerden, was es mir nur umso lieber macht. Sie ist erst seit zwei Monaten seine feste Freundin. Sie hat kein Recht, darüber zu entscheiden, was er tut.
Jeb umfasst mit einer schwieligen Hand meinen Ellbogen. »Kannst du aufstehen?«
»Natürlich kann ich das«, blaffe ich, nicht absichtlich schroff, nur nicht erpicht darauf, im Mittelpunkt zu stehen. Sobald ich mein Bein belaste, schießt ein stechender Schmerz durch meinen Knöchel, und ich krümme mich. Ein Mitarbeiter stützt mich von hinten, während sich Jeb hinsetzt, um seine Blades und Socken auszuziehen. Bevor ich ahne, was er vorhat, hebt er mich hoch und trägt mich aus der Bowl.
»Jeb, ich will selbst gehen.« Ich lege ihm die Arme um den Hals, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Auch wenn ich sie im Dunkeln nicht sehen kann, spüre ich das Grinsen der anderen Skater, während wir vorbeigehen. Sie werden mich noch ewig daran erinnern, dass ich wie eine Diva rausgetragen worden bin.
Jeb drückt mich fester an sich, was es schwer macht, zu ignorieren, wie nah wir uns sind: meine Hände um seinen Hals geschlungen, sein Oberkörper an meinen Rippen … sein Bizeps drückt gegen mein Schulterblatt und mein Knie.
Als er vom Beton auf Holzboden tritt, gebe ich es auf, mich zu wehren.
Zuerst denke ich, dass wir ins Café gehen, aber wir lassen die Ladenpassage links liegen und drehen nach rechts ab Richtung Eingangsrampe. Seine Helmlampe weist uns den Weg. Mit der Hüfte schiebt Jeb die Türen auf. Ich blinzele und brauche einen Augenblick, um mich an das helle Licht draußen zu gewöhnen. Warme Windstöße lassen mir das Haar ums Gesicht fliegen.
Er setzt mich sanft auf den sonnengewärmten Beton, lässt sich neben mich fallen, nimmt seinen Helm ab und schüttelt sich das Haar aus. Er hat es seit einigen Wochen nicht geschnitten und es reicht ihm bis zur Schulter. Dicke Ponyfransen hängen ihm tief ins Gesicht – ein schwarzer Vorhang, der seine Nase berührt. Er bindet sich das rotblaue Halstuch vom Schenkel los, wickelt es sich um den Kopf und knotet es im Nacken zu, um die Strähnen aus seinem Gesicht zu halten.
Mit seinen dunkelgrünen Augen betrachtet er den Verband an meinem Knie, aus dem Blut sickert. »Ich habe dir gesagt, dass du eine neue Ausrüstung brauchst. Die Riemen deiner Knieschützer nähern sich schon seit Wochen der Auflösung.«
Jetzt geht das wieder los. Schon ist er im Großer-Bruder-Ersatz-Modus, obwohl er nur zweieinhalb Jahre älter ist als ich und nur eine Klasse über mir. »Du hast wieder mit meinem Dad geredet, stimmt’s?«
Ein angespannter Ausdruck legt sich über seine Züge und er macht sich an seinen Knieschützern zu schaffen. Ich tue es ihm nach und nehme den letzten ebenfalls ab.
»Tatsächlich«, sage ich und beschimpfe mich im Geiste, dass ich nicht klug genug bin, mich in meine Schweigeblase zurückzuziehen, »sollte ich dankbar sein, dass du und Dad mir überhaupt erlauben, hierherzukommen. Da es doch so dunkel ist und mir hilflosem, armem Wesen alle möglichen schlimmen Dinge zustoßen könnten.«
Ein Muskel in Jebs Kiefer zuckt, ein sicheres Zeichen dafür, dass ich einen Nerv getroffen habe. »Das hat gar nichts mit deinem Dad zu tun. Abgesehen von der Tatsache, dass ihm ein Sportwarenladen gehört, weshalb du keine Ausrede dafür hast, deine Ausrüstung nicht in Schuss zu halten. Skateboarden kann gefährlich sein.«
»Ja. Genau wie London gefährlich ist, richtig?« Wütend starre ich zu den glänzenden Autos auf dem Parkplatz hinüber und streiche über die Falten meines roten T-Shirts: darauf ist ein blutendes Herz gedruckt, eingewickelt in Stacheldraht. Könnte genauso gut eine Röntgenaufnahme meiner Brust sein.
»Klasse.« Er wirft seine Knieschoner beiseite. »Also, du bist nicht drüber weg.«
»Was gibt es, worüber ich hinwegkommen müsste? Statt für mich einzutreten, hast du dich auf seine Seite gestellt. Jetzt kann ich erst dorthin, wenn ich meinen Abschluss habe. Warum sollte mich das stören?« Ich zupfe an meinen fingerlosen Handschuhen, um meine Zunge in Zaum zu halten.
»Zumindest wirst du deinen Abschluss machen, wenn du hierbleibst.« Jeb reißt den Klettverschluss an seinen Ellbogenschonern auf, als wollte er seinen Standpunkt unterstreichen.
»Ich hätte dort ebenfalls meinen Abschluss gemacht.«
Er schnaubt. Wir sollten darüber nicht diskutieren. Die Enttäuschung ist einfach noch zu frisch. Ich war so begeistert von dem Auslandsstudienprogramm, das es Oberstufenschülern ermöglicht, ihr letztes Highschooljahr in London zu beenden, während sie gleichzeitig Leistungspunkte von einer der besten Kunsthochschulen dort erhalten. Genau der Hochschule, die Jeb besuchen wird.
Da er bereits sein Stipendium erhalten hat und im Spätsommer nach London ziehen will, hat Dad ihn vor zwei Wochen zum Abendessen eingeladen, um mit ihm über das Programm zu sprechen. Ich fand, dass es eine großartige Idee war, weil ich mit Jeb an meiner Seite praktisch schon im Flugzeug saß. Und dann haben sie zusammen beschlossen, dass ich noch nicht so weit bin. Sie haben es beschlossen.
Dad macht sich Sorgen, weil Alison eine Abneigung gegen England hat – zu viel Liddell-Familiengeschichte. Er glaubt, wenn ich dort hingehe, würde das einen Rückfall bei ihr auslösen. Sie wird bereits mit mehr Nadeln gestochen als die meisten Junkies auf der Straße.
Zumindest waren seine Bedenken begründet. Ich habe immer noch nicht begriffen, warum sich Jeb dagegen ausgesprochen hat. Aber was spielt es jetzt noch für eine Rolle? Die Antragsfrist ist letzten Freitag abgelaufen, also lässt es sich nicht mehr ändern.
»Verräter«, murmele ich.
Er senkt den Kopf und zwingt mich, ihn anzusehen. »Ich versuche wie immer, dein Freund zu sein. Du bist noch nicht so weit, dein Dad ist dann zu weit weg … dort passt niemand auf dich auf.«
»Du bist doch da.«
»Aber ich kann nicht jede Sekunde bei dir sein. Mein Stundenplan wird der reine Wahnsinn.«
»Ich brauche niemanden, der jede Sekunde bei mir ist. Ich bin kein Kind mehr.«
»Hab ich auch nie gesagt. Aber du triffst nicht immer die besten Entscheidungen. Das hier ist ein typisches Beispiel.« Er zwickt mir ins Schienbein, zieht den zerrissenen Stoff meiner Leggings hoch und lässt ihn zurück auf meine Haut schnappen.
Ein Stich der Erregung durchzuckt mein Bein. Ich runzele die Stirn und rede mir ein, dass ich einfach kitzelig bin. »Also, es ist mir nicht erlaubt, ein paar Fehler zu machen?«
»Keine Fehler, die dich verletzen können.«
Ich schüttele den Kopf. »Als würde es mich nicht verletzen, hier festzusitzen. In einer Schule, die ich nicht ausstehen kann, mit Klassenkameraden, die es lustig finden, Witze über den weißen Kaninchenschwanz zu reißen, den ich verstecke. Vielen Dank dafür, Jeb.«
Er seufzt und richtet sich auf. »Okay. Alles ist meine Schuld. Ich schätze, es ist auch meine Schuld, dass du gerade in Beton gebissen hast.«
Die Anspannung in seiner Stimme zerrt an mir. »Nun, der Sturz war irgendwie deine Schuld.« Meine Stimme wird weicher, eine bewusste Anstrengung, die Anspannung zwischen uns zu lockern. »Ich würde den Sprung längst mit links schaffen, wenn du mir immer noch Skateboardunterricht geben würdest.«
Jebs Lippen zucken. »Also, der neue Lehrer, Hitch … Er bringt es nicht?«
Ich boxe ihn und baue etwas aufgestaute Frustration ab. »Nein, für meine Zwecke bringt er es nicht.«
Jeb tut so, als zucke er zusammen. »Er würde es bestimmt gern machen. Aber ich habe ihm gesagt, ich würde ihm in den Arsch …«
»Als hättest du was zu sagen.« Hitch ist neunzehn und der Ansprechpartner für gefälschte Papiere und Partydrogen. Er hat eine Bewährungsstrafe. Ich bin klug genug, mich nicht mit ihm einzulassen, aber das hier ist mein Auftritt.
Jeb wirft mir einen Blick zu. Ich spüre, dass gleich ein Vortrag darüber kommt, wie übel es ist, sich mit einem Aufreißer einzulassen.
Ich schnippe mit einem blauen Fingernagel einen Grashüpfer von meinem Bein, um zu verhindern, dass sein Flüstern alles noch peinlicher macht, als es ohnehin schon ist.
Glücklicherweise schwingen von hinten die Doppeltüren auf. Jeb rutscht weg, um zwei Mädchen durchzulassen. Eine Wolke pudrigen Parfums umweht uns, während sie vorbeigehen und Jeb zuwinken. Er nickt zurück. Wir beobachten, wie sie in einen Wagen steigen und den Parkplatz verlassen.
»Hey«, sagt Jeb. »Heute ist Freitag. Solltest du nicht deine Mom besuchen?«
Ich nehme den Themenwechsel gern auf. »Ich treffe mich dort mit Dad. Und dann habe ich Jen versprochen, die beiden letzten Stunden ihrer Schicht zu übernehmen.«
Nach einem Blick auf meine zerrissenen Kleider schaue ich in den Himmel, der das gleiche verblüffende Blau hat wie Alisons Augen. »Ich hoffe, ich habe Zeit, zu Hause vorbeizuspringen und mich umzuziehen, bevor ich zur Arbeit gehe.«
Jeb steht auf. »Ich mache Feierabend«, sagt er. »Ich hol dein Brett und deinen Rucksack und fahr dich zur Anstalt.«
Das ist das Letzte, was ich brauche.
Weder Jeb noch seine Schwester Jenara haben Alison jemals kennengelernt; sie haben nur Bilder von ihr gesehen. Sie wissen nicht einmal die Wahrheit über meine Narben oder warum ich Handschuhe trage. Alle meine Freunde denken, ich hätte als Kind zusammen mit meiner Mom einen Autounfall gehabt, bei dem die Windschutzscheibe mir die Hände zerfetzt und ihr Gehirn verletzt hat. Dad gefällt die Lüge nicht, aber die Realität ist so bizarr, dass er mir erlaubt, die Geschichte auszuschmücken.
»Was ist mit deinem Motorrad?« Ich greife nach dem erstbesten Strohhalm und denke an Jebs frisierte Honda CT70, die nirgendwo auf dem Parkplatz zu sehen ist.
»Sie haben Regen vorhergesagt, daher hat Jen mich hergebracht«, antwortet er. »Dein Dad kann dich später zur Arbeit bringen und ich fahre deinen Wagen nach Hause. Dafür muss ich keinen Umweg machen.«
Jebs Familie wohnt in der anderen Hälfte unseres Doppelhauses. Dad und ich haben uns nach ihrem Einzug an einem Sommermorgen bei ihnen vorgestellt. Jeb, Jenara und ich wurden dicke Freunde, noch bevor im Herbst die sechste Klasse begann – dick genug, dass Jeb am ersten Schultag unter dem überdachten Durchgang einen Jungen verprügelte, der mich die Liebessklavin des Verrückten Hutmachers genannt hatte.
Jeb setzt eine Sonnenbrille auf und arrangiert den Knoten des Halstuchs an seinem Hinterkopf neu. Die Sonne scheint auf die glänzenden, runden Narben, die seine Unterarme übersäen.
Ich drehe mich zu den Autos auf dem Parkplatz um. Gizmo – mein 1975-er Gremlin, benannt nach einer Figur in einem Film aus den 80ern, in dem Dad und Alison bei ihrem ersten Date waren – steht nur wenige Meter entfernt. Es kann gut sein, dass Alison mit Dad im Gemeinschaftsraum auf mich wartet. Wenn Jeb schon wegen London nicht auf meiner Seite stand, wie soll ich ihn dann mit der verrücktesten Nuss bekannt machen, die je von meinem Familienstammbaum gefallen ist?
»Oh-oh«, sagt Jeb. »Ich kenne deinen Blick. Auf keinen Fall kannst du mit einem verstauchten Knöchel die Kupplung treten.« Er streckt eine Hand aus. »Rück sie raus.«
Ich verdrehe die Augen und werfe ihm die Schlüssel in die Hand.
Er schiebt sich die Sonnenbrille bis zum Halstuch hoch. »Warte hier, dann bringe ich dich nach Hause.«
Als die Tür zur Anlage hinter ihm zufällt, schlägt mir ein Schwall klimatisierter Luft entgegen. Etwas kitzelt mein Bein. Diesmal wische ich den Grashüpfer nicht weg, und ich höre sein Wispern ganz deutlich: »Dem Untergang geweiht.«
»Ja«, flüstere ich zurück, streichele seine geäderten Flügel und ergebe mich meinen Wahnvorstellungen. »Es ist alles vorüber, sobald Jeb Alison kennenlernt.«
2
Stacheldraht & schwarze Flügel
Die Anstalt – Soul’s Asylum – liegt fünfundzwanzig Autominuten von der Stadt entfernt.
Die Nachmittagssonne brennt vom Himmel und funkelt grell auf der Motorhaube. Sobald man an den Gebäuden, Einkaufszentren und Häusern vorbei ist, wird es in Pleasance recht eintönig. Nur noch flache, trockene Landschaft mit spärlichen Sträuchern und dürren Bäumen.
Wenn Jeb ein Gespräch beginnt, murmele ich eine einsilbige Antwort. Dann drehe ich die Lautstärke des neu eingebauten CD-Players auf.
Endlich kommt ein Song – etwas Stimmungsvolles, von dem ich weiß, dass Jeb es hört, wenn er malt –, und er fährt in stiller Versunkenheit weiter. Das Eis in dem Beutel, den er mir für meinen geschwollenen Knöchel mitgebracht hat, ist inzwischen geschmolzen, und ich wackle mit dem Fuß, damit er herunterrutscht.
Ich kämpfe gegen die Schläfrigkeit an, denn ich weiß, was mich im Schlaf erwartet. Ich muss nicht mitten am Nachmittag meinen Alice-Albtraum noch einmal durchleben.
Als Teenager hat Alicia, Alisons Mutter, die Wunderlandfiguren auf jede Wand ihres Hauses gemalt und beharrlich behauptet, dass sie echt seien und in Träumen zu ihr sprächen. Jahre später machte Alicia einen großen Satz aus ihrem Krankenhauszimmer im zweiten Stock, um ihre »Flügel« auszuprobieren, nur wenige Stunden, nachdem sie meine Mom zur Welt gebracht hatte. Sie landete in einem Rosenbusch und brach sich das Genick.
Einige sagen, sie habe Selbstmord begangen – postnatale Depression und Trauer um den Verlust ihres Ehemanns, der einige Monate zuvor bei einem Fabrikunfall gestorben war. Andere sagen, man hätte sie lange vor der Geburt des Kindes einsperren sollen.
Nach dem Tod ihrer Mutter wurde Alison von einer Reihe von Pflegeeltern großgezogen. Dad glaubt, diese Unbeständigkeit habe zu ihrer Krankheit beigetragen. Ich weiß, es steckt noch mehr dahinter, etwas Erbliches, wegen meines wiederkehrenden Albtraums und den Insekten und Pflanzen. Und weil ich die Anwesenheit von jemand anderem in mir fühle. Sie macht sich immer dann bemerkbar, wenn ich Angst habe oder zögere, und sie treibt mich dazu, an meine Grenzen zu gehen.
Ich habe mehrere Sachen über Schizophrenie gelesen. Stimmen zu hören, soll ein Symptom sein – aber nicht flügelschlagähnliches Dröhnen im Schädel. Andererseits, wenn ich das Geflüster von Blumen und Insekten dazuzähle, höre ich jede Menge Stimmen. Und nach jeder dieser Einschätzungen bin ich krank.
Plötzlich habe ich einen Kloß in der Kehle, ich schlucke ihn herunter.
Auf der CD wechselt der Song, und ich konzentriere mich auf die Melodie und versuche, alles andere zu vergessen. Jeb schaltet hoch; der Wagen zieht eine Staubschleppe hinter sich her. Ich betrachte Jebs Profil. Irgendwo in seinem Stammbaum ist etwas Italienisches und er hat einen wirklich tollen Teint – olivfarben, rein und weich.
Er neigt den Kopf in meine Richtung. Ich drehe mich zum Rückspiegel und beobachte, wie der Lufterfrischer hin und her baumelt. Ich habe ihn erst heute aufgehängt.
Auf Ebay gibt es einen Anbieter, der individuelle Lufterfrischer für zehn Dollar das Stück anfertigt. Man braucht nur ein Foto zu mailen, und sie drucken es einem auf einer Duftkarte aus, dann schicken sie das fertige Produkt per Post. Vor zwei Wochen habe ich von meinem Geburtstagsgeld zwei davon gekauft, eine für mich und eine für Dad – die er in seinem Truck noch nicht aufgehängt hat. Er hat sie in seiner Brieftasche; ich frage mich, ob sie dort für immer versteckt bleiben wird, weil es zu schmerzlich für ihn ist, sie jeden Tag zu sehen.
»Es macht sich ganz gut«, sagt Jeb und deutet mit dem Kopf auf den Lufterfrischer.
»Ja«, murmele ich. »Es ist Alisons Foto, daher musste es ja so sein.«
Jeb nickt, und sein unausgesprochenes Verständnis ist tröstlicher als die wohlmeinenden Worte anderer Leute.
Ich starre das Foto an. Es ist ein Bild von einer riesigen Motte mit schwarzen Flügeln aus einem von Alisons alten Alben. Die Aufnahme ist große Klasse, die Art, wie die Flügel auf einer Blume gespreizt sind, zwischen Licht und Schatten, schwankend zwischen zwei Welten. Alison hat früher Dinge gesehen, die die meisten Menschen nicht bemerkt hätten – Momente, in denen Gegensätze kollidieren und dann nahtlos miteinander verschmelzen. Da stellt sich mir die Frage, wie erfolgreich sie vielleicht gewesen wäre, wenn sie nicht den Verstand verloren hätte.
Ich tippe gegen den Lufterfrischer und schaue zu, wie er hin und her baumelt. Die Motte war mir immer vertraut – auf unheimliche Weise faszinierend und gleichzeitig beruhigend.
Mir kommt der Gedanke, dass ich nichts von ihr weiß – zu welcher Art sie gehört, wo sie lebt. Wenn ich es herausfände, würde ich vielleicht wissen, wo Alison war, als sie das Foto gemacht hat, und irgendwie könnte ich mich ihr dann näher fühlen, aber ich kann nicht fragen. Sie ist sehr heikel, was ihre Alben betrifft.
Ich fische mein iPhone aus der Gesäßtasche und suche online nach leuchtende Motte.
Nach gut zwanzig Seiten mit Tattoos, Logos, Werbung für Schlafmittel und Kostümdesigns finde ich eine Zeichnung von einer Motte. Sie passt nicht perfekt zu Alisons, aber der Körper ist leuchtend blau, und die Flügel schimmern schwarz, also ist sie ähnlich genug.
Als ich auf das Bild klicke, wird das Display schwarz. Ich will gerade den Browser neu starten, da hält mich ein rotes Aufblitzen zurück. Der Bildschirm blinkt rot, als wäre es ein Herzschlag. Im gleichen Takt scheint die Luft um mich herum zu pulsieren.
Eine Website erwacht flackernd zum Leben. Weiße Schrift und bunte Grafiken, anschaulich vor einem schwarzen Hintergrund. Als Erstes fällt mir der Titel auf: Netherlinge– Bewohner des Netherreichs.
Als Nächstes folgt eine Definition: Eine dunkle und verdrehte Rasse übernatürlicher Wesen, heimisch in einer uralten, tief im Herzen der Erde verborgenen Welt. Die meisten benutzen ihre Magie, um Unfug zu treiben und Rache zu nehmen, doch einige wenige haben eine Schwäche für Freundlichkeit und Mut.
Ich scrolle durch Bilder, die genauso gewalttätig und schön sind wie die von Jeb: phosphoreszierende, regenbogenfarbene Kreaturen mit Glupschaugen und funkelnden, seidenen Flügeln, die Messer und Schwerter tragen. Grässliche nackte Kobolde in Ketten, die auf allen vieren kriechen und Korkenzieherschwänze und gespaltene Füße haben wie Schweine. Silbrige, elfenartige Wesen, die in Käfigen gefangen sind und ölige schwarze Tränen weinen.
Dem Text zufolge können Netherlinge in ihren wahrsten Gestalten wie so ziemlich alles aussehen: Sie können klein sein wie eine Rosenknospe oder größer als ein Mensch. Einige können Sterbliche sogar nachahmen und das Aussehen existierender Menschen annehmen, um ihre Umgebung zu täuschen.
Als ich die nächste Zeile lese, wächst ein unbehaglicher Knoten in meiner Brust: Während sie in der sterblichen Welt Chaos stiften, bleiben Netherlinge mit ihrer Art in Verbindung, indem sie Pflanzen und Insekten als Sprachrohr zum Netherreich benutzen.
Mir stockt der Atem. Die Worte tanzen um mich herum, ein schwindelerregendes Auf und Ab gebrochener Logik. Wenn das wahr wäre und nicht nur die seltsame Fantasie eines Spinners im Internet, würde es bedeuten, dass Alison und ich mit diesen unheimlichen, mystischen Kreaturen einiges gemeinsam hätten. Aber das kann nicht wahr sein.
Der Wagen holpert durch ein Schlagloch und ich lasse das Handy fallen. Als ich es aufhebe, sind die Website und jedes Signal weg. »Mist!«
»Nein. Schlagloch.« Jeb schaltet runter und wirft einen trägen Blick in meine Richtung – Mr Cool hinter der Sonnenbrille.
Ich funkele ihn an. »Behalte lieber die Straße im Auge, falls da noch mehr sind, du Genie.«
Er schaltet vom dritten in den vierten Gang und grinst. »Heftiges Solitairespiel?
»Insektenrecherche. Hier musst du rechts.«
Ich lasse das Telefon in meinen Rucksack fallen. Ich bin so angespannt wegen des Besuchs in der Anstalt, dass ich den Text wahrscheinlich falsch verstanden habe. Obwohl ich davon fast überzeugt bin, will sich der Knoten in meinem Magen nicht lösen.
Jeb biegt auf die lange, gewundene Straße ein. Wir fahren an einem verblassten Schild vorbei: SOUL’S ASYLUM: BIETETDEMERSCHÖPFTENGEISTRUHEUNDFRIEDEN – SEIT 1942.
Frieden. Ja, richtig. Wohl eher medikamentenbedingte Katatonie.
Ich kurbele das Fenster herunter und lasse die warme Brise herein. Gizmo läuft im Leerlauf, während wir darauf warten, dass sich das automatische schmiedeeiserne Tor öffnet.
Ich klappe das Handschuhfach auf und fische einen kleinen Kosmetikbeutel heraus, zusammen mit den Haarverlängerungen aus schimmerndem blauen Garn, bei deren Fertigung mir Jenara geholfen hat. Sie sind aneinandergereiht und geklammert, sodass sie wirken wie Rastalocken.
Wir rollen auf den fernen vierstöckigen Backsteinbau zu; er ragt blutrot in den klaren Himmel. Es hätte ein Pfefferkuchenhaus sein können, aber die weißen Schindeln des Giebeldachs sehen eher nach einem unvollständigen Gehirn aus als nach Zuckerguss.
Jeb parkt neben dem Pickup meines Dads und schaltet den Motor aus.
»Macht der Wagen das schon lange?« Jeb wirft seine Sonnenbrille aufs Armaturenbrett und konzentriert sich auf das Display hinter dem Lenkrad, um die Anzeigen zu überprüfen.
Ich ziehe meinen Zopf über die Schulter und schiebe das Gummiband runter. »Ungefähr seit einer Woche.« Nun hängen mir die Haare in platinfarbenen Wellen über die Brust, wie Alisons. Auf Wunsch meines Dads färbe ich mir weder die Haare, noch lasse ich sie schneiden, weil sie ihn an ihre erinnern. Also muss ich andere Wege finden, um mein Aussehen aufzupeppen.
Ich bücke mich, bis meine Haare wie ein Wasserfall über meine Knie fließen. Sobald ich das Gefühl habe, dass die Dreadlocks halten, hebe ich den Kopf und ertappe Jeb dabei, dass er mich beobachtet.
Sofort schaut er wieder auf das Armaturenbrett. »Wenn du meine Anrufe nicht ignoriert hättest, hätte ich mir den Motor mal ansehen können. Du solltest den Wagen nicht fahren, bis das in Ordnung gebracht ist.«
»Gizmo geht es gut. Nur ein wenig heiser. Vielleicht muss er mit etwas Salzwasser gurgeln.«
»Das ist kein Witz. Was machst du, wenn du mitten im Nirgendwo liegen bleibst?«
Ich zwirbele eine Haarsträhne um den Finger. »Hmm. Einem vorbeifahrenden Lkw-Fahrer etwas Dekolleté zeigen?«
Jeb beißt die Zähne zusammen. »Das ist nicht witzig.«
Ich kichere. »Oh, komm schon. Ist doch nur ein Scherz. Tatsächlich wäre nur ein wenig Bein nötig.«
Seine Lippen wölben sich leicht, aber das Lächeln ist im Handumdrehen wieder verschwunden. »Und das von einem Mädchen, das noch nicht einmal seinen ersten Kuss hatte.«
Er hat mich immer damit aufgezogen, dass ich eine Mischung zwischen Skaterstar und American Sweetheart sei. Sieht so aus, als wäre ich inzwischen auf prüde herabgestuft worden.
Ich stöhne. Es wird nichts nützen, es zu leugnen. »Schön. Ich würde mit meinem Handy jemanden anrufen und mit der Keule in der Hand und bei verschlossenen Türen sicher in meinem Wagen warten, bis Hilfe einträfe. So, bekomme ich jetzt eine Belohnung?«
Er klopft mit einem Finger gegen das Armaturenbrett. »Ich werde später rüberkommen und mir das ansehen. Du kannst in der Garage mit mir rumhängen. Genau wie früher.«
Ich nehme einen Lidschatten aus dem Kosmetikbeutel. »Das wäre schön.«
Sein Lächeln entfaltet sich – mit Grübchen und dem ganzen Drum und Dran –, und ich erhasche einen Blick auf den alten, verspielten, einem Flirt nicht abgeneigten Jeb. Mein Puls beschleunigt sich.
»Klasse«, sagt er. »Wie wär’s mit heute Abend?«
Ich schnaube. »Richtig. Taelor würde Zustände kriegen, wenn du den Schulball früher verlässt, um dich mit meinem Wagen abzugeben.«
Er lässt die Stirn auf das Lenkrad sinken. »Oh. Den Ball hatte ich ganz vergessen. Ich muss noch meinen Smoking abholen.« Er schaut auf die Uhr am Armaturenbrett. »Jen sagte, irgendein Typ hätte dich gefragt, aber du hättest nicht gehen wollen. Warum nicht?«
Ich zucke die Achseln. »Ich leide unter dieser Charakterschwäche. Man nennt sie auch Würde.«
Er schnaubt und hebt eine Flasche Wasser mit Himbeeraroma auf, die zwischen Handbremse und Armaturenbrett klemmt, und trinkt den Rest aus.
Ich öffne meine Puderdose und lege ein wenig Kajal über die bereits vorhandene Schminke, dann verlängere ich den Augenwinkel wie ein Katzenauge. Sobald ich mit einem Schwung die unteren Wimpern fertig getuscht habe, sticht meine eisblaue Iris gegen das Schwarz ab wie ein Leuchtstoffhemd unter den UV-Lichtern in Unterland.
Jeb lehnt sich in seinem Sitz zurück. »Gut gemacht. Du hast es geschafft, jede Ähnlichkeit mit deiner Mom zunichtezumachen.«
Ich erstarre. »Ich versuche nicht …«
»Komm schon, Al. Ich bin’s.« Er streckt eine Hand aus, um den Lufterfrischer anzutippen.
Die Motte dreht sich und erinnert mich wieder an die Website. Der Druck auf mein Brustbein wird stärker.
Ich werfe den Lidschatten in meine Tasche zurück und fische einen silbernen Lipgloss heraus, den ich mir auf die Lippen streiche, dann stopfe ich die Tasche zurück ins Handschuhfach.
Jebs Hand liegt neben meinem Ellbogen auf dem Armaturenbrett und seine Wärme überträgt sich auf mich. »Du hast Angst, dass du so wirst wie sie, wenn du so aussiehst wie sie. Und ebenfalls hier landest.«
Ich bin sprachlos. Er war schon immer in der Lage, mich zu durchschauen. Aber das … es ist, als wäre er buchstäblich in meinen Kopf gekrochen. Gott bewahre.
Meine Kehle wird trocken und ich starre auf die leere Wasserflasche zwischen uns.
»Es ist nicht einfach, in jemandes Schatten zu leben.« Seine Miene verdunkelt sich.
Er muss es wissen. Seine Narben gehen tiefer als die Brandwunden von Zigaretten, die er auf dem Körper und den Armen hat. Ich erinnere mich immer noch an die Zeit, nachdem sie eingezogen waren: die grauenvollen Schreie nebenan um zwei Uhr morgens, wenn er versuchte, seine Schwester und seine Mom vor seinem betrunkenen Vater zu beschützen. Das Beste, was Jebs Familie je passierte, war, dass Mr Holt vor drei Jahren eines Nachts seinen Lastwagen gegen einen Baum gefahren hat. Er hatte 3 Promille Alkohol im Blut.
Glücklicherweise fasst Jeb das Zeug niemals an. Seine dunklen Stimmungen lassen sich nicht gut mit Alkoholkonsum vereinbaren. Das hat er vor einigen Jahren erkannt, nachdem er bei einem Kampf beinahe einen Jungen getötet hätte. Das Gericht hat Jeb für ein Jahr in den Jugendknast geschickt.
Deshalb konnte er seinen Abschluss erst mit neunzehn machen. Er hat zwölf Monate seines Lebens verloren, aber eine Zukunft gewonnen, denn während des Jugendarrests hat ihm ein Psychologe geholfen, seine Verbitterung durch Kunst in Schach zu halten, und er hat ihn gelehrt, dass Struktur und Ausgeglichenheit am besten dabei helfen, seinen Zorn zu zügeln.
»Vergiss nur nicht«, sagt er und fädelt seine Finger zwischen meine. »Bei dir ist es nicht erblich. Deine Mom hatte einen Unfall.«
Unsere Hände berühren sich nur mit meinen Handschuhen dazwischen, und ich drücke meinen Unterarm gegen seinen, um die Schwellungen seiner Narben zu spüren.
Du irrst dich, hätte ich gern gesagt. Ich bin genau wie du. Aber ich kann nicht. Tatsache ist, Alkoholiker haben Programme, Schritte, die sie machen können, um sich in die Gesellschaft einzufügen und zu funktionieren. Verrückte wie Alison – die haben nur Gummizellen und stumpfe Utensilien. Das ist ihre Normalität.
Unsere Normalität.
Als ich nach unten schaue, bemerke ich, dass Blut durch den Verband an meinem Knie gesickert und getrocknet ist. Ich streiche darüber und mache mir Sorgen um Alison. Wenn sie Blut sieht, flippt sie aus.
»Hier.« Ohne dass ich auch nur ein Wort sagen muss, nimmt Jeb sein Bandana vom Kopf. Er beugt sich vor und bindet mir den Stoff ums Knie, um den schmutzigen Verband zu verbergen. Als er fertig ist, setzt er sich nicht wieder auf den Fahrersitz, sondern stützt einen Ellbogen aufs Armaturenbrett und streicht mit dem Finger über eine der blauen Rastalocken in meinem Haar. Sein Gesichtsausdruck ist ernst – entweder ausgelöst durch die Schwingungen unserer ungelösten Probleme oder unseres vertraulichen Gesprächs.
»Diese Dreadlocks sind superfest.« Seine Stimme ist leise und samtig, und mein Magen zieht sich zusammen. »Weißt du, du solltest wirklich zum Schulball gehen. Tauch einfach so auf und stoß alle vor den Kopf. Ich garantiere dir, dass du danach immer noch deine Würde haben wirst.«
Er mustert mein Gesicht mit einem Ausdruck, den ich sonst nur sehe, wenn er malt. Intensiv. Versunken. Als betrachte er sein Werk aus jedem Blickwinkel. Als betrachte er mich aus jedem Blickwinkel.
Er ist so nah, sein heißer Atem riecht nach Himbeeren. Sein Blick wandert zu dem Grübchen in meinem Kinn und meine Wangen werden heiß.
In meinem Hinterkopf erwacht dieses schattenhafte Gefühl, weniger eine Stimme als ein Vibrieren von Flügeln, die über mein Inneres streichen … es drängt mich, das Labret-Piercing seiner Unterlippe zu berühren. Instinktiv strecke ich die Hand aus. Als ich den silbrigen Stachel nachfahre, zuckt er nicht mal zusammen.
Das Metall ist warm und seine Bartstoppeln kitzeln meine Fingerspitze. Peinlich berührt von meiner Anmache fange ich an, mich zurückzuziehen.
Er hält meine Hand fest und drückt meine Finger an die Lippen. Seine Augen verdunkeln sich, werden schmal zwischen dichten Wimpern. »Al«, flüstert er.
»Schmetterling!« Dads Ruf dringt durch das offene Fenster.
Ich zucke zusammen und Jeb schnellt auf seine Seite des Wagens zurück. Dad kommt über den tadellos gepflegten Rasen geschlendert, in Khakihosen und einem dunkelblauen Poloshirt, auf dem in Silber Tom’s Sporting Goods gestickt ist.
Ich beruhige meinen rasenden Puls mit einigen tiefen Atemzügen.
Dad beugt sich vor, um durch mein Fenster zu schauen. »Hallo Jebediah.«
Jeb räuspert sich. »Hi, Mr Gardner.«
»Hmm. Vielleicht solltest du endlich anfangen, mich Thomas zu nennen.« Dad grinst, den Arm auf den Fensterrahmen gestützt. »Schließlich hast du gestern Abend deinen Abschluss gemacht.«
Jeb grinst stolz und jungenhaft. So benimmt er sich, wenn Dad in der Nähe ist. Mr Holt sagte ihm immer, dass er es niemals zu etwas bringen werde, und drängte ihn, von der Schule abzugehen und Vollzeit in der Reparaturwerkstatt zu arbeiten, aber mein Dad hat Jeb stets ermutigt, bis zum Abschluss auf der Schule zu bleiben. Wenn ich nicht immer noch sauer darüber wäre, dass sie sich wegen London gegen mich verschworen haben, würde ich den Moment ihrer Verbundenheit vielleicht tatsächlich genießen können.
»Also, mein Mädchen hat dich eingefangen, damit du ihren Chauffeur gibst?«, fragt Dad und wirft mir einen kecken Blick zu.
»Jepp. Sie hat sich sogar den Fuß verstaucht, um ihren Willen durchzusetzen«, witzelt Jeb.
Wie kann seine Stimme so fest klingen, während ich das Gefühl habe, als sei in meiner Brust ein Hurrikan entfesselt worden? Bringt es ihn nicht einmal ein klein wenig aus der Fassung, was zwei Sekunden zuvor zwischen uns geschehen ist?
Er dreht sich zur Rückbank und zieht die Holzkrücken hervor, die er aus dem Sanitätsraum von Unterland mitgebracht hat.
»Was ist passiert?« Dad öffnet meine Tür, Sorge steht ihm ins Gesicht geschrieben.
Ich schwinge langsam die Beine heraus und beiße die Zähne zusammen, weil ein pochender Schmerz in meinem Knöchel tobt. »Das Übliche. Beim Skateboardfahren geht es um praktisches Erproben, das weißt du doch?« Ich schaue Jeb an, als er auf die Beifahrerseite herüberkommt, und verbiete ihm im Geiste, Dad etwas von dem abgenutzten Knieschoner zu erzählen.
Jeb schüttelt den Kopf, und für eine Sekunde denke ich, dass er sich wieder gegen mich stellen wird. Stattdessen treffen sich unsere Blicke und mein Inneres schlägt einen Purzelbaum. Was hat ihn vorhin dazu veranlasst, mich so zu berühren? Es ist auch so schon komisch genug zwischen uns.
Dad hilft mir aufzustehen und hockt sich hin, um sich meinen Knöchel anzusehen. »Interessant. Deine Mom war davon überzeugt, dass etwas passiert ist. Sie sagte, du hättest dir wehgetan.« Er steht auf, zwei oder drei Zentimeter kleiner als Jeb. »Ich nehme an, sie vermutet einfach immer das Schlimmste, wenn du spät dran bist. Du hättest anrufen sollen.« Er umfasst meinen Ellbogen, während ich die Krücken unter den Armen in Position bringe.
»Tut mir leid.«
»Schon gut. Bringen wir dich hinein, bevor sie irgendetwas tut …« Dad reagiert auf meinen flehenden Blick und unterbricht sich. »Ähm, bevor unsere Eiscreme zu Käsekuchensuppe schmilzt.«
Wir schlendern auf den Gehweg zu, der mit Pfingstrosen gesäumt ist. Insekten tanzen auf Blumen, und um mich herum entsteht weißes Rauschen und weckt in mir den Wunsch, ich hätte meine Kopfhörer und den iPod dabei.
Auf halbem Weg zum Eingang schaut Dad über die Schulter. »Könntest du den Wagen in der Garage parken, falls es Regen gibt?«
»Geht klar«, antwortet Jeb. »Hey, Skatergirl …«
Ich bleibe hinter Dad stehen und drehe mich auf meinem heilen Fuß um, die Finger fest um die gepolsterten Krückengriffe gelegt. Ich betrachte Jebs Miene in der Ferne. Er wirkt so verwirrt, wie ich mich fühle.
»Wann arbeitest du morgen?«, fragt er.
Ich stehe da wie eine hirnlose Schaufensterpuppe. »Äh … Jen und ich haben die Mittagsschicht.«
»Okay. Fahr mit ihr hin. Ich sehe mir währenddessen Gizmos Motor an.«
Mir rutscht das Herz in die Hose. So viel dazu, dass wir rumhängen wie in alten Zeiten. Sieht so aus, als würde er jetzt mir aus dem Weg gehen. »In Ordnung. Sicher.« Ich schlucke meine Enttäuschung herunter und drehe mich um, um mit Dad weiterzuhumpeln.
Er fängt meinen Blick auf. »Alles in Ordnung zwischen euch beiden? Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ihr nicht zusammen in der Garage herumgewerkelt hättet.«
Ich zucke die Achseln, während er die Glastür öffnet. »Vielleicht leben wir uns auseinander.« Es tut weh, es zu sagen, mehr, als ich jemals laut zugeben werde.
»Er ist immer ein guter Freund gewesen«, erwidert Dad. »Ihr solltet das klären.«
»Ein Freund versucht nicht, dein Leben zu managen. Dafür gibt es Väter.« Ich ziehe die Augenbrauen hoch, um meinen Standpunkt zu betonen, dann humpele ich in das klimatisierte Gebäude.
Er folgt mir stumm.
Ich schaudere. Die lang gezogenen leeren Flure mit ihren gelben blinkenden Lichtern machen mich nervös. Weiße Kacheln verstärken die Geräusche und Krankenschwestern in pfefferminz-gestreiften Kitteln treiben verschwommen am Rand meines Gesichtsfelds vorbei. In der Arbeitskleidung sehen sie eher wie Freiwillige aus denn wie ausgebildete Gesundheitsprofis.
Während Dad mit der Krankenschwester am Empfang redet, zähle ich die Stacheldrahtstacheln auf meinem T-Shirt. Eine Fliege landet auf meinem Arm und ich schlage danach. Sie schwirrt um meinen Kopf herum, mit einem lauten Summen, das beinahe klingt wie »Er ist hier«, bevor sie den Flur hinunterfliegt.
Dad bleibt neben mir stehen, während ich der Fliege hinterherstarre. »Bist du dir sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist?«
Ich nicke und schüttele die Wahnvorstellung ab. »Ich weiß nur nicht, was mich heute erwartet.« Es ist nur eine halbe Lüge. Alison lässt sich in der Nähe von Pflanzen und Insekten zu sehr ablenken, sodass wir nicht sehr oft nach draußen gehen, aber heute hat sie um frische Luft gebettelt, und Dad hat ihren Arzt dazu überredet, es zu versuchen. Wer weiß, was dabei herauskommt?
»Ja. Ich hoffe, es bringt sie nicht allzu sehr aus dem Gleichgewicht …« Er verstummt, und seine Schultern sacken nach vorn, als drücke der gesammelte Kummer der letzten elf Jahre sie nieder. »Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, wie sie vorher war.« Er legt mir eine Hand in den Nacken, während wir Richtung Innenhof gehen. »Sie war so vernünftig. So gut beisammen. So sehr wie du.« Die letzten Worte flüstert er, vielleicht in der Hoffnung, dass ich sie nicht höre.
Aber ich höre sie, und der Stacheldraht spannt sich wieder einmal um mich, bis mein Herz erwürgt und zerrissen ist.
3
Die Spinne & die Fliege
Außer Alison sind noch ihre Krankenschwester und zwei Gärtner im Innenhof. Alison sitzt an einem der schwarzen gusseisernen Bistrotische. Selbst die Ausstattung muss an einem solchen Ort sorgfältig gewählt werden. Nirgendwo gibt es Glas, nur eine silbern glänzende Zierkugel, die solide auf einem Sockel befestigt ist. Der Boden sieht nur gepflastert aus, in Wirklichkeit ist er betoniert.
Da einige der Patienten bekanntermaßen mit Stühlen oder Tischen um sich werfen, sind diese im Beton fixiert. Aus der Mitte des Tisches sprießt ein schwarzrot gepunkteter Sonnenschirm wie ein riesiger Pilz und beschattet die Hälfte von Alisons Gesicht. Silberne Teetassen und Unterteller funkeln im Sonnenlicht. Drei Gedecke: eins für mich, eins für Dad und eins für sie.
Vor Jahren, als sie hier eingezogen ist, haben wir das Teeservice von zu Hause mitgebracht. Es ist ein Luxus, den die Anstalt zulässt, um sie am Leben zu erhalten. Alison weigert sich, irgendetwas zu essen – sei es ein Hacksteak oder Obstkuchen –, wenn es ihr nicht in einer Teetasse serviert wird.
Unser Karton Schokoladenkäsekucheneis wartet auf einem Platzdeckchen darauf, gelöffelt zu werden. An der Verpackung fließt Kondenswasser herunter.
Alisons platinblonder Zopf schwingt über der Rückenlehne ihres Stuhls und berührt fast den Boden. Ihre Stirnfransen hat sie mit einem schwarzen Stirnband gebändigt. Sie trägt ein blaues Kleid und eine lange Latzschürze darüber und hat mehr Ähnlichkeit mit Alice bei der Teegesellschaft des Verrückten Hutmachers als die meisten der Illustrationen, die mir je untergekommen sind.
Es reicht, dass mir schlecht wird.
Zuerst denke ich, sie redet mit der Krankenschwester. Aber die steht auf und streicht ihren Pfefferminzkittel glatt, um uns zu begrüßen, ohne dass Alison es auch nur bemerkt. Sie konzentriert sich zu sehr auf die Metallvase mit Nelken, die vor ihr steht.
Als ich die Stimmen der Nelken vor dem Lärmpegel im Hintergrund verstehen kann, wird meine Übelkeit schlimmer. Sie sagen, wie schmerzhaft es sei, an den Stielen abgeschnippelt zu werden, und sie beklagen sich über die Qualität des Wassers, in dem sie stehen. Dann bitten sie darum, wieder in die Erde gesteckt zu werden, damit sie in Frieden sterben können.
Jedenfalls höre ich das. Ich frage mich, was Alison wohl in ihrem verdrehten Geist hört. Der Arzt findet die Einzelheiten nicht heraus, und ich habe das Thema nie zur Sprache gebracht, weil es bedeuten würde, dass ich ihre Krankheit geerbt habe.
Dad wartet auf die Krankenschwester, aber sein Blick, schwer vor Enttäuschung und Sehnsucht, ruht weiter auf Alison.
Ein leichter Druck auf meinen rechten Arm lenkt meine Aufmerksamkeit auf das unnatürlich gebräunte Gesicht von Schwester Mary Jenkins. Der Duft, den sie verströmt, ist ein Mix aus angebranntem Toast und Talkumpuder. Ihr braunes Haar trägt sie zu einem Knoten frisiert und ein weißes Hochspannungslächeln verschleiert mir beinahe die Sicht.
»Hallöchen«, zwitschert sie. Wie gewöhnlich ist sie übertrieben quirlig – wie Mary Poppins. Sie mustert meine Krücken. »Huch! Hast du dir wehgetan, Herzchen?«
Nein. Mir sind hölzerne Gliedmaßen gewachsen. »Skateboard«, antworte ich, entschlossen, mich Dad zuliebe von meiner besten Seite zu zeigen, obwohl die jammernden Blumen auf dem Tisch mir unter die Haut gegangen sind.
»Du fährst immer noch Skateboard? So ein interessantes Hobby.« Für ein Mädchen, ergänzt ihr mitleidiger Blick besser, als Worte es jemals könnten. Sie betrachtet meine blauen Dreadlocks und das üppige Augen-Make-up mit grimmiger Miene. »Du darfst nicht vergessen, dass ein Unglück wie dieses deine Mom aufregen kann.«
Ich bin mir nicht sicher, ob sie meine Verletzungen oder meine Aufmachung meint.
Die Krankenschwester schaut über die Schulter zu Alison hinüber, die immer noch mit den Blumen tuschelt und uns nicht wahrnimmt. »Sie ist heute ein wenig überspannt. Ich sollte ihr etwas geben.« Schwester Poppins zieht langsam eine Spritze aus ihrer Tasche. Eines von vielen Dingen, die ich an ihr verabscheue: Sie scheint es zu genießen, ihren Patienten Spritzen zu geben.
Über die Jahre haben die Ärzte herausgefunden, dass Beruhigungsmittel am besten geeignet sind, um Alisons Ausbrüche zu kontrollieren. Aber sie verwandeln sie in einen sabbernden Zombie, der nicht mehr mitbekommt, was um ihn herum vor sich geht. Ich würde sie lieber wach und im Gespräch mit einer Küchenschabe sehen als so.
Ich sehe Dad böse an, aber er bemerkt es nicht einmal, weil er so beschäftigt damit ist, selbst die Stirn zu runzeln.
»Nein«, sagt er, und der tiefe, befehlende Ton seiner Stimme lässt die aufgemalten Augenbrauen der Krankenschwester hochfahren. »Ich werde Alyssa zu Ihnen schicken, falls es Probleme gibt. Und dort drüben sind die Gärtner, falls wir jemand Kräftigen brauchen.« Er deutet auf die beiden massigen Männer in der Ferne, die Zweige an einem Busch stutzen. Mit ihren riesigen Schnurrbärten und walrossförmigen Körpern, die in braunen Overalls stecken, könnten sie Zwillinge sein.