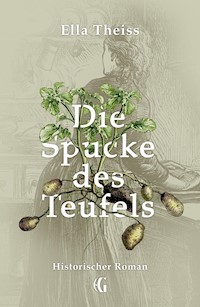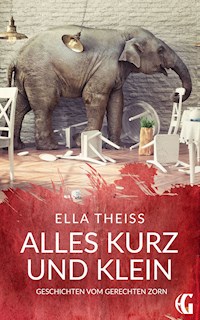9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Gegenwind
- Sprache: Deutsch
Ein authentischer Kriminalfall zur deutschen Biedermeierzeit, verwoben mit dem Schicksal des damals verfolgten Dichters und Revolutionärs Georg Bücher, dem Verfasser des "Woyzeck". Auch die damals 14-jährige Luise Büchner, spätere Frauenrechtlerin, spielt eine wichtige Rolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Autorin
Ella Theiss hat Germanistik und Sozialwissenschaften studiert, anschließend rund zwanzig Jahre unter ihrem Klarnamen Elke Achtner-Theiss als Redakteurin und Texterin gearbeitet, insbesondere im Themenbereich Ökologie und Bio-Lebensmittel. Seit 2008 schreibt sie auch Romane und Erzählungen. Mit ihrem historischen Krimi „Die Spucke des Teufels“ belegte sie Platz 2 zum Gerhard-Beier-Preis 2010. Für ihre Erzählungen und Kurzgeschichten erhielt sie mehrere Preise und Auszeichnungen.
Ella Theiss
Darmstädter Nachtgesänge
Historischer Roman
nach einem authentischen Kriminalfall
Neuauflage
Impressum:
Edition Gegenwind
© 2023 Ella Theiss: „Darmstädter Nachtgesänge“ (Neuauflage)
Umschlaggestaltung: Tilla Theiss unter Verwendung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv Darmstadt und des Gemäldes „Huile“ von Vilhelm Hammershoi
© bpk bildagentur / RMN Gran Palais / Michéle Bellot
Die Erstausgabe dieses Romans erschien 2021 bei
Verlag Edition Oberkassel unter dem gleichen Titel.
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-347-80497-5
Hardcover
978-3-347-80498-2
E-Book
978-3-347-80500-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin Ella Theiss verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Ähnlichkeiten mit Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.
1. Kapitel
Winter 1833 / 1834
Niemand
Er trägt sein Beil geschultert und stapft durch lichtes Gehölz. Nasskalte Luft, Dunstschleier hie und da. Gut so, keine Atemwolke wird ihn weithin verraten. Und doch dringt genug Nachmittagssonne durch die kahlen Wipfel, sodass es hell ist am Schmalberg, und dass er keine Sorge haben muss vor versteckten Baumwurzeln, über die er stolpern könnte, oder vor Schlammlöchern unter dem Moos, die an seinen Stiefeln saugen.
Er kennt den Waldstrich. Kennt ihn besser als mancher Förster der Grafschaft. Auch wo die Hasenfallen lauern, die er im Spätherbst gelegt hat, weiß er genau. Eine bei der umgestürzten Buche da hinten links, eine zwischen den zwei Eiben gleich daneben, eine in der Senke zwischen den Brombeeren. Sie sind leer geblieben, die Fallen. Bis jetzt. Im Frühjahr, um Ostern herum, da wird er Ernte halten. Ganz sicher.
Wie er erwartet hat, ist sonst keiner unterwegs. Jedenfalls kein Förster. – Oder doch? Er bleibt stehen, lauscht. Ein Eichelhäher. Ein Specht. Und das Pulsieren seines Bluts in den Ohren. So wenige Tage vor Weihnachten hocken alle am heimischen Herd. Sofern sie etwas haben, womit sie den Herd befeuern können. Aber auch wer nichts hat, der hat sich zuvor schon eingedeckt. Kahles Geäst abgehauener Wipfel liegt verstreut unweit des Wegs statt verborgen zwischen Hasel- oder Holunderbüschen. Baumstümpfe ragen zollhoch aus dem Laub, umringt von frischen weißen Spänen. Da sind Stümper am Werk gewesen. Jeder Sonntagsspaziergänger kann die Frevelei entdecken und der Grafschaft anzeigen.
Er sollte sich ein anderes Waldstück aussuchen, eine Meile nordwestlich, hinter einer der ausgedienten Köhlerplatten vielleicht. Entschlossen bahnt er sich einen Weg, meidet die Fichtenschonung, meidet die Lichtung, stapft geduckt eine Anhöhe hinauf. Sicher ist sicher.
So weit ist er noch nie gegangen. Dieser Teil des Walds scheint unberührt. Nester erfrorener Stockschwämmchen kleben auf moderndem Holz. Derart viel Wald hat der Graf, dass er nicht einmal die Pilze einsammeln lässt. Allein mit dieser Masse an Stockschwämmchen hätte die Mutter Suppe fürs ganze Dorf kochen können.
Da! Ein Rascheln, das Knacken kleiner Äste, wieder Rascheln. Erst weitab. Nun näher. Ein Wildschwein? Er wartet hinter einer dicken Eiche, späht in alle Richtungen, das Beil schlagbereit in der Rechten.
Kein Wildschwein. Ein Mann. Keinen Steinwurf entfernt. Ist in einen grauen Überwurf gehüllt, duckt sich hinter eine verwachsene Kiefer, starrt ihm entgegen. Unter einem tief in die Stirn gezogenen Schlapphut, wie er selbst einen trägt, blitzt das Weiße wie Angst aus seinen Augen.
Was soll der arme Teufel anderes hier wollen als er? Also nur Mut. Er tritt hinter der Eiche vor, lächelt breit, so breit, dass der andere seine Zähne erkennen muss, hebt die Hand zum Gruß und wendet sich wortlos ab. Geht ein paar Schritte ohne Eile. Nach Nordwesten, wie er beschlossen hat, wirft über das geschulterte Beil hinweg einen Blick zurück.
Der andere hat verstanden, tippt sich mit den Fingern an die Hutkrempe, wendet sich nach Osten. Der Wald ist groß genug für sie beide.
Kein Rascheln mehr. Er atmet auf, sucht sich dort, wo viele junge Buchen beisammen stehen, eine aus. Einen Fuß Durchmesser darf die Stange haben, mehr nicht. Und drei Ellen lang darf sie höchstens sein. Sonst schafft er sie nicht nach Hause. So eine Buchenstange gibt Glut für drei Abende und für eine schöne Kohlsuppe.
Er zieht die Fellhandschuhe aus, fasst das Beil mit beiden Händen, holt aus, schlägt zu … Ein Echo von irgendwoher. Er zögert, lauscht. Leises, langsames Pochen, das nachhallt. Das ist der andere. Alles gut! Er lächelt vor sich hin. Und holt erneut aus mit seinem Beil, haut beherzt in die Kerbe, die sein erster Schlag hinterlassen hat, die Rinde platzt auf. Wieder und wieder schlägt er zu, krachend splittert das frische grauweiße Holz, die Buche kippt, fällt, reißt abgestorbene Äste des Nachbarbaums mit sich.
Geschafft. Er nimmt den Hut ab, wischt sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Der größte Teil der Arbeit steht ihm noch bevor: das Aufräumen. Stümperei? Nicht bei ihm. Noch bevor die Dämmerung einsetzt, ist er fertig, beseitigt die letzten Spuren.
Ein Schrei durch die Stille. Heiser und dumpf. Ein Reh vielleicht. Er schultert die Stange mit einem Hauruck, will davon gehen. Wieder ein Schrei, nein, Gebrüll. Das ist kein Reh, das ist ein Mensch … der ruft, kommandiert. Etwas wie Haaalt! … Etwas wie Stejeblei-we! … Ein Schuss? War das ein Schuss? Jetzt ein Greinen, unbändig wie vor Schmerzen. Langgezogen, quälend langgezogen … Das Greinen erstirbt. Nur noch Stille.
Kein Zweifel, die Förster haben den anderen erwischt. Den mit dem Schlapphut, wie er selbst einen trägt. Gleich werden sie hier sein, werden auch ihn erwischen.
Er lässt die Buchenstange fallen, ebenso das Beil, er hetzt davon, die Arme vor dem Gesicht gekreuzt, um es vor dornigem Gestrüpp zu schützen. Er stolpert über Baumwurzeln, stürzt, rappelt sich auf, tritt in Morast, versinkt bis zum Knöchel, befreit sich, rutscht auf nassem Laub aus, stürzt noch einmal, diesmal mit dem Knie auf einen Gesteinsbrocken … Er blutet, egal, nur weiter!
Endlich gelangt er zur Chaussee. Festgetretener Schotter, ein bequemer Weg. Rechts geht es nach Momart, links nach Weiten-Gesäß. Nur ein Pferdefuhrwerk ist unterwegs, verschwindet hinter der Kurve am Hang.
Ruhig jetzt, ganz ruhig. Durchatmen, sich Holzspäne und Laub vom Mantelsaum klopfen, die schlammigen Moosfetzen von den Stiefeln wischen. Mit dem zerknüllten Hut in der Tasche gelassen weitergehen. Er ist ein Tagelöhner, der von der Arbeit kommt. Ein armer, aber rechtschaffener Mann auf dem Heimweg. Ein Niemand.
Der Gräflich Erbachische Unterförster Philipp Lust von Weiten-Gesäß war nach dem Zeugnisse seines ihm vorgesetzten Revierförsters einer der besten Forstschützen des Reviers; hinsichtlich seines Benehmens gegen die Holzfrevler wurden nie Klagen laut. Zur Zeit seines Todes 64 Jahre alt, war er noch rüstig, so dass er den ihm im Jahre 1801 übertragenen Unterförsterdienst noch gut versehen konnte. Er hinterließ eine Frau, drei Töchter und einen volljährigen Sohn, der über das Verschwinden seines Vaters angab: In den letzten acht bis vierzehn Tagen waren häufig gröbere Holzfrevel im Schmalberg, namentlich im sogenannten Sauschlag vorgefallen, so dass sich sein Vater fast jeden Abend dahin gewendet habe.
So wäre er auch am 17. Dezember 1833 des Nachmittags gegen Vier aus der Holzmacherei in der Litzart (einem Walde bei Weiten-Gesäß) in der Richtung nach dem Schmalberg weggegangen. Obgleich er nun nachts nicht nach Hause gekommen, so sei dieses doch nicht aufgefallen, weil dies in der Verrichtung seines Dienstes nicht selten vorgekommen sei. Indessen sei sein Vater auch bis zum Nachmittage des folgenden Tags nicht nach Hause gekommen, und so habe er sich besorgt auf den Weg gemacht (…).
Indessen habe sich gegen Nachmittag der Beigeordnete mit vielen Leuten hinzugesellt, und nun hätten Bernhard Walter und Matthäus Breidinger, zwei ganz unverdächtige Leute, seinen Vater in einem Fichtengebüsch im Rohr, vier Schritte unterhalb des Wegs, an einer Stelle, in deren Nähe er selbst mit ihm öfters Frevlern aufgepasst habe, getötet gefunden (…).
Aus den Aufzeichnungen des Untersuchungsrichters, zitiert nach »Annalen der deutschen und ausländischen Criminal-Rechtspflege«
Scherben
Der alte Lust getötet? Anna fällt die Terrine aus den Händen. Klirrend schlägt das Geschirr am Boden auf, zerschellt in einige grobe Scherben, zerstiebt in unzählige feine Splitter. Es ist die Suppenterrine mit den aufgemalten Efeuranken. War es. Die Hühnerfleischbrühe, die Anna in stundenlanger Arbeit aus Haut, Knochen, Krallen und Suppengrün zubereitet hat, breitet sich wie eine Pfütze schmutzigen Aufwischwassers auf den erst vorgestern gewachsten und gebohnerten Dielen aus. All die mühsam murmelgroß geformten Grießklößchen springen zwischen Stuhl- und Tischbeine, kullern bis unter die Anrichte. Am Boden zerstört ist alles. Auch Anna.
Herr Medizinalrat Dr. Büchner hat seiner Familie aus der Zeitung vorlesen wollen, wie er es oft vor dem Essen tut. Nur bis »getötet gefunden« ist er gekommen, da ist Anna das Malheur passiert. Nun sitzt er stumm am Tisch, hält die »Großherzoglich Hessische Zeitung« ausgebreitet in den erhobenen Händen, als müsse er das bedruckte Papier vor der Nässe bewahren. Er sieht so drein, wie er meistens dreinsieht und auch mit Vornamen heißt: Ernst.
Anna steht starr, wartet vergeblich darauf, dass der Alptraum sich auflöst. Der alte Lust ermordet, die Terrine kaputt, die Suppe ungenießbar. Für den Moment weiß Anna nicht, was schlimmer ist.
Familie Büchner hingegen gerät in Bewegung. Zuvorderst die zwei kleinen Buben. Sie begeben sich auf alle Viere und machen Jagd auf die Klößchen. Fräulein Mathilde schnellt von ihrem Stuhl hoch, zieht einen nach dem anderen am Ohrläppchen in eine aufrechte Position, schlägt dem sechsjährigen Alexander ein cremeweißes Beutestück samt anhängenden Glasursplittern aus dem Händchen. Sie darf das, sie ist die große Schwester.
Alexander greint und springt der Mutter wie ein Laubfrosch an den Hals.
Ob es wirklich Weiten-Gesäß heiße, fragt Wilhelm mit neugierigem Blick zum Vater hin. So wie weit und Gesäß. Wie viele Heranwachsende interessiert er sich besonders für Körperteile, über die im Allgemeinen selten gesprochen wird.
Ob das die Räuber gewesen seien, will Ludwig wissen. Er ist just neun geworden und liebt Räubergeschichten.
Ernst Büchner faltet die Zeitung zusammen und legt sie auf dem Fenstersims hinter sich ab. »Der Rest ist nichts für Kinderohren.«
Erst jetzt bemerkt der kleine Alexander, dass er am Daumen blutet. Er schreit, dass es in den Ohren wehtut. Mathilde eilt hinaus, um das Fläschchen mit der Jodtinktur zu holen. Da schreit Alexander umso ärger.
Endlich wacht Anna aus ihrer Erstarrung auf, rennt um Kehrwisch, Kehrrichtschaufel, Eimer und Lappen in die Putzkammer nebenan, scheuert und wienert. Dabei wischt sie sich mit dem Blusenärmel auch die eine oder andere Träne aus dem Gesicht. Gewiss wird man ihr Geld vom Lohn abziehen.
»Das kann jedem mal passieren«, sagt Georg, der Älteste und über die Maßen kluge Studiosus, der über Weihnachten aus Gießen zu Besuch ist.
Caroline Büchner, Mutter und stille Herrscherin über Haus, Hof und Garten, nickt und lächelt ihrem Gatten besänftigend zu. Schließlich ist Anna seit über einem Jahr im Dienst der Familie, und noch nie hat sie auch nur eine Blechkanne verbeult oder eine Tasse Minztee verschüttet.
Die Terrine sei sowieso hässlich gewesen, behauptet Mathilde.
Die kleine Luise hebt die Nase, schnuppert, stellt fest, dass es jetzt »viel besser riecht bei uns.« Das müssen alle zugeben. Denn der würzige Suppenduft hat den Geruch nach Ruß und kaltem Rauch verdrängt, der sich infolge eines defekten Kamins seit vergangener Woche im Esszimmer der Büchners eingenistet hat.
»Komm, Anna, lass uns die Hauptspeise auftragen.« Mutter Büchner macht eine aufmunternde Kopfbewegung in Richtung Tür und geht voran, dreht sich an der Schwelle noch einmal um. »Ihr Lieben, jetzt gibt’s Omelette mit Speck und Pilzen. Was haltet ihr davon?«
Eine gute Stunde später ist Anna allein mit den Essensresten, den schmutzigen Töpfen, Pfannen, Tellern und Gläsern, dem benutzten Besteck. Sie spült und trocknet, poliert und schrubbt, tut und macht. Die Arbeit beruhigt sie, allmählich wird sie Herr über ihren Schrecken. Und denkt nach. Was hat sie mit dem Tod vom Lust zu tun? Nichts. Zunächst einmal gar nichts. Allerdings muss sie wissen, was in der Zeitung steht. Wie ist der Mistkerl umgekommen? Wann genau und wo? Und vor allen: Wer wird verdächtigt?
Sie tritt in den Flur, hält Ausschau, nach links zur Eingangstür, nach rechts zur Hoftür, auch das Treppenhaus hinauf. Niemand da. Und doch verhält sie sich, als könne jemand sie beobachten. In einem Haus mit so vielen Kindern, die wie aus dem Nichts neben einem auftauchen, die einem fortwährend ihre Nasen entgegenrecken und warum-warum fragen, ist Vorsicht angebracht.
Wie beiläufig schlendert Anna ins Esszimmer. Die Zeitung liegt nicht mehr auf dem Fensterbrett, sie ragt aus dem Papierkorb. Das ist gut, sehr gut sogar. Sie trägt den Korb in die Küche, ihr Revier, wie um ihn zu leeren. Leise schließt sie die Tür, breitet die Bögen des dicht bedruckten Papiers auf der abgekühlten Herdplatte aus. Und liest.
Schon in der Schule hat Anna gelernt, wie sich Buchstaben zu Wörtern zusammenfügen. Auch wenn die Lehrerin an der Mädchenschule es selbst nicht recht konnte und mehr Wert auf korrektes Bügeln und sparsames Gemüseputzen legte, begriff Anna das Prinzip. Inzwischen hat sie das Lesen anhand eines Gesangbuchs geübt, das Pfarrer Stücker ihr zur Konfirmation geschenkt hat, damit sie ihre Stimme beim Kirchenchor hören lassen kann. Denn Anna hat eine herausragend schöne Singstimme, wie nicht nur der Herr Pfarrer befindet.
Zeitungen sind indes etwas anderes als Liederbücher. Durch die umständlichen Sätze mit den ungewöhnlichen Wörtern, wie sie in Zeitungen gedrängt beisammenstehen, findet Anna nur mit großer Aufmerksamkeit hindurch. Besonders verwirrend ist, dass die Schrift in zwei Spalten angeordnet wird, vielfach Einzüge, aber kaum Überschriften aufweist.
Anna fährt die Zeilen mit dem Zeigefinger ab, sucht nach kurzen Buchstabengruppen wie »Lust« und »Wald« und »tot«, lauter Wörter, die sie nicht erst entziffern muss, sondern auf Anhieb erkennt. Und da, auf einer der Seiten steht es mittendrin: Der Förster … in seinem Blut … Schädel eingeschlagen … Beil oder ähnliches … Die Polizei bittet um Hinweise … Anna schaudert es, richtet die Augen zur Decke. Lieber Gott, mach, dass es nicht der Rodrich war! Und greift sich einen Stoßseufzer später an die Stirn. Rückwärts gewandte Gebete machen keinen Sinn. Weiß doch jeder. Was der liebe Gott erst einmal zugelassen hat, kann er nicht mehr rückgängig machen. Anna selbst ist schuld, sie hätte verhindern müssen, dass Rodrich so weit abdriftet, dass er womöglich …
»Was ist dir, Anna?«, fragt die kleine Gestalt, die schief im Türrahmen steht und sie teilnahmsvoll mustert. Porzellanweiße, fast transparente Haut mit zartrosa Wangen, dunkle, zum Kranz geflochtene Locken, klar und gerade gezeichnete Brauen über einer feinen schmalen Nase. Nie hat Anna ein schöneres Kindergesicht gesehen.
»Es ist nix, Luischen, gar nix«, sagt sie rasch. »Es dauert mich nur, dass ich … die Terrine … «
»Hast du den toten Förster vielleicht gekannt, Anna? Der war aus der Gegend von Michelstadt, da kommst du auch her, gell?«
Ja, da kommt Anna auch her. Leugnen hilft nichts. Und den Lust, das Schreckgespenst, kannte jeder am Ort. Sie macht eine Kopfbewegung, die ja wie nein bedeuten kann. »Die eine Tochter vom ihm, die Helene, die ging mit mir in die Schule«, sagt sie und verkneift sich die Bemerkung, dass Helene eine Heulsuse war, die jedes Mal greinte, wenn sie der Lehrerin eine falsche Antwort gegeben hatte.
»Der Förster war ein strenger Mann, glaub ich«, ergänzt Anna, als sie Unzufriedenheit in Luises Blick bemerkt. Eilig knüllt sie die Zeitungsseite auf Schwammgröße zusammen, streicht eine Paste aus Schlämmkreide auf und wienert damit die Herdplatte, will vortäuschen, dass ihr heißes und bestimmt hochrotes Gesicht von der Anstrengung herrührt.
Das Kind verharrt in der Türfüllung. »Das kann jedem mal passieren«, zitiert es den großen Bruder. »Niemand ist dir gram, Anna.«
»Luischen, magst nachher mit mir zum Einkaufen?«
Natürlich will Luise mit zum Einkaufen, weil sie ein waches Kind ist, das gern rausgeht, den Menschen zusieht, zuhört. Und stundenlang über alles nachdenkt, was sie erfahren hat. Am liebsten laut und heftig disputierend. Still beim Ofen sitzen, häkeln, stricken, klöppeln wie andere Bürgermädchen ihres Alters ist nichts für Luise. Anna versteht das gut, sie war mit zwölf genauso.
Mutter Büchner sieht ein, dass ein erlebnishungriges Mädchen Ausgang braucht. Also darf Luise immer mit zum Einkaufen, wenn es draußen weder regnet noch windet noch gerade eine Seuche um sich greift. Damit der kleine Liebling sich bei der winterlichen Kälte keinesfalls eine Grippe holt, hilft Frau Büchner beim Ankleiden. Dicke Strickstrümpfe müssen unter die Stiefel, auch wenn Luise klagt, sie würden ihr die Knöchel wundscheuern. Über das Schultertuch muss eine wollene Pelerine mit eng anliegendem Schalkragen. Die soll nicht nur warmhalten, sondern auch den unebenen Rücken, Folge eines Unfalls in früher Kindheit, verstecken. Was Luise überflüssig findet: »Von meinem Buckel weiß eh jeder.« Auf den Kopf muss der wattierte Schutenhut, für die Hände gibt es einen Muff aus Kaninchenfell.
»Adieu, mein Liebling.«
»Adieu, liebe Frau Maman.« Luise haucht ihrer Mutter in alberner Geziertheit ein Küsschen auf jede Wange, wie es die Französinnen machen, und tippelt hinaus.
»Wer ihr das wohl beigebracht hat, Anna?«
»Ich war’s nicht, Frau Büchner.«
»Ich weiß, Anna. Bis später. Pass gut auf unseren Schatz auf.«
»Selbstverständlich, Frau Büchner.«
Der Akzessist in der Rheinstraße
Draußen scheint die Sonne von einem klaren Himmel und wärmt die Dezemberluft. Kaum sind sie ein paar Schritte gegangen, wirft Luise ihren Muff in den Einkaufskorb, lockert ihre Pelerine und hakt sich in Annas Arm ein. »Jetzt denken alle, du wärst meine große Schwester.«
Anna sieht an sich hinunter. Sie trägt ein altmodisches, aber gut erhaltenes Kattunkleid über ihrem Reifrock, ein Wolltuch mit Biesen über den Schultern und, wie Luise, einen hellen Schutenhut ohne Schleife. Die schwarzbraunen Lederstiefel sind ihr längst zu klein, aber sie glänzen frisch geputzt in der Sonne, genau wie Luises Stiefel. Und wenn sie nun auch noch untergehakt miteinander einhergehen … »Es ist aber nicht recht, eigentlich«, sagt Anna.
»Egal. Ist doch spaßig.«
»Das schon.« Anna macht kleine Schritte, damit Luise mühelos im gleichen Tritt mithalten kann, und schickt einen dankbaren Blick zum Himmel hinauf. Was für ein Kind!
Grafenstraße, Waldstraße, Rheinstraße … Die Büchners wohnen im vornehmsten Viertel von Darmstadt mit eleganten Wohnhäusern und Amtsgebäuden. Modisch dezentes Stuckwerk, Erker und Dachgauben überall, üppige Vorgärten, breite Straßen und wenig Verkehr. Manche nennen es »die Weststadt«, andere »die Mollerstadt«, weil ein Baudirektor namens Moller sie im Auftrag des früheren Großherzogs so entworfen hat. Viel Platz für ein aufstrebendes und sich rasch vergrößerndes Darmstadt sollte geschaffen werden. Die Einwohner mochten sich allerdings nicht ganz so rasch vermehren wie gedacht.
Vermehrt haben sich dafür die Hunde – allerlei neumodische Züchtungen wie Windhunde, Dalmatiner, Pinscher – und mit ihnen die Hundehaufen, die es sorgsam zu umrunden gilt. Anna, die kleinstädtische Enge und vor allem kleinstädtische Reinlichkeit gewohnt ist, kommt sich verloren vor. Aber Luise scheint sich wohlzufühlen, zumal sie immer was zum Gucken und Nachdenken findet: mal eine Laterne, die sich, aus ihrem Sockel gebrochen, schief übers Trottoir neigt, mal einen alten Mann, der armeschwenkend auf dem Fahrweg paradiert und die Marseillaise singt.
Diesmal gibt ihr eine Kutsche mit großherzoglichem Wappen Rätsel auf, die gut fünfzig Schritte von ihnen entfernt vor der ehemaligen Invalidenanstalt anhält. Seit wenigen Jahren ist das Gelände Sitz der vornehmen Druckerei Leske. Ein Lakai springt vom Bock, öffnet die Kutschentür, und kaum, dass ein wehender Militärmantel samt schwarzem Zweispitz herausgetreten ist, verschwindet er auch schon im Hoftor.
»Der wollte nicht erkannt werden«, glaubt Luise.
»Bestimmt ein Geheimagent«, sagt Anna. »Unter dem Mantel hat er eine Pistole.«
»Sei still, sonst kommt er raus und nimmt dich mit.«
»Nein, dich.«
Sie lachen, bleiben stehen, als Anna sich unversehens einen Rempler einfängt. »Aua!«
Ein hauchdünner Bursche in weißem Beinkleid, blauem Rock und mit schwarzem Tornister unter dem Arm witscht an ihnen vorbei, lässt ein flüchtiges »Pardon« fallen, ehe er mit wehenden Schößen weitereilt.
»So lang und breit die Rheinstraß’ ist, es wimmelt drin ein Akzessist«, zitiert Luise. Den Spruch hat Alexander neulich aus der Schule mit nach Hause gebracht. »Was ist ein Akzessist, Anna?«
»Einer, der mal ein vornehmer Staatsdiener werden will.«
»Wie Vater?«
»Genau.«
»Vater war auch mal einer?«
»Ich … ich glaube nicht.«
»Hallo, Sie, sind Sie ein Akzessist? Was wimmeln Sie so?«, ruft Luise dem Jüngling hinterher, der am Lieferanteneingang der Druckerei angehalten hat und hechelnd den Türklopfer betätigt.
Er fährt herum, starrt erst Luise, dann Anna mit aufgerissen Augen an, Augen von undefinierbarer Farbe hat er, tief violette Unterlider. Er zieht seine Mütze, rotes Haar und noch rötere Ohren. Anna meint, den komischen Kauz schon einmal gesehen zu haben, weiß nur nicht, wo. Jemand öffnet ihm die Tür einen Spalt, er verdrückt sich darin. Luise kichert. »Der geht jetzt dem Geheimagenten was petzen.«
Der Streich
Hat er die Büchner-Töchter angerempelt? Ausgerechnet die Büchner-Töchter? Gewiss waren sie es. Oscar hat den Hundehaufen allzu spät entdeckt. Wollte ihm ausweichen, ohne sein Tempo zu verringern, wollte eine Annonce des Juweliers Schreger pünktlich und wohlbehalten zum Verlag bringen, damit sie in der Weihnachtsausgabe erscheinen kann. Obendrein stand da diese Kutsche mit dem großherzoglichen Wappen, goldbeschlagen, zweispännig, vor der Hofeinfahrt zum Verlag, was so gut wie nie vorkommt. Auch wenn bei C. W. Leske die »Großherzogliche Hessische Zeitung« gedruckt wird, sind die Boten der Regierung eher unauffällig in Zivil und zu Fuß unterwegs.
Vor lauter Verwunderung hat Oscar nicht rechtzeitig bemerkt, dass die beiden Mädchen unmittelbar vor ihm anhielten. Erkannt hat er sie ohnehin nicht gleich. Wie auch? Er wohnt erst seit vier Wochen in der Weststadt. Doch seit dem Umzug liegt ihm die Mutter in den Ohren: Die älteste Büchner-Tochter, Mathilde, sei in seinem Alter und eine gute Partie. Da die vornehme Familie um die Ecke wohne, nur wenige Häuser entfernt, sogar die Gartengrundstücke grenzten aneinander, solle er sich dem Fräulein gegenüber einmal bemerkbar machen.
In erfreulicher Weise bemerkbar machen, versteht sich. Er hatte es fest vor, allein Mutter zuliebe. Er legte sich einen Plan zurecht, freundete sich mit dem jüngeren Bruder Wilhelm an, da kommt jetzt ihm dieses … dieses Exkrement in die Quere. Es erschien ihm recht hübsch, das Fräulein. Schlanke Gestalt, helle Augen und üppige kleine Lippen, die ihn an die flachshaarige Porzellanpuppe erinnern, die, seit er denken kann, auf dem Wohnzimmerbuffet sitzt, ohne dass er je mit ihr spielen durfte. Die Puppenlippen des Fräuleins öffneten sich vor Schreck in allerliebster Weise, als die kleine Schwester ihm etwas hinterherrief. »Akzessist«, rief das Kind, als handele es sich um ein Schmähwort. Was ihn zusätzlich verwirrte.
Hätte er sich nur nicht nach ihnen umgedreht, nur nicht die Mütze gezogen und sein rotes Haar entblößt. Nun werden ihn beide leicht erkennen, wenn sie ihm wieder begegnen. Hätte er wenigstens kehrt gemacht, sich entschuldigt, sich erkundigt, ob er sie verletzt habe. Die Entschuldigung muss er nachholen, bald, irgendwie.
Da! Das zweite Ungemach an diesem Tag. Einer der verhasstesten Regierungsvertreter in ganz Hessen-Darmstadt kreuzt seinen Weg: Karl du Thil, selbst von konservativen Stimmen als »der Großinquisitor« verschrien. Was will der hier? Durchmisst storchenbeinig das Vestibül, Hausmeister Jost im Gefolge. Eine Tür fliegt auf, und Verlagseigentümer Carl Wilhelm Leske erscheint im Rahmen mit gewohnt zerzaustem Haupthaar und selten verdrießlicher Miene.
»Guten Tag, die Herren«, sagt Oscar rasch, deutet einen Diener an und geht gemessenen Schritts durch den Innenhof zum Druckerei-Gebäude. Besser einem du Thil nicht auffallen.
An der Schwelle hält Oscar inne. So leise heute? Die Druckmaschinen stehen still, wenige Lehrlinge sitzen an den Satzkästen, arbeiten ohne aufzusehen. Drucker und Setzer haben sich am Fenster versammelt, mittendrin die Redaktoren Hofmann und Lange. Alle Köpfe und Stimmen sind gesenkt. Ist jemand gestorben? Zögerlich geht Oscar auf die Gruppe zu, nickt pietätvoll, öffnet seinen Tornister und zieht das einzige Couvert heraus, das darin liegt. »Hier die noch fehlende Anzeigenvorlage.«
»In Ordnung«, sagt Redaktor Lange und weist mit dem Kinn zum vordersten Setztisch. »Leg sie dorthin.«
Die anderen ignorieren Oscar. Wie sie ihn immer ignorieren. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so erklärt die Mutter gern das abschätzige Verhalten der Kollegen. Oscar weiß es besser. Er wurde eingestellt, weil seine Mutter mit der Ehefrau des Verlagsinhabers Leske befreundet ist. Vielleicht nicht bloß deshalb, aber auch. Zeitgleich wurden manche Arbeitsverträge nicht verlängert, weil die Obrigkeit Anstoß an zwei der bei Leske produzierten Zeitungen genommen hatte: dem »Beobachter in Hessen bei Rhein« und dem »Neuen Hessischen Volksblatt«.
Erst durften bestimmte Anzeigen nicht mehr darin erscheinen, was die Betriebskosten in die Höhe trieb, dann sollten regionale Themen unterbleiben, was die Lesekundschaft verärgerte und die Abonnementzahlen drosselte. Maßnahmen, mit denen die allzu liberal ausgerichtete Redaktion zur Räson gebracht werden soll.
Immerhin haben die Leskes auch das offizielle Regierungsorgan »Die Großherzogliche« mit im Programm, was den finanziellen Schaden so weit ausgleicht, dass die beiden beanstandeten Blätter weiterhin erscheinen. Doch der frisch als Volontär engagierte Oscar erntet scheele Blicke. Ein Verbündeter im liberalen Geiste kann er nicht sein, wenn er die Duldung der sich stets einmischenden Obrigkeit gewonnen hat. Na und? Ist er deswegen ein Reaktionär? Nein, politisch zurückhaltend ist Oscar. Rechtschaffen. Redlich. So ist es ihm anerzogen, und so soll es bleiben.
Trotzig wendet er sich ab, geht ohne ein weiteres Wort davon, trifft im Innenhof auf den vor sich hin schimpfenden Hausmeister. Den kann er fragen, das ist ein ganz Leutseliger. »Was ist passiert, Jost?«
»Ei wisse Sie’s noch net? De Beobachter und des Volksblatt hawwe se abgemurkst. De Hofmann und de Lange müsse gehe. Berufsväbot.«
Oscar schüttelt den Kopf. »Das wird Leske nicht zulassen.«
»Dem bleibt nix anneres üwwerisch. Do is grad der du Thil bei ihm drin, der’s ihm verklickert. Wenn er jetzt net spurt, dann isser selber weg vom Fenschter.«
»Tja«, sagt Oscar. Und fährt nach einer Weile betretenen Schweigens fort: »Lieber Herr Jost, da liegt ein umfangreicher Hundehaufen auf dem Trottoir, keine zwanzig Schritte von unserem Haupttor entfernt. Könntet Ihr möglichst bald –? Es wäre doch peinlich, wenn einer unserer Besucher hineintritt.«
Jost stutzt, grinst, tippt sich an seine Schildmütze und eilt in Richtung Putzkammer.
Oscar begibt sich an seinen Schreibtisch im ersten Stock. Was gehen ihn Hofmann und Lange an? Haben die ihm je geholfen, sich ein bisschen mehr Reputation im Verlag zu verschaffen? Sei’s drum. Alle Botengänge sind erledigt, jetzt kann Oscar sich seinem aktuellen Beitrag widmen, einem Beitrag über ein mit Spannung erwartetes Großereignis in der Stadt. Er säubert seine Feder, tunkt sie ins Tintenfass, streift sie ab. Wie beginnen?
»Die Heirat des großherzoglichen Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt mit Prinzessin Mathilde von Bayern steht unmittelbar bevor«, schreibt er. »Das hoheitliche Paar wird am 26. Dezember in München in den Stand der Ehe eintreten, sodann auf Hochzeitsreise gehen und am Wochenende des 9. und 10. Januar in Darmstadt eintreffen. Großherzog Ludwig II. hat ein prunkvolles Fest angekündigt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren …«
Anfangs, als Verlagsherr Leske ihm das Thema anbot, fühlte Oscar sich ungemein wertgeschätzt. Er, der Volontär, und ein solch wichtiges Thema! Inzwischen hat er begriffen, dass er den Auftrag nur bekommen hat, weil kein anderer ihn wollte.
Was Wunder, die Chose ist kompliziert. Wie lässt es sich vermeiden, all den Pomp und Prunk zu schildern, ohne die naive Begeisterung von Menschen zu wecken, die sich dergleichen nie im Leben werden leisten können? Und doch glauben, einen Anteil daran zu haben, weil es nun einmal ihr Großherzog ist, der die Feier ausrichtet, weil es ihre Stadt ist, in der er residiert. Höhepunkt des großen Fests soll ein öffentliches Schauessen sein. Die hoheitliche Familie und ihre erlauchten Gäste wollen dem Volk zeigen, wie sie dinieren. Einem Volk, das in diesem Winter – und nicht erst in diesem Winter – großenteils Hunger leidet. Forellenfilets, Trüffelpastete, Fasanenbraten, Burgunderwein … Wie das alles aufzählen, ohne den Zynismus der Veranstaltung zu brandmarken?
Redaktor Heinrich Carl Hofmann hat bei ähnlichen Begebenheiten kein Blatt vor den Mund genommen und saß schon einmal im Gefängnis. Jetzt hat er gar Berufsverbot, vermutlich in allen deutschen Landen. Oscar muss sich vorsehen, muss jedes Wort auf mögliche Missverständlichkeiten hin abklopfen, muss ausschließlich Tatsachen referieren, sachlich und ohne Wertung …
Nur, wie macht man das, wenn einem vor Empörung ein Kloß im Hals steckt? Oscar erhebt sich, tritt ans Fenster, betrachtet das großherzogliche Gefährt vor dem Hoftor, das offenkundig du Thil hierher befördert hat, halb Kalesche, halb Brougham, das Wappen pompös auf Rückfront und Türen. Der Lakai auf dem Kutschbock scheint eingeschlafen, sein Kopf hängt vornüber.
Da kommt Jost von hinten geschlichen, trägt eine Kehrschaufel vor sich her. Bückt sich, streicht mit einem Stock eine nicht zu identifizierende Masse von der Schaufel aufs Pflaster, drei, vier Schritte von der Kutsche entfernt. Das Hoftor klafft einen Spalt auf, Jost ist verschwunden. Oscar dämmert es. Der Hundehaufen! Nicht dass einer unserer Besucher hineintritt, hat er gesagt. Und genauso gemeint. Wie um alles in der Welt konnte Jost ihn missverstehen? Was jetzt? Soll Oscar du Thil warnen? Nein. Abwarten? Auch nicht.
Es kommt selten vor, dass Oscar der Teufel reitet. Aber es kommt vor. Zum Beispiel, wenn er eine vortreffliche Idee hat, die keinen Aufschub duldet. Er rennt zurück in die Druckerei. »Vor du Thils Kutsche liegt ein mächtiger Hundehaufen. Vielleicht tappt er rein«, ruft er den immer noch versammelten Kollegen zu. »Kommt gucken!«
Die Botschaft findet prompt Gehör, alle eilen zum Büro im oberen Stock, verteilen sich prustend und kichernd an den Fenstern, die zur Straße weisen. Alle? Ja, alle. Auch die Lehrlinge, die genau wie Oscar gern so tun, als ginge Politik sie rein gar nichts an. Sogar Hofmann, sogar Lange. Wetten werden abgeschlossen.
Keine zwei Minuten später passiert es: Der Justizminister schreitet, seinen Zweispitz unter dem Arm, auf die Kutsche zu. Hat mit einem Mal Mühe, seine Stiefel vom Trottoir zu lösen, hält inne, hebt ein Bein, besieht sich die Stiefelsohle, verliert die Balance, fällt hin, rappelt sich auf. Nun klebt der linke Schoß seines Mantels an der Hose fest. Ein unbeherrschtes »Arrrghhh« dringt durch die geschlossenen Fenster zum Kontor. Der besudelte du Thil zieht Mantel und Stiefel aus, lässt alles in die Arme des verwirrten und herbeigeeilten Lakaien fallen, der mit spitzen Fingern die Kutschentür zu öffnen versucht …
Die Kollegen wiehern vor Lachen, klopfen Oscar auf die Schulter. Er genießt es, lacht ausgiebig mit, bis ihm siedend heiß einfällt, dass Jost ihn verraten könnte. Dass sich herumsprechen könnte, der Streich mit dem Hundehaufen sei Oscars Idee gewesen. Und dass ein Spitzel davon erfahren würde, denn die Spitzel sind jetzt überall. Dann hätte Oscar sich die Anerkennung der Kollegen durch einen Eintrag in den Akten des Geheimdienstes erkauft? Er seufzt in sich hinein. Nichts im Leben ist gratis, nicht einmal ein Schulterklopfen.
Geht einmal nach Darmstadt und seht, wie die Herren sich für euer Geld dort lustig machen, und erzählt dann euren hungernden Weibern und Kindern, dass ihr Brot an fremden Bäuchen herrlich angeschlagen sei, erzählt ihnen von den schönen Kleidern, die in ihrem Schweiß gefärbt, und von den zierlichen Bändern, die aus den Schwielen ihrer Hände geschnitten sind, erzählt von den stattlichen Häusern, die aus den Knochen des Volks gebaut sind; und dann kriecht in eure rauchigen Hütten und bückt euch auf euren steinigen Äckern, damit eure Kinder auch einmal hingehen können, wenn ein Erbprinz mit einer Erbprinzessin für einen anderen Erbprinzen Rat schaffen will, und durch die geöffneten Glastüren das Tischtuch sehen, wovon die Herren speisen und die Lampen riechen, aus denen man mit dem Fett der Bauern illuminiert. Das alles duldet ihr, weil euch Schurken sagen, diese Regierung sei von Gott. Diese Regierung ist nicht von Gott, sondern vom Vater der Lügen.
Aus: »Der Hessische Landbote«, anonym verfasst von Georg Büchner und Ludwig Weidig
Abwege
Anna und Luise haben nach einigem Trödeln den Marktplatz erreicht. Der breitet sich vis-à-vis dem Alten Schloss aus, einem vielgliedrigen Sandsteinbau mit Glockenturm und pompösem Portal aus goldbeschlagenem Gusseisen. Dahinter residiert Großherzog Ludwig II. seit ein paar Jahren. Angeblich residiert er da, niemand weiß es genau, denn man bekommt ihn kaum zu Gesicht.
Wie er aussieht, wissen Zugezogene wie Anna nur von den Pappbildern, die zu seinem Geburtstag verteilt werden. Ein Künstler namens Glaeser hat ihn in Ölfarbe auf Leinwand gemalt: gedrungener Körper in schwarzer Uniform, Pausbacken, üppige Koteletten und runde graue Augen, die ins Leere sinnieren. Ludwig II. sei ein stiller Charakter, heißt es amtlicherseits. Böse Zungen werfen ihm Feigheit vor. Er habe Angst vor Volksaufständen, wie es sie vorigen April in Frankfurt, zuvor in Hambach, Eisenach und anderswo gegeben habe. Deshalb verschanze er sich im Alten Schloss, das nicht nur von Soldaten bewacht, sondern wie eine Burg von einem Bering und einem Graben umgeben ist.
Mit Luise am Arm schlendert Anna über den Markt und malt sich aus, wie der Großherzog in diesem Moment hinter einem der runden Dachfensterchen seines Schlosses steht und seine Untertanen argwöhnisch beobachtet: dieses Drängeln und Wuseln, dieses Zetern, Feilschen, Hökern, Streiten, all die zornigen Mienen und Gesten über die schon wieder teurer gewordenen Kartoffeln. Erst recht dieses Feixen und Grölen vom Apfelweinstand her. Dort lungert eine Traube offenkundig betrunkener Burschen herum.
Und mitten drin – Anna zuckt zurück und vergisst augenblicklich den Großherzog – steht Rodrich, hält ihr glücklicherweise den Rücken zugekehrt. Aufgeputzt sieht er aus: ein steingrauer Rock mit steif gebügeltem Kragen, eine Art Schiffermütze kess in die Stirn gezogen. Er pfeift einer jungen Bäuerin hinterher, die mit herausgerecktem Hinterteil einen Karren voller Rotkohl übers Pflaster schiebt.
Eilig dirigiert Anna Luise zum Gänsebauer, der seinen Pferch in einer anderen Ecke des Marktplatzes aufgebaut hat. Wie von den Büchners aufgetragen, lässt sie sich zwei Tiere von je sechs Pfund für den Montag reservieren. Bedrohlich wackelt ein gutes Dutzend fetter Gänse ans Gatter, faucht aus aufgerissenen Schnäbeln die Besucher an. Luise lacht, faucht zurück, was ein ohrenbetäubendes Geschnatter auslöst.
»Luise, lass das!« Annas Ermahnung klingt weniger streng als sie gemeint ist, beinahe fahrig klingt sie, weil Anna nicht bei der Sache ist. Die Burschen am Apfelweinstand haben begonnen, den Marktplatz mit einem Gassenlied zu beschallen. Es ist ein derbes Lied, das Anna nur vom Weghören kennt. »Die Rose taut, die Hose blaut« … »Die Ader sticht, das Mieder bricht« …
Zum Glück hat das Kind kein Ohr für solche Gesänge. Es entdeckt den Stand eines Bonbonkochers aus dem Elsass, rennt hin und bestaunt das bunte Angebot. Anna folgt ihr, besieht sich die glasierten Zuckerbrezeln und -kringel mit den rot-weißen Streifen, überlegt, ob sie Mutter Büchner als Weihnachtsschmuck gefallen könnten. Aber die kosten zehn Pfennige pro Stück? Da wird sie erst fragen müssen.
»À votre service, Mesdames«, sagt der Händler und schenkt ihnen ein Tütchen mit kissenartig geformten, seidig glänzenden Bonbons. Luise bedankt sich mit einem Knicks.
Lutschend bewegen sie sich durch die immer dichter werdende Menschenmenge, wobei Anna sorgsam einen Sicherheitsabstand zu dem grölenden Haufen einhält.
Vergeblich. Rodrich kommt zwischen einer Bude mit westfälischem Schinken und einer mit holländischem Käse angetaumelt und hält in Richtung der Aborte. Schon hat er Anna erkannt, grinst, winkt … Sie schüttelt abwehrend den Kopf und dreht ihm den Rücken zu. »Guck mal, Luischen, da drüben gibt es kleine Karnickel. Sind die nicht niedlich?«
Anna kennt Rodrich, seit sie denken kann. Sie sind weitläufig verwandt und wohnten als Kinder benachbart, er nicht ganz drei Jahre älter als sie. Er lehrte sie mit Murmeln spielen, schnitzte ihr Pfeifchen aus Weidenholz, setzte sie in einen Karren und zog sie damit über Stock und Stein.
Ob Rodrich noch manchmal daran denkt? Als sie größer waren und bei der Feldarbeit helfen mussten, erzählten sie sich Preußenwitze, damit das viele Bücken erträglicher wurde. Und an Sommersonntagen verkrochen sie sich in einem Erdloch im Wald, zogen sich aus und schmusten – Rodrich nannte es »Mann und Frau spielen« – und versprachen, einander zu heiraten. Daran scheint er sich zu erinnern, denn gelegentlich erzählt er herum, er wäre mit Anna verlobt. – Verlobt? Früher einmal hat der Gedanke sie glücklich gemacht.
Beim Militär ist Rodrich ein anderer geworden. Nachdem er freigestellt wurde, begann er zu stehlen, zu saufen und ließ sich mit Dirnen ein. Und einen Jähzorn entwickelte er! Einmal als Anna ihm Vorwürfe machte, verprügelte er sie. So heftig schlug er zu, dass sie ein blaues Auge und geprellte Rippen davontrug. Auf Knien bat er sie um Verzeihung und versprach, sich zu ändern.
Anfangs lief es gut. Er fand eine Arbeit als Tagelöhner bei den Michelstädter Bauern, denn er war kräftig und hatte Ausdauer. Doch bald fing er wieder an zu stehlen. Erst bei den Bauern. Die warfen ihn raus. Dann im Wald des Landgrafen. Da schlug er Brennholz und legte Hasenfallen. Unterförster Lust erwischte ihn und zeigte sich erbarmungslos, legte ihm noch mehr zur Last, als er tatsächlich getan hatte. Behauptete, Rodrich habe mit einer Steinschleuder Jagd auf Rebhühner und Fasane gemacht.
So kam Rodrich für Wochen ins Gefängnis, schimpfte über eine schmutzige Zelle, über Hunger, Durst, Stockhiebe. Und ging doch wieder in die Wälder Holz klauen, brachte seine Beute zu einem Schnapsbrenner und erhielt dafür die eine oder andere Flasche von dem Gesöff. Immerhin hat ihn Förster Lust nicht wieder erwischt.
Seit ein paar Wochen ist Rodrich bei der Maschinenfabrik Jordan in Darmstadt als Kurier unter Vertrag. Man habe ihn für eine richtige Arbeit bei der Verpack- und Versandstelle empfohlen, hat er neulich behauptet. »Glaub mir, Änne, der Jordan baut immer mehr neue Maschinen und sucht händeringend nach Männern, die die schweren Teile stemmen können. Wenn das klappt, krieg ich bestimmt auch eine Heiratserlaubnis. Und dann heiraten wir, meine Änne.«
Anna mag nicht »seine Änne« sein. Ihn heiraten schon gar nicht. Was, wenn er sie wieder verprügelt? Und auf alle Fälle muss sie verhindern, dass Luise ihn derart besoffen zu Gesicht bekommt. Und dass die Büchners von ihm erfahren.
Glücklicherweise hat er es eilig, zum Abort zu kommen. Er geht weiter, wobei er sich augenscheinlich Mühe gibt, nicht zu torkeln.
Anna lotst Luise um den ohnehin stattlichen, nun mit Tannenzweigen und Flitterzeug reich verzierten Sandsteinbrunnen herum und vom Marktplatz weg in die Große Ochsengasse hinein, wo der Schuster seine Werkstatt hat. Dort soll sie die neubesohlten Stiefel vom jungen Herrn Georg abholen, die er unbedingt braucht, bevor er nach Gießen abreist. »Komm, Luischen, lass uns ein Stück rennen.«
Die Große Ochsengasse schlängelt sich durch die vordere Altstadt und gehört zu ihrem besseren Teil. Auch wenn das Fachwerk der Häuser meist verblichen ist und mitunter der Putz bröckelt, die Wege sind sauber gekehrt, und die streunenden Katzen halten die Ratten in Schach.
Das Haus des Schusters weist einen verwitterten Anstrich auf, doch das Ladenschild mit den geschwungenen Lettern strahlt wie frisch geputzt: Schuhmacherei Hepp & Söhne. Anna geht mit Luise an der Hand die Steinstufen hinauf in den Ladenraum, wo allerlei Leute, vor allem Gesinde und Laufburschen, auf Bedienung warten. Kurz vor Weihnachten scheint es vielen Darmstädtern einzufallen, dass sie neue Schuhe brauchen. Oder dass sie ihre alten Schuhe ausbessern lassen wollen.
Einige der Wartenden scheinen einander zu kennen. Sie schwatzen und tratschen, erzählen einander davon, wie es neulich in der Kaplaneigasse gebrannt hat, wie die Gendarmerie eine Ladung Schießpulver in einem am Woog abgestellten Kinderwagen gefunden hat … Und mit einem Mal ist das Gespräch bei »dem grauehafte Moard im Odewald« angekommen. Moard. Moard. Moard. Das Wort hallt, mundartlich verzerrt, in Annas Ohren.
Gewiss sei es ein Holzfrevler gewesen … ein vielleicht ganz armer Kerl, den der Förster auf frischer Tat erwischt hätte … »Awwer mit em Beil en Förschter erschlache, des geht gar nett«, darin ist man sich einig.
Anna tut, als sei sie in die Betrachtung der Meisterurkunde für Schuhmacher Leonhard Hepp vertieft, die in verschnörkelter Umrahmung an der Wand des Verkaufsraums hängt, spannt indes die Ohren auf. Es könnte sein, dass mancher mehr weiß, als heute früh in der Zeitung stand.
Luise zupft sie am Ärmel, reckt sich, um ihr ins Ohr zu flüstern. »Anna, was ist ein Holzfrevler?«
»Ist einer, der Holz klaut.«
»Ach so.«
»Na, die wer’n den Borsch bald schnappe«, prophezeit eine Frau mit bäuerlicher Haube, spielt auf einen Mordfall vor siebzehn Jahren an: »Den Schustergesell von Bischoffsem hawwe se aach gekrischt.« Anna bemerkt, wie sich alle Blicke zur offenen Werkstatttür richten, aus der es kräftig nach gegerbtem Leder, Leim und Wichse riecht. Da hocken zwei Gesellen auf dreibeinigen Stühlchen, einer hämmert angestrengt, der andere sucht die Werkzeugkonsole neben sich nach einer passenden Ahle ab.
»Manscht du den, der sein eischene Freund mit seim Schustermesser umbrocht hot?«
»Freilisch, den man isch.«
Luise scheint das mundartliche Geplauder nicht gut zu verstehen. Oder sie mag sich nicht ablenken lassen. »Anna, der Holzfrevler hätte doch dem Förster einfach das Holz zurückgeben und sich entschuldigen können, oder?«
»Tja, hätte er können«, sagt Anna und pfriemelt ein zweites Bonbon für Luise aus dem Tütchen.
Endlich sind sie an der Reihe. Schustermeister Hepp nimmt lächelnd einen grauen Pappzettel mit aufgedruckter Nummer entgegen und reicht Anna im Austausch die neu besohlten Stiefel vom jungen Herrn Studiosus. »Des macht drei Grosche und sechs Penning … Und grüße Se die werte Familje Büschner von mir.« Luise bekommt, weil bald Weihnachten ist, ein daumengroßes, aus Lederresten geklebtes Schweinsfigürchen geschenkt. Was sie mit einem artigen »Auch Dankeschön und auf Wiedersehen, Herr Hepp!« beantwortet.
Aufatmend verlässt Anna, Luise vor sich herschiebend, den Schusterladen.
Es ist Zeit, um zum Haus der Büchners zurückzukehren. Aber Luise hat einen anderen Plan, sie will unbedingt in die Hinkelsgasse, zu einem fast mannshohen, fassförmigen Findling mitten in der Altstadt.
Anna stutzt. »Da waren wir doch noch nie.«
»Eben«, sagt Luise.
»Und was willst du da?«
»Raufklettern.«
Anna schüttelt es. Die Hinkelsgasse, benannt nach dem Hinkelstein, der sie seit Jahrhunderten verengt, gehört zu dem Teil der Innenstadt, den sie gern meidet. Lieber geht sie einen Umweg als durch die armseligen und verwahrlosten Gassen. »Der schmutzige alte Findling ist doch nichts für Kinder von feinen Leuten«, wendet sie ein und verweist auf den Apfelbaum im Garten hinterm Haus, der sich famos zum Klettern eigne.
Luise gibt keine Ruhe. »In der Schule sagen sie, dass, wer niemals oben auf dem Hinkelstein gestanden hätte, gar kein echtes Darmstädter Kind wäre. Bitte, Anna! Ich sag’s auch keinem, dass ich mit dir da war.«
»Aber nur ganz kurz.«
Als ihre »Altstadt« bezeichnen die Darmstädter einen ungeordneten Haufen engster und allerverwinkelster Sträßchen aus schiefen, planlos aneinandergereihten Häuschen. Dazwischen kein Baum, kein Strauch, nur graubraune Reste von verwittertem Gras. Oft neigen sich die oberen Geschosse der Häuser schräg nach vorn oder springen aus der Reihe, verengen so zusätzlich die Gassen. Kaum ein Sonnenstrahl erreicht die Gehwege. Viehhofgasse, Stinkegasse, Bangertsgasse – allein diese Straßennamen!
Noch ärger sind das bröckelnde Mauerwerk, die müffelnden Pfützen, der Rattenkot im Rinnstein … Anna bekommt Heimweh nach Michelstadt. Dort sorgen die Handwerker und Händler dafür, dass die Straßen nicht verkommen, auch wenn noch so arme Leute darin wohnen. Nun gut, Michelstadt ist kleiner, ein Dorf beinahe, wo jeder jeden kennt und es Ehrensache ist, einander zu helfen.
An einer langgekrümmten, von Schwamm und Flechten überzogenen Hausfront bricht er aus dem Pflaster, der verflixte Hinkelstein, auf den das Kind so versessen ist. Nicht mal einen Pferderücken hoch ist er. Luise ist enttäuscht, Anna halbwegs beruhigt. Was sich jäh ändert, als sie direkt davorsteht. Ein grünschillernder, glatter Belag überzieht die ansonsten raue Oberfläche. Anna schüttelt den Kopf. »Das wird heute nichts mit dem Klettern.«
»Wieso?«
»Fühl mal, wie glitschig. Das kommt vom nasskalten Wetter.«
Luise betupft den Findling hie und da mit den Fingerkuppen und befindet: »Das geht noch.«
»Lass uns umkehren. Deine Eltern werden mit mir schimpfen, wenn du dich verletzt. Und dein lieber Bruder Georg erst! Der wird auf ewig mit mir böse sein. Im Sommer, wenn es schön trocken ist, komm ich mit dir her. Versprochen.«
»Nix da«, sagt Luise, »jetzt sind wir hier«, rafft ihren Rock, setzt die Stiefelspitze in eine Felskerbe, gleitet ab … und bekommt unversehens Unterstützung.
»Warum ein andermal, wenn das kleine Fräulein heute hinauf will?«, sagt eine Männerstimme hinter ihnen. Ein Hauch von gezuckertem Apfelwein weht Anna an. Sie muss sich nicht erst umdrehen. So rau und einschmeichelnd zugleich sprechen nur wenige Männer.
»Dann woll’n mir mal«, sagt Rodrich, fasst Luise um die Taille, fasst sie so sicher, dass sie ohne zu straucheln hinauftappen kann. Oben angekommen jubelt sie, als habe sie es allein geschafft.
»Jetzt loslassen«, kommandiert sie, und Rodrich gehorcht. Sie breitet die Arme aus, als wolle sie fliegen, drei Wimpernschläge, sechs Wimpernschläge lang … Luise strahlt vor Stolz.
»Nun aber wieder runter«, sagt Anna in einem Ton, den sie Mathilde Büchner beim Zurechtweisen der jüngeren Geschwister abgelauscht hat.
Rodrich lacht. »Na dann, alles klar zum Abstieg!«
Wieder gibt er Hilfestellung, packt das Kind fest um die Mitte.
Luise setzt die Füße ungelenk an, rutscht aus …
Rodrich lockert wie aus Versehen seinen Griff, lässt sie über das Gestein gleiten, um eine ganze Fußlänge lässt er sie abgleiten. Anna schreit auf.
»Hoppla!« Schon hat Rodrich wieder zugefasst, eine Hand hält Luises Achselhöhle, die andere ihren Ellbogen, und sie steigt herab mit dem Lächeln einer Siegerin.
»Oha! Ist das nicht das kleine Fräulein Büchner, Tochter des Medizinalrats Ernst Büchner?« Rodrich tut erstaunt.
»Bin ich«, sagt Luise. »Und dies ist meine große Schwester.«
»Ach, deine Schwester? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, das werde ich dem Herrn Medizinalrat erzählen, wenn ich ihn im Spital antreffe. Dass ich seine beiden Töchter hier in der Hinkelsgasse getroffen habe. Nein sowas!« Er zwinkert Anna zu.
Anna hasst es, wenn er so zwinkert. Was gibt es denn für ein heimliches Einverständnis zwischen ihnen, das diese Geste rechtfertigt?
»Vielen Dank für Ihre Hilfe, mein Herr«, sagt Luise und gibt ihm die Hand. So kiebig und vorlaut sie zuhause ist, gegenüber Fremden gibt sie sich überwiegend artig. »Wissen Sie«, fährt sie fort, »ich tu mich etwas schwerer beim Klettern als andere Kinder. Wegen meines Buckels.«
Rodrich hebt fragend die Arme. »Was für ein Buckel? Ich sehe gar keinen. Schönen Tag noch, die Damen.«
Luise zupft ihren Hut zurecht und hakt sich bei Anna ein. »Ein netter Mann. Aber … kann’s sein, er war betrunken? Er roch etwas.«
»Guck mal, Luischen, die hübschen weißen Hühner. Die laufen hier einfach so über die Gasse.«
Wildpferdsätze
Es ist einer dieser herrlichen Abende, an denen Luise zu »den Großen« gehört. Schon acht vorbei, und sie muss noch nicht ins Bett, weil Georg, Mathilde und Wilhelm Schafkopf spielen wollen und einen »vierten Mann« brauchen. Und wer wäre ein besserer vierter Mann als Luise? In froher Erwartung solcher nicht gerade häufigen Abende hat Luise die Regeln gelernt und mit sich selbst das Bedienen von Farben geübt: Eichel, Gras, Herz und Schelle. Und dann das Bedienen der Trümpfe: Ober und Unter und Herz. Zu ihrer Verblüffung sind die Könige, im Gegensatz zum wahren Leben, rein gar nichts wert. Und je mehr Damen man hat, desto leichter gewinnt man. Lustig! In Vollmondnächten hat sie heimlich im Bett ein paar Solo-Varianten ausprobiert.
Ha, und jetzt kann sie Schafkopf. Sogar besser als Wilhelm. Weil sie eben ein Schafkopf sei, sagt der, wenn sie wieder einmal ein Spiel gewonnen hat. Darüber kann Luise nur lachen. Ein Schlaukopf ist sie, so schlau wie Georg. Vielleicht nicht ganz, aber beinahe. Beste Schulnoten hat sie. Die hatte Wilhelm jahrelang nicht, der musste sogar im vorigen Schuljahr zum Entsetzen der Eltern das Pädagog verlassen.
Die Geschwister haben sich um den kleinen runden Eichentisch im Wohnzimmer gruppiert, beugen sich vornüber, um ihre Spielkarten im Schein der matten alten Öllampe in der Tischmitte erkennen zu können. Der Kamin in der Ecke verbreitet Wärme und schickt einen heimelig großen Lichtkegel in die Stube. Da kommen, gefolgt von Anna samt Kerze, die zwei kleinen Brüder in ihren Nachthemden hereingetapst, um eine gute Nacht zu wünschen. Ihre nackten Füße schmatzen über die Dielen. Alex hält sein Kaninchenfell vor der Brust verknäult. Ludwig sagt mürrisch »Nacht-auch«. Ein neidischer Blick trifft Luise, die mit Hingabe ihre Karten in der Hand auffächert. Die Hand ist etwas klein für die riesigen acht Karten, aber das soll niemandem auffallen. Am allerwenigsten Ludwig.
»Schlaft gut, ihr Hammelmäuse«, sagt Georg. Er erfindet öfter so komische Wörter. Sogar die Hammelmäuse finden das lustig, Alex wirft sich auf den Boden vor Lachen und lässt sich bis unter die Kommode kullern, sodass Mathilde ein Machtwort sprechen muss. Die Eltern sind nämlich zu Gast bei vornehmen Herrschaften namens Kahlert, wo sie bis in die Nacht speisen und Wein trinken. Mathilde hat für heute »die Oberhoheit«. Und sie hat eine sehr laute Stimme, wenn es drauf ankommt.
Motzend folgen die Hammelmäuse Anna und der Kerze wieder zur Tür hinaus, Luise lauscht den knarzenden Schritten die Treppe hinauf, malt sich aus, was die beiden jetzt erwartet: erst Gesicht und Hände gründlich waschen, mit Seife und warmem Wasser aus dem Krug, den Anna zuvor auf dem Nachttisch bereitgestellt hat. Dann kommt Zähnebürsten dran, das ist das Allerlangweiligste. Und nur wenn sich beide beeilen, wird Anna ihnen ein Märchen erzählen, bevor sie das Nachtgebet mit ihnen spricht. So geht nämlich das Zu-Bett-geh-Prozedere im Haus der Büchners vonstatten. Luise kennt es gut, weil sie normalerweise zu »den Kleinen« gehört.
Dass dieser Tage manches anders ist als sonst, liegt an Georgs Besuch. Er hat sich in Gießen ein böses Fieber zugezogen und ist heimgekommen, um sich auszukurieren. Und weil Weihnachten und Neujahr bevorstehen, bleibt Georg sogar eine Woche länger.
Darüber freuen sich alle. Und sind hinter ihm her, wetteifern um seine Aufmerksamkeit. »Georg, weißt du schon das Neuste?«, »Georg, kannst du mir helfen?«, »Georg, guck mal, was ich kann.«
Alle? Zumindest Wilhelm, Ludwig und Alexander. Und besonders Luise, wie sie zugeben muss. Mathilde hält sich bei der Jagd auf Georg zwar zurück, dafür ist sie umso mehr hinter Luise her. Will sie zu einer stillen, artigen jungen Frau erziehen, wie sie selbst eine ist. Auch wenn Mutter das für »vergebliche Liebesmüh« hält und schon aufgegeben hat.
Mutter andererseits ist hinter Ludwig her. Er sei so empfindsam, glaubt sie, und sie müsse ihn lehren, sich gegenüber dem wilden Alex und der vorlauten Luise zu behaupten. So sind sie denn doch alle hinter Georg her, die einen unmittelbar, die anderen mittelbar, und sie folgen ihm, wie eine Kükenprozession ihrer Entenmama, auf Schritt und Tritt durchs Haus. Das einzige Familienmitglied, das hinter niemandem her ist, ist Vater. Er sitzt, sofern er überhaupt zuhause arbeitet, in seinem düsteren kleinen »Büro« mit dem wuchtigen, von Akten und Schriftstücken überladenen Schreibtisch und ärgert sich gewiss im Stillen, dass sich niemand um ihn bekümmert. Vielleicht befiehlt er Georg deshalb ab und an zu sich, schilt ihn aus, weil er mit seinen losen Reden die jüngeren Geschwister aufwiegele.
Aus solchem Anlass kann Vater richtig wütend werden. Dann erhebt sich seine Stimme, überschlägt sich wie zu einem Salto, und die übrige Familie, die Georg wieder einmal auf dem Fuß gefolgt ist, steht dabei, weiß nichts zu sagen. Nur dass die Mutter den Vater bittet, leiser zu schimpfen, der Nachbarn wegen.
Was lose Reden sind, weiß Luise nicht so genau. Wahrscheinlich meint Vater, dass die Sätze, die jemand ausspricht, angebunden gehören wie Kühe im Stall. Oder wenigstens ordentlich eingepfercht wie auf einer umzäunten Weide. Manches Mal springen auch Vaters Sätze ungestüm umher. Etwa wenn er von Napoleon und Frankreich und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit spricht. Und man möchte an einen lebensfrohen jungen Bullen denken.
Doch im nächsten Atemzug erklingt, bei gepresster Stimme und gefolgt von einer winzigen Pause, ein Aber. Dieses Aber leitet gänzlich andere Sätze ein, die von Gesetz und Ordnung und Sitte und Verantwortung handeln. Und ehe Luise es richtig begreift, hängt der lebhafte Bulle an der Kandare.
Georgs Sätze dagegen klingen nach einem Wildpferd. Ach was, nach einer ganzen Horde Wildpferde. Sie hoppeln von irgendwoher herbei, verweilen, als wollten sie sich ausruhen, grasen hie und da, springen auf, bocken, wiehern … und galoppieren unversehens wieder davon, so wild, dass der Staub unter ihren Hufen aufstiebt, sodass mancher in Deckung gehen möchte. Man sieht diesen Pferden nach und fragt sich, wo es sie wohl hintreibt.
»Wo soll das hinführen? Wie soll das enden?«, fragt Vater folgerichtig. Und einigermaßen aufgebracht. So zum Beispiel neulich, als Wilhelm, auf Georgs Empfehlung hin, zu einem Treffen von Studenten in der »Bockshaut« ging und freimütig zuhause erzählte, was da los war. Da hätten welche von einem Sturm in Frankfurt gesprochen, hätten gesagt, so was würde es auch bald in Darmstadt geben. Und hätten berichtet, dass im Darmstädter Stockhaus Kameraden von ihnen zusammen mit Räubern und Dieben eingesperrt seien, bloß weil sie zuvor bei so einem Fest dabei gewesen seien, einem Fest in Hambach oder so.
Luise hat bis heute nicht recht verstanden, weshalb die Mutter die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Besonders als Georg beides, den Sturm und das Fest, mit galoppierendem Wortschwall verteidigte. Keine Frage, Mathilde hält stets zu Georg und Wilhelm. Was nicht heißt, dass sie ihrerseits ohne Zaumzeug spricht. Sie appellierte an Wilhelms Vernunft und drohte zu petzen, falls Wilhelm sich unterstehe, noch einmal dorthin zu gehen.
So sehr Luise es genießt, mit den großen Geschwistern Schafkopf zu spielen, noch lieber lauscht sie deren Gesprächen. Weshalb sie ab und zu für ein Thema sorgt, das die anderen interessieren könnte. Als sie an diesem Abend mit Mischen und Kartengeben an der Reihe ist, hält sie mittendrin inne: »Übrigens, dieser tote Förster im Odenwald, ihr wisst schon. In der Stadt erzählen sich die Leute, ein Holzfrevler hätte den umgebracht.«
Georg nickt. »Kann gut sein.«
»Was ist denn ein Holzfrevler?«, fragt Wilhelm.
Luise hebt zu einer Erklärung an, will Eindruck machen mit dem, was sie am Nachmittag gelernt hat.
Doch Georg ist schneller: »Jemand, der sich im Wald Holz besorgt, um es zuhause warm zu haben.«
Luise stutzt. Das hört sich gänzlich anders als: Jemand, der dem Förster das Holz stiehlt.
Sie mischt weiter Karten, indem sie zwei Stapelhälften zwischen Daumen und Zeigefingern ineinanderflappen lässt, und fragt scheinbar gleichmütig: »Was ist daran so frevelhaft?«
Schon stürmen Georgs Wildpferde heran: »Weil die verdammten Gesetze vom Adel so gemacht sind. Die Gesetze verbieten es, Holz zu sammeln oder zu schlagen, genau wie das sogenannte Wildern. Auch wenn die Menschen Hunger haben und frieren. Die Gesetze bestimmen, dass ein Stück Wald nur einem gehört, in dem Fall dem Grafen von Erbach-Fürstenau. Also glaubt er, ihm gehören auch all die Rehe und Hasen und Bäume darin.«
Luise nickt verständig und teilt die Karten aus, acht für jeden, überlegt dabei, ob die Frage, die ihr auf der Zunge liegt, sich kindisch anhören könnte. Und entscheidet sich, es drauf ankommen zu lassen: »Was will der verdammte Graf mit all den Bäumen? Der hat doch bestimmt einen schönen Schlossgarten, da muss er verdammt noch mal nicht auch den Wald besitzen.«
Georg wirft ihr eine Kusshand zu. »Schwesterherz, das ist die klügste Frage, die ich seit langem von einem Kind gehört habe.«
Ein Lob von Georg hat etwas Erhebendes. Und dass er sie nicht Hammelmaus, sondern Schwesterherz nennt, lässt Luise die Wangen heiß werden vor Glück. Aber eine Antwort auf ihre Frage will sie trotzdem. »Dann sag schon warum.«
»Weil der Wald nicht wirklich dem Grafen gehört, Luise. Seine Vorfahren haben ihn sich einfach so genommen. Der Wald ist seit Jahrhunderten gewachsen. Den gab es schon, als die alten Germanen hier hausten. In Wahrheit gehört der Wald dem Volk, also uns allen.« Die Wildpferde haben die Wiese erreicht, springen umher und wiehern.
Prompt stellt Wilhelm seinen eigenen, noch etwas ungelenken Wildpferdnachwuchs daneben: »Genau. Eigentum ist Diebstahl. Jeder sollte in allen Wäldern Deutschlands Tiere jagen, Holz holen und Pilze sammeln dürfen, so lange genug davon da ist«, sagt er, sortiert seine Karten und schickt ein knappes »Weiter« hinterher, um anzudeuten, dass er nicht führend spielen will.
Mathilde hat ihr Blatt längst geordnet und zimmert einen Pferch der Vernunft: »Wenn jeder, der mag, einfach in den Wald gehen und sich holen kann, was er mag, ist bald kein Wald mehr übrig. – Weiter.«
»Aber die Gemeinschaft kann Leute wählen, die den Menschen zuweisen, was sie brauchen. Besonders den Armen. Wer sich keine Kohlen leisten kann, sollte wenigstens Brennholz sammeln dürfen, damit er nicht friert.« Damit haben Georgs Wildpferde den Pferch eingerissen, grasen aber noch ein wenig. »Top!«, sagt er, »und ich nehm’ die Schellen-Sau mit.«