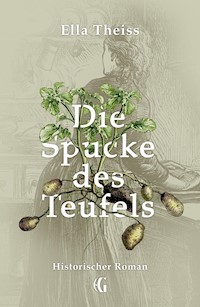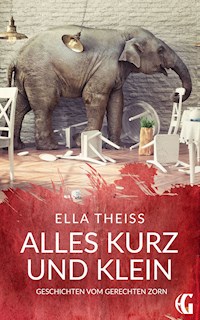Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Prolibris Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Für die menschenscheue Isabell kommt es knüppeldick. Erst der Tod der Mutter, dann der Auszug aus der vertrauten Wohnung und schließlich der Überfall durch eine Bande Jugendlicher. Nun hat Isabell eine posttraumatische Belastungsstörung namens Billie. Die klopft 68er Sprüche und will partout als Streetworkerin die Welt retten. Prompt erhält Billie die schwierige Aufgabe, zwei in Darmstadt gestrandete junge Menschen vor dem Zugriff einer Zuhältermafia zu bewahren: einen amnesiekranken Schleuserhelfer und eine geflohene Zwangsprostituierte. Dass beide Heimkinder waren, scheint ein Zufall, bis plötzlich zwei Darmstädter Kinder auf Initiative von Behörden in einem dubiosen ungarischen Waisenhaus verschwinden. Billie nimmt den ungleichen Kampf mit den Menschenhändlern auf. Und unversehens hängt Isabell mit drin. Ein turbulenter Krimi mit Tiefgang und bissigem Humor zum Thema Geschäftemacherei mit Heimkindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalte
Ella Theiss
Duo mit Beretta
Ein Kriminalroman aus Darmstadt
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren sind frei erfunden. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Autorin
Ella Theiss lebt in der Nähe von Darmstadt. Sie hat Germanistik und Sozialwissenschaften studiert und rund zwanzig Jahre unter ihrem Klarnamen Elke Achtner-Theiss als Redakteurin und Texterin gearbeitet, insbesondere im Themenbereich Bio-Lebensmittel. Seit 2008 schreibt sie auch Romane und Erzählungen. Mit ihrem historischen Krimi »Die Spucke des Teufels« belegte sie Platz 2 zum Gerhard-Beier-Preis 2010. Für zwei ihrer Erzählungen erhielt sie den 2. Freiburger Krimipreis 2013 und den QuoVadis-Kurzgeschichtenpreis 2013. »Duo mit Beretta« ist ihr dritter Roman. – Mehr unter www.ellatheiss.de
Alle Rechte vorbehalten,
auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe
sowie der Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2016
Tel.: 0561/766 449 0, Fax: 0561/766 449 29
Titelfoto: © Karsten Christiansen, Darmstadt
E-Book: Prolibris Verlag
ISBN E-Book: 978-3-95475-142-6
Dieses Buch ist auch als Printausgabe erhältlich.
ISBN: 978-3-95475-135-8
www.prolibris-verlag.de
Morgens um sechs fanden Reinigungskräfte des Straßenverkehrsamts den Jungen schlafend unter einer der Picknickbänke am Autobahnrastplatz Bornbruch Ost. Er hielt einen lehmverkrusteten Plastikbeutel mit beiden Armen umklammert. Seine vom Regennassen Turnschuhe hatte er ausgezogen und ordentlich neben sich im Gras aufgestellt. Die Männer riefen die Polizei.
Anfangs glaubten die Beamten an einen Ausreißer, denn er hatte nichts als ein paar Superman-Comics, eine zur Hälfte verzehrte Packung Karamellbonbons, mehrere Münzen und ein rostiges Taschenmesser in seinem Beutel. Keinen Ausweis, keinerlei Papiere.
Er sprach akzentfrei Deutsch, nannte aber einen russischen Namen: Jegor Antonowitsch Plewe. Er wusste sein Alter, fünf Jahre, und er konnte angeben, wieso er sich am Rastplatz aufhielt. Seine Tante Tanjuscha mochte ihn nicht bei sich haben. Nur seine Schwester Milenka habe sie in ihrem Auto mitgenommen. Er dagegen sollte unter der Picknickbank warten, bis ihn jemand fand.
1. ISABELL
Mit mir stimmt was nicht. Ich sehe Gespenster. Genauer gesagt nur eins. Noch genauer gesagt nur meins, mein Double. Seit Wochen geht das schon, ich sehe in den Spiegel und sehe – nicht mich. Sondern sie. Mit verschränkten Armen steht sie vor mir und grinst mir ins Gesicht. Manchmal zwinkert sie mir zu, als wolle sie mich aufmuntern, manchmal rollt sie die Augen, als sei sie von mir genervt. Wende ich mich von ihr ab, kriecht sie in meine Ohren, flüstert peinliche Sprüche: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Oder: Macht kaputt, was euch kaputt macht. Solche Sachen. Am schlimmsten ist, wenn sie leibhaftig neben mir auftaucht mit ihrem Zottellook, ihren schwarz umrahmten Augen und meinen Alltag durcheinanderbringt. Billie heißt sie. Ein peinlicher Name für eine Frau Mitte dreißig. Meine Meinung.
Billie trat in mein Leben in Form eines Molotowcocktails, ja, wirklich, sie katapultierte sich quasi aus einem Brandsatz in meine Seele. Psychologen würden sagen: Billie ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Und zwar eine hartnäckige.
Es passierte am 31. März, einem Tag, der sich wie November anfühlte, so grau und trüb. Was nicht nur am Wetter lag. Ich musste mich von der Wohnung in Kranichstein verabschieden, in der ich fast drei Jahrzehnte gelebt hatte, ging ein letztes Mal durch alle Räume. – Neu-Kranichstein, nach Ansicht mancher Darmstädter ihr »schlechtester« Stadtteil im Norden: jede Menge Hochhäuser, meist brutale 13 bis 19 Stockwerke hoch und satellitenstadtüblich gruppiert. Eine typische Bausünde der 60er Jahre, seit den 90ern mit viel Grün, viel Teich und viel Infrastuktur aufgehübscht und aufgewertet. Sogar einen Wochenmarkt gibt es jetzt. Mag sein, dass es keiner glaubt, aber inmitten der »Eiger Nordwand«, wie die Wohnblöcke rings um die Bartningstraße im Volksmund heißen, habe ich mich als Kind und auch später durchaus heimisch gefühlt.
Kurz nach meinem fünften Geburtstag waren wir eingezogen, Vater, Mutter, meine großen Brüder und ich. Damals war die Familie noch komplett, nicht glücklich, aber komplett. Mit Vaters Tod, er starb an einer Leberzirrhose, ging es bergab. Mutter arbeitete hart, bis sie an Parkinson erkrankte, was sie schließlich in den Rollstuhl zwang. Meine Brüder zogen aus, ich gab meinen Job als medizinisch-technische Assistentin auf und blieb bei Mutter wohnen. Ihre Rente reichte für die Miete und ein passables Auskommen für uns beide. Urlaub war nicht drin, Kino auch nicht, doch Mutter wäre zu solchen Ausflügen ohnehin nicht in der Lage gewesen.
Mitleid mit mir? – Ist unangebracht. Ich bin nicht der Typ für ein geregeltes Berufsleben. Schlecht gelaunte Chefs und ehrgeizige Kollegen machen mich unglücklich. Softwaresysteme auch. Besonders unglücklich machen mich Männer. Sie übersehen mich einfach. Schon in der Schule haben sich die Jungs mir nur genähert, um an meine attraktiveren Freundinnen heranzukommen. Den Gedanken ans Heiraten gab ich folgerichtig mit achtzehn auf. Nein wirklich, ich habe in all den Jahren, die ich mit Mutter allein zusammenwohnte, nicht viel vermisst. Mein Leben hätte gut und gerne so weitergehen können. Doch Parkinson verläuft in unvorhersehbaren Schüben: Zittern und Muskelsteifigkeit, Störung der Reflexe, Inkontinenz, Ohnmachtsanfälle … Zuletzt ging es ganz rasch. Mit Mutters Tod entfiel ihre Rente. Beim Jobcenter nötigte man mich, mir Arbeit zu suchen. Und aus der Vierzimmerwohnung auszuziehen.
Ich gebe zu, ich bin sentimental. Der Abschied von den Räumen, die so lange mein Zuhause gewesen waren, tat schrecklich weh. Alles deprimierte mich: Das bleichgraue Licht, das sich ausbreitete, seit die Vorhänge fehlten, die hellen Rechtecke an der Tapete, die Mutters Blumenaquarelle hinterlassen hatten, die von Blut gedunkelten Fliesenfugen vor der Badewanne, Zeugnis von Mutters verzweifeltem Versuch, ihr Leiden abzukürzen. Die ganze ausgeräumte Wohnung erschien mir wie tot. Wie Mutters Leiche. Kalt und fremd.
Aber ich wollte tapfer sein, zwang mich zur nüchternen Überprüfung, ob alles leer und »besenrein« war, wie der Mietvertrag es bei Auszug verlangte. Mangels eines Besens – ich hätte ihn schlecht in der Straßenbahn transportieren können, ohne Aufsehen zu erregen – benutzte ich einen Akku-Handstaubsauger, kroch damit durch die Zimmer, bearbeitete auch die Ecken, die Scheuerleisten, die Fensterbänke, versuchte, die Staubflusen zu erwischen, die ich beim Auszug übersehen hatte.
Es war diese Gewissenhaftigkeit (eine sicherlich positive, aber heimtückische Eigenschaft, weil sie mir ständig Nachteile im Leben einbringt), die mich in einer nachlässig gezimmerten Abseite im Wandschrank diese Pappkiste entdecken ließ. Das heißt, ich konnte nicht gleich erkennen, was da lagerte. Viele Generationen von Spinnen hatten sie umwebt, irgendwann vertrieben von dem Staub, der Jahr für Jahr durch die Ritzen gedrungen war und ihre Netze verklumpt hatte.
Ich hielt mir die Hand vor Mund und Nase, richtete die Staubsaugerdüse auf das eklige Gewirr, bis sich ein altertümlicher Waschpulverkarton zu erkennen gab. Drinnen lauter Flaschen: Whisky, Wodka, Doppelkorn … Mein Vater, ein unentwegter Altlinker, war nicht wählerisch, wenn es darum ging, sich aus Gram über die ausgebliebene Weltrevolution zu betrinken.
Es versteht sich, dass ich diese Überreste entsorgen musste, damit die Nachmieter, die schon am folgenden Tag renovieren wollten, nicht schlecht von mir oder gar von meiner Mutter dachten. Kein Problem, sagte ich mir, die Flaschencontainer stehen ja keine zwanzig Meter weit an der Biegung der Zufahrtsstraße.
Ich nahm die Kiste und die Wohnungsschlüssel, trat in den Flur – und sah sie durchs Fenster: drei junge Männer mit wattierten Jacken, Schirmkappen oder Kapuzen, Beuteljeans und Sportstiefeln. Sie standen an einer halbhohen Betonmauer, die die Glascontainer großzügig einfriedete und von der Einfahrt einer alten, kaum noch frequentierten Tiefgarage abteilte. Sie tranken Bier aus Flaschen, rauchten was auch immer, rangelten und knufften sich. Keine Chance, unbemerkt an ihnen vorbeizukommen. Ihr Gegröle drang durchs Fenster und klang gefährlich nach Langeweile und Imponiergehabe. Oder nach Wut auf alle Welt.
Der Tag war kühl, und es dämmerte schon. Sie würden bald verschwinden. Dachte ich. Ich spielte auf meinem Handy ein paar Solitärs und spähte gelegentlich hinaus. Nach einer Viertelstunde zählte ich vier, nach weiteren zehn Minuten fünf Kerle.
Das war so ein Moment in meinem Leben, in dem ich gern ein eigenes Auto gehabt hätte, meinetwegen ein altes und unscheinbares. Dann hinein mit dem Karton, ab und weg. Ich träume oft von einem kleinen Wohnwagen. Der würde reichen für die paar Sachen, die mir wichtig sind. Damit würde ich an die Schottische Küste fahren oder in die Schweizer Berge oder in die Camargue. Irgendwohin, wo man nicht dauernd aufMenschen trifft. Erst recht nicht auf herumlungernde, Bier saufende und grölende Halbstarke.
Ich überlegte, ob ich eine Bekannte mit Auto anrufen könnte, damit sie die Kiste und mich in meine neue Wohnung bugsiert. Oder zu einer anderen Altglassammelstelle. Doch es gab niemanden, dem ich gern erklärt hätte, woher die vielen alten Flaschen stammten. Es half nichts, die mussten in die Container vorm Häuserblock. Noch vor zwanzig Uhr, wie die Aufkleber verlangten, um die Nachbarn nicht zu belästigen.
Als sich nach einer weiteren Viertelstunde die Anzahl der Kerle wieder auf drei reduziert hatte, nahm ich all meinen Mut zusammen, den Karton in beide Hände und den Aufzug nach unten. Ich trat aus dem Haus und ging, meine Kiste fest an den Bauch gepresst, auf die Mülltonnen zu. Der ein oder andere geparkte SUV bot mir ein paar Meter weit Sichtschutz.
Ich spitzte die Ohren und registrierte zufrieden, dass sie mit einer Diskussion über die Qualitäten der örtlichen Spielhölle beschäftigt schienen. Also trat ich aus der Deckung, marschierte ohne einen Blick in ihre Gesichter auf die Einfriedung zu, passierte den Durchgang zu den Containern und drehte der Meute den Rücken zu. Mein Herz pochte, ich atmete flach und hastig, schob aber scheinbar unbekümmert meine Flaschen nacheinander – weiß zu weiß, grün zu grün, braun zu braun –durch die dosendicken runden Öffnungen, jedweden Schwung und damit lautes Klirren vermeidend.
Ich war fast fertig, griff nach der letzten Flasche, die im Gegensatz zu den anderen in vergilbtes Zeitungspapier gehüllt war und mich in ihrer Form an Sekt denken ließ. Sie war keinesfalls leer, wog schwer in meiner Hand. Vorsichtig löste ich das Papier ab, fand ein unversehrtes Etikett mit dem Aufdruck Moët & Chandon und einen kunstvoll mit Draht umwickelten Korken.
Ich stutzte. Ein echter Champagner, ein teurer Champagner, viele Jahre alt. War so etwas noch genießbar? Fieberhaft überlegte ich, was ich auf die Schnelle damit anfangen sollte, als sich eine nach Tabakrauch stinkende Pranke auf meine Schulter legte: »Na, Püppi, was haste’n da Schönes?«
Ich fuhr herum, sah in ein pickelnarbiges Gesicht mit schwarzem Flaum auf der Oberlippe. Und schwieg.
»Sie will mir was schenken«, murmelte ein feister Kerl mit flächigen Wangen und einer brennenden Zigarette im spöttisch verzerrten Mund. Er lehnte betont lässig an der Mauer und säuberte seine Fingernägel mit der Spitze eines Klappmessers.
»Unser Freund Jeggo hat nämlich Geburtstag, Pussy. Und da darf er sich von allen was wünschen«, sagte der dritte Typ, ein Pykniker, der seine mangelnde Körpergröße durch Breitbeinigkeit wettzumachen versuchte. Nein, leider tatsächlich wettmachte, mir wurde schwindelig vor Angst, als er sich mir voll in den Weg stellte. Ich sah von einem zum anderen, wusste nicht, wen von den dreien ich am unsympathischsten finden sollte.
»So isses«, sagte der Feiste und grinste müde. »Aber ihr sollt nicht leer ausgehen. Machen wir’s so: Ihr kriegt die Braut, ich krieg die Flasche.«
»Nix da, wir teilen uns die komplette Beute. In der Tiefgarage.« Die Pranke ließ meine Schulter los, ergriff meinen linken Ellbogen und drehte mir den Arm schmerzhaft auf den Rücken. Eine schwielige Hand presste sich auf meinen Mund. Sie stank nach Schmutz, Schweiß und Bier.
Aus Richtung der Parkplätze hörte ich eine Autotür zuschlagen. Und noch eine. Die drei Typen hielten inne, verstummten, und ich schöpfte Hoffnung. Ein Paar, Anfang fünfzig, war aus einem Honda ausgestiegen, beide groß gewachsen, sie bewegten sich drahtig, sportlich. Ich holte tief Luft, brüllte gegen die Hand vor meinem Mund an, mehr als ein schwaches Grunzen brachte ich nicht heraus. Es genügte. Das Paar sah herüber! Sah gleich wieder weg, raffte ein paar Einkaufstüten aus dem Honda und verschwand, ohne einen Blick zurück, hinter der Ecke des Nachbarhauses.
Der Pykniker keckerte leise.
Panik ergriff mich, ich hielt meine Moët-&-Chandon-Flasche mit der Rechten fest umklammert und schwang sie wie eine Keule, um mir Respekt zu verschaffen.
»Na, gib’s mal her, dein Geschenk, Fotze.« Der Feiste rappelte sich von der Mauer weg, machte zwei Schritte auf mich zu. Er hatte ein tiefes Grübchen im Kinn, was seinem Gesicht etwas unpassend Kindliches gab. »Mach schon.« Er ließ die Klinge seines Klappmessers aufschnappen, drehte sie hin und her, sodass sie trotz des matten Abendlichts aufblinkte.
Andere Frauen besuchen Selbstverteidigungskurse, lernen tief in den Bauch zu atmen, sich zu straffen und ihre Körpermitte zu finden, um den Opferlook zu vermeiden. Sie üben sich darin, ihre Zähne in Schweineschwarten zu hauen und mit Handkantenschlägen und Fußtritten zentimeterdicke Holzbretter zu zertrümmern. Ich kann nicht beurteilen, ob mir derlei Fertigkeiten in meiner Lage geholfen hätten. Mir fiel nur eine einzige Methode der Selbstwehr ein, ich hob meine Champagnerflasche und schleuderte sie dem Dicken an den Kopf. Das heißt, ich zielte auf seinen Kopf. Tatsächlich flog sie seinen Oberbauch an. Er fing sie wie einen Ball.
Nicht mal einen Sprung hatte sie bekommen. Aber der Verschluss war aufgebrochen und eine hellschimmernde Flüssigkeit sprudelte wie ein Brünnlein heraus, besudelte seine Jacke, seine Hose …
»Huach!« Er hielt die Flasche von sich, ließ sie fallen. Sie zerbrach, und auch der Rest lief aus, sammelte sich vor seinen Boots, wo die Zigarette, die ihm zeitgleich aus dem Mundwinkel gerutscht war, zaghaft vor sich hin qualmte.
Ich betrachtete die Bescherung. Der Champagner war dahin. Und ich keineswegs gerettet. Ich wagte nicht, dem fluchenden Dicken ins Gesicht zu sehen, blickte weiter zu Boden, beobachtete staunend, wie die brennende Kippe nicht etwa in der Pfütze erlosch, sondern im Gegenteil aufglimmte, aufstob, aufloderte. Und ein paar Sekunden später – die ich brauchte, um zu glauben, was ich sah, und um den sich ausbreitenden Geruch von Reinigungsbenzin zu bestimmen – stand der Kerl in einer Suppe aus Flammen, die beide Hosenbeine erfassten. Er fluchte, keuchte, bückte sich, schlug mit bloßen Händen nach dem Feuer, umsonst, es kroch an ihm hinauf, bis zum Knie, bis zum Schritt. Er schrie, jaulte, taumelte, stolperte, fiel zu Boden. Da erst kamen seine Freunde auf die Idee, ihr restliches Bier über ihn auszukippen, ihre Jacken auszuziehen und die Flammen damit zu ersticken.
Eine gefühlte Ewigkeit später war das Feuer erloschen, es blieben Glasscherben, verrußte Jeans, stinkender Qualm und ein sich vor Schmerzen krümmender und brüllender Mensch. So unbändig und laut brüllte er, dass es in den Häusern ringsum zu hören sein musste. Dann sank er zusammen und lag da wie tot.
Seine Freunde waren zurückgewichen, standen starr und mit offenen Mündern. Ich auch. Als die ersten Jalousien sich bewegten, die ersten Fenster sich öffneten, rannten die beiden davon, den Grünstreifen in Richtung der Hauptstraße entlang. Ich nicht, ich floh in den erstbesten Hauseingang, tappte wie benommen die Treppe zum Keller runter, kauerte vor der Eisentür im Halbdunkeln und zitterte vor Entsetzen.
Ich hab ihn umgebracht, bestimmt hab ich ihn umgebracht oder ganz schwer verletzt, hämmerte es in meinem Kopf. Möglicherweise stammelte ich es halblaut vor mich hin. Jedenfalls antwortete mir eine Stimme, die klang, als käme sie aus einem Radio: »Quatsch, das war ich.«
Und da stand sie. Wie aus dem Fliesenboden gewachsen, keine drei Schritte von mir entfernt, hatte die halblangen aschblonden Haare im Nacken zu einem Zopf gebunden wie ich, trug ein eierschalenfarbenes Poloshirt mit geringeltem Strickblouson drüber wie ich. Ihre Füße steckten in meinen bevorzugten Gesundheitsschuhen mit dem Klettverschluss. Kritisch sah sie an sich hinunter.
Wer sind Sie, wollte ich fragen. Doch ich schwieg. Die Frage war überflüssig. Trotz der Dunkelheit im Keller (ich hatte vermieden, die Lampe anzuschalten) erkannte ich auf Anhieb ihre kleine Nase, ihr leicht fliehendes Kinn, das Muttermal über ihrer linken Augenbraue.
Sie antwortete trotzdem. »Ich bin dein Geist aus der Flasche, Isa, dein Dschinn aus der Champagnerpulle. Oder, um es präziser zu formulieren«, sie hob theatralisch die Arme, »ich bin die Dämonin aus dem Molotowcocktail, den unser Vater Ende der Achtziger nicht mehr hat schmeißen können.«
Mir wurde übel, ich brach zusammen.
»Und, tja, dein tapferes alter Ego bin ich auch«, sagte sie, als ich zu mir kam. Sie streichelte mich sanft und kicherte dabei wie ein Kind, das sich an einem drolligen Hund erfreut. Ihr Name war nicht schwer zu erraten, Vater hatte sie immer Billie genannt.
Es war Vater, dem wir den unsäglichen Vornamen unserer Kindheit zu verdanken hatten: Ilsebill. Wie die dreiste und gottlose Fischersfrau aus Grimms Märchen. Mit Mutter vereinbart war Isabell, doch auf dem Weg zum Standesamt entschied Vater sich anders. Er hatte schon immer die fixe Idee, dass unser Nachname, Liebmann, nach einem Kontrast verlange. Weil aus seinen Nachkommen keine angepassten Staatsbürger werden sollten, im Gegenteil. Ein den Mut stählender Vorname, so glaubte er, sei von Vorteil auf dem »Marsch durch die Institutionen«, zu dem sein Idol, Rudi Dutschke, aufgerufen hatte. Meine großen Zwillingsbrüder Hagen und Etzel hatte Vater nach den beiden bösartigsten klassischen Sagenhelden taufen lassen, weil der Standesbeamte sich auf Lenin und Trotzki partout nicht einlassen wollte. – Vater hieß übrigens Gottfried, weshalb wir ihn niemals mit Vornamen ansprechen sollten, wie es damals in den links orientierten Familien üblich war.
Zu seiner Enttäuschung entwickelten sich meine Brüder zu freundlichen Jungs mit besten Schulnoten, sogar in Betragen, Fleiß und Ordnung. Aufmüpfig waren sie allenfalls Vater gegenüber. Früh beschlossen sie, Elektrotechnik zu studieren und kündigten ihre Auswanderung in die Hochburg des kapitalistischen Imperialismus an, in die USA. Vielleicht nicht nur, um Vater zu ärgern, sondern auch weil in Amerika Leute die seltsamsten Vornamen haben können, ohne unangenehm aufzufallen. Ich, das um elf Jahre jüngere Nesthäkchen, wurde erneut in den revolutionären Kampf geschickt und in einen sogenannten Kinderladen gesteckt, eine von Vater initiierte Privatkita im Martinsviertel, wo ich schmutzig, laut und böse sein durfte, sollte, musste. Und wo es Lernziel war, jeden Vorschlag der Erzieherinnen mit einem emphatisch vorgetragenen Gegenvorschlag zu parieren. Sprüche wie Der Bundeskanzler Helmut Kohl ist außen dick und innen hohl lernte ich auswendig wie andere Kinder das Hänschenklein.
So verlief mein Leben in zwar ungewöhnlichen, aber immerhin geordneten Bahnen, bis ich zur Schule kam, wo mir das Stigma meines Vornamens zum ersten Mal bewusst wurde. Ich erinnere mich gut an die ungläubig aufgerissenen Augen der Lehrerin beim Verlesen der Klassenliste. Und Gesänge wie Ilsebillse, keiner willse verfolgten mich anfangs in jeder großen Pause. Um nicht zusätzlich anzuecken, lernte ich rascher als meine Mitschüler, leise zu sein, still zu sitzen und unbekannte Zeichen präzise in linierte oder karierte Hefte zu malen. Der Drill im Kinderladen kam mir dabei zugute.
Vater hätte mein Wohlverhalten in der Schule gewiss missfallen. Mehr noch, es hätte ihn schwer getroffen, wenn auch sein jüngstes Kind, seine über alles geliebte Billie, sich genauso konform entwickelt hätte wie seine missratenen Söhne. Um ihn zu beschwichtigen, erklärte ich die ein oder andere Hausaufgabe zur Strafarbeit, die mir auferlegt worden sei, weil ich die Klassenraumwände mit Fingermalfarben verschönert, die Lehrerin mit einem nassen Schwamm beworfen und eine reaktionäre Qualle genannt hätte. Auf dem Schulweg nach Hause brach ich Mercedessterne ab und klaute Tulpen, Lilien oder Astern aus Vorgärten von Einfamilienhäusern, um sie Vater als Trophäen meiner Rebellion gegen das Establishment ans Krankenbett zu bringen. Er war stolz auf seine Billie.
So begann meine aufregende Doppelexistenz, die anderthalb Jahre später jäh endete. Vater fiel ins Koma und wachte nie wieder auf. Man brachte ihn in die Städtischen Kliniken, hängte ihn an lärmende Apparate, nährte ihn tropfenweise aus Kanülen, die in seiner aufgedunsenen Haut steckten. Seine Hilflosigkeit schmerzte, und ich glaube im Nachhinein, dass dies der Anlass dafür war, dass ich mich später für einen medizinischen Beruf entschied.
Mutter bereitete sich frühzeitig auf seinen Tod vor. Und zögerte meine Umerziehung um keinen Tag hinaus. Sie kaufte mirEnid-Blyton-Bücher, ließ mich evangelisch taufen und erwirkte beim Einwohnermeldeamt (gegen die Gebühr eines Monatsgehalts) eine Eintragsänderung: Ich bekam den von Mutter ohnehin favorisierten Vornamen, aus Ilsebill wurde Isabell.
Die kleine Isabell gedieh zum Musterkind. Und Vaters Liebling Billie verschwand, wie ich nun begriffen habe, in dem Brandsatz, den er eigens gebastelt hatte, um ein letztes Fanal gegen die Stationierung von Pershing-Raketen auf deutschem Boden zu entzünden. Zu spät, die Demo fand ohne ihn statt und verlief laut Zeitungsberichten unerwartet friedlich.
»Und? Was willst du von mir?«, fragte ich matt.
»Von dir? Gar nix, Isalein. Bleib ganz ruhig.« Billie musterte mich abschätzig, wie ich als Häuflein Elend auf dem blanken Boden kauerte, trat zu dem kleinen Oberlicht im Kellervorraum und lauschte. Ein Krankenwagen tatüterte herbei, jemand rief etwas, Nachbarn quasselten aufgeregt.
»Wie … wie soll es weitergehen?«, fragte ich.
»Wir warten, bis die Sanis weg sind. Wenn der Kerl noch lebt und bei Bewusstsein ist, erkennt er dich. Und zeigt dich womöglich an.«
»Das meine ich nicht. Wie es mit uns weitergehen soll, meine ich.«
Sie lachte. »Schau’n wir mal.«
Ich richtete mich auf. »Ich komme nämlich gut allein zurecht.«
»Ha, das haben wir gerade gesehen. Ohne mich würden sich die drei Kotzbrocken jetzt in der Tiefgarage über dich hermachen.«
Kotzbrocken? Mir wurde schon wieder übel. Ich versuchte, langsam und konzentriert zu atmen.
Blaulicht waberte durchs Fenster, ein Martinshorn heulte auf, verklang allmählich. Billie reckte sich auf die Zehen und sah hinaus. »Der Krankenwagen ist weg. Dafür ist die Polizei angerückt, zwei Männer in Uniform. Und jede Menge Nachbarn stehen rum und gucken.«
Ich sagte nichts mehr, stand auf, klopfte ein paar Staubflusen von meiner Hose und verließ, ohne auf Billie zu achten, mein Schlupfloch, um den Polizisten pflichtschuldigst zu bekennen, was passiert war. Mir zitterten die Beine, ich fühlte schon die Handschellen an meinen Gelenken, sah mich auf dem Rücksitz eines vergitterten weiß-blauen Transporters davonfahren, mit beiden Händen die Stäbe umklammernd … Dazu kam es nicht. Die Menge vor dem Haus erwies sich als undurchdringlich. Und sie ignorierte mich. Wie mich alle Welt immer ignoriert. Kaum gelang es mir, einen meiner Oberarme zwischen einen Brustkorb und einen Schmerbauch zu schieben, holte ein angewinkelter Ellbogen aus und bugsierte mich zurück. Ich überlegte, wie ich mich akustisch bemerkbar machen könnte, entschloss mich, laut zu rufen: Ich war’s. Lassen Sie mich durch!
Die zwei lächerlich kurzen Sätze lagen mir schon auf der Zunge, da hielt mir jemand den Mund zu und rief etwas anderes, etwas ganz anderes: »Ich bin Zeugin, hab’s genau gesehen.« Billie rempelte sich erfolgreich bis zu den Polizisten vor und tischte ihnen eine derart plausible Lügengeschichte auf, dass ich heute am liebsten selbst daran glauben möchte: Vier junge Männer hätten sich geprügelt, erzählte sie, zwei von ihnen seien mit Messern auf die anderen beiden losgegangen. Da hätte einer der Angegriffenen einen länglichen Gegenstand aus seiner Lederjacke gezogen, ein Feuerzeug darangehalten, die Gegner damit beworfen. Ich hörte nicht mehr hin, registrierte nur noch, wie Billie mit erhobenem Kinn und leuchtenden Wangen redete und redete … und alle überzeugte. Manche der Nachbarn beeilten sich zu versichern, dass sie genau dasselbe beobachtet hätten. Als die Spurensicherung das Klappmesser des Opfers bei der Abmauerung fand und als Beweismaterial sicherstellte, überwand ich einen erneuten Schwächeanfall und lächelte schweigend in die Runde.
Billie tat, was getan werden musste. Sie holte meine restlichen Sachen aus der alten Wohnung, schloss die Tür ab und warf den Schlüssel, wie mit dem Hausmeister verabredet, in dessen Briefkasten. »Schönen Abend allerseits!«, rief sie den noch immer am Wendehammer gruppierten Nachbarn zu, hakte sich bei mir ein, als seien wir beste Freundinnen, und schleppte mich nach Hause.
Meine neue Wohnung (anderthalb Zimmer, Dachgeschoss) liegt gut sechs Kilometer Luftlinie von der alten entfernt in der lauten und abgasreichen Heidelberger Straße. Ein gewisser Trost: Die Heidelberger quert Bessungen. Bessungen, das Kultviertel. Die geschichtsträchtige Siedlung, im vierten Jahrhundert gegründet und damit um einiges älter als Darmstadt selbst, ist heute ein urbanisiertes Dorf oder ein dörflicher Stadtteil, ganz wie man will. Lebhaft und still, bunt und bieder, teilweise edel, teilweise nicht so edel – Bessungen ist alles zusammen im Kleinformat. Und von meinen Mansardenfenstern aus habe ich den perfekten Überblick.
Die wenigen Möbel, die mit umziehen konnten, waren noch provisorisch platziert, die unausgepackten Umzugskisten türmten sich im Flur. Mir hatte bis dahin der Elan gefehlt, mich wohnlich einzurichten.
Billie sah sich um. Liebevoll strich sie über Vaters klassizistischen Schreibtisch, sein selbstgebautes Kiefernholzregal, blätterte sich durch seine Doppelkopfkarten, spielte auf seiner Maultrommel die Internationale. Zuoberst in einer der Bücherkisten fand sie die mehrbändige DDR-Ausgabe von Bertold Brechts Gesammelten Werken, das dreibändige »Kapital« von Marx und Engels, auch die legendären »Pariser Manuskripte«. Sie jubelte. »Die bekommen einen Ehrenplatz.«
Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden, wagte nicht zu bekennen, dass ich die Bücher nur behalten hatte, um sie bei Ebay gegen Höchstgebot zu verscherbeln. Was man nicht brauchen kann, ist Plunder. Meine Meinung.
Nachdem sich Billie, ohne zu fragen, einen Schokopudding aus meinem Kühlschrank und ein Lavendelblüten-Wellnessbad in meiner Wanne genehmigt hatte, begann sie, meine Kleiderkoffer zu durchwühlen, rechtfertigte sich damit, dass sie »was Gescheites zum Anziehen« benötige. Ich konnte nur ahnen, was sie darunter verstand. Meine Feincordhosen und Baumwollblusen waren es nicht, mein Kammgarnkostüm und mein Tweedsakko auch nicht. Die musste ich am folgenden Tag aus einem Altkleidersack der Johanniter retten, zusammen mit den praktischen warmen Achselunterhemdchen, die ich von Mutter geerbt hatte.
Billie entschied sich für ein paar schwarze Strumpfhosen und ein Strandshirt mit Leopardenmuster, die sie mit meinen einzigen – etwas zu klein gekauften – Pumps kombinierte.
Um der Gastfreundschaft willen überließ ich ihr die Sachen, ebenso mein Bett und machte mir ein Lager auf dem Sofa. Sie schlief sofort ein. Ich trank eine halbe Flasche Rotwein und versuchte, all die Bilder, all die Eindrücke des Abends zu verscheuchen. Umsonst. Wie in einem Kaleidoskop rotierten die Splitter in meinem Kopf: das Pickelgesicht mit dem Bartflaum, die stinkende Hand, die mir den Mund zugehalten hatte, der feiste Kerl mit dem Messer und dem kindlichen Grübchen im Kinn. Die Schampusflasche, die Flammen … und Billie. Billie, die nebenan schlief, als sei nichts passiert.
Zu zweit in einer so kleinen Wohnung, war das auszuhalten? Schwerlich. Zu zweit in einem so kleinen Leben? Ging gar nicht. Ich beschloss, einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Familiär inspiriertes posttraumatisches Syndrom würde ich ihm als Diagnose nahelegen. Tabletten, Hypnose oder eine sogenannte Familienaufstellung? Ich schaltete meinen Laptop ein und googelte alle Möglichkeiten durch. Am Ende erschien mir Familienaufstellung nach Hellinger in Kombination mit Urschreitherapie als ein erfolgversprechender Ansatz. Aber würde die Krankenkasse zahlen? Ich nahm mir vor, es am Morgen herauszufinden.
Meine Sorge erwies sich als überflüssig. Vorerst. Als ich aufwachte, war Billie verschwunden, regelrecht auf und davon. Auf dem Esstisch lag ein Zettel: »Geh du zu deinem Psychodoktor und mach dich lächerlich. Ohne mich. Ich packe jetzt mein neues Leben an. Endlich!«
Konnte sie Gedanken lesen? Ich schämte mich, sie nicht als gleichberechtigte Partnerin in meine Überlegungen einbezogen zu haben. Doch dann schämte ich mich wieder nicht. Kein bisschen. Hatte ich nicht das Recht auf meinen Vorsprung in Sachen Reife und Persönlichkeitsbildung? Nicht das Recht, unbeeinflusst von ihr mein Leben auf meine Weise fortzusetzen? Ich riss den Zettel in kleine Stücke und ließ sie in den Papierkorb rieseln. Keine Woche später kam ich zu der Überzeugung, dass alles nur ein böser Traum gewesen war. Was für ein Irrtum!
Da keine Vermisstenmeldung vorlag, übergab die Polizei den kleinen Jegor Plewe dem Fürsorgeamt der Stadt Darmstadt, das ihm einen Platz im Kinderheim Martinushof vermittelte. Akteneinträge beschreiben den Jungen als »freundlich und integrationswillig, aber auch etwas still und in sich gekehrt«. Dem Bericht eines Betreuers zufolge fragte Jegor mehrmals nach seiner Schwester und bat darum, sie ebenfalls im Heim wohnen zu lassen.
Es dauerte Monate, ehe das Fürsorgeamt die Zeit fand, nach seiner Herkunft zu forschen. Die Ergebnisse waren spärlich. Jegors Vater, Anton Plewe, war als Deutschrusse mit zwei Kindern aus Tomsk eingereist. Er arbeitete als Lagerist bei der Firma Merck, die Familie wohnte im Stadtteil Arheilgen. Wenige Tage vor dem Auffinden Jegors starb der Vater bei einem Autounfall, nachdem er seinen Sohn von einer Kinderfreizeit abgeholt hatte. Der Junge, im Fond des Wagens, blieb unversehrt. Nachbarn vermuteten, dass die Mutter bereits vor Übersiedlung der Familie verstorben sei. Von einer Tante und vom Verbleib der Schwester war niemandem etwas bekannt.
*
Billies Auftritt hatte eine nachhaltige Wirkung auf meine seelische Verfassung. Ich überwand meine Trauer um Mutter und mein verlorenes Zuhause, beschloss nun selbst, meinneues Leben anzupacken, wie Billie es ausgedrückt hatte. Was zunächst bedeutete, meine Umzugskisten auszupacken. Ich räumte Geschirr und Besteck in die Küche, hängte Mutters Blumenaquarelle an die Wände, setzte meinen alten Teddybären aufs Sofa und ersteigerte mir Gardinen bei Ebay. Täglich ging ich die Stellenangebote im Internet durch – und tatsächlich haben sogar Frauen wie ich mitunter Glück. Ich fand einen Job als Pflegehilfskraft in einer mir bis dahin völlig unbekannten Klinik in Eberstadt. Seit Mai verdiene ich achthundert Euro im Monat bei ausgesprochen abwechslungsreichen Tätigkeiten. Und Arbeitszeiten.
Als Springkraft habe ich all das zu erledigen, was simpel, aber nötig ist: Malventee für die Patienten kochen, in Kannen füllen und auf einem kleinen Tisch im Flur bereitstellen, die Seifenbehälter in den Krankenzimmern und Besuchertoiletten auffüllen, die Einweghandschuhe und Einwegspritzen aus den Großpackungen nehmen und auf die Stationen verteilen, Wundpflaster in brauchbare Streifen schneiden …
Die Stationsärzte und Chirurgen übersehen mich gerne, gucken durch mich hindurch wie durch aufgewirbelten Staub. Die Krankenschwestern nicht, denn sie haben jede Menge Arbeit zu delegieren und zeigen sich durchweg freundlich, weil von mir keinerlei Konkurrenz ausgeht. Im Gegenteil, wir Springkräfte (außer mir gibt es noch drei) sind ihnen überaus willkommen. Wir nehmen ihnen die unqualifizierten Alltagsdinge ab, und bei kleinen Pannen können sie leicht die Schuld auf unsere Unerfahrenheit schieben. Kurz, es ist der ideale Job für einen zurückhaltenden Menschen wie mich. Ich habe es dank meiner beflissenen Demut nun sogar in die heiligsten Hallen des Hauses geschafft, habe Zugang zur Chirurgie und zur Intensivstation, wo ich die Ampullen wechseln und frische Bettwäsche bereitlegen darf. Wenn man mit meiner Arbeit zufrieden ist, winkt mir nach einem Jahr eine Festanstellung. So zumindest hat man es mir beim Bewerbungsgespräch zugesagt. Dass es noch rascher klappen könnte, habe ich Billie zu verdanken. Und so ein bisschen auch Jegor Plewe, genannt Jeggo.
Es war neulich, am 19. Mai, kurz vor Mitternacht, da trat er erneut in mein Leben, genauer gesagt, er kam angerollt. Wieder mal rotierte Blaulicht, schepperten Fahrzeugrampen an der Notaufnahme der Klinik. Sekunden später bugsierten zwei Sanitäter in routinierter Hektik eine Liege mit einem Schwerverletzten darauf den Krankenhausflur entlang, begleitet von einem Assistenzarzt, der sie mittels knapper, scharf intonierter Kommandos Richtung OP lotste und per Funk den Bereitschaftschirurgen verständigte. Einen kurzen Moment parkte man die bewusstlose Person vor dem Tresen der Notaufnahme in unmittelbarer Nähe von Schwester Karin und mir. Wegschauen ging nicht. Ich erkannte einen kurzgeschorenen linksseitig eingedellten Schädel, aus dem eine blutverschmierte, grauschimmernde Masse quoll und von dem eine fast weiße Ohrmuschel herabhing. Schwester Karin stieß einen Seufzer aus. »Ein ganz junger Mann!«
Ich schwieg, ortete unterhalb der üblen Verletzungen ein Kinn mit kindlichem Grübchen, erahnte die massige Gestalt unter der Thermofolie, schrie leise auf und wich einen Schritt zurück.
»Das gibt sich, Kindchen, mit der Zeit gibt sich das. Atmen Sie ein paar Mal tief ein und aus, trinken Sie einen Schluck Wasser!« Schwester Karin steht kurz vor der Rente und versorgt, seit sie mehr und mehr von der direkten Patientenversorgung abgeschnitten wird, jüngere Kollegen gern mit probaten Tipps.
»Geht schon wieder«, sagte ich, riss mir den Kittel vom Leib und floh aus der Klinik nach Hause. Meine Schicht war zum Glück um.
Da hatte dieser Kerl also meine Molotowattacke nicht nur überlebt, er hatte sie so unbeeindruckt überstanden, dass er weiterhin in der moralischen Verfassung war, seine Mitmenschen zu drangsalieren. Dachte ich. Denn einen anderen Hintergrund, als dass eines seiner Gewaltopfer ihm aus Notwehr oder aus Rache den Schädel eingeschlagen hatte, konnte ich mir nicht vorstellen. Vielleicht eine Frau wie ich, die er zusammen mit einer Crew ähnlicher Scheusale vergewaltigen wollte. Ich hoffte im Stillen, diese Frau würde nachhaltigeren Erfolg haben, nein, sie würde ihn endgültig erledigt haben. Was unangemessen unchristlich gedacht war, ich weiß, aber schließlich ging es um meine Haut, zumindest um meinen Job. Ein wiederhergestellter Jeggo würde früher oder später hier auf mich treffen. Mich erkennen. Sich an mir rächen. Um dem zu entgehen, müsste ich kündigen. Meinen wunderbaren neuen Job aufgeben?
Nach ein paar schlaflosen Stunden meldete ich mich zum Frühdienst. Ich musste wissen, wie es um ihn stand, und kreiste mit meinem Tablettwägelchen durch die Chirurgie.
Da sah ich zwei Männer im Flur sitzen, die offenbar auf eine Nachricht warteten, einmütig stumm in ihrer Besorgnis: einer schätzungsweise Mitte vierzig, graublond, Stirnglatze, hängende Wangen, scharfe Linien zwischen Mundwinkeln und Kinn wie Angela Merkel; ein anderer, zirka dreißig mit südländischem Teint, dunklem Haar und dunkel umwimperten hellblauen Augen. Zusammengesunken hockten sie auf den Fiberglasstühlchen, schauten abwechselnd mal aufs Linoleum, mal auf die Schwingtür, empfingen jeden heraustretenden Weißkittel mit gespannten Blicken.
»Das sind Angehörige der Schädelfraktur«, flüsterte mir Schwester Mareike zu. Ich grüßte die Männer mit einem knappen Nicken, eilte mit Mullbinden und Wundpflasterpäckchen beladen an ihnen vorbei ins Depot und wieder heraus, und wieder hinein und wieder heraus, tat hektisch, als ginge es auch beim Einräumen von Lagermaterial um Leben und Tod.
Am nächsten Tag gelang es mir, einen Blick in die Krankenakte zu werfen. Jegor Plewe, geb.: 31. März 1995, Nowosibirsk (Russland), Staatsbürgerschaft: deutsch, verlegt in Zimmer 010, Schädelfraktur mit akuter Subduralblutung. Die Diagnose las sich schlecht. Sehr schlecht. Also gut. Er würde mit hoher Wahrscheinlichkeit das Zeitliche segnen. Oder behindert sein. Zu behindert, um mir gefährlich zu werden. Erleichtert packte ich meine Sachen, wollte nach Hause …
Vielleicht war es Neugier, vielleicht hatte ich auch gehofft, mit meinen Erlebnissen leichter abschließen zu können, jedenfalls besann ich mich an der Pforte anders und machte kehrt. Ich wollte ihn mir noch einmal anschauen, den Dreckskerl, ihn hilflos daliegen sehen. Ich genehmigte mir einen doppelten Espresso in der Kantine und beschäftigte mich mit dem Überprüfen der Batterien in allen Fieberthermometern des Hauses, bis es Abend wurde.
Nach dem Schichtwechsel schlich ich mich zur Intensivstation, Zimmer 010. Da lag er. Allein. Lang ausgestreckt, ganz in Weiß, nur die Nase mit den Schläuchen und das Kinn mit dem Grübchen ragten aus den Kissen. Friedlich sah er aus.
Mein Herz schlug noch lauter als sein Beatmungsgerät pumpte. Geh jetzt, Isabell, dachte ich, trat stattdessen näher an ihn heran.
Seine Lider waren geschlossen, die Haut blass, leichenblass. Kein Wunder, der Monitor zeigte eine Herzfrequenz von 45 an, viel zu niedrig. Da konnte was nicht stimmen. Fetzen einer Erinnerung schossen mir ins Bewusstsein: Bildhaft tauchten zwei junge Ärzte vor mir auf, wie sie just an diesem Nachmittag im Flur gestanden, ihre Köpfe zusammengesteckt und über eine Mappe mit Röntgenaufnahmen gebeugt hatten. Einer verschwand für einen Moment in der 010 … Keine drei Minuten später verließen sie zusammen die Station, so eilig, dass die Schöße ihrer weißen Kittel flatterten. Dass ich sie nicht kannte, war ungewöhnlich, auch wenn ich mit der Röntgenabteilung bis dahin wenig Kontakt hatte. Und jetzt, im Nachhinein, fiel mir dieses unnatürliche Leuchten ihrer Kleidung auf. Es deutete auf ein Waschmittel mit optischen Aufhellern hin, wie sie hier, in der Eberstädter Magdalenen-Klinik, verpönt sind. – Waren das gar keine Ärzte? Wie sind die dann hier reingekommen? Ich betrachtete die Apparate, beobachtete die Zahlen am Monitor … eine Herzfrequenz von 43! Ich fröstelte vor Verwirrung. Und war kein bisschen erstaunt, hier und jetzt wieder diese aufwühlende Radiostimme zu hören, Billies Stimme. »Er wird sterben, wenn du nichts unternimmst.«
»Unsinn, sobald er zu kollabieren beginnt, geht die Alarmanlage los«, versicherte ich.
»Kann sein, zu spät.«
»Er hat ohnehin kaum Chancen.«
»Aber so hat er null Chancen, und du weißt es.«
»Was mischst du dich ein? Ist keine sieben Wochen her, da hast du ihn fast umgebracht.«
»Das war Notwehr.«
»Und jetzt?«
»Ist er in Not und braucht Hilfe.«
Am Monitor erschien die 42.
»Wenn er überlebt und mich erkennt, bin ich geliefert.«
»Hach, Isahäschen, da findet sich doch garantiert ein Ausweg.«