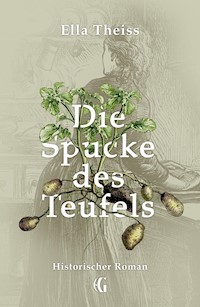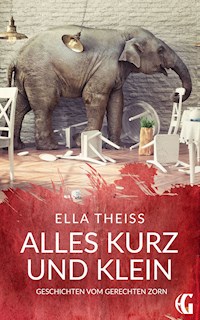Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Wahre Verbrechen im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Darmstadt, 1847. Gräfin Emilie von Görlitz stirbt bei einem Brand in ihren Gemächern. Während Polizei und Justiz von einem Unfall ausgehen, wittert die Öffentlichkeit einen Gattenmord. Kurz darauf wird Kammerdiener Johann verhaftet, ihm droht die Todesstrafe. Seine Braut Christina ist von seiner Unschuld überzeugt, gerät aber als Mörderliebchen selbst an den Pranger. Dann bricht die Revolution aus, und die Welt steht Kopf. Christina wittert eine Chance für Johann und schließt sich dem Radikaldemokraten Paul an. Aber ist dem tollkühnen Kerl zu trauen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ella Theiss
Das Darmstädter Mörderliebchen
Ein wahrer Kriminalfall
Zum Buch
Mord, Liebe, Revolution Darmstadt 1847. Die gemütskranke Gräfin Emilie von Görlitz kommt bei einem Brand in ihrem Salon ums Leben. Ein Unfall? Selbstmord? Oder gar Gattenmord? Mit ihrer Ehe stand es nicht zum Besten. Doch dann wird überraschend der Kammerdiener Johann festgenommen. Ihm droht die Todesstrafe. Für seine Verlobte Christina, die an seine Unschuld glaubt, beginnt ein Spießrutenlauf. Bürgersleute werfen ihr scheele Blicke zu und Gassenbuben sogar Steine hinterher. Sie verliert ihre Arbeit, ihre Wohnung, ihre Freunde. Gäbe es nicht Luise Büchner und ihren als Häkelkränzchen getarnten Frauenzirkel, Christina würde verzweifeln. Da bricht die Revolution aus. Dem Adel geht es nun hoffentlich an den Kragen, und Johann bekommt die Chance auf ein faires Gerichtsverfahren. Christina schließt sich dem Radikaldemokraten Paul an, um mitzukämpfen. Doch kann sie dem tollkühnen Kerl vertrauen?
Ella Theiss ist das Pseudonym von Elke Achtner-Theiss, die in der Nähe von Darmstadt lebt. Sie hat Germanistik und Sozialwissenschaften studiert und anschließend rund 35 Jahre lang als Redakteurin, PR-Texterin und Sachbuchautorin gearbeitet, insbesondere in den Themenbereichen Ökologie und Bio-Lebensmittel. Heute schreibt sie vor allem Romane und Erzählungen, von denen bereits mehrere ausgezeichnet wurden. Unter anderem belegte sie mit einem Histo-Krimi den zweiten Platz beim Gerhard-Beier-Preis, und eine ihrer Kurzgeschichten gewann den Quo-Vadis-Preis für historische Kurzgeschichten.
Mehr Informationen zur Autorin unter: www.ellatheiss.de
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Market_place,_Darmstadt,_Germany,_ca._1895.jpg
ISBN 978-3-8392-7836-9
Zitat
»Die Fähigkeit zur Freundschaft gehört zu den edelsten, welche unsere Seele überhaupt besitzt, die Freundschaft selbst ist zugleich eine der reinsten und genussreichsten Gemütsstimmungen und vielleicht die einzige Leidenschaft, deren Übermaß nichts Tadelnswertes hat.«
Georg Büchner
Kapitel 1 13. Juni 1847
Feuer
Der Luisenplatz lag rotgold leuchtend in der Dämmerung. Tauben tippelten umher, befreiten das Pflaster von den Krümeln des langen Tags. Rund um den Sandsteinsockel des Ludwigsmonuments hatten sich einige Nachtschwärmer eingefunden. Es war ein lauer Abend, was sollten sie da in der Kammer hocken? Sie guckten dem Mond beim Aufgehen zu, sinnierten, witzelten oder klagten über ihren Großherzog Ludwig II., über den Filz in seinen Amtsstuben, über sein Heer an bewaffneter Polizei, das mehr Angst als Sicherheit verbreitete. Niemand achtete auf die Rauchschwaden, die über die Dächer der Neustadt krochen, denn in den vornehmen Vierteln der Stadt brannten auch im Sommer die Kamine.
Christina und Babette hatten sich eben erst eine Bank am Brunnen erobert, um Neuigkeiten aus dem Dunstkreis ihrer jeweiligen Dienstherrschaft auszutauschen, da stob eine Horde Gassenbuben wie eine Windbö aus der Rheinstraße heran. »Feiiier! S’brennt … S’brennt!« Einer rannte das Wägelchen eines Scherenschleifers über den Haufen und landete bäuchlings zu ihren Füßen.
Christina brachte den Korb mit den Biskuitküchlein hinter ihrem Rücken in Sicherheit. Die waren vom Geburtstagsessen ihrer Herrschaft übrig und für Johanns Nachtmahl gedacht. Babette bückte sich, hob den Pinscher, mit dem sie wie an jedem späten Abend Gassi ging, auf ihren Schoß. Amtsrat Schwab und seine Gattin wären untröstlich gewesen, wenn dem Tier etwas zustieße.
»Ja, wo brennt’s denn?«, fragte Babette den Buben, der sich keuchend vor ihnen erhob und so aussah, als gehöre er längst ins Bett.
»Ei, in de Neckarstraß’ beim Graf Gällitz.« Wohliges Schaudern zeigte sich auf seinem verdreckten Gesichtchen.
»Beim … Grafen … von Görlitz …« Auch Christina überkam ein Schaudern. Kein wohliges, nein, ein fröstelndes, ein eiskaltes Schaudern vom Scheitel den Rücken hinunter. Sie übergab Babette den Korb mit den Küchlein, raffte ihr Kleid und rannte, erst die Rhein-, dann die Neckarstraße hinunter zur Hausnummer 81. Johann!
Von ferne wehte ihr Brandgeruch entgegen. Sie erstarrte. Und lief sofort weiter in ihren zu großen Pantinen, so entschlossen und zielstrebig, dass ihre Schritte von den Häuserzeilen widerhallten. Jo-hann! Jo-hann!
Eine Traube Neugieriger versperrte die Sicht auf den Wohnsitz des Grafen, doch aus den Fensterritzen der Beletage quollen unübersehbar pechschwarze Rauchschlieren, stiegen über die Ansammlung von Zylindern, Batschkappen und Schutenhüten hinweg in den Abendhimmel.
Vom Pumpbrunnen in der Nähe wurde Wasser in Eimern herangeschleppt und in einer Menschenkette bis in den Hof des Anwesens gereicht. Fast ein Dutzend Männer waren im Einsatz. Christina wollte mitmachen, etwas tun gegen die Angst. Der Gedanke, Johann könnte mit dem Leben ringen, elend ersticken, qualvoll verbrennen, brachte sie um den Verstand. Sie warf sich in die Menge, setzte Ellbogen gegen Wänste und Brüste ein. Und kam dennoch nicht voran. Obwohl sie eine erwachsene Frau war – zudem groß gewachsen – und längst kein Kind mehr. Sondern eines hatte, das bei ihrer Mutter in Fränkisch-Crumbach aufwuchs und an das sie jetzt denken musste. Dorchen,mein Liebchen, dein Papa …
Die sich vergrößernde Schar der Neugierigen schob sich an Christina vorbei, drängte sie zurück an den Rand des Trottoirs. Mit Eifer tauschten sie aus, was sie wussten und was sie nicht wussten.
»Is denn noch aaner im Haus?«
»Ei, die Greefin is drin.«
»Was? Die Greefin?«
»Die bewohnt nämlisch die Beletasch. Un geht kaum enaus.«
»Die soll sisch andauernd eischließe in ihrm Salong.«
»Warum denn des?«
»Weil se e bissje spinnt.«
»Weil se nix mehr wisse will. Von ihrm Graf net und von de Welt net.«
»Sterwe will se. Hot se doch schon amohl vesucht.«
Christina faltete die Hände, schloss die Augen. Lieber Gott, mach, dass die verrückte Gräfin meinen Johann nicht mit eingeschlossen hat. Mach, dass er in Sicherheit ist. Angespannt sah sie zu, wie Männer von der Hofseite her eine Leiter zum ersten Stock aufstellten. Einer stieg hinauf mit einem Hammer in der Hand, schlug damit auf ein Fenster ein … Glas klirrte und splitterte, Flammen züngelten aus der zertrümmerten Scheibe. Die Menge schrie. Der Mann wich zurück, trat eine Leitersprosse tiefer, ließ sich einen Eimer reichen, schleuderte den Inhalt ins Innere des Hauses. Die Menge johlte. Christina greinte dem teilnahmslosen Mond ins Gesicht, bis ihr schwindelig wurde, bis ihre Knie nachgaben, ihr ganzer Körper nachgab, ihr Wunsch, dieses erbärmliche Leben durchzustehen, nachgab und sie in sich zusammensank.
Sie erwachte in einem Meer aus blassblauem Kattun, das sich bei näherer Betrachtung als Schoß einer Frau erwies. Etwa so jung wie sie selbst war die Frau. Ihr zum Kranz gebundenes, schwarzbraunes Haar glänzte im Mondlicht. Helle Augen leuchteten über einer feinen geraden Nase, die Haut schimmerte wie Porzellan. Wunderschön war die Frau. Der Todesengel vielleicht. Christina starrte die Erscheinung an.
»Na, na«, sagte die Frau und tätschelte ihr die Wange. »In Ohnmacht fallen vorzugsweise Damen der besseren Gesellschaft. Sind Sie eine Verwandte der Görlitzens? Oder eine Freundin? Sie schauen, offen gestanden, nicht danach aus.«
So sprach kein Todesengel. Christina war verwirrt. Wie sollte sie nach besserer Herkunft aussehen mit ihrem geflickten Kleid, ihren abgetretenen Pantinen, ihrer vergilbten Haube? »Christina Born«, sagte sie, als würde ihr Name ihre Stellung erklären. »Es ist nämlich so … Mein Verlobter ist da drin.«
»Luise Büchner. Angenehm.« Die Schöne reichte ihr die Hand. »Mein Bruder ist auch da drin.«
»Und Sie sind so ruhig?«
»Der Kindskopf ist immer dabei, wenn was los ist. Und wenn es gefährlich ist, erst recht. Aber er kann auf sich aufpassen.«
Christina kämpfte gegen die Tränen an, die ihr in die Augen traten, stotterte, dass ihr Verlobter der Kammerdiener der Gräfin und vielleicht im Haus eingesperrt war. Da beugte sich eine zweite Frau zu ihr herab. Warmherziges Lächeln umrahmt von dunkelblonden Korkenzieherlocken. »Mathilde Büchner, die Schwester, ebenfalls angenehm.« Sie reichte Christina ein linsenförmiges braunes Steinchen. »Ein Brustbonbon«, erklärte sie. »Nehmen Sie nur. Und beruhigen Sie sich. Warum an das Schlimmste denken? Ihrem Verlobten wird schon nichts passiert sein. Er ist vermutlich jung und kräftig genug, um eine nicht mehr junge Gräfin zu überwältigen, ein Fenster zu öffnen und aus der Beletage in den Vorgarten zu springen. Oder?«
»Das stimmt wohl«, sagte Christina, fasste das Bonbon gehorsam zwischen Daumen und Zeigefinger, erschnupperte Malzgeruch und steckte es in den Mund.
»Das Zuckerzeug ist für’n Husten«, sagte die Schwarzbraune.
»Brustbonbons sind gegen Husten«, sagte die Dunkelblonde »Und Vater meint, sie stärken allgemein Leib und Seele.«
Die beiden diskutierten noch eine Weile, Christina hörte nicht hin. Sie rappelte sich aus dem blauen Kattun, erhob sich tapfer. »Herzlichen Dank für Ihre freundliche Hilfe, liebe Frauen, es geht mir schon besser«, sagte sie und suchte die Beletage mit den Augen ab. Kein Qualm mehr, das Feuer schien erloschen, Ruß hatte sich auf Stuck- und Mauerwerk rings um die Fenster gelegt. Wo bist du, Johann?
Sie wandte sich zu dem weit geöffneten, mittlerweile von strammstehenden Gendarmen flankierten Hoftor um. Sie würde Einlass verlangen. Sofort. Sie würde jeden, der sich ihr in den Weg stellt, mit Fäusten …
Johann! Da war er. Unversehrt, Gott sei Dank. In einem hinteren Winkel des Hofs hielt er Graf Görlitz und einer Schar weiterer Personen die Lampe. Aufrecht und mit vornehm erhobenem Kinn stand er zwischen allen anderen in seiner Livree. Einen Hauch von Nervosität verriet die Geste, mit der er sich das Haar glattstrich. Dagegen nahm sich der fortwährend die Arme in die Luft werfende Graf Görlitz in seinem bunten Morgenmantel aus wie ein Irrwisch aus dem Morgenland.
Christina wollte hinrennen, wollte durchs Portal in den Hof zu ihrem Verlobten gelangen, wollte ihn in die Arme schließen, was ihr an diesem schrecklichen Abend wohl niemand verwehren würde. Hastig setzte sie den ersten Schritt, da kippte ihr der Fuß aus der Pantine, ein scharfer Schmerz zog bis über die Wade, stach bis zum Hinterteil hinauf, und erneut wurde es neblig vor Christinas Augen. Die blaue Kattunwolke, die sich just erhoben hatte und den Straßenstaub von sich schüttelte, fuhr geistesgegenwärtig zwei Arme aus, um Christina aufzufangen. »Sag ich doch, dass die Bonbons nix taugen.«
Christina hatte Glück im Unglück, wie sie nachträglich befand. Die hilfreichen Schwestern entpuppten sich als Töchter des Großherzoglichen Obermedizinalrats Dr. Ernst Büchner, der Arzt im Spital war und stadtbekannt. Die beiden hatten zusammen mit ihrem jüngsten Bruder den Abend im Lesekabinett in der Rheinstraße verbracht, einem Lesekabinett, von dem es hieß, dass dort heimlich die Republikaner tagten, aber das mochte ein Gerücht sein. Und als die Geschwister auf dem Heimweg die Nachricht vom brennenden Grafenhaus erreichte, hatten sie den Umweg durch die Neckarstraße genommen.
Mehr als das Schicksal der Gräfin von Görlitz schien die Schwestern allerdings Christinas Ohnmachtsneigung und ihr verletzter Fuß zu interessieren. Während die Menschenmenge mit ausdauerndem Ach und Weh auf Verlautbarungen aus der Görlitz’schen Villa wartete, begleiteten sie Christina zu einer steinernen Bank beim Pumpbrunnen, der unterdessen verwaist war. Mathilde schöpfte Wasser, Luise umwickelte Christinas Fuß mit genässten Taschentüchern.
»Sie haben eine gute Nachricht verschlafen, meine Liebe«, sagte Mathilde. »Außer der Gräfin wird niemand vermisst, alle Bediensteten sind unverletzt.«
Christina lächelte, verschwieg, dass sie Johann putzmunter im Hof des gräflichen Anwesens entdeckt hatte.
»Ihrem Schatz geht es also gut«, sagte Luise. »Im Gegensatz zu Ihnen. Fallen Sie öfter um? Dann sollten Sie Herz und Kreislauf untersuchen lassen. – Tut der Fuß weh?«
»Ein bisschen. Bestimmt nur verstaucht.«
»Hoffentlich kein Sehnenriss.« Luise Büchner erhob sich aus ihrer Kauerhaltung, trat zurück und sah um sich, als suche sie jemanden.
Sie hatte, wie Christina jetzt erst bemerkte, einen verkrümmten Rücken, stand ein wenig schief. Konnte es sein, dass der liebe Gott einen gerechneten Ausgleich für das schöne Gesicht schaffen wollte? Christina wandte den Blick rasch ab, tat, als bemerke sie nichts, starrte auf ihren liebevoll mit Taschentüchern umwickelten Knöchel. Über einen Buckel soll man weder spotten noch mitleidig tun, weil unter der unschönen Wölbung Engelsflügel verborgen sein könnten. So hieß es in einem Märchen, das die Mutter gern erzählte. War diese Luise Büchner also doch eine Art Engel?
Eher nicht, so resolut wie sie sich gab. Mit einem Kopfnicken winkte sie einen Gassenbuben herbei, sagte: »Komm mal her, du Dreckspatz«, und hielt ihm eine Münze vor die Nase. »Du läufst jetzt, so schnell du kannst, in die Grafenstraße 39, da wirfst du ein paar Kieselsteinchen gegen das Fenster im ersten Stock links. Hörst du? Erster Stock links. Unser Bruder Ludwig ist bestimmt noch wach. Sei leise, die Eltern schlafen wohl schon. Ludwig soll herkommen und Verbandszeug mitbringen. Und die Beinwellsalbe. Und die Hoffmannstropfen. Ach was, sein komplettes Arztköfferchen soll er mitbringen. Und er soll sich beeilen.«
Der Bube schnappte sich das Geldstück und rannte los.
Christina erschrak. »Kein Arzt. Ich kann keinen bezahlen.«
Mathilde bückte sich und streichelte Christina über die Wange wie einem Kind. »Ludwig kostet Sie keinen Kreuzer.« Keine Frage, diese Büchner-Tochter war die engelsgleichere von beiden.
»Er ist kein richtiger Arzt«, erklärte Luise. »Noch nicht. Er studiert erst. Aber was ein Wald- und Wiesendoktor kann, kann er auch.«
»Ach so«, sagte Christina, ohne wirklich erleichtert zu sein.
Wasser
Alles rennet, rettet, flüchtet,
Taghell ist die Nacht gelichtet …
Hoch im Bogen spritzen Quellen, Wasserwogen …
Mussten ihm in jeder Lebenslage, in wirklich jeder, diese Gedichte durch den Kopf schießen, die er während seiner Gymnasialzeit zu pauken und fließend auswendig vorzutragen hatte? Von wem war das nun? Goethe oder Schiller? Andere Dichter ließ der Deutschlehrer am Pädagog ja nicht gelten.
Sei’s drum! Alexander postierte sich am Fuß einer Leiter, die zur Beletage führte, schaute hinauf, betrachtete die schwarzen Rauchfäden, die durch die Ritzen heraustraten, und schob die Frage beiseite. Er war ein gut benoteter Student der Juristerei. Nun galt es, den Schulkram endlich von sich zu schütteln und seinen Scharfsinn walten zu lassen.
So dramatisch wie in dem Gedicht ging es rund um das Haus des Grafen von Görlitz ohnehin nicht zu. Es schien ein Schwelbrand zu sein, kein lodernder, sondern ein vor sich hin glimmender Brand, wie er von einer einzelnen nachlässig gelöschten Lampe herrührte. Oder durch den Funkenflug von einem Rest Glut im Kamin. Unter Luftabschluss entwickelten sich Schwelbrände langsam, und man konnte sie bändigen – es sei denn, man erstickte zuvor am Rauch.
Schon zweimal war Emilie von Görlitz bei brennender Kerze eingeschlafen, so erzählte man sich. Doch immer war es glimpflich ausgegangen und bei einem Zimmerbrand geblieben, den die Bediensteten hatten löschen können. Diesmal jedoch mochte die Gräfin in Gefahr sein, ihre Tür war abgeschlossen, und sie antwortete nicht, wenn man rief oder klopfte. So hatte der Diener berichtet, der als Erster den Rauch bemerkt hatte.
Wollte die Gräfin sterben? Oder hatte sie das Haus verlassen und die brennende Kerze vergessen? Das war nicht wahrscheinlich. Eine angesehene Frau ging am Abend nicht ohne ihren Gemahl aus. Sonst wäre sie anderntags keine angesehene Frau mehr. Nun gut, die Gräfin konnte am Nachmittag zu einer Verwandten oder Freundin gereist und dort geblieben sein, ohne ihrem Mann Bescheid zu geben. Um sich auszuweinen, weil sie mit dem Grafen Streit hatte, zum Beispiel. Es wurde gemunkelt, dass es mit der Ehe des Paares nicht zum Besten stehe. Was wiederum, besonders in Adelskreisen, keine Seltenheit war.
Nur Klatsch und Tratsch? Vielleicht. Doch Überlegungen dieser Art gehörten zu Alexanders Kerngeschäft. Er wollte Advokat werden. Und das bedeutete, jedem Verdacht nachzugehen, allen Spuren zu folgen, auch dem Geschwätz der Leute zuzuhören.
Durch der Hände lange Kette
Um die Wette fliegt der Eimer …
Einen Unsinn hatte Goethe da gedichtet! Oder Schiller. Wassereimer flogen nicht. Mit Umsicht mussten sie weitergereicht werden, damit auf dem Weg vom Brunnen bis zur Brandstätte wenig verschüttet wurde.
Mit Rücksicht auf seine Schuhe nahm Alexander einen vergleichsweise trockenen Platz in der Rettungskette ein, dafür einen hochwichtigen: Er hielt die Leiter fest, die zum Wohnzimmer der Gräfin hinaufführte, wo die Feuerquelle vermutet wurde. Und es galt, diese Leiter gewissenhaft zu stabilisieren, denn am oberen Ende balancierte ein tollkühner Kerl, der einen hinaufgereichten Eimer nach dem anderen ergriff und das Wasser durch die zerborstene Scheibe schleuderte. Die Leiter zitterte, bebte, wackelte. Alexander umfasste die Holme mit beiden Händen, er spannte die Bizepse an, atmete in die Flanken, um Brust und Arme ruhig zu halten. Alles ungeachtet des Rinnsals, das unter seiner Mütze hervortrat und ihm beißend in die Augen sickerte.
Von der Stirne heiß
rinnen muss der Schweiß …
Dennoch war Alexander dankbar für die ihm zugekommene Aufgabe, denn viele andere Helfer waren durchnässt, besonders der am oberen Ende der Leiter. Dem tropfte es aus den Schuhsohlen, seine Hemdsärmel schienen sich im Wasser aufzulösen. Und doch glühten seine Wangen vor Eifer. Von den Gesichtszügen her mochte er Mitte dreißig sein, seine Arbeiterkluft ließ ihn älter erscheinen, sein Elan jünger. Alexander kam nicht umhin, ihn im Stillen zu bewundern.
Andererseits erschien ihm der Mann … nun ja, rätselhaft. Dieser üppige Bart, das Zottelhaar, die rote Halsbinde zur abgetragenen sandfarbenen Weste, dazu eine schlecht sitzende, von der Sonne geblichene, vormals vermutlich schwarze Hose – eine unauffällige Kombination der Revolutionsfarben Schwarz, Rot und Gold also. So kleideten sich gern die radikalen Demokraten, die Sozialisten und Kommunisten, die Wühler, wie sie im Volksmund genannt wurden. Und riskierten damit das Interesse der Geheimpolizei. Wer seine umstürzlerische Gesinnung nach außen kehrte, der lebte gefährlich.
Wenn dieser Mann aber ein Wühler war, was um Himmels willen tat er hier? Dies war das Haus eines Hochadligen, bitte sehr. Friedrich Graf von Görlitz war ein ordensreicher Geheimrat und hochbesoldeter Zeremonienmeister Seiner Majestät des Großherzogs von Hessen-Darmstadt. Und überdies mit allerlei Weihen gesegnet. Ein echter Wühler würde inmitten der gaffenden Menge vor dem Haus stehen und sich ins Fäustchen lachen, dass das Mobiliar des hochherrschaftlichen Hauses, für das schlecht bezahlte Manufakturarbeiter mit Schwielen an den Händen und Holzstaub in den Lungen geschuftet hatten, zu Asche zerfiel. Eher noch würde ein wahrer Wühler sich mit desinteressierter, wenn nicht verächtlicher Miene abwenden und seiner Wege gehen. Warum sollte er nur einen Gedanken verschwenden an eine der Melancholie anheimgefallene Gräfin, die sich mit Absicht oder aus Unachtsamkeit oder aufgrund einer Mischung aus beidem einen Fluchtweg aus ihrem goldenen Käfig ins Jenseits verschaffen wollte? Statt das Spektakel zu ignorieren, riskierte der Kerl seine gesunden Gliedmaßen. Denn wenn er aus dieser Höhe fiele, wäre ein Arm- oder Beinbruch das Mindeste. Ein Schnupfen drohte ihm sowieso.
Andererseits … warum sollte ein Wühler kein guter Christ sein? Einer, der in seinem politischen Gegner in erster Linie den Menschen sieht, dem geholfen werden muss, wenn er in höchster Not ist. Vielleicht ist dieser Mann ein Feind der Vornehmen, aber nicht der Feind von Menschen, die doch nur der historische Zufall zu Vornehmen gemacht hat. So zumindest hatte Georg gedacht, der große Bruder, der ein stadtbekannter Radikaler gewesen war und vor der Geheimpolizei ins Ausland hatte fliehen müssen, wo er letztlich starb. Alexander war keine neun Jahre alt gewesen, als er ihn das letzte Mal sah.
»Vom Fenster aus ist nix mehr möglich«, rief der Wühler und riss ihn aus seinen Überlegungen, kletterte wieselhaft die Sprossen herunter, schüttelte seine Mähne, dass die Tropfen flogen und alle Umstehenden zurückwichen. »Wir müssen ins Haus.« Sein Blick heftete sich ans Seitenportal mit der Sandsteintreppe. »Wir müssen durch die Tür da, wenn das geht.« Er riss einem Halbwüchsigen den Wassereimer aus der Hand, sprang die Stufen hinauf, drückte die Klinke herunter … Die massive Tür öffnete sich, eine Rauchwolke trat aus, verzog sich. Keine Flammen. Löschwasser sickerte als Rinnsal eine gewundene Steintreppe herab.
Er drehte sich um und winkte. »Ich glaub, wir können rein.«
Aus einem Pulk, der sich in einer efeuberankten Ecke des Innenhofs versammelt hatte, trat Graf von Görlitz in orientalisch gemustertem Schlafrock. Mit schlaffen Schultern und der Andeutung eines Kopfnickens tappte er an dem Wühler vorbei ins Haus. Ein Diener folgte ihm mit der Lampe. Der übrige Pulk – bestehend aus zwei weiteren Schlafrockträgern und einigen Männern und Frauen, die nach Dienstpersonal aussahen – ging zögerlich hinterdrein.
Der Wühler nickte Alexander auffordernd zu. Ohne ein Wort zu wechseln, schlossen sie sich der Prozession an, jeder mit einem Eimer Wasser bewehrt, und stiegen die Steintreppe hinauf in den ersten Stock. Hinter einer doppelflügeligen Tür, ab Brusthöhe mit Glasintarsien versetzt, herrschten Dunkelheit und Stille. Kein Schreien, kein Wimmern, kein Klopfen. Auch kein Feuerlodern, kein Lichtflackern. Nichts.
»Mein Gott, wenn die Frau Gräfin nur nicht verbrannt ist«, sagte eine Frau mit Schürze, Haube und Damenbart.
Der Wühler drückte die Klinke herunter. »Verschlossen.«
»Das wissen wir schon«, sagte der Diener mit der Lampe.
Der Graf rieb sich die Tränensäcke mit Daumen und Zeigefinger. Er werde unverzüglich nach einem Schlosser schicken, erklärte er und straffte sich ein wenig. Der solle einen Dietrich mitbringen und die Tür öffnen.
Ein Schlosser? Warum auf einen Schlosser warten? Alexander und der Wühler sahen einander verdutzt an. Einer der Schlafrockträger – den Gesichtszügen nach konnte es jemand von der benachbart wohnenden und äußerst betuchten Sippe derer von Riedesel sein – legte dem Grafen die Hand auf die Schulter. »Wir müssen die Tür aufbrechen, lieber Friedrich.«
»Wir müssen die Tür aufbrechen«, wiederholte der Graf mit belegter Stimme.
Doch wie bei hochwohlgeborenen Herrschaften häufig, war mit »wir« nicht unbedingt »wir« gemeint. Manchmal bedeutete »wir« so viel wie »ich«, war also ein Pluralis Majestatis. Manchmal aber hieß »wir« im Gegenteil »nicht ich«, sondern die anderen. In diesem Fall griff die zweite Auslegung. Tätig werden sollten nach Ansicht des Grafen seine Bediensteten. Die damenbärtige Frau, als Marie angesprochen, sollte den Vorschlaghammer aus dem Keller holen, damit die Lakaien Fritz und Johann damit hantieren konnten. Der Kutscher Franz wurde angewiesen, den Hausarzt aufzusuchen und ihn herzubefördern.
»Es geht auch ohne Vorschlaghammer«, sagte der Schlafrockträger, der nach Riedesel aussah, und warf sich gegen die Tür. Als hätte er auf ein Zeichen gewartet, sprang der Wühler ihm bei. Und ehe Alexander seinen Körpereinsatz mit anbieten konnte, brach das Schloss aus der Füllung. Das weiß lackierte Holz splitterte, beide Türflügel flogen auf, die Glasintarsien blieben erstaunlicherweise heil. Eine dichte schwarze Wolke quoll ins Treppenhaus, nahm ihnen den Atem.
Man ächzte, hustete, wich zurück. Alexander versuchte, einen Blick durchs Vestibül ins Innere der Wohnung zu werfen. Zu erkennen war rein gar nichts, teils wegen des Qualms, teils wegen der geschlossenen Vorhänge, die nicht einmal Mondlicht hereinschimmern ließen.
»Da liegt ja die Unglückliche«, rief der Graf.
Alexander spähte angestrengt, erkannte nur schwarzen Nebel in schwarzer Nacht. Erst allmählich verzog sich der Qualm durchs Treppenhaus hinauf in den unbewohnten oberen Stock, und es wurde möglich, in die Gefilde der Gräfin vorzudringen. Der Lakai mit der Lampe musste vorangehen, ihm folgte der Graf, dann die anderen.
Und da, inmitten eines kleinen Wohnraums mit halb verbranntem Sekretär, Ruß bedecktem Kanapee, pitschnassem Parkett und einem sich darauf ringelnden abgerissenen Klingelzug, lag eine Gestalt – an Kopf, Brust und Oberarmen vollkommen verkohlt. Als Frau war sie durch ihr aschebeflecktes weißes Negligé und die Reste eines dunklen Wollkleides erkennbar, die nach oben verrutscht waren und zwei magere Beinchen freigelegt hatten. Der linke Fuß war nackt, der andere steckte in einem schiefgetretenen rosa Pantoffel. Angekokelter Schmuck lag verstreut um die Leiche. Perlenketten? Edelsteinbroschen? Schwer zu identifizieren. Eine bleiche Hand mit Goldring ruhte abgetrennt neben dem teils zu Asche zerfallenen Arm.
Alexander wurde übel, doch er zwang sich, den bizarren Anblick auszuhalten und genauer hinzusehen, denn kein Schwelbrand konnte einen menschlichen Körper derart zurichten. Das, was einmal der Mund der Gräfin gewesen sein musste, klaffte auf, als habe sie im Moment ihres Todes geschrien. Oder verzweifelt um Luft gerungen.
Graf von Görlitz stürzte an ihre Seite, kniete vor ihr auf dem nassen Fußboden und greinte. »Ach, dass du mir diesen Schimpf angetan! Wärst du doch lieber in deinem Bett gestorben.«
Die Gräfin Emilie von Görlitz, eine geborene von Plitt, gebürtig von Frankfurt am Main, stand in ihrem 46. Lebensjahr, war schlanker Statur, eher mager und mittlerer Größe. Ihre Ehe war stets kinderlos geblieben. Sie war eine Frau von hoher Geistesbildung, ihr Charakter war ausgezeichnet durch Gutmütigkeit, Wohltätigkeitssinn und Teilnahme für Notleidende, welche eine große Stütze an ihr fanden. Dabei aber zeigte sie in ihrer Haushaltung eine ins Kleinliche gehende übertriebene Ersparungssucht. Sie unterzog sich aller, selbst sehr harter Arbeiten der Haushaltung. Sie war sehr streng in den Anforderungen, welche sie an die Tätigkeit ihres Gesindes stellte, und dabei misstrauisch, sodass es einem Dienstboten schwerfiel, ihr Vertrauen zu erwerben. Sie hielt alle Behältnisse ihres Hauses soweit tunlich unter eigenem Verschluss. In dem verbrannten Schreibsekretär verbarg sie wertvollen Schmuck und ihr bares Geld, das sie sich nach Bedarf von ihrem Gemahl geben ließ. Ihr kostbarster Schmuck, Goldschmuck mit Emaille, Diamanten und orientalische Perlen im ungefähren Wert von 23.000 Gulden, war in einer der unteren Schubladen des Sekretärs in einer besonderen Kassette verwahrt. Der Sekretär war mit sehr guten, durch keine Nachschlüssel zu öffnenden Schlössern versehen. Niemandem von der Dienerschaft war der Anblick des kostbaren Inhalts zugänglich, und nur die unterste mit Quittungen und Papieren aller Art angefüllte Schublade stand nach der Angabe einer früheren Kammerjungfer gewöhnlich offen.
Aus dem Original-Prozessbericht, sanft an moderne Rechtschreibung angepasst (siehe erster Eintrag im Quellenverzeichnis).
Wärst du doch lieber in deinem Bett gestorben … diesen Schimpf angetan … Hatte Graf von Görlitz das wirklich so gesagt? Der ganze Salon schien den Atem anzuhalten, vier Sekunden, fünf Sekunden … Alle, mit Ausnahme des vor der Leiche kauernden und vor sich hin schluchzenden Grafen, standen stumm und starr da wie die angekokelten Möbel.
Alexanders Befremden wich den kühlen Fragestellungen eines künftigen Advokaten: Warum tat der Graf so, als stünde ein Selbstmord außer Frage? Wie konnte es sein, dass er mehr Mitleid mit sich selbst hatte als mit seiner Gattin, die auf qualvolle Weise gestorben war?
Auch hinter der Stirn des Wühlers schien es zu arbeiten. Er kniff die Lippen zusammen, als müsse er ein sarkastisches Gelächter unterdrücken. Und mit einem Mal kam er Alexander bekannt vor. War er ein Freund von Georg gewesen? Ein Kommilitone, ein politischer Mitstreiter? Vom Alter her würde es passen.
»Nun denn«, sagte der Graf und erhob sich abrupt, »es ist an der Zeit, dass das Volk da draußen sich zerstreut.« Er gab die Order, weitere Lampen zu entzünden und die Vorhänge aufzuziehen. Dann schritt er mit gefasster Miene zu einem der bodentiefen Fenster, das nach französischem Vorbild mit einem Austritt zur Straße hin versehen war, öffnete die Flügeltüren weit und verkündete der versammelten Menge: »Was wir befürchtet haben, ist eingetreten. Meine geliebte Gattin ist in den Flammen gestorben.« Den vielstimmigen Aufschrei quittierte er mit der Bitte, sich nunmehr nach Hause zu begeben und im Stillen für die Seele der Verstorbenen zu beten.
Bevor die Menge gehorchte, musste er noch einige zugerufene Fragen beantworten. Nein, weitere Personen seien nicht verletzt. Ja, Sachschaden sei entstanden, großer Sachschaden, doch der sei zu verschmerzen, im Gegensatz zum Tod seiner »geliebten Emilie«. Er danke für das Mitgefühl, so sagte er, und breitete die Arme aus, und besonders danke er allen Helfern für ihren tapferen Einsatz. Er werde sich anlässlich der Trauerfeier erkenntlich zeigen. Damit schloss er das Fenster und wandte sich seiner Dienerschaft zu. »Lasst uns die Gräfin hinüber ins Schlafzimmer bringen und pietätvoll aufbetten, bevor der Arzt eintrifft. Fritz, suchen Sie den zweiten Pantoffel, der muss ja irgendwo liegen, und werfen sie beide zum Abfall.«
»Was geschieht mit der … abgetrennten Hand?«, fragte die damenbärtige Zofe namens Marie.
»Die platzieren wir selbstverständlich beim Körper. Ebenso die Asche, die …«
»Es wäre besser, die Gräfin vorerst genau so liegen zu lassen, wie wir sie gefunden haben«, unterbrach ihn Alexander. »Sonst werden wertvolle Spuren beseitigt, im Fall, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt. Ein Einbruch etwa, bei dem der Täter von der Gräfin überrascht wurde.«
»Unsinn«, sagte der Graf und machte eine Geste, als wolle er eine Fliege verscheuchen. »Wie sollte jemand hier hereinkommen? Wo wir doch selbst die Tür aufbrechen mussten.«
»Wo ist der Schlüssel?«, fragte der Wühler. »Wenn die Gräfin sich eingeschlossen hat, würde der von innen im Schloss stecken. – Also, ich denke auch, dass Sie auf die Polizei warten sollten. Die hat Übung darin, Spuren zu sichern und …«
Der Graf schnappte sichtlich nach Luft. Er danke den beiden »Fremden«, die so uneigennützig geholfen hätten, »ganz, ganz herzlich«, doch er wolle diese Stunde der Trauer ausschließlich in vertrautem Kreis verbringen und bitte dafür um Verständnis.
Das war so deutlich gesprochen, dass keine weitere Aufforderung ans Personal ergehen musste. Der Diener mit der Lampe komplimentierte Alexander und den Wühler hinaus, deutete eine Verbeugung an und drückte die Portaltür zum Hof geräuschvoll ins Schloss.
»Wen die Dankbarkeit geniert,
Der ist übel dran;
Denke, wer dich erst geführt,
Wer für dich getan!«, sagte Alexander. »Von wem ist das? Goethe oder Schiller?«
Der Wühler zuckte die Achseln. »Keine Ahnung.«
»Ich tippe auf Goethe.« Alexander streckte die Hand aus. »Alexander Büchner, mein Name.«
»Angenehm, Paul. Paul Mink.«
»Kennen wir uns nicht irgendwoher?«
»Kaum«, sagte der Wühler, ohne Alexander anzusehen, »ich bin selten in Darmstadt.« Er rubbelte seine nasse Mähne mit einem nicht weniger nassen Taschentuch.
Wenn Alexanders Menschenkenntnis so gut arbeitete wie sonst, dann log der Mann. Und Lügen weckten Alexanders Jagdinstinkt. Er beschloss, sich nicht abschütteln zu lassen. »Ist es nicht seltsam«, fragte er, als der Wühler Anstalten machte, sich zu verabschieden, »dass Graf von Görlitz die Leiche seiner Frau vom Vestibül aus erkannt haben will – trotz der Dunkelheit und des ganzen Qualms?«
Unter der Zottelmähne zuckten die Augenlider. »Na ja, er kennt die Räumlichkeiten, da ist ihm wohl der Umriss am Boden gleich aufgefallen.«
»Ist es nicht eigenartig, dass er die Tote ins Schlafzimmer hat räumen lassen, noch ehe der Arzt eintraf?«
»Ihm waren vielleicht der abgetretene Hausschuh und die mageren Beine seiner Frau peinlich.«
»Haben Sie den abgerissenen Klingelzug bemerkt? Zeugt der nicht davon, dass die Gräfin um Hilfe rufen wollte?«
»Es passiert, dass Selbstmörder sich im Moment des Todes umbesinnen und gerettet werden wollen.«
»Und dieser Satz: Wärst du lieber in deinem Bett gestorben.«
Der Wühler lächelte dünn. »Sie war ihm gleichgültig. Soll vorkommen in manchen Ehen.«
»Tja, ähmm …« Alexander musste sich nicht lange nach seinen Schwestern umzusehen, die er vor einer halben Stunde hier zurückgelassen hatte. Die Neckarstraße hatte sich geleert, wenige Schaulustige harrten in kleinen Gruppen weiter vor der Görlitz’schen Villa aus, um das Eintreffen des Arztes abzuwarten. Luise und Mathilde standen entfernt im Mondlicht, neigten sich wie ein einziger Schatten zweier Samariterinnen über eine offenbar hilfsbedürftige Gestalt. Und da, Ludwig war wundersamerweise ebenfalls anwesend, kniete vor der Verletzten und hantierte mit Verbandszeug. Was immer geschehen war, es kam Alexander gelegen. Alle drei waren älter als er, konnten sich besser an Georg und vielleicht auch deutlicher an dieses Wühler-Gesicht erinnern. »Herr … ähm … Mink, darf ich Ihnen meine Geschwister vorstellen?«
Zwei Einladungen
Herrje, die Büchners! Ganze vier von ihnen. Peter kam nicht umhin, ihnen reihum die Hand zu reichen, nachdem das jüngste Familienmitglied, Alexander, ihn formvollendet vorgestellt und einen wahren Sermon auf Peters Einsatz bei den Löscharbeiten gesungen hatte. Die Geschwister lauschten ehrfürchtig, lächelten ihm zu, erkannten ihn Gott sei Dank nicht. Sie waren Kinder gewesen damals und er höchst selten zu Besuch bei der Familie – als einer von Wilhelms zahllosen Freunden. Und mit seinem probaten neuen Namen, Paul Mink, war er ihnen erst recht unbekannt.
Luise, die jüngste Büchnertochter, sprach eine Einladung aus: »Zum Tee, an einem der kommenden Sonntage«, und nannte ihm überflüssigerweise die Adresse.
Er dankte höflich. Den Teufel würde er tun, dorthin zu gehen. Wilhelm, der jetzt Fabrikant für irgendein Seifenzeug in Pfungstadt war, könnte samt Anhang an einem Sommersonntag im Haus der Eltern anwesend sein. Und er würde ihn womöglich erkennen.
Luise redete weiter. Plapperte in einem fort über Mut und Zivilcourage, Nächstenliebe, Herzensbildung. Und befand, dass dies Qualitäten seien, an denen es heutzutage mangele …
Peter senkte den Blick in der Hoffnung, es möge ihm als Bescheidenheit ausgelegt werden, und wollte sich verabschieden. Doch da war diese verletzte junge Frau, die nicht auftreten konnte, aber irgendwie nach Hause in die Altstadt gelangen musste.
»Ich zahle eine Droschke«, sagte Peter rasch. »Bestimmt stehen welche am Friedensplatz herum. Dort muss ich ohnehin vorbei. Ich schicke eine her und begleiche vorab die Fahrt in die Altstadt. Kein Problem.«
Die Büchners starrten ihn mit offenen Mündern an. Er trug seine Arbeiterkluft an diesem Abend und wirkte gewiss nicht wie einer, der es gewohnt ist, per Droschke unterwegs zu sein. Geschweige denn, einer Fremden eine Fahrt zu spendieren.
»Das kann ich nicht annehmen«, sagte das verletzte Fräulein und sah zu ihm auf, als sei er ein überirdisches Wesen. Sie hatte entzückend zerzaustes Blondhaar und blassblaue Augen, groß und hungrig, wie Menschen, die seit Tagen nichts gegessen haben.
»Es ist mir eine Ehre«, sagte Peter förmlich, dienerte knapp und ging mit hastigen Schritten die Neckarstraße hinunter, bevor die Büchners auf die Idee kommen konnten, sich an den Kosten für die Droschke zu beteiligen.
Der Kutscher freute sich über die späte Kundschaft, zählte die Münzen und fuhr los. Peter atmete auf und blickte sich um. Der Friedensplatz war wie leergefegt, wie immer um diese Zeit, der Mond stand hoch am Himmel, tauchte das Alte Schloss, Wohnsitz des unbeliebtesten Darmstädter Regenten aller Zeiten, in ein versöhnliches Licht. Die Stadtkirchenglocke schlug Mitternacht.
Peter schlenderte über den Ballonplatz zu seinem Haus in der Mauerstraße, das er der kinderreichen Familie seiner Cousine vermietet hatte. Für sich selbst beanspruchte er bloß die Dachkammer. Gelegentliche Übernachtungen in Darmstadt ließen sich nicht vermeiden, doch die Maskerade, das lange Haar, der volle Bart halfen ihm, unerkannt zu bleiben. In Frankfurt war er ein Niemand, ein Mensch ohne Vergangenheit.
Was aus Kindern so wird! Peter schmunzelte in sich hinein. Die freche kleine Luise war zur reinsten Schönheit gediehen. Wäre nicht der Buckel, man könnte sich vom Fleck weg in sie verlieben. Der blondgelockte Ludwig, damals Liebling sämtlicher alten Damen, wollte Arzt werden. Wie der Vater. Und wie Georg es hatte werden sollen, allerdings nicht recht wollte. Ein gewiss artiger Sohn, der Ludwig. Artiger als Georg und Wilhelm. Mit Aussicht auf eine glänzende Zukunft. Jetzt dürften nicht allein die alten Damen hinter ihm her sein.
Der Jüngste, das war der Wildfang, der seinerzeit mit ohrenbetäubendem Gejohle durchs Haus gefegt war und – warum auch immer – den Vornamen Alexander bekommen hatte. Dabei deutschtümelten die Büchners bei der Wahl der Vornamen, wie die meisten Hessen es taten: Georg, Wilhelm, Ludwig, Mathilde, Luise … Nur der Kleine fiel aus der Reihe: Alexander – wie der antike Eroberer und Kriegsheld.
Er hatte auch was von einem Eroberer, der Bursche. Dreist war er, ließ sich schwer abschütteln. War so unvorsichtig gewesen, spitze Bemerkungen über Graf Görlitz fallen zu lassen. Ja, es stimmte, bei diesem Todesfall gab es zahlreiche Ungereimtheiten. Peter würde dem »Deutschen Zuschauer« in Mannheim bald anonym zukommen lassen, was er gesehen und gehört hatte. Wenn ihn keiner aufhielt.
Warum sollten sie ihn gerade heute aufhalten? Sie ließen ihn seit Wochen in Ruhe. Landauf, landab waren Metternichs Geheimdienste angeschlagen, Metternich selbst war angeschlagen. Alle Welt spuckte Gift und Galle, sobald sein Name fiel. In den Kneipen wurden zu ausgelassener Stunde verbotene Lieder gesungen und politische Witze gerissen, Flugblätter wurden offen verteilt, aber die Spitzel kamen nicht hinterher. Gewiss stand viel bewaffnete Polizei auf den Straßen herum, besonders in Hessen-Darmstadt, doch das war Staffage. Sie sollte Angst verbreiten, was lediglich teilweise gelang. Die Zahl der Verhaftungen war rückläufig, viele Richter trauten sich nicht, die vorgeblichen »Landesverräter« einzusperren. Die kleinen Fische, die Peter anlieferte, wurden schon nach Tagen wieder aus dem Gefängnis freigelassen. Die karge Auftragslage drohte, ein Loch in Peters Geldbeutel zu reißen. Aber er kam zurecht, es gab andere Einnahmequellen.
War da doch jemand hinter ihm her? Peter drehte wie beiläufig den Kopf zur Seite, versuchte aus dem Augenwinkel die Quelle des Klackerns von groben Schuhen auf dem unebenen Pflaster auszumachen. Eine graue Batschkappe, ein Bibermantel … Ein Mantel an einem so lauen Abend? Und an der nächsten Straßenecke wartete eine monströse schwarze Kutsche – ohne Wappen. Wollte man ihm eine Falle stellen, eine, die von zwei Seiten zuklappte?
Bei der erstbesten Hauslaterne hielt Peter an, kramte die Schatulle mit den Zigaretten aus dem Wams, steckt sich eine zwischen die Lippen und zündet sie umständlich an, indem er die Streichholzflamme mit hohlen Händen schützte. Dabei lugte er durch seine Finger, um den Bibermantelträger zu beobachten. Ebenso die Kutsche.
»’n Avend«, sagte der Mann und tappte an Peter vorbei. Klein und hager war er, torkelte, als habe er Alkohol getrunken. Sagte ein zweites Mal »’n Avend« und lallte in ausgeprägtem Darmstädter Dialekt über »’s Geld, des wo isch net hab«.
Peter warf ihm zwei Kreuzer zu, blickte ihm ins Gesicht und entspannte sich. Es war der alte Datterich, der legendäre Saufbold und Kleinganove. Dass der noch lebte!
Peter wechselte die Straßenseite, ging gelassen weiter. Er freute sich auf seine Dachkammer, die er sich gemütlich eingerichtet hatte mit einem Plüschsessel samt Fußbank. Die Familie schlief gewiss schon, aber seine Cousine hatte ihm bestimmt wie immer ein Butterbrot und ein großes Glas Bier hingestellt. Schade, dass er die Kinder diesmal nicht sehen würde. Er liebte es, mit ihnen über Katzen, Hasen und Waldfeen zu fachsimpeln.
Er schickte sich an, einen Bogen um die verdächtige Kutsche zu machen, da entstiegen ihr zwei Männer. Vornehm gekleidet. Zylinder. Stiefel. Sie schritten direkt auf ihn zu, nahmen ihn in ihre Mitte und zwangen ihn einzusteigen. Einer ließ ein Messer aufblitzen. Die Kutsche ächzte, der Kutscher fluchte, als sie Peter auf den Sitz drückten.
Er lächelte kalt. »Na, um wen geht’s diesmal?«
Sie steckten ihm einen Zettel mit einem Namen und einer Adresse zwischen die Finger: irgendein Heinrich Hoffmann, Arzt in Frankfurt.
»Wird erledigt«, sagte Peter, »aber ich brauch ein paar Tage, hab was mit einer Frau zu klären.«
Sie lachten dreckig, schubsten ihn aus dem Wagen, dass er hinschlug, und fuhren davon. Wut kroch in ihm hoch. War dem Geheimdienst das derbe Benehmen seines Fußvolks bekannt? Er würde diese Art von Behandlung bei Gelegenheit anmahnen. Langsam rappelte er sich auf, rieb seinen schmerzenden Ellenbogen, klopfte sich den Straßenschmutz von Hemd und Hose. Wenigstens hatte er etwas Zeit gewonnen. Bei den Kerlen gab es keine bessere Ausrede als Weibergeschichten. Wenn die wüssten, dass Peter seit Monaten abstinent war wie ein Kapuzinermönch. Frauen waren kompliziert. Sie wollten heiraten, sie wollten Kinder … Ein Zuträger der Geheimdienste durfte nicht heiraten. Niemals.
Ärmlich, aber reinlich
Eine Droschkenfahrt! Luise musste sich Mühe geben, ihre Vorfreude zu verbergen. So was gab es für die sparsamen Büchners nicht alle Tage. Dabei waren in Darmstadt mit »Droschken« keineswegs vornehme offene Kutschen wie in den großen Städten gemeint, mit denen man zweispännig und meist zum Vergnügen durch die Gassen gefahren wurde. »Droschken« hießen vielmehr die schlichten, oft überalterten Lohnkutschen, die von einem einzigen Kaltblutpferd gezogen wurden und für maximal vier Personen Platz boten. Dafür konnten diese zum Preis von einer reisen, wenn sie dasselbe Ziel hatten. Allenfalls Trinkgeld wurde von jedem Fahrgast erwartet.
Die Geschwister Büchner mussten somit nicht die Barschaft in ihren Geldbörsen zählen, doch sie diskutierten ausgiebig, wer das verletzte Fräulein nach Hause geleiten durfte. Zwei mussten mindestens mit, um es zu stützen. Und mindestens einer musste schleunigst nach Hause, schon allein, um die Mutter zu beruhigen, die manchmal nachts aufwachte und mit einer Kerze in der Hand hinter den Fenstern zur Straße auf und ab ging, falls nicht sämtliche Kinder, und seien sie noch so erwachsen, in ihren Betten schliefen. Ludwig gab schließlich klein bei. Er verabschiedete sich mit einem Rezept, das er auf einem Zettelchen notierte, drückte es Luise in die Hand. »Kannst es ihr vorlesen, während der Fahrt.«
Der Vorschlag beruhte auf einer Fehlannahme. Das Fräulein konnte ausgezeichnet lesen, sogar Ludwigs Gekrakel erfasste sie sofort, und trug vor: »Umschläge mit Essigsaurer Tonerde für den Knöchel. Ordentlich essen und trinken gegen die Ohnmachtsneigung. Und falls es nicht besser wird, wieder melden: Ludwig Büchner, Grafenstraße 39.« Sie lächelte schüchtern: »Ich danke Ihnen so sehr, jedem von Ihnen!«
»Wollen wir uns nicht duzen?«, fragte Luise.
Alle nickten. Das Geholper der Kutsche durch die Schlaglöcher der Altstadtstraßen hätte ohnehin keine andere Kopfbewegung zugelassen.
Es gab manches in Darmstadt, das sich nie änderte, zumindest nicht zum Guten. Zum Beispiel die Altstadt, Wohnquartier der Armen und Bedürftigen, der Lohnarbeiter und ihrer Familien, gleichzeitig ein Schlupfloch für Hehler, Gauner und Spieler. Die Gegend zwischen Holz- und Obergasse war und blieb ein Schandfleck der Stadt, seit Luise denken konnte.
Die Droschke hielt vor einem verwitterten einstöckigen Fachwerkhaus mit Giebel zur Straßenseite. Luise ließ den Blick über die gräulich verblichenen Balken und Streben fliegen, den bröckelnden Lehmverputz, die aus rohen Brettern gezimmerte Eingangstür. Sie überspielte ihren Schrecken, als sie zwei lange, dürre Ratten die Gasse entlangflitzen und im zerbrochenen Kellerfenster nebenan verschwinden sah. »Wir sind schon da?«
Alexander kletterte als Erster aus dem Wagen, reichte Christina die Hand, um ihr herauszuhelfen, schickte sich an, sie Huckepack zu nehmen und über die Schwelle zu tragen. »Wo geht’s hin? Erster Stock? Dachgeschoss?«
»Oder Kellergeschoss?«, fragte Mathilde. Die Besorgnis in ihrer Stimme war unüberhörbar. Bestimmt hatte sie die Ratten ebenfalls gesehen.
»Hüa«, kommandierte der Kutscher, und das Gefährt rumpelte davon.
Ein Fenster des gegenüberliegenden Hauses klappte auf. »Jetz is awer Ruh!«
Christina fasste in ihre Schürzentasche, förderte leise klimpernd einen Schlüsselbund zutage und flüsterte: »Nochmals lieben Dank für eure Hilfe, ich komme allein weiter.«
Alexander ließ sich nicht abwimmeln. »Wenn wir schon hier sind …« Er bückte sich umständlich, streckte die Arme nach hinten. »Steig auf.«
Dieser Hering wollte Christina ins Haus tragen? Bis in ihre Wohnung? Luise staunte. War es Hilfsbereitschaft, die den Bruder antrieb? Oder war es Neugierde? Sie tippte auf Letzteres und musste sich eingestehen, einen Funken Wissbegier auch bei sich selbst wahrzunehmen. Sie kannte die Straßen der Altstadt, doch war es ihr noch nie gelungen, einen Blick ins Innere der Häuser zu werfen. Herrschte dort wirklich die »vollkommene Verwahrlosung«, von denen die Nachbarn in der Weststadt sich gern erzählten? Vater müsste es wissen, er ging in jede Kammer, in die er gerufen wurde. Immer. Schwieg indes über seine Beobachtungen.