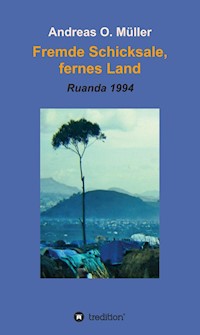3,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dr.med. Paul Wieland, der auch als Paul, Dr. W. und Herr von W. auftritt, ist Arzt wie der Autor, er ist aber nicht mit diesem identisch, wenn sich auch ihre Lebenswege immer wieder kreuzen oder auch für eine gewisse Zeit parallel verlaufen. Insofern sind autobiografische Momente durchaus gegeben. Eine Ausnahme macht "Kein guter Tag für Robert". Nur einmal begegnen wir dieser Figur - aus gutem Grund. Die hier vorliegenden Kurzgeschichten spannen einen weiten Bogen von den frühen Kinderjahren Pauls bis zum Tod von Herrn Dr. Wieland infolge einer Corona-Infektion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andreas O. Müller
Das 17. Instrument
Fünfzig Kurzgeschichten
Verlag tredition Hamburg 2021
Andreas O. Müller
Das 17. Instrument
Fünfzig Kurzgeschichten
Verlag tredition Hamburg 2021
© 2021 Dr. med. Andreas O. Müller
Fotos, Zeichnungen, Koloration A.O.Müller
Umschlaggstaltung A.O.Müller
Lektorat, Korrektorat A.O.Müller
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-19435-9
Hardcover:
978-3-347-19436-6
e-Book:
978-3-347-19437-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
für Carla RC
Inhaltsverzeichnis
1. Im Warteraum
2. Auf einem Bauernhof
3. Am Ufer entlang
4. Das Buch
5. Das Ende von Dr. W.
6. Die Grippeimpfung
7. Das Motorrad
8. Das siebzehnte Instrument
9. Paul, Christian und Max
10. Das traurige Pferd
11. Das verkaufte Fohlen
12. Der Gehirntumor
13. Die Brücke über den Fluß
14. Die grüne Tasche
15. Die Katastrophe
16. Bagenkop Havn
17. Die tote Frau
18. Die Verlobung
19. Die Wiese
20. Ein erstes mal
21. Unerwarteter Besuch
22. Das vergessene Kind
23. El Trocadero
24. Erster Schnee
25. Analyse einer Motivation
26. Gold, Gold
27. Herr von W. und seine Welt
28. Ich und ich
29. Im Osten von Huesca
30 Am stillen Fluß
31. Irrweg an der Albegna
32. Kein guter Tag für Robert
33. La Verna
34. Lope und sein Onkel
35. Marianne
36. Mein Bruder Hannes
37. Melolontha oder die Maikäfer
38. Missgeschick im Auwald
39. Nur ein Traum?
40. Schizoide Gedanken
41. Suum cuique-Jedem das Seine
42. Notfall in der Ägäis
43. Wohin, Paulchen?
44. Sturz am Pass
45. Schlehen und Hagebutten
46. Was für eine faszinierende Frau
47. Zwischen Feldern
48. Das Pferd mit dem gebrochenen Röhrbein
49. Meister der Thermik
50. Der Spaziergang
Im Warteraum
Da saß er nun und wartete, wartete darauf, was als nächstes geschehen würde. Es war amüsant, einmal derjenige zu sein, der wartete, während sonst umgekehrt auf ihn gewartet wurde. Er blickte um sich, weil er die Umgebung kennenlernen wollte, in die er geraten war. Etwas anderes gab es im Augenblick nicht zu tun. Er stellte fest, daß der großzügig angelegte, längliche Raum eigentlich nur eine Querverbindung zwischen zwei endlos langen Fluren darstellte, die an ihren Längsseiten mit Glastüren abgetrennt worden war. Die linke war nach außen hin ganz aufgeklappt und an ihrer Klinke mit einem Stück Mullbinde fixiert. Auf der rechten Seite hingen die Flügel zweier Schiebetüren in Schienen, die an die hohe Decke angeschraubt waren. Es gab einen Bewegungsmelder, auf dessen Signal hin sich die beiden Flügel voneinander entfernten und den Durchgang freigaben. Kurz darauf liefen sie, wie von Geisterhand bewegt, wieder aufeinander zu und schlossen den Raum. Sie gaben dabei ein leises, schleifendes Schabegeräusch von sich.
Eine eigene Beleuchtung hatte der Durchgang nicht. Dr. Wieland mußte sich mit den faden Lichtresten begnügen, die zu beiden Seiten aus den Fluren hereinfielen. Fünf Sitzgelegenheiten, mit einem orangefarbenen, groben Stoff bezogen, warteten auf Gäste. Sonst gab es hier keine Farbe. An den Wänden standen ringsum, bis auf einen kleinen, freigelassenen Zwischenraum gegenüber der Stuhlreihe, auf der er sich niedergelassen hatte, mannshohe Wandschränke mit weiß lackierten Außenflächen. An ihrem Oberrand lief eine Messingstange entlang. Er vermutete, daß sie als Halterung für eine Leiter diente, wenn man an die darüber liegenden Fächer gelangen wollte. Auch diese waren mit Schiebetüren versehen, aber es gab keine automatische Vorrichtung zum Öffnen und Schließen. In das Holz waren flache Metallschalen eingelassen, die der Hand einen Angriffspunkt boten. Auf der Sitzfläche neben ihm lag ein Stapel Zeitschriften. Ein hübsches, kleines Gesichtchen schaute mit leeren Augen zu ihm hoch und weckte flüchtig einen Gedanken, dessen er sich sogleich schämte.
Durch die linke, offen stehende Tür bewegte sich jetzt eine gedrungene Gestalt, eine Person in dunkelblauer Arbeitskleidung. Sie schob einen Metallwagen vor sich her, auf dem mehrere große, aufeinander gestapelte Kartons lagen. Auf einer der aufgeklebten Etiketten konnte er einen Namen entziffern: GLOVES stand da. „Aha, Handschuhe,“ dachte er. Dann saß er wohl eigentlich in einem Vorratsraum der Klinik. Es spielte keine Rolle, solange man ihn hier nicht vergaß.
Obwohl der Wagen auf schwarzen Gummirollen lief, und der mißfarbene, linoleumbedeckte Boden ohne Unebenheiten war, gab es ein schepperndes Geräusch. Vor einem der Schränke blieb die Gestalt mit dem Wagen stehen. Jetzt konnte er sehen, daß es sich um eine korpulente Frau handelte, die sich bückte, um in einem der Schränke unten Platz zu schaffen. Sie hatte schwarze, dichte Haare, die über dem breiten, fleischigen Rücken mit einem Gummiband zu einem struppigen Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Ohne daß er es wollte, fiel sein Blick auf ihr breites, flaches Hinterteil. Peinlich berührt wandte er sofort seine Augen ab. Der tiefere Grund hierfür war, daß solche amorphen Körperformen sein ästhetisches Empfinden verletzten. Das Abladen und Verstauen der Pakete dauerte einige Minuten, in denen sich seine Augen vergeblich gegen den unerwarteten und wenig angenehmen Anblick zu wehren versuchten. Er konnte schließlich nicht ständig zur Seite sehen. Die Frau vermied es während der gesamten Zeit ihrer tätigen Anwesenheit, sich umzudrehen, so als sei ihre Vorderansicht noch deprimierender als das, was er bereits widerstrebend zur Kenntnis hatte nehmen müssen. Mit einem Knall schlossen sich die Schranktüren, und das Schauspiel nahm sein ersehntes Ende. Die Blaugekleidete kehrte mit ihrem Wagen auf den Flur zurück, von wo sie gekommen war. Das Klappern verebbte, dann eroberte die Stille den Raum zurück.
Die Schiebetür rauschte, zwei Schwestern, auch in Blau, aber heller getönt, huschten nach links durch den Raum. Er verstand ihre fröhlich zwitschernde Sprache nicht, aber ihre Worte klangen angenehm jung und lebendig.
Die automatisch bewegten Flügel trafen sich wieder. Kurz darauf noch einmal das Rauschen auf der rechten Seite. Ein Patient wurde hereingeschoben, zwei Krankenpfleger manövrierten das ungelenke Bettgestell geschickt an seinen Beinen vorbei. Ihm gelang ein kurzer Blick durch die Türe. Jenseits des Flures las er über einer Tür die Aufschrift „Behandlungsraum - Sonografie“. In dem Bett lag ein Mann, die Decke wölbte sich über seinem Bauch. Er lag auf dem Rücken, seitlich hing ein Plastikschlauch, der in einem Beutel mit grüner Flüssigkeit mündete. Der Mann hatte seinen Kopf nach links zu ihm hin gedreht. Seine Augen schienen um Hilfe zu bitten. Aber Dr. Wieland konnte nichts für ihn tun. Im Augenblick war er selbst im Begriff, Patient zu werden, und überhaupt, er wußte nichts von dem Mann. Wie hätte er helfen sollen. Die beiden Pfleger verschwanden mit dem Bett. Die Schiebetüren schlossen sich, wieder wurde es still.
Er saß da und erinnerte sich nicht mehr, was er bei seiner Ankunft in dieser eher trostlosen Örtlichkeit amüsant gefunden hatte. Seine Anwesenheit war jedenfalls kein Spaß. Er überlegte, ob es wirklich notwendig gewesen war, seine Fahrt in die benachbarte Großstadt abzubrechen. Er hatte ein Konzert besuchen wollen, nach längerer Zeit hatte er sich aufgerafft und ein Ticket im Internet reserviert. Es war heute einfach, einen Konzertbesuch zu organisieren. Man buchte online, bezahlte online und konnte sogar die Eintrittskarte selbst ausdrucken, sofern man einen Drucker angeschlossen hatte.
Die zwitschernden Mädchen kehrten zurück und verschwanden hinter der Schiebetüre. Bedauerliche Stille diesmal. Mit knarrenden Schritten kam jemand heran. Eine schlanke, große Gestalt, weiß gekleidet, ein Stethoskop in der Kitteltasche. Ein Arzt also. „Guten Abend.“ - „Guten Abend, Doktor.“ Das Wort „Kollege“ hätte er für zu anzüglich gehalten, in dieser Situation. Wieder das Schabegeräusch, dann Ruhe, etwas bedrückend.
Warum war er hier? Auf der Fahrt über die Autobahn waren plötzlich krampfartige Schmerzen in der linken Wade aufgetreten, die nicht nachlassen wollten. Als Arzt kamen ihm sofort Bedenken, weil er sich zwei Wochen zuvor eine Nagelbettinfektion an der linken Großzehe zugezogen hatte. Die Penicillintherapie, die er durchgeführt hatte, war zwar umgehend erfolgreich gewesen, was ein Hinweis darauf sein konnte, daß es sich um einen Streptokokkenangriff gehandelt hatte. Aber er wußte auch, daß sekundäre, bakterielle Venenentzündungen auftreten konnten. Wenn diese eine Thrombose nach sich zogen, war das nicht nur eine unangenehme, sondern unter Umständen auch gefährliche Sache, die besonders nach Operationen gefürchtet war. Durch einen chemischen Einfluß der Krankheitserreger bildeten sich Gerinnsel in den Venen. Lösten sich davon Teile ab, so wurden diese in den Gefäßen weitergetragen und landeten schlimmstenfalls wie Geschosse in der Lunge. Dort unterbrachen sie die Durchblutung, was zu einer Funktionsminderung des Organs mit fatalen Folgen führen konnte.
Dr. Wieland war mehrfach mit dieser häßlichen Komplikation konfrontiert worden. Nicht alle Patienten hatten überlebt, obwohl sie sich in stationärer Behandlung befunden hatten. So tragisch endete auch der Fall eines Freundes, den er erfolgreich an einem Bandscheibenvorfall operiert hatte. Alles war gut gegangen. Am Tage der ersten Mobilisation war es dann geschehen. Er war am Nebenbett mit der Visite beschäftigt, als sein Freund ganz unvermittelt einen Seufzer ausstieß. Als Dr. Wieland sich zu ihm umdrehte, war dieser bereits dunkelblau im Gesicht und rang nach Luft. Mit einer Hand griff er an seinen Hals, sein Blick war glasig in die Ferne gerichtet. Sekunden später wurde er bewußtlos, ehe auch nur die Sauerstoffleitung am Kopfende seines Bettes aufgedreht war. Das von der Stationsschwester umgehend gerufene Notfallteam konnte nichts mehr für ihn tun. Der Freund war bereits verstorben, als die Kollegen eintrafen. Diese Gedanken hatten es ihm heute unmöglich gemacht, einfach weiterzufahren. Er hatte sich von der Vorfreude auf einen musikalischen Abend verabschiedet und die Autobahn bei der nächsten Ausfahrt verlassen.
So saß er nun im Wartezimmer der Klinik und tat, was in einem solchen Zimmer zu tun war: er tat nichts. Er wartete. Und das bereits seit einer halben Stunde. Es kam ihm in den Sinn, daß er diese Schattenseite des Lebens nicht kannte, obwohl er selbst viele Jahre lang Tag für Tag an dem Warteraum seiner Ambulanz vorbeigekommen war.
Dennoch hatte er die Menschen darin vor den persönlichen Gesprächen bei der Untersuchung kaum wahrgenommen. Selbst die Räumlichkeit hätte er nicht genauer beschreiben können. So war es ihm auch nicht möglich gewesen - er hatte gar keinen Anlass gesehen - sich mit der Situation eines Patienten zu befassen, solange dieser nicht in seinem Konsultationsraum vor ihm saß. Konnte es sein, daß er da etwas übersehen, etwas außer Acht gelassen hatte, das er sich vorwerfen mußte?
Wieder näherten sich Schritte. Zwei Blaugekleidete durchquerten den Raum, die Schiebetüre verrichtete ihre Aufgabe, dann blieben wieder nur die nüchternen, öden Schrankwände mit ihren nichtssagenden, matt glänzenden Flächen.
Seinem Platz gegenüber hing ein länglicher, rahmenloser Spiegel. Darin sah er einen älteren Mann, nach vorne gebeugt, er wirkte krank, leidend. Seine Körperhaltung erweckte den Eindruck einer depressiven Stimmung. Befremdet erkannte Dr. Wieland, dass es sich um sein eigenes Spiegelbild handelte. So also sah er aus? Er fühlte sich nicht krank, nicht alt, schon garnicht verzweifelt. Was hatte das zu bedeuten? Schätzte er sich falsch ein? Ging es ihm vielleicht doch nicht so gut, wie er dachte?
Hinter den Flügeln der Schiebetüre auf der rechten Seite huschten murmelnde Schatten vorbei und lenkten ihn von seinen trüben Gedanken ab. Ein kurzes Öffnen und Schließen, der Bewegungsmelder hatte angeschlagen. Doch niemand kam herein.
Deutlich wurde ihm bewußt, was alles sich in Wartezimmern abspielte, wieviele Schicksale dort ihren Lauf nahmen, meist in negativer Weise. Wie oft war er eilig vorübergegangen, ohne eine Vorstellung davon, wie quälend es sein mußte, einer gnadenlosen Ungewissheit ausgeliefert zu sein. Wo waren seine Augen, seine Gedanken gewesen, da er doch unmittelbar Zugang gehabt hatte zu Leid und Krankheit und Angst, die sich in den Körpern und Sinnen der Wartenden aufstauten und heraus wollten, wenigstens im Gespräch mit einem, dem sie vertrauten, von dem sie Hilfe erwarten durften.
Ein zweites mal rollte ein Bett an ihm vorbei. Diesmal lag darin eine schmale, kleine Frau mit spitzer Nase und fahlgelber Haut. Eine Decke lag in Falten über ihrem Körper. Die Männer, die an beiden Enden des Bettes anfaßten, waren guter Laune. Einer lachte verhalten auf. Verschiedenes konnte man daraus folgern. Entweder war die Frau nur alt, aber nicht ernstlich erkrankt, oder aber sie war bereits tot. Paul wollte nicht genauer hinsehen. Besonders im zweiten Fall wäre es pietätlos gewesen, sie anzustarren, besonders, da ihr Gesicht frei lag.
Für einen Freitagabend, stellte er fest, war hier ganz schön viel los, auch wenn es noch nicht sehr spät war.
Seine Rechtfertigung, er habe sich mit allen seinen Fähigkeiten und Kräften für kranke Menschen eingesetzt, fand in seinem Inneren keinen rechten Widerhall, das Echo klang falsch, hölzern, und er ahnte, daß da etwas schief gelaufen sein mußte. Wo lag die Grenze, bis zu der sich ein Arzt einzusetzen hatte? Gab es eine solche Grenze? Mußte auch sie überschritten werden bis in die Unendlichkeit der Selbstaufgabe? Genug oder nicht genug, wirkliche Antworten würde es darauf nicht geben, nicht geben können. Dazu waren die Wege und Befindlichkeiten der Menschen zu vielfältig, die Belastbarkeit des Einzelnen zu variabel. Das galt für den Arzt genau so wie für seine Patienten. Und das an jedem Tag neu.
An der Unterkante des Spiegels ihm gegenüber bemerkte Dr. Wieland eine Bewegung. Er beugte seinen Oberkörper nach vorne, um besser sehen zu können. Etwas Rostbraunes, flach Abgerundetes schob sich hinter dem Glas hervor. Lange, an den Spitzen haarfein auslaufende Antennen sondierten die Luft. Eine Kakerlake zeigte sich, gemächlich wanderte sie bis an den linken Rand des Spiegels. Dort angekommen, öffnete sie kurz ihre Deckflügel. Reflexartig machte Dr. Wieland eine Abwehrgeste mit seinem Arm. Er fürchtete, das Insekt könne ihn angreifen. Aber der Käfer glättete seinen Rücken wieder. „Reingefallen, Angsthase!“ wisperte er. „Du, das habe ich gehört!“ antwortete Dr. Wieland verblüfft. Das freche Tier warf nur einen verächtlichen und zugleich hinterhältigen Blick auf seinen Beobachter, der die Bewegungen der langen Fühler vorsichtshalber im Auge behielt.
In die öde, trockene Stille drang ein Lärm, der sich schnell zu einem Dröhnen aufschwang, und direkt über Pauls Kopf zu entstehen schien. Die Scheiben der Schiebetüren vibrierten kurz, dann ebbte das Geräusch ab und verwandelte sich in ein flatterndes Rauschen, das leiser und leiser wurde und schließlich die Stille wieder freigab. Ein Rettungshubschrauber war auf dem Dach der Klinik gelandet. Die Kakerlake hatte sich in eine schmale Ritze zwischen Spiegel und Wandschrank hineingezwängt. Als das kleine Ungeheuer verschwunden war, lehnte sich Paul erleichtert auf seinem Stuhl zurück und war doch voll von Dank für das makabere Schauspiel, denn eine zunehmend ermüdende Langeweile hatte ihn befallen. Er griff nach seiner Wade und betastete die Muskulatur. Die Spannung im Gewebe war noch da, aber eine schmerzende Stelle konnte er nicht finden.
Auch der Sekundenzeiger seiner Uhr kämpfte mit dem Schlaf. Die Minuten stapelten sich gleichgültig im Raum. Pauls Gedanken drifteten weiter und weiter in die Vergangenheit auf der Suche nach dem Ursprung seines vermeintlichen Fehlverhaltens. Er ertappte sich dabei, einzelne Versäumnisse gegen besonders selbstlose Aktionen aufzurechnen, als könne eine Art von Ablasshandel das Gewissensproblem lösen. Mehr und mehr verdunkelten sich seine Sinne, zu grundlegend waren die Selbstvorwürfe, die er nun gegen sich erhob. Es konnte doch nicht alles falsch gewesen sein! Er wußte keinen Ausweg.
Jemand berührte ihn an der Schulter. Dr. Wieland öffnete die Augen. Ein freundliches Gesicht beobachtete ihn aufmerksam und nachsichtig. „Na, Herr Kollege, wieder wach? Alles in Ordnung?“ Paul sah auf, der Mann im weißen Kittel lächelte gewinnend. „Ich bin Doktor Schröder, der Ambulanzarzt, bitte kommen Sie. Es tut mir leid, daß Sie warten mußten.“ Dr. Wieland stand auf und folgte ihm. Nur langsam gelang es, zur Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit zurückzufinden und sie wieder in Richtung Diesseits zu überschreiten. Aber er fühlte sich gut, die beklemmenden Gedanken waren wie ausgelöscht. Was hatte dieser Warteraum nur mit ihm gemacht! Was mochte in den vielen Leidensgenossen vorgegangen sein, die unter ähnlichen Umständen hatten ausharren müssen. Er nahm sich vor, diesen Erkenntniszuwachs künftig in seine Tätigkeit mit einzubeziehen. Es schien ihm, als sei dies der eigentliche Gewinn des Tages.
Auf einem Bauernhof
„He Paulchen, fahr´ du doch eben die Kartoffeln zur Genossenschaft rüber. Du weißt ja, wo das ist, warst doch schon mal dabei. Der Knecht ist mit den Pferden beschäftigt.“ Paul wußte vor Schreck nicht, was er antworten sollte, aber Bauer Ernst hatte sich schon abgewendet. So stieg er auf den Traktor und murmelte: „Kupplung, Bremse, Gas.“ So viel wusste er immerhin schon. Schweiß rann ihm kalt in den Nacken. Aber er durfte sich keine Blöße geben. Stadtkinder wie er waren schließlich auch nicht blöd. Irgendwie brachte er das Gefährt in Bewegung und fuhr ruckelnd aus der Hofeinfahrt hinaus, auf die Landstraße, über den Bahnübergang, an dem die beiden Anhänger bedrohlich schwankten, und dann hinüber zu dem langen Gebäude und der Anfahrt neben der Rampe, wo schon andere Fahrzeuge warteten, um ihre Lasten abzukippen. Paul bemühte sich, gelangweilte Lässigkeit zu zeigen. Aber in seinem Inneren kämpften Stolz und Furcht miteinander um die Vorherrschaft. Noch nie zuvor in seinem Leben hatte man ihm eine solche verantwortungsvolle Aufgabe zugetraut und übertragen. Zum ersten mal überkam ihn eine vage Ahnung, was das Leben bedeutete, was seine eigene Existenz damit zu tun hatte, die sich aus der Ungewissheit seines Kind-seins zu lösen begann.
Beim Mittagessen erzählte Ernst der Bauer in der Runde, was Paul heute geleistet habe. Dieser blickte auf seinen Teller, aber aus dem Augenwinkel sah er doch, wie die Tochter, die von ihrer Mutter nicht nur den Vornamen, sondern auch ihren rustikalen Liebreiz geerbt hatte, ihm einen Blick zuwarf, der ihn verwirrte und etwas in ihm auslöste, das er bisher nicht gekannt hatte. Alles hätte er Gott oder auch dem Teufel versprochen, damit seine heißen Ohren niemandem auffallen sollten. Das war der Augenblick, in dem Paul einen unbekannten Schmerz in sich spürte, der von dem Mädchen herrührte.
Am Nachmittag sah er sie wie zufällig hinter dem Wohnhaus an der großen Scheune stehen, angelehnt an einen der alten, verblichenen Torbalken. Sie war barfuß, ein Bein hatte sie angewinkelt, der Fuß stützte sich auf dem Holz ab. Ihr einfacher Baumwollrock mit schmalem Spitzensaum reichte gerade bis unterhalb der knochigen Knie. Das weisse Hemdchen zeigte schon ein wenig ihre kommende Weiblichkeit. Sie hatte ihr Netz ausgeworfen und überlegte, ob der junge Fisch, den sie fangen wollte, für die Maschen womöglich noch zu klein sein könnte. Einen Versuch war es jedenfalls wert mit dem hübschen Kerl aus der Stadt. Sie würde ihm schon den rechten Weg zeigen. Diese Charaktereigenschaft hatte sie ebenfalls von ihrer Mutter mitbekommen.
Paul kam heran, er trat nah zu ihr, kam ihr, eigentlich nur aus Versehen, zu nah, als daß er sich einfach wieder hätte entfernen können. Er sah ihr Gesicht, sah den roten Mund, wie er sich öffnete und schloß, sah den lebendigen Bogen ihrer Unterlippe, die aufregende Linie der Oberlippe, die an den Mundwinkeln in feinen Wulsten endete, und wie am Mittag war da wieder dieses unbekannte, brennende, unbezwingbare Gefühl. Sie hatte in seinem Gesicht gelesen, was kommen würde, und ihre verführerisch funkelnden, dunklen Augen sagten kapriziös: „Wage es ja nicht!“ Aber es war nicht ernst gemeint, und es war auch schon zu spät. Überraschend, für ihn mehr als für sie, beugte er sich vor und küßte ihre Wange. Er empfand sie als unendlich weich und warm, und sie verströmte einen betörenden Duft, der den ländlichen Geruch von fauligem Kraut, dampfendem Tierdung und ätzender Gülle für einen kurzen, seligen Augenblick überdeckte, wenn er ihn auch nicht ganz auszulöschen vermochte. Pragmatisch, wie Landmenschen auch in jugendlichem Alter schon sind, fragte sie gerade heraus: „mußt du denn unbedingt Arzt werden?“ Sie sprach mit ganz ruhiger Stimme und sah ihn direkt an. Ihre Angriffstaktik , die sie für eben so raffiniert wie unwiderstehlich hielt, scheiterte an seiner jugendlichen Einfalt. Spontan sagte er: „ja, muß ich, das wollte ich doch schon immer.“ Er war stolz auf diese Lebensentscheidung, die sich, solange er denken konnte, unverändert erhalten hatte. Das Leuchten in den Augen des Mädchens ließ nach, Paul bemerkte es nicht. Unwissend hatte er für seinen Traumberuf ein erstes Opfer gebracht, das doch niemand von ihm verlangte. Seine Schroffheit war ihm nicht bewußt, er hatte die Besonderheit dieses Augenblicks nicht verstanden, und für eine egoistische, Vorteil bringende Lüge war er noch zu unverdorben. So gingen sie nebeneinander zurück zum Wohnhaus, und niemals mehr kamen sie sich so nah wie an diesem Tag.
Die letzte Woche seines Aufenthaltes arbeitete Paul auf den Feldern mit. Er arbeitete hart, um seine Dummheit zu vergessen, aber es gelang ihm nicht. Er war damals gerade fünfzehn Jahre alt, aber im Gegensatz zu dem Mädchen war er noch ein Kind. Alt genug, um sich zu verlieben, vielleicht, aber zu jung für eine erste, tiefere Liebe.
Am Ufer entlang
Wenn du einen Weg zurück gehst, denkst du, er sei dir schon bekannt. Jedoch ergeben sich viele neue Perspektiven, alleine schon durch den Blick in die Gegenrichtung, aber auch durch das wandernde Licht der Sonne und die Veränderung der Schatten. Nimmst du den selben Weg erneut, diesmal in der Anwesenheit eines dir nahestehenden Menschen, der, wie eine Komplementärfarbe auf die andere, unwillkürlich auf dich einwirkt, so wirst du wiederum in deinen Ansichten und in deinem Erleben verändert.
Die Mittagszeit war lange vorbei, als Paul den Weg hinunter zum See wollte, an der Apfelplantage vorbei, deren kurze, gedrungene Stämme aus knolligen Veredelungen herauswuchsen, die ihnen eine besondere Winterhärte verliehen. So oft war Paul mit seiner Frau auf diesem Weg entlanggegangen, daß es ihm nicht schwer fiel, sie sich an seiner Seite leibhaftig vorzustellen, auch wenn er alleine war. Manchmal redete er sogar mit ihr.
Er lenkte seine Schritte hügelabwärts. Sein Fuß stolperte über ein bleich aus der Erde ragendes, weiss leuchtendes Schädeldach, dicht am Boden.Nein, gottlob, es war ein großer Siliziumstein, der ihn für einen erschreckenden Augenblick irregeführt hatte. „Pass´ doch auf, Schatz!“, hörte er seine Frau neben sich erschrocken sagen. Der schmale Pfad schlängelte sich am Bachufer entlang durch die Wiese hinter dem Haus und führte dann parallel zur Straße auf eine kleine Anhöhe. Hier ging es nach links ab, und der Blick auf die Flußniederung wurde frei, die von Wiesen, Feldern und einem Bauernhof geprägt wurde. Dahinter, jenseits des silbrigen Flusses, standen Pappeln in Reihen. Den Hintergrund bildeten die sanft geschwungenen Hügel der heute bewaldeten Moränen, die durch Gletscherablagerungen während der letzten Eiszeit entstanden waren. Sie lagen bereits auf der anderen Seite der Grenze, die durch die Flußmitte verlief. Das Blau des Himmels, über den Wolken nach Osten zogen, wölbte sich auf das Land und begann unmerklich, aber unaufhaltsam, dem Abenddämmern zu weichen.
Am Rande eines frisch gepflügten Ackers lag etwas, das von einem Erntewagen herabgefallen sein mochte. Es war eine bleiche Zuckerrübe, aus deren plumpem Körper Wurzelarme und eine zerzauste Blätterfrisur herausragten. Sie weckte Pauls lebhafte Fantasie. Er blieb stehen, um das Rübenmännchen näher zu betrachten. Spaziergänger kamen entgegen, und er machte sie auf das seltsame Naturprodukt aufmerksam. Die Frau sah mit einer höflichen, ratlosen Kopfbewegung zu Boden, um dann Paul einen verlegenen Blick zuzuwerfen. Sie lachte nervös und folgte ihren beiden Begleitern, die bereits uninteressiert weitergegangen waren. “Wer spinnt da jetzt, die oder ich?“, fragte Paul. „Na DU natürlich,“ antwortete seine Liebste und lachte ihr helles Lachen. Dabei lehnte sie ihren Kopf leicht an seine Schulter. Das bedeutete in der Geheimsprache der Frauen: „du bist der Größte für mich.“
Auf der rechten Seite reckten sich violett-rote Rhabarberstängel mit ihren immer noch goßen, dunkelgrünen Lappenblättern, die im Gegenlicht transparent aufleuchteten. Links gab es einen dickpfähligen Drahtzaun, der die bereits vergilbenden Nussbäume bis zum Ufer des Flusses hinab begleitete. Zu Füßen ihrer Stämme standen einige Kubikmeter Brennholz aufgeschichtet, die mit grauen Plastikplanen abdeckt waren, auf denen braun getrocknete Herbstblätter lagen. Auf den beiden parallel laufenden Spuren des Feldweges knackten Walnüsse unter den Schritten. Sie lagen hier so zahlreich, daß es unmöglich war, ihnen auszuweichen. Als Paul weiter ging, stürzten sich hungrige Krähen auf die unerwartet präsentierte Mahlzeit herab.
Schwere Felsbrocken, an deren groben, unbehauenen Flächen Feldspatkristalle blitzten, hinderten das breite Gewässer daran, die Ränder des angrenzenden Weidelandes aufzuweichen und wegzuspülen. Unten angekommen, überquerte Paul auf schmalem Pfad den Grenzbach. Bogenförmig liefen Holzplanken hinüber, seitlich von Geländern geschützt, an deren gedrehten Stahlseilen Liebesschlösser hingen. “Sieh nur, wie schön!“, sagte sie. „Ja“, sagte er leise vor sich hin. Es gab ein surrendes Geräusch, als Paul eines über die Drähte zog. Er nahm ihre Hand, die sich wie ein kleines, weiches Tier anfühlte. Jetzt betraten sie das benachbarte Land. Die Dachfirste der wenigen Gebäude mit den breiter überhängenden Dächern waren anders, als sie es von ihrem Dorf her kannten. Bäume und Gräser dagegen hatten sich nicht verändert, auch nicht die würzige Luft oder der Fluß mit seinem Algengeruch. Hier standen einzelne Apfelbäume, deren reife, rote Früchte hinter dornigen Zweigen einer Akazie vor Spaziergängern sicher waren. Jetzt folgte Paul dem Flussbett weiter nach Westen. Mächtige Pappeln traten mit breit gefächerten Stützwurzeln aus dem Boden, die grün mit Moos bedeckt waren. Aus den Polstern ragten einzelne bleiche, winzige Pilze mit hauchdünnen, zerbrechlichen Stielen. Aufwärts strebend verloren sich die Wurzelstreben in zahlreichen Astgabeln. Hoch oben hatte sich in ihrer gefurchten Rinde ein orangefarbener Baumpilze festgesaugt, ein Schwefelporling, dessen mehrfach gelappte Konsolen den Kleidern von Flamenco-Tänzerinnen glichen. Zwischen den Stämmen der Bäume wucherten Wildrosenhecken, Bündel von Haselsträuchern und breit ausladender, schwarzer Holunder. Vereinzelt säumten schmale Kieselstrände das Ufer, deren bunte Steine im Frühjahr durch das grüne, kalte Schmelzwasser schimmerten, das aus dem Gebirge kam. Dunkel-feuchte Randstreifen auf den Kiesbänken verrieten den nächtlichen Rückgang des Wasserstandes. Unter Ästen mit dichten Kastanienblättern krümmten sich von einem böigen Nachtwind verfrüht aus ihren Blütenkerzen herausgewehte Stachelkugeln. Mit ihren gebogenen Stielen wirkten sie wie hilflose, kleine Embryos. Weidenbäume, bis über das Wasser des Flusses ragend, hingen mit fadenförmigen Zweigen bis über die Wasseroberfläche. Berührten sie diese, so sprangen Wellenringe auf und trieben mit der Strömung davon. Zahllose lanzettförmig schlanke grüne, gelbe und braune Blätter lagen verstreut auf dem Weg und bildeten ein buntes Tapetenmuster. Nicht weit vom Ufer entfernt, etwas höher gelegen, blickten kleine Fenster auf der Rückseite eines alten Bauernhauses gleichgültig, wie gelangweilt zu Paul herab. Auf der kleinen Insel, zu der vom Gegenufer ein alter, grau verblichener Holzsteg führte, leuchteten die weiß gekalkten Stufengiebel des Klostergebäudes. Die dünnstimmige Glocke klang jeden Abend über das Wasser bis zu Pauls Balkon herüber, und löste ein vages Heimatgefühl aus. Dahinter zogen sich die Konturen der bläulichen Hügel hinter Reihen von schlanken Baumkronen weit an beiden Seiten des Stromes entlang.
„Komm, hier bleiben wir ein wenig“, sagte Paul. Sie hielten an und setzten sich auf einen der Ufersteine, lehnten sich aneinander und ließen die Sonne ziehen. Im Hauptstrom trieben weiße Schwäne wie Spielzeuge dahin. Vor dem gegenüber liegenden Ufer war eine langgezogene, bleiche Sandbank trockengefallen, auf der Kormorane träge ihre Flügel trockneten, und elegant gefiederte Möven aufgeregt hin und her trippelten. Dahinter stand das Uferschilf im Wasser, überragt von einem Eschenwäldchen, in dem sich Biber angesiedelt hatten.
Vielleicht hatte ihn für eine kurze Zeit ein Traum entführt. Als er die Augen wieder öffnete, fand er sich alleine in einer gewandelten Welt. Seine Frau war wieder in andere Sphären zurückgekehrt. Die Sonne hatte sich unaufhaltsam weiter nach Westen bewegt und stand nun schräg über den flachen Bergen. Sie waren ihm nicht fremd, aber ihre Hänge hatten schärfere Konturen angenommen, Paul konnte jede einzelne Nivellierung der jetzt blaßgrün schimmernden Flächen erkennen. Die Baumkronen standen mit ihren dunklen Körperschatten und den strahlenden Lichtseiten plastisch davor, schienen jetzt viel näher als sonst. Die hellen Wände des Klosters auf der Flußinsel dagegen waren im Dunkel fast verschwunden, der Holzsteg zum jenseitigen Ufer hinüber wirkte wie eine filigrane Tuschzeichnung in Grautönen. So anders präsentierte sich die doch bekannte Landschaft durch das veränderte Licht der immer weiter absinkenden Sonne, die ihre Schattendecke hinter sich herzog.
Paul erhob sich. Der kurze Schlaf auf dem harten Stein hatte seinen Körper steif werden lassen, sodaß er sich mehrmals streckte. Der silberne Glanz der breiten Wasserfläche war einem bleiernen Grau gewichen. Langsam ging er den Weg zurück und dachte über das kleine Erlebnis der verzaubernden Erinnerung nach, das ihm die Sonne in ihrem seit Jahrmillionen andauernden Gang heute auf seinem Uferweg geschenkt hatte.
Efeu-überwucherte Baumstümpfe hockten wie dunkelgrüne Kobolde im Ufergestrüpp. Das Bauernhaus stand nun vor einem verschatteten Hintergrund, es hatte dadurch eine andere, gedämpfte Kulisse bekommen. Paul kam wieder an dem Rhabarberfeld vorbei, dessen Blätter nur noch unscheinbar, braungrün an farblosen Stielen hingen und alles Lebendige vermissen ließen. Weiter vorne standen, jetzt auf der rechten Seite, die Zaunpfähle wie krumme, schwarze Gestalten unter den Bäumen, fast ebenso schwarz wie die Krähen, die lamentierend aufflogen, weil sie bei ihrer frühabendlichen Nahrungssuche gestört wurden. Paul nahm den Rest des nun ansteigenden Weges und sah oben auf der Anhöhe nochmals zurück in das seichte Tal, das schon ganz im Schatten unterzugehen drohte. Er meinte etwas Feines, Weißes zu sehen, erstes Anzeichen eines Nebelschleiers, der sich durch die kühle Abendluft über dem noch tageswarmen Gewässer bildete.
Während das Land zunehmend ergraute und sich dem aufsteigenden Nebel hingab, dachte Paul daran, auf wie viele Arten man auch seine eigene Existenz betrachten konnte, je nachdem, ob man voraus in die Zukunft schaute, oder zurück in die Vergangenheit.
„Auch in meinem Leben hat es immer wieder Licht und Schatten gegeben,“ überlegte er. Rückwärts betrachtet sah heute manches weniger positiv aus, was er damals als helle Zeit erlebt hatte, auch wenn es nur kurze Lichtblitze gewesen waren.
„Dieses Erlebnis vom Nachmittag bis zur untergehenden Sonne ist wie die Metapher eines ganzen Lebens.“ Paul versuchte, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu beurteilen, sie „in einem anderen Licht“ zu sehen, denn das war es, was wirklich Erkenntnisse brachte, die über dem einzelnen, subjektiven Eindruck standen. Damit kam man der Wahrheit näher, sofern daran ein Interesse bestand. Die Bereitschaft zu diesem Spiel mit dem Wechsel der Blickrichtungen war nicht für jeden selbstverständlich, denn es wandelten sich eher vermeintliche Glanzpunkte der Karriere in enttäuschende Beispiele des Selbstbetrugs oder des Versagens, als daß sich weniger beachtete Tätigkeiten als genial oder heroisch erwiesen hätten, wenn man später darüber reflektierte. Und das motivierte nicht gerade zum Nachdenken über sich selbst.
Das Buch
Ein sanfter Mairegen klopfte auf das schräge Dachfenster, unter dem Paul auf seinem Bett lag und döste. Die Jalousie hatte er heruntergelassen, die Lamellen aber gerade gestellt, sodaß etwas von dem grauen Himmel sichtbar blieb.
Vor einigen Wochen hatte er begonnen, ein Buch über die Zeit zu schreiben, als er an einem Einsatz der Hilfsorganisation MHD beteiligt gewesen war. Das alles lag nun schon über ein Vierteljahrhundert zurück, und in den Jahren danach hatten ihn seine kleine Familie und sein anspruchsvoller Beruf ausgefüllt. Darum, und vielleicht auch, um zu vergessen, was in Ruanda um ihn herum und in ihm geschehen war, hatte er nicht darüber gesprochen, mit seiner Frau nicht, und nicht mit seinen Kollegen. Und da auch niemand Fragen stellte, wurde der Abstand zu jenen Ereignissen im Sommer 1994 immer größer, bis er selbst nicht mehr daran dachte. Nicht einmal in seinen seltenen Träumen kehrten die bedrückenden Bilder wieder, die ihn nach seiner Rückkehr zunächst rücksichtslos und zermürbend verfolgt hatten.
Paul wußte, daß traumatisierende Erlebnisse zwar vergessen werden können, daß sie aber in der Tiefe des Unterbewußtseins gespeichert bleiben, und von dort aus das weitere Leben, alle nachfolgenden Entwicklungen und Entscheidungen einer Persönlichkeit beeinflussen können, häufig in negativer Weise.
Das war nicht der Hauptgrund, trug aber mit dazu bei, daß er sich dazu entschlossen hatte, Erinnerungen aus der Tiefe doch wieder hervorzuholen, von denen er wußte, daß sie noch da waren, von denen er allerdings nicht wußte, was sie mit ihm machen würden. Denn es war ihm klar, dass eine Auseinandersetzung mit diesem Teil seiner Vergangenheit nicht leicht werden würde, weder emotional noch intellektuell.
Pauls größte Sorge war: würden seine Erinnerungen ausreichen, würden sie ihm genügend Klarheit geben, genügend Einzelheiten zurückbringen, würden sie ein unverzerrtes Bild der Vergangenheit zeichnen können? Es war ein Experiment, eine Expedition in ein fremd gewordenes und zugleich bekanntes Land, und er war bereit, den Preis dafür zu bezahlen.
Anfangs fiel es ihm schwer, sich auf die Zeit vor über fünfundzwanzig Jahren zu besinnen. Einzelne, grobe Bilder ließen sich zuerst isolieren, und er begann damit, diese mit seinen Gedanken zu umkreisen, bis sie an Deutlichkeit gewannen, und er sie festhalten und niederschreiben konnte. Je mehr er die Erinnerungen suchte, desto mehr boten sie sich ihm an. Seite um Seite füllte sich, ein Prozeß schien in Bewegung gekommen zu sein, der sich unaufhaltsam beschleunigte und schließlich selbstständig eine solche Fülle von einzelnen Geschehnissen, von Gedanken, Gefühlen und Bildern ans Licht brachte, daß Paul Mühe hatte, alles aufschreiben, bevor es, so fürchtete er anfangs, wieder verblasste und irgendwo in seinem Inneren verloren ging. Deshalb hatte er nun immer Schreibzeug bei sich, wenn er das Haus verließ, um unterwegs festhalten zu können, was nicht warten wollte Er notierte jede Kleinigkeit, jede Formulierung, jeden neuen Gesichtspunkt, der sich ihm anbot, ja, sich ihm aufdrängte.
Paul erwachte unzählige Male aus dem Schlaf, weil die Gedanken keine Ruhe gaben, und ihm immer Neues in den Sinn kam. Es gab Nächte, in denen weckten ihn Eingebungen oder Formulierungen, die ihm am Tage nicht einfallen wollten, wie Blitze. Sie waren plötzlich da, manchmal im Abstand von wenigen Minuten. Sie kamen wie nach oben drängende Gasblasen aus der glühenden Tiefe eines Vulkankraters, die aufstiegen, heraus mussten und nicht nachließen, ehe sie nicht ins Freie gelangt waren. Dann war ihm wohler für den Augenblick, bis das Drücken wieder begann und ihn erneut weckte. Der Schlaf hatte seine regenerierende Wirkung eingebüßt. Paul erwachte am Morgen manchmal erschöpfter, als er es am Abend davor gewesen war.
Wie aus einer angebohrten Ölquelle sprudelte immer mehr, immer stärker die Vergangenheit, seine Vergangenheit. Er wußte nicht, wie er sie zurückhalten sollte. Gleichzeitig riß er jede Einzelheit gierig an sich, denn die Absicht, dieses Kapitel seines Lebens aufzuschreiben und sichtbar zu machen, konnte er nicht aufgeben.
Erst als das Manuskript wuchs und schließlich einen bereits bemerkenswerten Umfang anzunehmen begann, wurde es besser. Die Panik, wesentliches zu vergessen, ehe es auf dem Papier festgehalten war, schwand nach und nach und machte ruhigeren Recherchen Platz. Paul hatte es endlich geschafft, sich einem Arbeitsprinzip unterzuordnen und alles, was seine innere Quelle auswarf, auf Karteikarten zu schreiben und in einem Kasten aufzubewahren. So konnte er sicher sein, daß nichts verloren ging, was ihm je in den Sinn kam. Das manchmal unlesbare Gekritzel im Halbschlaf unruhiger Nächte hatte damit ein Ende gefunden und auch Pauls Angst, seiner Vergangenheit nicht gerecht zu werden.
Das Ende von Dr. W.
Dr. W. war mit heftigen Atembeschwerden aus dem Schlaf hochgeschreckt. Dennoch gelang es ihm, eine plötzlich hochsteigende Panik zurückzudrängen und den ärztlichen Notruf zu wählen.
Es war das bedrückende erste Jahr der großen Grippe-Pandemie im einundzwanzigsten Jahrhundert, die den Menschen vor Augen führte, wie dünn die schützende Decke der Zivilisation war, wie übermächtig die Natur alles beherrschte, auch wenn dies nicht immer ganz so offen zu Tage trat wie in dieser deprimierenden Zeit.
Während der letzten Tage hatte er sich ungewohnt schlapp gefühlt, das Essen hatte einen faden Geschmack angenommen, und mehrmals war ihm übel geworden. Sonst war alles wie immer gewesen. Dann aber, in jeder Nacht, begann dieses Stechen in der Lunge, und eine beklemmende Atemnot war über ihn hergefallen. Da war ihm klar, daß ihn das Virus erwischt hatte, obwohl er sich bemüht hatte, alle empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Wie er in die Klinik gekommen war, wußte der alte Mann nicht mehr. Es war nicht wichtig. Wichtig war nur, daß er in einem Intensivbett lag, und mit jedem Atemzug Sauerstoff über eine Nasensonde in seine Lungenflügel flutete. Die Luftnot wurde dadurch erträglich, aber das Stechen in der Lunge hatte nicht aufgehört. Dennoch, er fühlte sich besser, auch weil die Angst nachließ, die ihn zuhause überkommen hatte, die Angst, alleine zu sterben.
Während Dr. W. versuchte, die Gedanken zu ordnen, die durch seinen Kopf eilten, füllte das leise Rauschen der Sauerstoffleitung den Raum. Niemand sonst war in dem nüchternen, hellen Krankenzimmer. Das leise, immer wiederkehrende Signal des Monitors, der auf einem Regal über ihm stand, beruhigte ihn, auch wenn die Töne unregelmäßig aufeinander folgten. Das kannte er, es war gut so. Auch das stetige Fallen der Flüssigkeit in der länglichen, durchsichtigen Tropfkammer der Infusionsflasche neben dem Bett beruhigte ihn. Er fühlte sich in Sicherheit. Ping-pingping-ping, tönte das elektronische Echo seines Herzschlages. Die monotone Melodie führte ihn zurück zu den langen Nächten im Klinikum, wo er während des Studiums als Sitzwache bei schwer Erkrankten gegen den Schlaf ankämpfte. Nichts war auch damals zu hören gewesen außer diesem technischen Geräusch, das in der Stille der Mitternacht lauter und lauter wurde, bis es in den Ohren schmerzte.
Dr. W. ließ seinen Blick durch das Zimmer wandern, hinüber zu der Nische, in der sich das Waschbecken befand, und der Spiegel darüber, und die weißen Kacheln sich hygienisch darum herum ausbreiteten. „Ob die Wand hinter dem Spiegel auch gekachelt ist?“, fragte er sich. Die Sparmaßnahmen der Krankenhäuser nahmen manchmal absurde Formen an.
Er war selbst viele Jahre lang klinisch tätig gewesen, hatte eine Intensivstation geleitet und immer darauf geachtet, daß seine Patienten sich geborgen fühlten, soweit es in der sterilen Atmosphäre der hochtechnisierten Räume möglich war. Sein Arztzimmer, das ihm Jahrzehnte lang nicht nur als Büro und Sprechzimmer gedient hatte, sondern auch als Rückzugsort, als Refugium nach anstrengenden Operationen und ermüdenden Nachtdiensten, hatte auch dieses Arrangement von Waschbecken, Spiegel und hygienischen Kacheln vorzuweisen gehabt. Merkwürdigerweise erinnerte er sich jetzt genau an den Wasserhahn, an die beiden runden Chromgriffe mit dem blauen und dem roten Punkt darauf, und an den immer verschmutzten Stöpsel, der auf dem Rand des Waschbeckens lag und mit einer Metallkette befestigt war, die aus lauter kleinen, silbrigen Kügelchen bestand. Aber sonst war es ein sehr ansprechender Raum gewesen mit einem Balkon, der zur Stadt und zum Stadtpark freie Sicht hatte. Am gegenüberliegenden Hang des Tales, in dem die Stadt lag, war der Giebel der Villa zu erkennen gewesen, in deren Erdgeschoß er wohnte.
Die Inneneinrichtung des Arztzimmers hatte er bei seinem Einzug selbst aussuchen können, und so hatte er sich eine Atmosphäre geschaffen, in der er sich wohl fühlte, die ihm gut tat, weil sie sein inneres Harmoniebedürfnis befriedigte. Das helle Palisander-Braun der Regale kontrastierte beruhigend mit den farbigen Buchrücken und dem Grün der Zimmerpflanzen. Der dunkelblaue Bezug des Sofas, das ihm auch als Bett dienen konnte, bestand aus weichem Velours, dessen Oberfläche matt glänzte, wenn schräge Sonnenstrahlen am späten Nachmittag auf ihn fielen. Der Lichtkasten an der Wand, versteckt hinter der Tür, war, abgesehen von der einfallslosen Spiegel-Waschbecken-Kreation, der einzige kühl-nüchterne Gegenstand im Raum. Unzählige Röntgenbilder und Schichtaufnahmen von Tumoren, Blutungen und Hirninfarkten hatte er hier betrachtet. Welche Schicksale hatten sich hinter ihnen verborgen!
Die Tür öffnete sich, eine Krankenschwester kam herein, und seine Erinnerungsbilder huschten erschreckt davon. Sie trug ein Tablett in der Hand. „Ich bin Magdalena und bringe das Cortison“, sagte sie nur und schien zu lächeln. Genau konnte er es nicht sehen, denn sie trug ihre Schutzmaske korrekt über Mund und Nase. Magdalena trat an sein Bett und machte sich an der Infusionsleitung zu schaffen. Er fühlte ein unangenehmes Kratzen im Hals und hüstelte. „Das ist aber neu,“ hörte er sie sagen, „sicher ist der Sauerstoff daran schuld. Sie kennen das ja selbst von Ihren Patienten, nicht?“ Die Zufuhr von Sauerstoff über eine Nasensonde trocknete die Rachenschleimhaut aus und konnte einen Hustenreiz auslösen. Ja, er kannte das Phänomen. Er ging nicht weiter auf ihre Bemerkung ein. Es war eine rücksichtsvolle Freundlichkeit von ihr gewesen. Aber er wollte sich nichts vormachen. Das Virus war daran schuld, es breitete sich immer weiter in ihm aus.
Weder die Zuwendung des Personals noch der fast kameradschaftliche Ton der betreuenden Kollegen konnte darüber hinwegtäuschen, daß seine bisher so farbige Lebensweise und die großartigen Freiräume seiner Motorradtouren hier zu Ende gehen würden. Wie fern war das, wie lange schon vorbei. Er lag da, und in der Zeitlosigkeit des Tages entließ er seine Gedanken wieder in die Freiheit. Aber sie wollten ihn nicht verlassen. „Ist das jetzt die große Abrechnung?“ fragte er sich. Aber nein, daran konnte er nicht glauben. Kein Mensch, kein Lebewesen stand unter der Kontrolle eines gebenden und nehmenden großen Willens. Das widersprach einfach zu sehr seinen Erfahrungen aus einer Jahrzehnte langen, intensiven Berufstätigkeit.
„Sind wir nicht alle in der Lage, uns selbst zu gestalten, mehr oder weniger?“ Glück oder Zufall, aber auch Unglück wirkten als Joker mit in dem unübersehbaren Gemenge des Lebens, wie der Wind, der endlose, unentzifferbare Muster in die Dünen der Wüste zeichnete.
Schwester Magdalena stand wieder neben seinem Bett. Er hatte ihr Eintreten diesmal nicht bemerkt, hörte aber ihre Stimme, als sie ihn ansprach. Diesmal bemühte er sich, ein genaueres Bild von ihrer Erscheinung einzufangen, weil sie ihn an seine Tochter erinnerte, die es allerdings nur in seiner Fantasie gab. Ihr dichtes, schwarzes Haar war teilweise unter einer grünen Gazehaube versteckt. Es fiel, zu einem dicken Zopf gebündelt, nach vorne über ihre Schulter und endete in der Höhe der Ellenbeuge ihres linken Armes. Die Stirn der jungen Frau erinnerte ihn in ihrer Makellosigkeit an das Spiegelbild des Mondes in einem stillen Teich. Das schmale Gesicht war, wie vorgeschrieben, von der Schutzmaske bedeckt. Ihre schönen, dunklen Augen, über denen sich markante Brauen wie die Schwingen eines Vogels ausbreiteten, sahen ihn nachdenklich an, aber er bemühte sich nicht, ihr Geheimnis zu deuten. „Ach ja, einfach davon fliegen“, dachte er müde.
Magdalenas jugendlicher Körper blieb unter ihrem graublauen Schutzkittel verborgen. Er bedauerte das, denn ein Gefühl für die romantische Poesie der weiblichen Figur war noch wach in ihm. Auch wenn sie ihn in seinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr erregte, so war ihm doch ein ästhetisches Empfinden geblieben.
Ihre Stimme klang professionell, als sie sagte: „Zufrieden, Doktor?“ Sie legte die Blutdruckmanschette um seinen Oberarm und nickte, nachdem sie das Ergebnis der Messung abgelesen hatte. Er fragte nicht nach den Werten, sie spielten für ihn keine Rolle mehr. Sie mussten registriert werden, es gehörte zu einer korrekten Patientenversorgung dazu.
„Ja, ich fühle mich ganz gut, danke“, sagte der alte Mann, und sie schien wieder zu lächeln. Bevor sie ging, sagte er noch: “Bitte rufen Sie meinen Sohn an, vielleicht kann er mich mit meiner kleinen Enkelin besuchen kommen.“ Mehrfach machte er eine Pause, das Sprechen fiel ihm schwer. Es bestand kein Zweifel, sein hohes Alter war eine zusätzliche Belastung. Als er wieder alleine da lag, kehrten seine Gedanken zurück zu der Frage von Schuld im Leben jedes einzelnen Menschen. Er wusste, daß er er für ausgeglichen. Viel Gutes hatte er geleistet mit Hilfe seines privilegierten Berufes. Aber es fielen ihm auch manche Dinge ein, für die er sich auch jetzt noch verachtete. Er hatte darüber niemals ein Wort verloren, nicht gegenüber vertrauten Freunden, nicht einmal, oder gerade nicht gegenüber seiner geliebten Frau, die schon vor Jahren von ihm hatte gehen müssen.
selbst vieles richtig, aber auch vieles falsch gemacht hatte. Die Bilanz seiner eigenen siebenundsiebzig Jahre hielt
Diese intimsten Schattenseiten seiner Persönlichkeit hatte er mit keinem Menschen teilen können. Er war überzeugt, daß er nicht der Einzige war, der in seinem Innersten irgendein beschämendes Geheimnis verbarg. In diesem Augenblick verzieh er sich selbst seine Sünden. Er fühlte sich erleichtert, befreit von allem Ballast, den er so lange auf seinen Schultern mit sich herumgetragen hatte.
Das monotone Geräusch des stetig strömenden Sauerstoffes erinnerte ihn an etwas. Aber er konnte nicht herausfinden, was es war. Als Magdalena eintrat, drehte er nur langsam den Kopf zu ihr hin.
„Ist mein Sohn schon gekommen?“- „Nein Doktor, leider noch nicht.“ Er nickte und blickte traurig zur Decke, von der die matt-weiße Lampenkugel an einer Metallstange herabhing. Er dachte jetzt an die verträumte Wiese, die sich vor dem Balkon seiner Wohnung bis zu dem kleinen Wäldchen ausbreitete, einen Teil des dahinter aufsteigenden Hügels verdeckend, auf dem die mächtigen Mauern der Burg thronten. Sein Zuhause existierte für ihn nur noch in vagen Erinnerungsbildern, die sich immer mehr mit anderen Lebensstationen vermischten. Alles war irgendwie miteinander verbunden, gleich wichtig, gleich unwichtig. Wie Schlaglichter leuchteten einzelne Begebenheiten, Gesichter und Gefühle auf, die früher eine Bedeutung für ihn gehabt hatten, die sein Leben farbig und lebenswert gemacht hatten.
Die kleine Bucht an der türkischen Südküste, wo er mit seiner Frau vor Anker lag, die Telefonzelle in K., in der er vor übermächtigem Glück geschluchzt hatte, als er seinen Eltern von dem bestandenen Staatsexamen berichtete. Besonders klar stand vor ihm das Lächeln des Mädchens, das ihm zum ersten Mal eine heiße Röte ins Gesicht getrieben hatte. Und die ehrwürdige, in einer verwunschenen Parklandschaft versteckte Villa seiner Großeltern im Elsaß.
Aber auch der fremde Raum, das fremde Bett, in dem er sich als kleiner Junge in den Schlaf geweint hatte, stumm vor Verlorenheit, auch dies drängte sich zwischen die lieblichen Bilder, und auch die Sekunde, in der ihm auf einer von Raureif bedeckten, kurvenreichen Strecke in den Bergen unvermittelt das Vorderrad seines Motorrades weggerutscht war, und es ihn auf der Straße vielfach um seine Längsachse herumwirbelte, sodaß er sich schmerzhafte Verletzungen zugezogen hatte.
Einmal kam die Nachtschwester, um nach ihm zu sehen. Im Schein der Nachtbeleuchtung bemerkte er, daß auch sie nur durch den Ausdruck ihrer Augen lebte. „Mein Sohn?“ fragte er leise und blickte zu ihr hin. Sie schüttelte leicht den Kopf und ging wieder hinaus. „Ach“, sagte er nur. Es klang, als sei damit für ihn ein letztes Kapitel abgeschlossen, eine letzte Hoffnung aufgegeben. Für einen Augenblick noch war sein Geist glasklar. Er erkannte, daß dies alles sein Leben gewesen war, vielleicht nicht das Wichtigste in seinem Leben, aber was war wirklich bedeutend, wenn er zurückblickte.
So lag er da, die ganze Nacht, in seinen letzten, dünner werdenden Gedanken gefangen. Sein Blick fiel auf das Fenster. Er ahnte, dass die Morgendämmerung kam und die Konturen des frühlingshaft blühenden Parks draußen aus dem nächtlichen Grau auferstehen ließ, aber er konnte es kaum noch wahrnehmen. Nebelschleier stiegen in seinen Augen hoch.
Das grelle Pfeifen des Oxymeters erreichte noch entfernt das Ohr des Reisenden. Als der Herzalarm losschlug, atmete er schon nicht mehr. Schwester Magdalena stürzte mit einem Arzt ins Zimmer, blieb dann aber für einen Augenblick reglos stehen und schaute auf den leblosen Körper unter dem weißen Tuch. Sie setzte sich auf den Bettrand, griff nach dem schlaffen Arm und tastete den Puls, als könne sie damit etwas ungeschehen machen. „Nichts“, sagte sie. Dann stand sie langsam auf, zog die Decke ein Stück nach oben und legte sie vorsichtig über das Gesicht des Toten. Dabei war ihr so elend zumute, als hätte sie ihren Vater verloren.
Dr. W. hatte bei seiner Einlieferung verfügt, daß keine Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden sollten, wenn es soweit war. Seinen Sohn und seine so geliebte kleine Enkelin hatte er nicht mehr gesehen. Er hatte es nicht geschafft, länger auf sie zu warten. Auch Magdalenas Reaktion hätte ihn glücklich gemacht. Das war eigentlich das Bedauerlichste. Aber dafür wäre es ohnehin zu spät gewesen.
Die Grippeimpfung