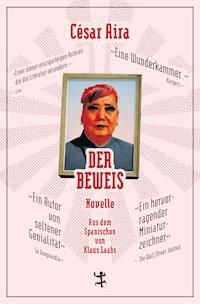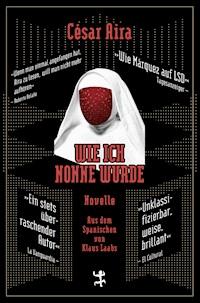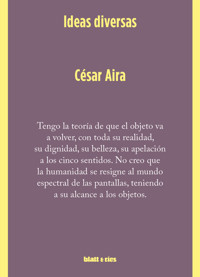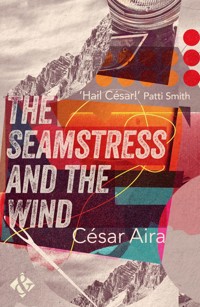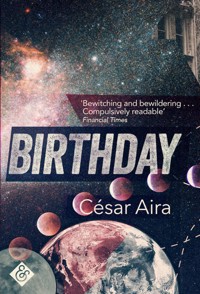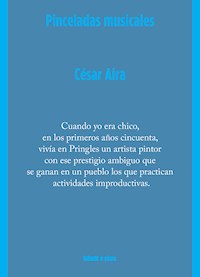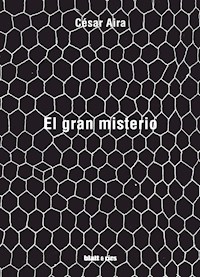Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bibliothek César Aira
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt mit einem Abendessen: Zusammen mit seiner Mutter ist der Erzähler bei einem Freund zu Gast. Doch der Abend gestaltet sich für ihn frustrierend, denn sofort beginnen Freund und Mutter mit ausuferndem Namedropping: Meisterlich beherrschen sie, was die kleinstädtische Welt zusammenhält und jedem seinen Ort zuweist, den Lebenden genauso wie den Toten. Der Erzähler, der all die Namen nicht kennt, sieht für sich daher hüben wie drüben keinen Platz, doch wohin mit sich? Zu Hause zappt er sich durchs Fernsehprogramm und landet beim örtlichen Reality-TV-Sender. Gerade geht es in rasender Fahrt zum Friedhof, und gebannt verfolgt er, wie sich reality in ein Splattermovie verwandelt: Die Toten steigen aus ihren Gräbern, und eine Flut hungriger Untoter strömt in die Stadt Coronel Pringles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliothek César Aira
Band 11
Aus dem Spanischenvon Christian Hansen
César Aira
Das Abendessen
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
I
Mein Freund war allein zu Haus, trotzdem lud er uns zum Essen ein; er war ein sehr geselliger und redseliger Mensch, der für sein Leben gern Geschichten erzählte, obwohl er das nicht gut machte; er brachte Episoden durcheinander, ließ Wirkungen ohne Ursachen, Ursachen ohne Wirkungen, übersprang wichtige Teile, brach eine Erzählung mittendrin ab. Meine Mutter, die es altersbedingt zu einer ähnlichen geistigen Unordnung gebracht hatte, wie sie meinem Freund in die Wiege gelegt worden war, störte das nicht weiter, ich glaube, sie bemerkte es nicht einmal. Tatsächlich hatte sie die größte Freude an der Unterhaltung, und es war ihre einzige Freude an diesem Abend. Letztere verdankte sich einer Rekurrenz der Namen ortsansässiger Familien – magische Worte, in denen sich ihr ganzes Interesse am Leben zu konzentrieren schien. Ich hörte die Namen fallen, wie man es regnen hört, für sie dagegen waren sie Schätze voller Bedeutung und Erinnerung; Mamá genoss, was ihr die tägliche Unterhaltung mit mir nicht bieten konnte; in dieser Hinsicht, und nur in dieser, befand sie sich in völligem Einklang mit meinem Freund; er war Bauunternehmer und hatte seit Jahrzehnten in Pringles Häuser gebaut, weshalb er die Konstellationen und Genealogien sämtlicher Familien des Städtchens kannte. Ein Name zog den anderen nach sich, was einer altbewährten Praxis folgte, da sich die örtliche Bevölkerung ihre gesamte intellektuelle und sentimentale Erziehung dadurch erwarb, dass die einen von den anderen sprachen, und ohne Namen wäre das schwierig gewesen. Es stimmt, dass mit dem Alter und fortschreitender Verkalkung Dinge verloren gehen, und es heißt immer, die Namen seien das Erste, was man verliert. Aber sie sind auch das Erste, was man findet, denn die Suche nach ihnen führt über andere Namen. Sie wollten an eine Frau erinnern, »die … wie hieß sie noch gleich? Die mit Miganne verheiratet war, die gegenüber dem Büro von Cabanillas wohnte …«, »Welcher Cabanillas? Der, der mit einer von den Artolas verheiratet war?« Und so in einem fort. Jeder Name war ein semantischer Knotenpunkt, in dem viele andere Namensfäden zusammenliefen. Die Geschichten verhedderten sich in einem Wirrwarr abgespulter Namen und blieben ohne Auflösung, so wie zuvor schon die alten Verbrechen oder Betrügereien, Intrigen oder Familienskandale, von denen die Geschichten handelten. Für mich bedeuteten die Namen nichts, hatten nie etwas bedeutet, waren mir deswegen aber doch nicht unbekannt. Im Gegenteil, sie klangen in meinen Ohren altbekannt, bekannter als alles andere auf der Welt, möchte ich sagen, denn von frühster Kindheit an hörte ich sie tagein, tagaus, noch bevor ich sprechen lernte. Aus irgendeinem Grund konnte oder wollte ich die Namen nie mit Gesichtern oder Häusern verknüpfen, vielleicht aus einer Abneigung gegen das Leben in der Stadt, in der sich trotz allem mein ganzes Leben abgespielt hat, und jetzt, wo ich mit dem Alter die Namen zu verlieren begann, ergab sich das interessante Paradox, dass ich verlor, was ich nie gehabt hatte. Und doch war jetzt, wo ich sie aus dem Mund meiner Mutter und meines Freundes hörte, jeder einzelne ein Glockengeläut von Erinnerungen, leeren Erinnerungen, Klängen.
Nun war es nicht so, dass ich keine echten Erinnerungen besessen hätte, gehaltvolle Erinnerungen. Das stellte ich nach dem Essen fest, als mein Freund mir ein altes Aufziehspielzeug zeigte, das er aus einer Vitrine nahm. Es war klein, kaum größer als die Handfläche, auf der er es präsentierte, und stellte doch ziemlich naturgetreu ein Schlafzimmer aus alten Zeiten dar, mit Bett, Nachttisch, Vorleger, Kleiderschrank und, dem Bett gegenüber, einer Tür, die mangels einer Wand, in der sie sich öffnen konnte, wie ein weiterer Kleiderschrank aussah, zumal sie als rechteckiger Kasten ausgeführt war, in dem sich meiner Vermutung nach eine der Figuren verbarg. Die andere war sichtbar und lag im Bett: eine blinde alte Frau, halb sitzend, auf Kissen ruhend. Den Boden des Zimmers bildeten nicht Fliesen, auch kein Parkett, sondern schmale, dunkle Bohlen, wie sie mir von den Fußböden der Häuser meiner Kindheit in Erinnerung waren. Das fiel mir deswegen auf, weil sie mich an das Haus zweier Schneiderinnen erinnerten, in das meine Mutter mich mitnahm, als ich ganz klein war; mit diesem Haus verbindet sich für mich eine seltsame Erinnerung. Als wir einmal bei ihnen waren, fehlte in ihrem Salon der Fußboden, zumindest ein großer Teil davon, man hatte ihn wegen einer Reparatur ausgehoben oder er war eingestürzt, jedenfalls gähnte in dem Raum eine große Grube, sehr tief, mit dunklen, jähen Wänden aus bröckelnder Erde und Steinen und Wasser am Grund. Die Schneiderinnen, ihre Gehilfinnen und Kundinnen standen außen herum. Alle lachten, kommentierten die Katastrophe und gaben jede ihren Senf dazu. Kurz: eine dieser unerklärlichen Erinnerungen, die einem aus frühster Kindheit bleiben. Ich glaube nicht, dass der Fall so krass war, wie ich ihn in Erinnerung hatte, niemand könnte an so einem Ort leben oder arbeiten. Ich war sehr klein, vielleicht kam mir die Grube deshalb so groß vor. Da sie mir noch so gegenwärtig ist, fragte ich einmal Mamá, ob sie sich daran erinnern könne. Sie erinnerte sich nicht nur nicht an die Grube im Salon der Schneiderinnen, auch an die beiden selbst besaß sie keinerlei Erinnerung. Dass sie sich nicht erinnerte, erzeugte in mir einen irrationalen Groll, so als erinnerte sie sich absichtlich nicht. Tatsächlich hatte sie keinen Grund, sich an ein triviales Ereignis von vor sechzig Jahren zu erinnern. Dennoch ließ es ihr keine Ruhe, und einen Tag lang kam sie immer wieder darauf zurück. Es gab nur einen Anhaltspunkt, um ihr auf die Sprünge zu helfen: Eine der Schneiderinnen hatte einen steifen Finger, hart und gerade wie ein Stöckchen. Ausgehend von diesem Finger, der mir deutlich vor Augen stand, glaubte ich seine Besitzerin als eine alte Frau zu erinnern, mit dunkelbraunem Haar, sehr streng frisiert, hochgeschossen, dünn und knochig; der Finger war riesig. Überflüssig zu sagen, dass der Anhaltspunkt zu nichts führte. Meine Mutter fragte mich: Sollten das die Schwestern Adúriz gewesen sein, die Razquíns, die Astuttis? Es machte mich ungeduldig, dass sie es über den Umweg der Namen versuchte, die mir nichts sagten. Meine »Namen« waren die Grube, der Finger, alles Dinge, die keine Namen hatten. Ich insistierte nicht länger und bewahrte die Erinnerung an die Grube wie so viele andere vorher. Bei meiner ältesten Erinnerung, der ersten meines Lebens, geht es auch um eine Ausgrabung: Die Straße, in der wir wohnten, war quasi noch ein Feldweg, und als man ihn asphaltierte, musste man dafür Unmengen Erde und Steine ausheben, und in meiner Erinnerung war die ganze Straße ein Gitternetz aus rechtwinklig ausgeschachteten Gruben, ich weiß nicht, warum, da es mir unwahrscheinlich scheint, dass man ein solches Raster anlegen muss, um einen Feldweg zu asphaltieren.
Diese rekurrenten Erinnerungen an Gruben, so primitiv, so fantastisch sie womöglich waren, symbolisierten am Ende vielleicht für »Lücken« im Gedächtnis oder, besser noch, Lücken in den Geschichten, die es nicht nur in denen nicht gibt, die ich erzähle, sondern die ich auch in denen, die man mir erzählt, ständig auffülle. Pannen in der Kunst des Erzählens stelle ich bei allen fest, fast immer zu Recht. Meine Mutter und mein Freund zeigten sich in dieser Hinsicht besonders unzulänglich, vielleicht wegen dieser Leidenschaft für Namen, die eine normale Entwicklung ihrer Geschichten verhinderte.
Es war wirklich magisch. Sie gingen ihnen mit einer automatischen Leichtigkeit und in ungeheurer Zahl von den Lippen. So viele Menschen lebten in Pringles oder hatten dort gelebt? Jeder Anlass war ihnen recht, um ihnen einen neuen Schwarm Namen zu entlocken. Von Leuten, die in einem Häuserblock wohnten. Leuten, die aus dem Häuserblock fortgezogen waren. Leuten, die ihre Häuser unter Wert verkauft hatten. Leuten, die einen Kräutergarten besaßen. Letzteres ergab sich aus einer Lobrede, die mein Freund auf gutes Essen zu halten begann, die in eine Erzählung abglitt, wie er an frischen Salbei gekommen war, um ihn an den Reis zu tun. Fertig verpackt sei er nämlich nicht so gut, er verliere beim Trocknungsprozess das Aroma. Und sein eigenes Kräuterbeet sei zufällig wenige Tage zuvor bei einer der vielen Reparaturen und Ausbauten, die ständig an seinem Haus vorgenommen wurden, zerstört worden. Weshalb er an diesem Nachmittag losgezogen sei, um bei Bekannten zu klingeln, von denen er wusste, dass sie Kräuter zogen. Bei der ersten Adresse hatte er kein Glück, dort habe ein möglicherweise giftiges Pulver den Salbei kontaminiert; zwar ließe er sich, wenn man ihn gut wüsche, vielleicht noch verwenden, aber das lohnte die Mühe nicht, wenn man am Ende den Verdacht nicht loswurde, man könnte sich daran vergiften. Ich fragte, ob Insektengift gesprüht worden sei. Nein, viel schlimmer! Im Übrigen verwendete Delia Martínez – denn um sie handelte es sich – in ihrem Garten keine Chemie. Der Name, der mir nichts sagte, riss meine Mutter aus ihrem Schweigen. Die Delia Martínez, die einen Liuzzi geheiratet hatte? Die am Boulevard wohnte? Ja, genau die. Mich machte die Marotte stutzig, Frauen immer mit ihrem Mädchennamen anzusprechen; als würde man jedes Mal die Geschichten der Leute ans Licht zerren. Mamá sagte, erst gestern sei sie ihr begegnet, und sie habe ihr erzählt, welche Ängste sie wegen dieser Statue ausstehe … Mein Freund unterbrach sie: Eben das sei ja der Grund für die Kontaminierung ihres Salbeis und der übrigen Kräuter sowie des gesamten Gartens. Weil sie annahmen, dass ich davon nichts wüsste, erklärten sie mir, die Frau würde am Boulevard wohnen, mit Blick auf das Plätzchen, wo ein Bildhauer seit Monaten an einem von der Stadt in Auftrag gegebenen Denkmal arbeitete. Der feine Marmorstaub fliege bis zu ihrem Haus und zwinge sie, hinter hermetisch verschlossenen Fenstern und Türen zu leben, und ihren Garten, der ihre ganze Leidenschaft, ihr Lebens- und Meisterwerk sei, habe er bis zum letzten Halm eingenebelt. Sie habe sich bereits beim Bürgermeister, beim Radio und beim Fernsehen beschwert. Mit besorgter Miene und Blick auf ihren halb vollen Teller sagte Mamá, Marmorstaub sei äußerst schädlich für die Gesundheit. Das war neu für mich, und ich hielt das für Unsinn, weshalb ich schon etwas sagen wollte, um meinen Freund für den Fall in Schutz zu nehmen, dass er diesen Salbei benutzt hatte, aber er pflichtete ihr bereits überschwänglich bei: Der Staub sei das Schlimmste überhaupt, ein Gift, das tödlich sein könne. Er müsse es wissen, von Berufs wegen. Selbstverständlich habe er nicht mit dem Salbei aus Delias Garten gewürzt, die ihm übrigens unter diesen Umständen niemals welchen gegeben hätte! Nein, der Salbei im Reis, den wir äßen, stamme anderswoher. Delia selbst habe ihm den guten Tipp gegeben. Die Witwe Gardey, die Inhaberin der Pension Gardey, sei es gewesen, die Salbei besaß. Eine Schönheit!, rief meine Mutter aus und überschlug sich in Lobreden auf diese Frau, die ihr zufolge mit ihren weit über neunzig Jahren noch immer attraktiv war, in ihrer Jugend sei sie Miss Pringles gewesen, ihre Schönheit sei innerlich und äußerlich: herzensgut, liebenswert, sanft, intelligent, eine Ausnahme unter den bösartigen alten Weibern der Stadt. Mein Freund nickte zerstreut und beendete die Erzählung, indem er sagte, die alte Dame habe ihn, als er sie aufsuchte, mit den Worten empfangen, es täte ihr furchtbar leid, aber sie habe keine Zimmer frei, die Hochzeit einiger französischer Viehzüchter habe so viele Menschen in die Stadt gespült (einige sogar aus Frankreich), dass ihre Kapazitäten erschöpft seien; als er ihr den Grund seines Kommens erklärte, ging sie eine Schere holen, führte ihn in ihren Garten und schnitt für ihn die Salbeiblätter, nicht ohne ihm vorher eine »private Führung« durch ihr Etablissement zu gewähren. Meine Mutter: Wie schön, die Pension, wie ordentlich, wie sauber, als junges Mädchen sei sie zu den Karnevalstänzen gegangen, die der verstorbene Gardey organisiert habe. Mein Freund korrigierte sie: Es sei nicht mehr dasselbe Gebäude … Aber Mamá war sich ihrer Sache sicher, widersprach ihm energisch und schwelgte in ihren Erinnerungen. Und doch verhielt es sich anders, mein Freund wusste das gut und brachte sie mit seiner genaueren Kenntnis zum Schweigen: Die alte Pension Gardey, eines der bemerkenswertesten Gebäude der Stadt, sei abgerissen worden, an gleicher Stelle habe man das heutige Gebäude errichtet, sehr viel schlichter und architektonisch belanglos. Darüber bestehe kein Zweifel, denn es gab damals einen skandalösen Gerichtsprozess, der Epoche machte. Dazu kam es, als der Besitzer des brachliegenden Nachbargrundstücks bauen wollte. Bei der Prüfung der Pläne im Katasteramt wurde festgestellt, dass die Erbauer der Pension sich geirrt und die Außenwand zehn Zentimeter jenseits des gültigen Grenzverlaufs auf dem Gebiet des Nachbarn hochgezogen hatten. Das Problem war gravierend: Gardey konnte den aus Unachtsamkeit usurpierten Teil nicht kaufen, da Gebietsstreifen von weniger als einem Meter Breite nicht beurkundet werden konnten, und das Angebot einer finanziellen Entschädigung anzunehmen, blieb dem guten Willen des anderen anheimgestellt. Es gab Reibereien, Missverständnisse, und am Ende landete man vor Gericht; der Nachbar zeigte sich unnachgiebig, und da das Recht auf seiner Seite war, lief es darauf hinaus, dass die Pension, dieser fantastische Beaux-Arts-Palast, Stolz der Stadt und Heimstatt der besten Erinnerungen der Teilnehmer der großen Karnevalsbälle, abgerissen werden musste, wegen zehn Zentimetern! Hier machte mein Freund beim Erzählen eine Geste, bei der er Daumen und Zeigefinger (zehn Zentimeter) spreizte. Für Gardey, der ein guter Mensch war, bedeutete das den Ruin; der Nachbar, ein schlechter Mensch, wurde von ganz Pringles verurteilt. Gardey starb kurz darauf verbittert, und es war seine Witwe, die die Pension wieder aufgebaut und sie die letzten Jahrzehnte über geführt hatte.
Aber zurück zu dem Spielzeug mit dem blinden Püppchen, das er uns nach dem Essen gezeigt hatte: Die Grundplatte besaß zwei Federwerke, auf jeder Seite eines. Läuft es noch? Mein Freund sagte, es funktioniere perfekt, er habe es aus der Vitrine geholt, um uns »eine Vorführung zu geben«. Es sei fast hundert Jahre alt, stamme aus französischer Produktion, er ziehe es gelegentlich auf, nicht zu sehr, denn er hüte es als eine der kostbarsten Perlen seiner Sammlung, aber er müsse es in Gang halten, damit es nicht einroste. Im Wesentlichen seien es zwei Mechanismen, die gleichzeitig ablaufen müssten, weshalb es zwei Federwerke besitze. Das eine für eine Spieldose, das andere für die Bewegung von Automaten. Ein Startknopf an der Vorderseite sicherte die Gleichzeitigkeit. Er drückte ihn und zog dann die beiden Federn auf. Dazu dienten zwei winzige bronzene Schmetterlinge, die er mit in langer Übung erworbener Geschicklichkeit drehte. Seine dicken, wulstigen Finger schienen für solche mechanischen Miniaturen ungeeignet, doch bediente er sie fehlerlos. Er besaß knotige, abgearbeitete Maurerhände, und einmal hatte er zu mir gesagt, würde er Verbrechen begehen, bräuchte er sich wegen der Experten von der Spurensicherung keine Sorgen machen, weil der Kontakt mit den