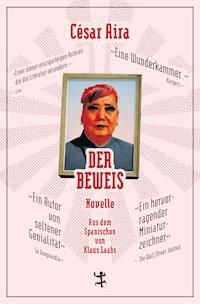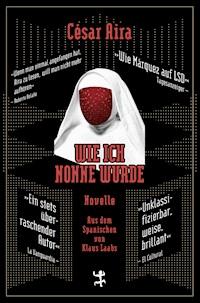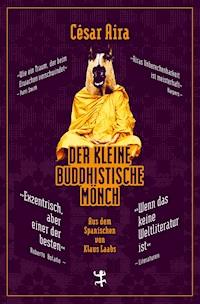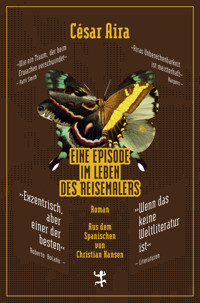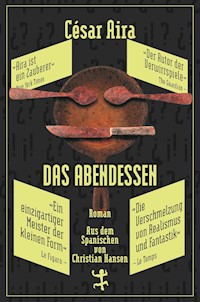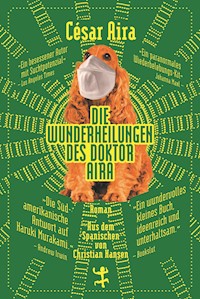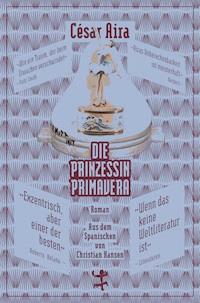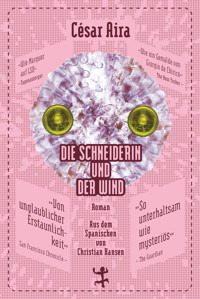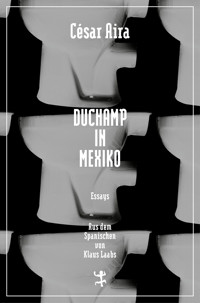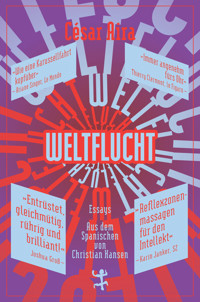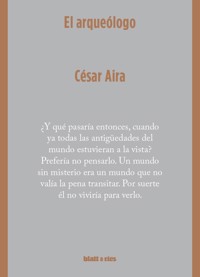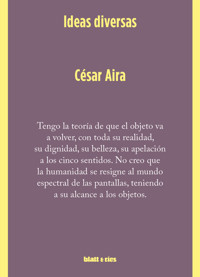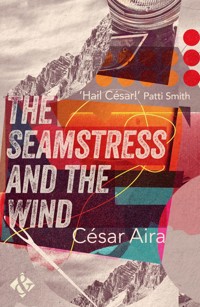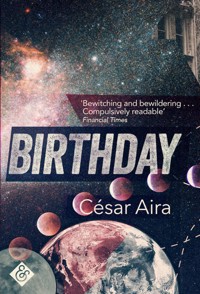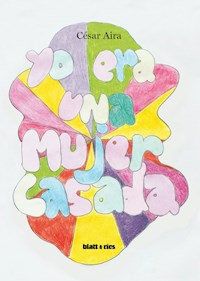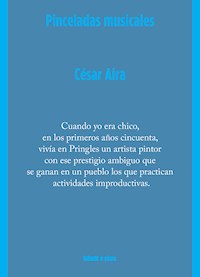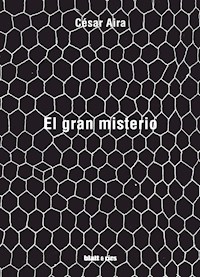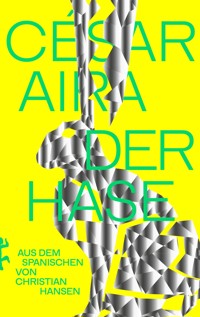
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach dem legibrerianischen Hasen, der scheinbar fliegen kann, reist der englische Naturforscher Clarke in den Süden Argentiniens. In Begleitung des jungen Aquarellmalers Carlos Alzaga Prior und des Gauchoführers Guana begegnet »der Engländer« einer Gruppe indigener Mapuche, die ihm schließlich bei seiner Mission helfen und ihn in ihre Lebensweise sowie Sprache einführen. Als Gegenleistung soll Clarke ihnen bei der Suche nach dem vermissten Stammesanführer helfen. Doch ist dieser wirklich entführt worden? Existiert ein hasenförmiger Diamant der Witwe Rondeau tatsächlich? Auch eine Reihe ungewöhnlicher Phänomene macht dem Naturforscher zu schaffen: menschengroße Enten, improvisierte Kehlenschlitzer, ein Betrunkener, der ihm über den Kopf fliegt, eine durch unterirdische Tunnel reitende Kriegerkolonne und sein Doppelgänger, der ihm um Mitternacht begegnet. Voll Witz, Ironie und mit dem bekannten Aira-Zauber reflektiert César Airas Großwerk subtil über die Liebe, den Kolonialismus des viktorianischen Zeitalters und die Realitäten, die die Sprache formt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Hase
César Aira
Der Hase
Aus dem Spanischen von Christian Hansen
Inhalt
Vorspann
DER LEGIBRERIANISCHE HASE
Impressum
Schweißgebadet, die Augen schreckgeweitet, sprang der Restaurator aus dem Bett, stand eine Weile schwankend auf den kalten Fliesen und flatterte mit den Armen wie eine Ente. Er war barfuß und im Nachthemd. Zwei weiße, sehr saubere Laken, von den Konvulsionen des Alptraums zerwühlt und verknäult, waren das einzige Bettzeug auf einer Pritsche aus Bronzerohr und Lederriemen, die ihrerseits das einzige Möbel in dem kleinen Siesta-Alkovens war. Er griff sich eines der Laken und wischte sich Gesicht und Hals damit trocken. Noch pochte ihm vom nachwirkenden Entsetzen das Herz bis zum Hals; die Nebel der Benommenheit aber begannen sich bereits zu lichten. Er tat einen Schritt, dann noch einen; setzte den ganzen Fuß auf den Boden, denn er gierte förmlich nach seiner festen Frische. Er trat ans Fenster, lupfte mit der Fingerspitze den Vorhang. Der Hof war menschenleer, Palmen, senkrecht stehende Sonne, Stille. Er kehrte zur Pritsche zurück, legte sich aber nicht hin; vielmehr setzte er sich nach kurzer Überlegung auf den Boden, die Beine ausgestreckt, der Rücken aufrecht. Die Kälte der Fliesen an seinem nackten Gesäß verursachte ihm einen wohligen Schock. Er zog die Beine an und begann mit einer Folge von Klappmessern. Dazu nahm er die Hände hinter den Kopf, weil sich dadurch die Anstrengung noch steigern ließ. Anfangs musste er sich ins Zeug legen, später lief es wie am Schnürchen, schnell und geschmeidig, der Schwerkraft zum Trotz, und gab ihm Zeit nachzudenken. Er machte hundert am Stück, zählte automatisch in Zehnerblöcken und hing derweil seinen Gedanken nach. Er rekonstruierte den Alptraum in all seinen Details, gleichsam als selbstauferlegte Strafe. Das Wohlgefühl körperlicher Aktivität löschte den Schrecken der Erinnerung. Oder löschte ihn nicht so sehr, als dass es ihn handlich machte, zu einer weiteren Zahl im Rahmen seiner gymnastischen Übungen. Die allgemeine Bedeutung dieser Gespenster, die ihn zur Stunde der Siesta heimsuchten, blieb ihm durchaus nicht verborgen. Es waren die Eins, die Zwei, die Drei, die Vier, die Fünf, die Sechs, die Sieben, die Acht, die Neun, die Zehn. Wie sehr irrten diese tintenklecksenden Wilden, wenn sie annahmen, es handle sich um die Schatten seiner Verbrechen, die auf sein Gewissen fielen. Das hieße ja, rückwärts zu zählen: Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Dabei verhielt es sich genau umgekehrt, und wenn seine Feinde sich so präzise irrten, dann weil die Opposition der Ort war, von dem aus man alles verkehrt herum sah; die Verbrechen, die er nicht begangen hatte, waren es, die ihn verfolgten, die Gewissensbisse, das Maß nicht vollgemacht zu haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Er war zu weich gewesen, hatte sich mit dem Üblichen zufriedengegeben. Sie sagten, er sei ein Monster, er dagegen bedauerte, irgendwo unterwegs die Gelegenheit verpasst zu haben, wirklich eines zu werden. Er bedauerte, nicht seine eigene Opposition zu sein, um sich, wie eine gut gemachte Stickerei, auf beiden Seiten zu verwirklichen. Eins, zwei, drei, vier … Es hatte ihm an Fantasie gefehlt, und ohne Fantasie konnte sich die Grausamkeit nicht voll entfalten. Fünf, sechs, sieben, acht … Die Träume waren das invertierte Bild der Anschuldigungen in Hieroglyphisch, die in jenen illustrierten Schmähschriften erschienen, früher in Der Schrei, später in Rosas Verrecke (was für kindische Namen). Verdrehte Welt. Eine Literatur war das. Das Rätsel der Träume fand seine Auflösung in der Traurigkeit über das vergangene Leben. Ihm fehlte das wahre erfinderische Genie, die poetische Gewandtheit. Neun … In seiner ein wenig barbarischen Unverblümtheit sich selbst gegenüber gestand er sich das ein und bedauerte es. Aber woher, woher bloß sollte er das Talent nehmen, die fantastische Negativität der Schreiberlinge von Montevideo in die Wirklichkeit, in das Leben, ins Argentinische zu verwandeln. Zehn, hundert …
Er genehmigte sich einen halben Liter Gin mit kaltem Wasser, während der andere eine Seite schrieb. Ein Gläschen pro Zeile, was nicht zu viel war. Jemand schreiben zu sehen faszinierte ihn. Er fand darin ein Schauspiel, das wie wenige sich selbst genügte, das dem Zuschauer nichts abverlangte. Sicher, er musste von seiner persönlichen Geduld etwas beisteuern, aber davon hatte er reichlich, so viel, dass er manchmal dachte, nichts könne ihren Rahmen sprengen. Der Zeitraum, in dem sich seine mündlichen Absichten in eine wohl formulierte und kalligrafierte Seite verwandelten, verging ihm wie im Flug. Darum war er so auf Sorgfalt bedacht. Es schien nichts zu passieren, aber er sah einen Brückenschlag zwischen Personen, nicht mehr und nicht weniger; in der dämmrigen Luft des Arbeitszimmers sah er den blassen Schemen eines Gespenstes. Gesten erzeugten immer eine Perspektive, erst recht, wenn sie jene des Schreibens waren. Die Bewegung von Arm, Hand, Pupille, Schreibfeder war eine prall gefüllte Absicht, wie eine Blase voll gespenstergeschwängerter Luft. Gespenster waren eine Person, die zu einer anderen wird. Er sah alles wie in feuchtem Glanz, als steckten die Dinge in einer Hülle aus sublimiertem Wasser. Das war eine Wirkung des Getränks in der flirrenden Hitze, aber auch Teil der Szene. Er behauptete, herausgefunden zu haben, dass gegen Hitze am besten Gin mit Wasser half; was er nicht sagte, war, dass ihm Hitze eigentlich nichts ausmachte. Doch die Illusion von Kälte zu erzeugen, als sehnlichen Wunsch, wenn Hitze herrschte, und umgekehrt, konnte wunderbar wirksam sein, um Äußerungen wirklich werden zu lassen; das erklärte, warum die Menschheit in prototypischer Gestalt der Engländer so leidenschaftlich über das Wetter sprach. Es war eine Welt in der Welt, aber nicht als Theater, sondern ernst genommen und geglaubt. Vielleicht bestand darin der Sinn der Drinks, die er sich mixte: das kalte Wasser für die Temperaturumkehr, der Gin für den Glanz, ohne den es keine Hüllen gab oder sie zumindest nicht zu sehen waren. Alles erschöpfte sich im Übergang von einem Zustand in einen anderen, von einem Körper in einen anderen, von einer Möglichkeit in eine andere. Und darin lag zuletzt auch die Erklärung dafür, warum er und sonst keiner der Restaurator und nichts anderes als der Restaurator war. Er war es, weil … Weil? Nein, es war ihm wieder entfallen, mit derselben blitzartigen Geschwindigkeit, mit der es ihm eingefallen war. Er zuckte die Schultern, im Geiste natürlich. Der Moment des Verstehens war verstrichen, ohne dass er es gemerkt hatte. Eine unbestimmte Zeit lang blieb er starr wie eine Mumie und dachte an nichts. Seine einzige Bewegung war, sich das Glas an die Lippen zu führen. Auf einmal reichte ihm der Sekretär das Blatt, ein Ausbund an Sorgfalt. Und mit der anderen Hand die Feder, damit er unterschriebe.
Hatte er sein Tagwerk verrichtet, das unendlich leicht war, wie nicht vorhanden, dann ging und setzte er sich unter das Laubdach, wo Manuelita ihm den Mate bereitete. Diese Stunde der Entspannung in intimer, familiärer Runde verwendete er darauf, nachzudenken. Paradoxerweise tat er das mit gänzlich leerem Kopf. Unmöglich, möchte man meinen, aber jemandem mit einer so hohen Meinung vom eigenen Verstand gelang das mühelos. Eine vielstimmige Menge Vögel sang, und drei oder vier Hunde liefen zwischen den sich vergnügenden Kindern hin und her. Ein Halbkreis aus Zitronenbäumen hinter ihm sorgte für saubere Luft; ein Korbweidenbaum direkt vor ihm, mit Zweigen, die unmittelbar aus dem Boden wuchsen, sah aus wie eine wildwüchsige Ikebana, die man dort platziert hatte, um ihm eine Freude zu machen. Die stark zertrampelte Erde unter den Weinranken war ihm zu Ehren leicht begossen worden. Manchmal, wenn er an nichts dachte, konnte es passieren, dass er sich für den einzigen Menschen auf Erden hielt, den einzigen wirklich lebendigen. Nicht ein Lüftchen regte sich, aber die Hitze war alles andere als erdrückend. Manuelita, hässlich und bleich, lief mit dem Mate in der Hand zwischen Küche und Sessel hin und her. Ihr geliebtes Papachen trank im Laufe solcher Sitzungen kaum ein halbes Dutzend Mates, weshalb es nicht lohnte, die Vorrichtungen dafür nach draußen zu verfrachten. Sie wartete im Stehen, während er mit schockierendem Geräusch am Röhrchen saugte. Rosas fand seine Lieblingstochter weder reizvoll noch intelligent; eher war er davon überzeugt, dass sie blöde war. Blöde und versnobt, das war Manuelita. Das Schlimmste aber war ihr unentschuldbarer Mangel an Natürlichkeit. Eine unansehnliche Marionette. »Sie ist eine meiner furchtbarsten Marotten«, pflegte er seinen Freunden zu gestehen. Er hatte an diesem Mädchen einen Narren gefressen, wusste aber nicht warum. Es herrschte eine Art Missverständnis zwischen ihnen, so weit sah er klar, aber auch nicht einen Millimeter weiter. Sie war fest davon überzeugt, dass ihr Papachen sie vergötterte. Er aber fragte sich, wie er sie hatte zeugen können. Zum Glück war eine Vaterschaft immer ungesichert. Die Mutterschaft dagegen so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn er Manuelita anschaute, fühlte sich Rosas als Frau, als Mutter. Seit Jahren spielte er mit dem Gedanken, sie mit Eusebio zu verheiraten, einem seiner Idioten. Das war sein geheimer Plan, skandalöses Vergnügen am Unmöglichen. Das Skandalöse daran war, dass das Unmögliche, wie jeder weiß, immer als Erstes Wirklichkeit wird. Als er daher eines Tages sah, dass die Wilden ihm in ihren Schmähschriften genau diesen Plan andichteten, kannte seine Verblüffung keine Grenzen. Ganz sicher hatte er davon kein Sterbenswörtchen verlauten lassen. Und sie schrieben nicht nur davon, sondern fertigten auch, wie es ihre eingefleischte Gewohnheit war, eine Zeichnung voller Spruchblasen an. Klar, dass die dreckigen Wilden wie jede Opposition nur im Rahmen einer Kombinatorik operieren konnten und gezwungen waren, das Puzzle aus nur wenigen Teilen zusammenzusetzen und auseinanderzunehmen, weshalb man sich nicht zu wundern brauchte, dass sie auf die Lösung Tochter – Idiot kamen. Aber dadurch wirkte die Sache, wie Rosas sie darstellte, nicht weniger verblüffend: War es möglich, sich in ein fremdes Missverständnis einzuschleichen? Man würde doch dem eigenen wie dem fremden bescheinigen, weder Türen noch Fenster zu haben. Die überspannteste Fantasie schuf durch die beiden Extreme, Übermaß und Mangel, das für das tägliche Leben konstitutive Missverständnis. Obwohl es durchaus sein konnte, dass die Unitarier durch die von ihnen heiß verehrte Allegorie darauf gekommen waren: Der Restaurator »vermehlt« unsere manuelitische Mama Patria mit einem verblasenen, als Mehlsack getarnten Windbeutel. Hier brachte Rosas, auf dessen Rechtschreibkünste nicht viel Verlass war, etwas durcheinander; aber das hatte nicht die geringste Bedeutung, denn was für sie allegorisch war, war für ihn real, womit das Missverständnis zur Konstellation, zum Universum, zum Gesetz der Schwerkraft erhoben wurde. Tatsächlich war ihm die fragliche Idee an dem Tag gekommen, als Eusebio wegen seiner Exzesse als Einbläser, denunziatorischer Blasebalg oder Pustekuchen an der Schwelle des Todes stand. Sie in articulo mortis zu verheiraten, wäre ideal gewesen, weil man sich die praktischen Konsequenzen erspart hätte, der ganze symbolische Wert dagegen erhalten geblieben wäre. Schon bevor es so weit war, trug Manuelita ein Witwengesicht zur Schau. »Mein Wittiblein …«, sagte der Restaurator manchmal in seinen Tagträumereien, und die ihn hörten, vermochten nicht zu sagen, ob er sich auf Manuelita, die Heroine, auf die Frau im Allgemeinen, auf Eusebio, auf die Mama Patria oder auf sich selbst bezog.
Die beiden letzten Audienzen des Tages wurden einer betagten Schwarzen und einem Engländer gewährt. Die Schwarze kam wegen einer Lappalie, einer lächerlichen persönlichen Tragödie, aber Rosas hatte es sich zur Regel gemacht, seine geliebten Dunkelhäutigen immer zu empfangen und ihnen den Salomon zu spielen, eine Einstellung, die sie mit an Verehrung grenzender Dankbarkeit quittierten. Er hatte die Theorie, Argentinien werde mittelfristig ein Land von Schwarzen sein. Was er vielleicht noch erleben würde, wenn er lang genug überlebte. Einstweilen machte er sich die Mühe, sie oben auf die politische Agenda zu setzen, als bevorzugte Objekte von Gesetz und Gerechtigkeit. Es kostete ihn wenig, und in gewisser Weise verehrte auch er die Schicksalhaftigkeit von Elend und Dummheit, die aus der schwarzen Nation eine gesellschaftliche Fiktion machte. Die Schwarze des Tages erschien mit ihren beiden ältesten Töchtern. Sie war ein scheußliches Exemplar, vermutlich kaum älter als vierzig, aber mit dem Aussehen einer Sechzigjährigen, einer reichlich verlebten. Sie läutete ihre Ausführungen mit einem schrecklichen Geheul und Geschrei ein. Die Anhörung fand in der großen Besuchergalerie des Hauses statt, die um diese Zeit im Schatten lag. Unter den sadistischen Schaulustigen, die sich an der Szene ergötzten, tat sich, Mitleid heuchelnd, Manuelita mit ihren knallroten Bändern und Schleifchen hervor. Sie war eine grauenvolle Schauspielerin, die Ärmste. Ihr Mangel an Natürlichkeit! Der Restaurator in seinem Sesselchen aus Palo-Santo-Holz lauschte mit versteinerter Miene und fraternisierte derweil mit seinem Ginglas. Die Sache war aussichtslos, von welcher Seite man sie auch betrachtete: Der Ehemann des Klageweibs war nach dreißig Ehejahren zu einer anderen gezogen. Es gab absolut keine Lösung. Der verheulten Rede der Schwarzen war zu entnehmen, der Besagte hätte, nachdem er seinen voll- und minderjährigen Töchtern, den anwesenden wie den abwesenden, inzestuös beigewohnt habe, nichts mehr gefunden, was ihm die Ehe in sexueller Hinsicht noch hätte bieten können. Das war für jeden verständlich. Von da an aber verfing sich die Argumentation der Verlassenen in purer Quengelei. Der Mann mit der Marmormaske fand, dass die Quengelei, wenn sie ihren absoluten, also statischen Zustand erreicht hatte, eine gute Gelegenheit zum Nachdenken war. Die Argumente treten auf der Stelle, und es scheint, als würden sie ewig darin verharren. Was wollte sie, das er tat? Ihn kastrieren lassen? Das war sehr einfach, war zu einfach. Aber sie selbst musste doch wissen, dass das zu nichts führte. Manuelita vergoss Krokodilstränen, die Töchter der Schwarzen studierten seinen Abendrock in der Absicht, den Schnitt zu kopieren, während die Frau Mamá ihre Augen auf den Salomon von Palermo* geheftet hielt, der gerade auf einer Gedankenschleife über den Verfall des weiblichen Körpers entlangtrabte. Dieser Reflexionsparcours (der sich in die Frage übersetzen ließe: Was hat eine Frau zu bieten, die über das Naheliegendste nicht mehr verfügt?) führte ihn auf unverhofftes Terrain, und plötzlich kam ihm eine Idee, wurde ihm sonnenklar, wie die Alte ihren Mann behalten könnte. Eine unfehlbare Methode, einwandfrei, kinderleicht anzuwenden und mit totaler Erfolgsgarantie. Seltsam, dass ihr das nicht selbst eingefallen war, aber dann hätte es allen Frauen einfallen können müssen, ihre Rivalin eingeschlossen, was die Wirksamkeit der Methode zunichtegemacht hätte. Ihm aber war sie eingefallen, ausgerechnet ihm, der er niemals einen Mann in seinem Bett würde festhalten müssen. Noch seltsamer war, dass er sie ihr nicht verriet, der Betroffenen die Lösung nicht mitteilen konnte, sondern sie für sich behalten musste. Nicht weil er die Lächerlichkeit fürchtete (darüber war er erhaben), sondern weil es ein Schweigegebot logischer Art gab, das wie immer ausgerechnet da zur Anwendung kam, wo das Wort zu etwas nutze gewesen wäre. Er schaute die Schwarze an, die ihn zurückanschaute … Die Sache steckte fest, woraufhin sie sich, nachdem sie eine Konzession für ihre Geschäfte im Schlachthof erhalten hatte, einigermaßen beruhigt zurückzog. Das war mehr als ausreichend, damit sie zufrieden die Segel streichen durfte. Und der Ehemann? Den gab sie verloren. Zu diesem Thema hatten sie nichts vereinbart. Oder doch? Er fragte sich, ob sie wohl seine Gedanken gelesen hatte.
Was den Engländer betraf, so erschien er zur angenehmsten Nachmittagsstunde, begleitet vom Konsul seines Landes, der hier gleichsam zu Hause war. Auch sie wurden in der Galerie empfangen, die jetzt frei von Schaulustigen und um zwei zusätzliche Stühle ergänzt war. Der Gast aus England wirkte wie fünfunddreißig, hatte sehr dunkle Haut und tiefschwarzes Haar. Sehr englisch sah er nicht aus, aber dass es solche Engländer gab, die wie Indios aussahen, war Rosas schon aufgefallen, sie waren geradezu prototypisch, wogegen er seinerseits wie ein Engländer der anderen Sorte aussah, blond und rötlich. Anfangs fand er ihn hässlich, obschon er den Vorteil besaß, klein wie ein Orientale zu sein. Und wenn er sprach, in seinem gut verständlichen Kastilisch, in einer ernst reservierten, stilvollen Art, machte ihn das fast attraktiv. Sie wechselten ein paar Belanglosigkeiten. Clarke, so der Name des Engländers, war mit Darwin verschwägert, von dem er Grüße für den Restaurator überbrachte. Es folgte Floskelhaftes über Wetter, Reisen, dies und jenes. Wichtig in diesem Moment war, die Atmosphäre des Ortes und der abendlichen Stunde einzufangen, den häuslich-moralischen Zusammenhang, der Rosas zufolge einen starken politischen Eindruck entfalten konnte. Zu dieser Tageszeit war der höfische Zirkel komplett und drehte sich in gewisser Entfernung um die Albernheiten Manuelitas. Für Manuelita teilte sich die ganze ehrbare Menschheit in »Cousinchen« und »Herren der Schöpfung«; das war ihr nicht abzugewöhnen. Der Engländer bekundete seine Absicht, eine Reise ins Landesinnere anzutreten, sobald alle Vorbereitungen getroffen wären. Ein Hinweis fast von der Sorte, deren Erwähnung überflüssig ist, weshalb kaum mehr Worte gewechselt wurden. Jede Seite wähnte sich über das im Bilde, was sie von der anderen hätte erfahren können. Rosas Polizei hatte tags zuvor bestätigt gefunden, dass Clarke der war, der er zu sein vorgab, dass der Clipper, von dem er an Land gegangen war, aus Valparaíso kam und dass die Maske des Naturforschers und Geografen im Dienst imperialer Interessen nichts verbarg, was erwähnenswert gewesen wäre. Natürlich wäre es interessanter gewesen, es hätte etwas gegeben, und darum gab es auch bestimmt etwas. Die Polizei war auch nur ein Mensch, wenn auch im Plural. Rosas bedauerte, dass die gute Erziehung es verbot, die Leute direkt zu fragen, was sie im Schilde führten. Eine andere Art von Höflichkeit, dachte er, wäre vonnöten.
»Mein Freund«, sagte er, als tauche er aus dem Halbschlaf auf, »ich werde Ihnen ein paar Pirouetten zeigen, die ich mit dem Pferd veranstalte, und Sie werden mir sagen, ob die Reitkunst in Großbritannien ähnlich weit fortgeschritten ist.«
Der Engländer nickte und machte sich auf eine Darbietung gefasst. Eusebios Gesicht, das plötzlich vor ihm auftauchte, ließ ihn zusammenzucken. Es gehörte einem Homunculus von einem Meter Größe, dessen Kopf allein schon gut vierzig Zentimeter maß. Er war auf einen Pfiff des Restaurators herbeigeeilt, den dieser, unhörbar für andere Ohren, zwischen seinen Suaden oder Pausen ausgestoßen hatte. Dieser Eusebio musste wache Antennen haben für das, was ihn anging, nicht umsonst war er ein Monster. Man musste ihm auch den Namen des Pferdes nicht wiederholen, das sein Herr ihm zu holen befahl: Repetido.
Es folgte daraufhin ein Schauspiel, das der Restaurator seinen europäischen Besuchern selten gewährte. Repetido war ein geschecktes Pferdchen unbestimmten Typs, weder Araber noch Kreole, schlank, mit Beinen wie bei einer Katze aus Draht, geradem Rücken und winzigem, ausdruckslosem Kopf. Die Engländer drehten ihre Stühle der weiten Esplanade zu, die als Reitplatz diente, die Höflinge unterbrachen andächtig ihr Tuscheln. Mit dümmlichem Grinsen im Mundwinkel richtete Manuelita ihre feuerroten Zöpfchen; sie war überzeugt, dass in der High Society solche Darbietungen üblich waren. Der allerhöchste Reiter, der oberste Zentaur der Konföderation, trabte ein paar Runden, um den Gaul auf Betriebstemperatur zu bringen; in dieser Hinsicht brauchte es nicht viel; ein wenig Tänzelei, ein paar Hüpfer, und schon flitzte Repetido durch die Gegend wie der geölte Blitz. Rosas hatte ein schlankes, schmales Hinterteil; nie schien er vollends im Sattel zu sitzen. Es wirkte sehr natürlich, wie er die Beine nach hinten anhob, bis sie sich an den Knöcheln über der Kruppe kreuzten. Ohne die Sitzposition zu verändern, erhöhte er die Geschwindigkeit, und beim nächsten Vorbeiritt streckte er die Füße in die Luft, steckte den Kopf zwischen die Arme, die sich auf dem Sattel abstützten, bis er aussah wie einer, der von einem Gebäude fiel. Erster Applaus ertönte. Beim dritten Passieren der Besuchergalerie hatten sich die Füße bis zu den Ohren des Pferdes vorgebogen; bei der vierten Passage befand sich sein ganzer Körper in der Horizontalen. Dann tauchte er einmal unter dem Bauch des Pferdes durch, stand mit beiden Füßen im Sattel, auf einem Bein, auf den Knien, auf den Knien mit dem Kopf nach hinten und den Zügeln zwischen den Füßen, dann Zügel zwischen den Zähnen, während seine Handflächen und die Sohlen seiner Stiefel sich berührten. Er vollführte seine Kapriolen mit virtuoser Langsamkeit auf jener Windeseile namens Repetido, aber sie gewannen immer mehr an Fahrt, ohne dass das Pferd seinen Schritt verlangsamte, bis alles unter tosendem Applaus in einer Reihe fulminanter, direkter und invertierter Spiralen kulminierte. Die Darbietung bestand aus zwei Arten von Übungen: einfache, die Aufsehen erregten, und schwierige, die weniger hermachten. Man konnte mit den einen wie mit den anderen punkten, mit jeweils minimalem Aufwand, je nachdem, ob die Zuschauer Kenner der Materie waren oder nicht. Da Rosas das nicht vorhersehen konnte, seine Zuschauer außerdem sehr unterschiedlich waren, hatte er ein System entwickelt, beide Arten zu kombinieren, indem er aus der schwierigen Sorte einfache Übungen machte und umgekehrt.
Clark und der Konsul kehrten auf ihren Pferden nach Buenos Aires zurück, trabten den Weg durch die Niederung entlang und vertrieben sich nach Art der Engländer die Zeit mit Small Talk; dank der Stille in dieser wilden Einöde brauchten sie nicht einmal die Stimme zu heben, selbst wenn sich ihre Reittiere, wo sie durch Gräben getrennt wurden, einmal voneinander entfernten. Sie sahen einen aufgescheuchten Tschaja oder Halsband-Wehrvogel, der sich im Davonflattern schier überschlug, als übte er sich in selbstverliebter Akrobatik. Beide mussten gleichermaßen an den Restaurator denken. Ein paar fette Tauben bogen die Äste Peruanischer Pfefferbäume, auf denen sie hockten, fast bis zum Boden. Sie steckten wohl für die Nacht die Köpfe unter die Flügel. Der gelbbraune Fluss zur Linken der Reiter lag reglos da wie ein See; nur gegen das flache Ende seines grünlichen Ufers ließ er die Wasserränder plätschern, und das zu sehen, musste man schon genau hinsehen. Der Konsul, der die Landschaft zur Genüge kannte, beachtete sie nicht weiter, um lieber über politische Dinge nachzudenken. Dadurch kümmerte er sich nicht länger um seinen Gast, aber das störte ihn wenig. Er gehörte zu jenen Diplomaten alter Schule, die nicht der Ansicht waren, dass es zu den Aufgaben eines Konsuls gehöre, für seine Landsleute den Touristenführer zu spielen. Er beschränkte seine Höflichkeit ihnen gegenüber auf ein Minimum, das er in diesem Fall mit dem Besuch bei der größten Attraktion des Landes, dem Diktator, schon überschritten sah. Und noch zwei Dinge: Erstens konnte Clarke, wenn es stimmte, dass er mit der Absicht gekommen war, das Landesinnere zu bereisen, in Buenos Aires allein zurechtkommen. Zweitens musste er viel über Politik nachdenken, und die vierundzwanzig Stunden eines Tages reichten ihm bei weitem nicht. Folglich schaltete er vollständig ab. Der andere ließ sein Pferd vorlaufen. Mehr als das Land betrachtete er den Himmel, an dem sich eine violette Lavur ausgebreitet hatte, über der wiederum Hellblau- und Rosatöne dräuten. Die Hitze war erstickend, die Luft von Feuchtigkeit gesättigt. Das Zirpen der Insekten schwirrte in der Stille … Als der Konsul den Blick hob, irritierte ihn Clarkes Haltung. Er hatte die Zügel fahren lassen, um auf Höhe des Bauchnabels irgendetwas mit den Händen zu machen. Was, das konnte er von hinten nicht sehen. Er trieb sein Pferd an und lenkte es gleichzeitig zur Seite, um sich Gewissheit zu verschaffen, ohne gleich indiskret zu erscheinen. Clarke war indes so versunken, dass er nichts mitbekam. Mit der Linken hielt er ein metallenes Kästchen auf, mit der Rechten machte er sich darin zu schaffen. Der Konsul erkannte in dem Gegenstand einen Chromatografen. Dieser bestand aus einigen in Reihen angeordneten winzigen Metallringen von unterschiedlicher Farbe, in die Clarke mit einem Geschick, das eine lange Übung verriet, Nadeln stach. Der Konsul näherte sich nicht weiter. Die Beschäftigung erschien ihm nicht nur nutzlos, sondern auch zwielichtig: als würde jemand kleine Spießchen in die weichen Farben der Dämmerung stoßen.
Ein paar Tage waren vergangen und die Zurüstungen für die Reise ins Landesinnere abgeschlossen, als der Naturforscher eine erneute Exkursion in der gleichen Richtung unternahm, um einiges weiter allerdings, zu einer Ortschaft im Norden der Stadt, wo ganz zurückgezogen ein guter Maler lebte. Diesmal ritt er allein. Er brach früh am Morgen auf, machte um elf, auf halbem Weg, eine Art Einpersonenpicknick, schlief eine Siesta am Flussufer unter einer Weide und ritt ohne Eile im Schneckentempo weiter. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit fiel es ihm immer schwerer, das Pferd zu lenken: Er wusste nicht, ob er noch vorankam oder schon stillstand. Er wollte besagten Maler wach antreffen und wusste, dass er sich, was die Siestazeiten betraf, allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz in diesem tropischen Klima regelmäßig verkalkulierte. Es gab keinen ausgeschilderten Weg, und niemand kam hier entlang. Einem Karren begegnete er doch, der von einem grün gekleideten Schwarzen gelenkt wurde, grün wie das Gefieder eines Papageis. Vorneweg lief ein Junge von vier oder fünf Jahren und verscheuchte die Tauben, die sich auf die Spur setzten, auf der sich das Gefährt Millimeter um Millimeter vorwärts bewegte. Das Gespann war spektakulär: ein Zwillingspaar Ochsen, weiß und so schlecht kastriert, dass sie sich mit der Zeit (sie waren hundertjährig) äußerlich zu japanischen Stieren deformiert hatten, mit runzligen Schnauzen und einem so faltigen Rückenfell, dass es schien, als steckten sie in Marmortuniken wie die Statuen von Bernini in Rom. Es wurde sehr höflich gegrüßt, als man aneinander vorbeikam. Dabei war es Clarke so vorgekommen, als trüge der Schwarze eine Brille, aber nachher war er sich nicht mehr sicher, ob er richtig gesehen hatte. Ein bisschen weiter vorn, wo die Küste jählings abfiel, erspähte er eine Versammlung kleiner Tierchen, die er aus der Entfernung für Krebse hielt, die in Wirklichkeit aber sonnenbadende Ameisenigel waren. Es geschah etwas Eigenartiges. Die Ameisenigel, sonst die Scheu in Person, sahen ihn im selben Moment, in dem er sie sah; aber sie reagierten nicht alle auf einmal, sondern einer nach dem anderen, wenn auch in rascher Folge, die ihm Gelegenheit gab, die Flucht jedes einzelnen Exemplars genau zu verfolgen. Es war kein wirkliches Fliehen; wenn sie sich fortbewegen wollen, sind Ameisenigel extrem langsam, aber wenn sie sich erschrecken, verschwinden sie, man weiß nicht wie. Der, den Clarke beobachtete, rollte sich zu einer Kugel zusammen, und da Ameisenigel zu diesem Zweck ihre Stacheln einziehen, rollten er und seine Kollegen unweigerlich den Abhang hinunter und versanken im Wasser. So lange, bis keiner mehr übrig war, schneller, als der Engländer blinzeln konnte.
Prilidianos Siesta fiel an diesem Nachmittag kürzer aus als gewöhnlich, entbehrte aber nicht der Phantasmagorien, was nicht ungewöhnlich war, sondern nur allzu gewöhnlich. Er war die Gewohnheit in Person, wie Kinder. Und dieser Mann, der für die argentinische Geschichte seines Jahrhunderts eine solche Bedeutung besaß, hatte viel von einem Kind: dicklich, hitzköpfig, unbeherrscht, furchtsam, dabei ein Sklave seiner Leidenschaften, häusliche Zielscheibe der verrücktesten Fantasien. Er hatte eine Horrorkomödie erfunden, die innerhalb der Mauern seiner Villa oben in der Ortschaft San Isidro andauernd zur Aufführung kam; aber immer nur solange die Sonne schien, denn in den Stunden, da sie unterm Horizont verharrte, schlief er tief und traumlos. Er war unverheiratet, ohne direkte Angehörige, und hatte seine Dienerschaft durch das Vertrauen verloren, das er Facunda López geschenkt hatte, seiner Köchin und mittlerweile auch Haushälterin, Zimmermädchen, Gärtnerin und sogar Pferdemagd. Facunda hatte alle diese Aufgaben übernommen; sie war eine übergewichtige Mittvierzigerin, die sich keine Liebeskünste anzueignen brauchte, um ihren Dienstherrn um den Finger zu wickeln; das hatte sie längst, und zwar lebenslänglich. In ihren Selbstgesprächen, aber manchmal auch laut, nannte sie ihn »El Repetido«, weil er immer auf exakt dieselbe Weise mit ihr Liebe machte, und so tagein, tagaus, dabei unersättlich wie ein Kind. Wie immer, wenn die Siesta sich ihrem Ende zuneigte, tauchte sie beim ihm auf, betrachtete ihn, der sich wie immer schlafend stellte, und stürzte sich dann ins wie immer gleiche Techtelmechtel. Seit ein paar Monaten arbeitete Prilidiano zu seinem eigenen Vergnügen an einem Bild, das erste, das er so malte, ohne dass ein Auftrag im Spiel war. Für sich, nicht für den Verkauf. Das hatte ihn schon ein wenig verunsichert. Anfangs hatte er seine Zweifel, ob aus Gratisarbeit Kunst entstehen konnte. Mit seinem System, das von einer enervierenden Weitschweifigkeit war, sah er nach und nach ein Bild entstehen, und es war wie jedes andere. Vielleicht letzten Endes dann doch Kunst. Er ging bei diesem Werk besonders langsam vor, denn er malte es in seiner freien Zeit. Ursprünglich hatte er die Idee, Facunda während ihrer Siesta nackt zu malen. Natürlich würde das Gemälde immer sein Geheimnis sein und bleiben. Aber um nicht das kleinste Krümelchen Geheimnis zu vergeuden, mit dem man noch mehr als mit der Leinwand haushalten musste, wollte er Facunda ein zweites Mal malen, im selben Bett, neben der ersten Gestalt. Unüberlegt, wie er war, fiel ihm nicht ein, dass er auf diese Weise zwei Frauen darstellte und nicht eine zweimal. Als er es merkte, war es zu spät. Das machte ihn starr vor Staunen. Er war ein Genie, aber dann passierten ihm solche Sachen. Zumindest hatte er die Lektion gelernt. Und da er wirklich El Repetido war, wurde er nicht müde, sie mit jeder Siesta erneut zu lernen.
Besuche im Landhaus waren nicht häufig, aber auch nicht allzu selten. Als am Nachmittag der Engländer eintraf, hatte die Schläfrigkeit seine beiden Bewohner noch fest im Griff. Facunda kam heraus, um ihm sein Pferd abzunehmen. Sie fragte, wer er sei und was er wolle. Nachdem er ihr das beantwortet hatte, fand Clarke es impertinent, dass sie weiterbohrte, ob er denn wirklich den Maler sehen wolle. Natürlich wollte er. Ihn sehen oder sich von ihm malen lassen? In letzterem Fall müsse er sich in Geduld fassen. Er habe sich den langsamsten Künstler der Welt ausgesucht. Genervt von ihren unangebrachten und im Übrigen reichlich plebejischen Hinweisen, begab er sich ins Wohnzimmer, ohne abzuwarten, dass die Frau ihn dazu aufforderte, und nahm Platz. Im nächsten Moment erschien der Künstler. Clarke dachte, es handle sich um den Sohn, aber nein, er war es selbst. So hatte er ihn sich nicht vorgestellt: Ein molliger Junge mit sehr dunklem Teint, weit fortgeschrittener Glatze, obwohl ihn niemand auf älter als fünfundzwanzig geschätzt hätte, dazu wirren, asymmetrischen, asiatisch wirkenden Augen. Er besaß keine Manieren, dafür hatte der Engländer deren genug für zwei. Er erwähnte eine Tante des Hausherrn, die ihm seine Adresse gegeben habe, und ging dann zu einer diskreten Huldigung seiner Arbeit über. Es war das erste Mal, dass Prilidiano etwas Derartiges wie Kritik vernahm. Mit entwaffnender Naivität gab er ihm in allem Recht. Facunda, die sich für immer aus dem Staub gemacht zu haben schien, tauchte mit einer Flasche eiskaltem Rosé und zwei Gläsern wieder auf. Im Handumdrehen hatten sie die halbe Flasche geleert. Nachdem der junge Mann Vertrauen gefasst hatte, verriet er, dass er demnächst nach Europa zu reisen gedächte, um sich den letzten Schliff zu holen. Clarke riet vehement davon ab. Er habe hier alles, was er zu seiner Weiterentwicklung brauche. Die europäische Künstlerszene sei erschöpft, die Maler der Alten Welt würden schon bald in der Neuen Zuflucht suchen. Und die Technik?, wandte der andere ein. Besitze er zur Genüge. Und die alten Meister? Die würden, entgegnete der Engländer, eigentlich gewaltig überschätzt. So ging das eine Weile hin und her. Prilidiano bedauerte, keine Gemälde von sich im Haus zu haben, um sie dem Kunstliebhaber zu zeigen. Eines hatte er doch, das der beiden Facundas, aber das war unvollendet und nicht vorzeigbar. Doch ermunterte er ihn, sich einige kleinere Werke anzusehen, die die Wände des Wohnzimmers schmückten. Höflich stand Clarke auf. Es waren aus Wolle und Espartogras gewebte Bilder, die Manuelita Rosas angefertigt und ihnen geschenkt hatte. Er besah sie sich und wusste nicht, was er sagen sollte. Dieser Schund verschlug ihm die Sprache. Er hatte während der letzten Tage in verschiedenen Salons von Buenos Aires ein halbes Dutzend von Prilidiano signierte Porträts gesehen. Und er fand, dass er besser war als Reynolds und Gainsborough zusammen, ein wahres Genie, und nicht so sehr aufgrund der psychologischphantasmatisch treffsicheren Darstellung der Porträtierten, die erhaben war, sondern wegen der von ihm erzielten Oberfläche. Darin konnte ihm niemand das Wasser reichen. Sein Merkmal war eine in ultimative Sichtbarkeit überführte visuelle Reinheit, eine bestimmte Art, die Oberfläche auf die Oberfläche zu übertragen und mit ihr zur Deckung zu bringen, Malerei genau dort zu erschaffen, wo man sie ohne es zu wissen immer schon erwartet hatte. Dieser Triumph lag jenseits der trügerischen Dialektik von Naivität und Weisheit. Manuelitas lächerliche wollene Fleißarbeiten führten das genaue Gegenteil vor. War es Sarkasmus, dass das Genie sie sich ins Wohnzimmer gehängt und sie ihm gezeigt hatte? In diesem Moment war das für ihn nicht zu entscheiden.
Nachdem das Thema Malerei erledigt war, nahmen sie wieder Platz und sprachen über die Pläne des Besuchers. Er sei ein Naturforscher und beabsichtige, ins Innere der Provinz zu reisen, um gewisse Tierarten zu beschreiben, insbesondere eine, an der gewisse wissenschaftliche Gesellschaften in Europa großes Interesse zeigten.
»Nun«, sagte Prilidiano leichthin, »ich nehme an, wenn Sie einen guten Balsamierer dabeihaben, können Sie sich ein paar hübsche Exemplare von dort mitbringen.«
Nein. Das war nicht die Absicht des Engländers, ganz und gar nicht. An Einbalsamieren, sagte er, habe er zuallerletzt gedacht habe. Er arbeite nicht mit Blick auf die Sammlung, eher im umgekehrten Sinne. Er erklärte ihm in groben Zügen, dass es eine neue Theorie gebe, wonach einige Tiere von anderen abstammten, weshalb es nicht lohnte, sie in einer bestimmten Form zu fixieren. Und es kam nicht einmal infrage, sie zu transportieren, weil eine andere, komplementäre Theorie besagte, dass in alten Zeiten die Kontinente miteinander verbunden waren … Im Kopf des Malers entstand totale Verwirrung. So als würde der andere mit ihm Chinesisch sprechen. Er wechselte lieber das Thema, zumal ihm ein Einwand eingefallen war:
»Dann gehen Sie also … in die Wildnis?«
»Ja.«
»Aber sind da nicht die Indianer?«
»Ich denke schon.«
»Aber lieber Freund, die bringen sie um, sobald sie Sie sehen!«
»Ich hoffe, ich habe Gelegenheit, meine Vorsichtsnahmen zu treffen.«
Prilidiano insistierte nicht, denn seine unsteten Gedanken waren zum vorigen Thema zurückgekehrt. Dass Tiere von anderen Tieren abstammen sollten, so absurd das klang, hatte ihn auf eine Idee gebracht, die vielleicht das Dilemma seines Bildes der schlafenden Facundas lösen konnte, was zumindest bewies, dass einige Ideen von anderen abstammten. Aber auch damit hielt er sich nicht auf (über alle seine Einfälle nachzudenken, verschob er auf später). Unerheblich, ob die Indianer einen Reisenden umbrachten; letztlich war es ein Zufall wie jeder andere. Die Frage musste allgemeiner gefasst werden. Wie konnte man reisen und glücklich sein? War das nicht ein Widerspruch? Er schob die Studienreise nach Europa seit Jahren vor sich her, weil er sich ein Leben, das nicht bis ins Detail sein jetziges war, nicht vorstellen konnte. Er maß dem Glück eine zu große Bedeutung bei und zugleich wiederum nicht so viel, um es suchen zu gehen. Die Malerei und die Liebe waren überall oder nirgends. In einer blitzhaften Ahnung, die ihm durch den kindischen, launenhaften Kopf schoss, gelangte er bis auf den Grund des Darwinismus und drehte ihn komplett um. Jede Verwandlung war eine Hundertachtziggradwende. Die Ewigkeit als solche war eine Verwandlung, war die Gegenwart, die Figur des Glücks, und alle diese Worte ließen sich gegeneinander austauschen.
»Ich würde Sie gern begleiten«, sagte er mit herrlicher Zusammenhanglosigkeit, »aber ich kann nicht. Ich habe zu viel zu tun!«
Bevor er in die Wildnis aufbrach, machte Clarke einen zweiten und letzten Besuch bei Rosas in Palermo, um sich vom Restaurator zu verabschieden und dafür zu bedanken, dass er ihn mit einem Führer oder »Ortskundigen«, dem Gaucho Gauna oder Guana, ausgestattet hatte. Er tat das an einem Samstag zur epiphanischen Nachmittagsstunde. Nach den üblicherweise fälligen Huldigungen an Manuelita zogen sie sich zum Gespräch in das Büro des Hierarchen zurück. Wie immer zeigte Rosas sich locker und barbarisch, hochrot wegen des vielen Weins, den er bei einem gewaltigen Asado mit Gouverneuren getrunken hatte. Er hatte sich über sämtliche Bewegungen des Engländers ins Bild setzen lassen. Das war der Vorteil, wenn man eine Geheimpolizei besaß, obwohl es für niemanden ein Geheimnis war, dass er sie besaß: Einer wusste alles über die anderen, und die anderen wussten alles über einen, denn um über eine Polizei zu verfügen, musste einer zunächst eine Person des öffentlichen Lebens sein. Daher berührten sie keine praktischen Themen, was redundant gewesen wäre. Sie sprachen über Sprachen. Clarkes Spanisch war bemerkenswert gut für einen Ausländer, was er bescheiden einem angeborenen Sinn für Sprache zuschrieb. Rosas wähnte sich mit demselben Sinn begabt, und zwar im höchsten Maße. Er hatte ihn nie praktisch erprobt und brauchte es nicht zu tun, denn seine Gewissheit, ihn zu besitzen, bedurfte keiner Überprüfung. Eine solche Begabung, sagte er, würde er statt auf konventionelle Sprachen wie Englisch oder Französisch gern auf etwas wirklich Schwieriges verwenden, zum Beispiel auf das Bable der Schwarzen. Irgendwann würde er mit dem Studium beginnen und eine Grammatik des kreolischen Bantu schreiben. Der Engländer nickte.
»Und glauben Sie nur nicht«, sagte Rosas, »dass ich's tun würde, weil ich mir die Langeweile vertreiben muss, an Beschäftigung fehlt es mir nicht. Und damit meine ich nicht nur die Politik. Ich habe eine Unmenge häuslicher Probleme! Schauen Sie sich bloß den da an …« Ein Junge, eines seiner unzähligen unehelichen Kinder, hatte sich ins Arbeitszimmer geschlichen und sah ihnen von einem Sessel aus zu. »In letzter Zeit versteift er sich darauf zu schielen, und ich hab Angst, dass er Luftzug bekommt und die Augen so bleiben. Dass die Furcht physiologisch unsinnig ist, weiß ich selbst, aber ich kann es nicht vermeiden, ein Atavismus. Er könnte ja von dieser hässlichen Gewohnheit lassen, aber weil er weiß, dass es mich beeindruckt, ist er ganz versessen darauf.« Der Junge, hübsch und stumm, schaute von einem zum anderen, mit geradezu perfekter Augenstellung; vielleicht wusste er nicht einmal, wie man schielte. »Obwohl ich zugeben muss, dass ich es in seinem Alter auch nicht lassen konnte zu schielen. Aber ich bin keiner von den Vätern, die sich damit abfinden zu sagen: ›Ich war auch mal sieben.‹«
Clarke nickte bloß. Er dachte, dass dieser Rosas ein Genie war. Vielleicht nicht für Sprachen, auf jeden Fall aber für Small Talk. Die ganze Abschweifung war eine Falle, um herauszufinden, wie gut er über indianische Gemeinschaften Bescheid wusste. Aber Clarke hielt sich nicht für dumm. Natürlich kannte er die Bedeutung des Schielens unter Indianern. Damit nicht genug, war er einer der wenigen Europäer seiner Zeit, die es in einer amerikanischen Sprache hätten erklären können. Aber das würde er Rosas nicht auf die Nase binden, nicht einmal, um eine Lücke in der Unterhaltung zu füllen.
»Dann«, sagte Rosas, »hoffen Sie also, auf ein Geheimnis zu stoßen?«
Clarke erwiderte, das sei am Ende nicht die passende Formulierung. Der Legibrerianische Hase, von dem er ihm erzählt habe und der den hauptsächlichen, um nicht zu sagen den einzigen Gegenstand seiner Expedition ausmache, sei kein Geheimnis. Wenn er eines wäre, wie könnte er hoffen, ihn mit seinen armseligen Mitteln zu entdecken, allein und verloren in diesen unermesslichen Weiten? Aber andererseits müsse er eines sein, damit sich die ganze Mühe lohne. Richtig gestellt, würde die Frage so lauten: Was ist so verborgen, dass man einmal um die Welt reisen muss, um es zu finden, und gleichzeitig so sichtbar, dass man es bloß suchen kommen muss, um es zu entdecken? Definitionsgemäß müsste so etwas an jedem beliebigen Ort anzutreffen sein, überall, egal wo man sich befand, sogar in diesem Arbeitszimmer …
»Huch, aber hier ist er nicht«, sagte Rosas und tat, als schaue er unter den Tisch.
»Weil nämlich die Definition einen Umweg erzwingt, weil jede Definition nominal aufgefasst werden kann, und …«
»Rosas war ihm mit der ganzen Aufmerksamkeit gefolgt, die ihm zu Gebote stand, schweifte jedoch ab, sobald er sich eine grobe Vorstellung von der Idee machen konnte. Er hatte in der Angelegenheit Manuelita gewittert. Was der berühmte Hase auch immer sein mochte, seine Tochter war es auch. Und sie war es durch sein Werk. Er hatte aus dieser dummen Gans das am vollständigsten sichtbare Element seiner Politik gemacht, aber indem er die Erklärung verschwinden ließ, die die Form der Sichtbarkeit war. Darwin hatte in die gleiche Richtung gewiesen, nur unendlich schüchtern, so sehr, dass es pathetisch wirkte; er hatte sich auf das stützen müssen, was Rosas am wenigsten brauchte: auf den Glauben. Wie immer war ein Argentinier vorangeprescht. Er fühlte sich so glücklich, so erfüllt, dass er auf der Stelle einige fundamentale Entschlüsse fasste, die ihm schon länger keine Ruhe ließen: erstens bei dem Sohn von Pueyrredón ein Ganzkörperporträt von Manuelita