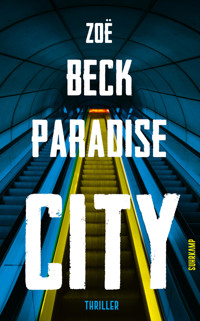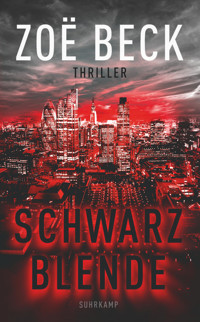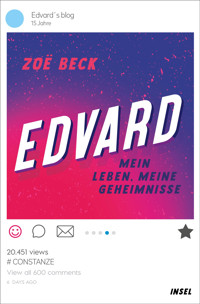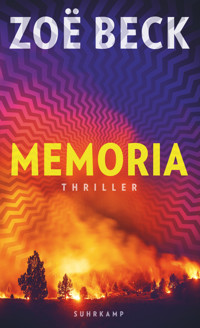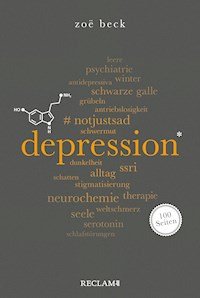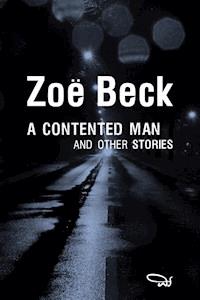10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Schottland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Es sind nur wenige Tage, die Carla von ihrem Kind getrennt im Krankenhaus verbringt – Tage, die alles verändern. Als die Schwester ihr das Baby in die Arme legt, ist Carla überzeugt, dass es gar nicht ihr Kind sein kann. Doch niemand glaubt ihr …
Fiona wacht in ihrer Badewanne auf. Kerzen stehen am Wannenrand, Blütenblätter schwimmen auf dem Wasser, das sich allmählich rot färbt – von ihrem Blut. Mit letzter Kraft schleppt sie sich zum Telefon. Im Krankenhaus behauptet sie, jemand hätte versucht, sie zu töten. Doch niemand glaubt ihr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Zoë Beck
Das alte Kind
Thriller
Suhrkamp
Der vorliegende Text ist eine durchgesehene Version des 2010 unter demselben Titel bei Bastei Lübbe, Köln, erschienenen Romans.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5199.
Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildungen: Christie Goodwin/Arcangel (Edinburgh Castle); FinePic©, München (Wolken, Rastertexture)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
eISBN 978-3-518-77002-3
www.suhrkamp.de
Das alte Kind
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Cover
Titel
Impressum
Berlin, September 1978
1
New York, Berlin, September 1978
2
Berlin, November 1978
Berlin, Wien, März 1979
3
Berlin, Dezember 1979
Berlin, Dezember 1979
4
Berlin, Januar 1980
5
6
Salzburg, Januar 1980
7
Privatklinik Dr. Bengarz, Kanton Zug, März 1980
Berlin, April 1980
8
Privatklinik Dr. Bengarz, Kanton Zug, April 1980
9
10
11
12
Berlin, April 1980
13
14
Privatklinik Dr. Bengarz, Kanton Zug, Juni 1980
15
16
Berlin, Juni 1980
17
18
Salzburg, März 1981
19
20
London, Juli 1989
21
London, 15. September 1991
22
23
Berlin, November 1993
24
25
26
27
28
29
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Berlin, September 1978
Carla musste lachen. »Das ist nicht mein Kind«, sagte sie.
Die Schwester sah sie erschrocken an. »Ach Gott, das ist mir jetzt aber peinlich!« Sie nahm Carla den Säugling aus den Armen und beeilte sich, aus dem Zimmer zu kommen.
»Für manche sehen sie alle gleich aus«, sagte die Frau im Bett neben ihr. Schwere Neurodermitis.
Carlas Gürtelrose war abgeheilt, sie durfte ihr Kind wiedersehen, und sie hatte sich über eine Woche auf diesen Tag gefreut.
»Haben Sie Kinder?«, fragte sie die Neurodermitis, deren Namen sie noch nicht kannte, weil sie gerade erst ins Zimmer gekommen war.
Die Frau war etwa in Carlas Alter, höchstens aber Mitte dreißig. Wie Carla schon vermutet hatte, schüttelte sie den Kopf. »Habe keine, will keine, und ja, auch für mich sehen sie alle gleich aus.« Sie grinste. »Ella Martinek.«
»Ella Martinek?« Carla setzte sich auf. »Die Fotografin?«
Ella nickte neugierig. »Sie interessieren sich für Fotografie?«
»Carla Arnim«, stellte Carla sich vor.
Ella machte große Augen. »Das gibt’s doch nicht.« Sie schlug sich die Hände vors Gesicht. »Und wir müssen uns ausgerechnet dann treffen, wenn ich so schlimm aussehe!«
Carla lachte. »Ich bin auch nicht frisiert und im Chanel-Kostüm. Nehmen Sie die Hände runter! So schlimm ist es gar nicht.«
Es war schlimm. Besonders für eine junge Frau, das war Carla klar. Die Neurodermitis zog sich quer über die linke Gesichtshälfte und fast den gesamten Hals. Die Arme konnte sie nicht sehen, Ella trug ein langärmeliges Pyjamaoberteil, aber die linke Hand war am schlimmsten betroffen. Wahrscheinlich wollte sie deshalb keine Kinder. Weil sie fürchtete, die Krankheit zu vererben. Oder weil sie sich nicht auf eine feste Beziehung mit einem Mann einlassen wollte, aus Scham über die immer wiederkehrende Entstellung, aus Angst, die vielen Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte wären eine zu große Belastung für den Partner.
Sie kamen ins Plaudern. Über Ellas aktuelles Projekt; sie war eine Zeit lang in London gewesen und hatte dort Punkbands begleitet und porträtiert. Über die nächsten Auktionen, die Carla plante. Sie fachsimpelten über die im vergangenen Jahr verstorbene Lee Miller, fanden über sie schnell den Bogen zum Thema Hausfrauendasein und Depressionen, entdeckten gemeinsame Bekannte, fingen an, über diesen oder über jene zu lästern, hatten einen Riesenspaß, und Carla merkte gar nicht, wie die Zeit verging. Wie lange die Schwester brauchte, um Felicitas von der Säuglingsstation zu holen. Erst als der Arzt ins Zimmer trat, die Schwester mit großen Augen und einem Säugling im Arm hinter ihm, dachte sie: Das hat aber gedauert.
»Frau Arnim.« Der Arzt lächelte sie an. »Wir bringen Ihnen Ihre Tochter.«
Die Schwester trat vor und legte ihr Felicitas in die Arme.
Nur, dass es nicht Felicitas war. Immer noch nicht.
»Ist das dasselbe Kind wie vorhin?«, fragte Carla verwirrt.
»Das ist Ihre Felicitas«, sagte der Arzt und nickte der unsicher dreinblickenden Schwester zu.
»Ich erkenne doch meine eigene Tochter, und das hier ist nicht meine Tochter. Sie haben das Kind vertauscht.« Carla wunderte sich selbst, wie ruhig sie das sagte.
Der Arzt setzte sich ans Fußende ihres Betts, ohne sie zu fragen. »Wir haben im Moment nur einen weiblichen Säugling im Alter von sechs Monaten auf der Station. Die Kinder bekommen ein kleines Bändchen, sehen Sie hier.« Er beugte sich vor und nahm behutsam das linke Ärmchen des Säuglings in die Hand, um ihr das Bändchen zu zeigen.
Carla hielt das fremde Kind ein gutes Stück von sich weg, hoffte, er würde es ihr abnehmen, aber das tat er nicht.
»Da steht der Name Ihrer Tochter«, sagte er ruhig und lächelte wieder. »Es ist alles in Ordnung. Wir haben Felicitas ganz sicher nicht verwechselt, es geht ihr gut, und sie war sehr brav. Natürlich hat sie Sie vermisst.«
Das Kind fing an zu weinen. Carla begann reflexartig, es zu schaukeln, doch dann hielt sie es wieder von sich weg. »Nehmen Sie sie bitte, das ist nicht meine Tochter.« Sie versuchte, die Panik in sich zu ersticken. Als sie sah, wie der Blick des Arztes ernster wurde, wie die Schwester sich nervös von ihr wegdrehte und ans Fenster trat, konnte sie nicht mehr. »Nehmen Sie mir doch endlich dieses Kind ab!«, rief sie und hielt den schreienden Säugling so weit von sich weg, wie sie konnte.
Die Schwester stürzte auf sie zu und entriss ihr das Kind. Schützend nahm sie es auf den Arm und sprach auf das heulende Mädchen ein.
»Das da ist nicht mein Kind«, sagte Carla. Ihre Stimme bebte, und die Tränen ließen sich nicht mehr aufhalten. »Wo ist meine Tochter? Wollen Sie behaupten, dass Sie nicht wissen, wo sie ist? Sie können mir doch nicht einfach mein Kind wegnehmen!« Nichts wie raus hier. Sie musste selbst nachsehen. Die Decke weg und rüber zur Säuglingsstation und nachsehen.
Sie war so schnell aus dem Bett gesprungen, dass der Arzt sie nur mit Mühe aufhalten konnte. »Frau Arnim, wir gehen gemeinsam, in Ordnung? Dann werden Sie sehen, dass wir Ihre Tochter nicht verwechselt haben. Versprechen Sie mir, sich wieder zu beruhigen? Soll ich Ihnen etwas geben?«
Sie glaubte zu begreifen, dass hier etwas passierte, das sie nicht mehr aufhalten konnte. Carla riss die Tür auf und rannte den Gang entlang, verlief sich, rannte zurück und fand sich endlich vor der großen Scheibe, hinter der die Neugeborenen lagen.
Der Arzt hatte sie eingeholt. »Frau Arnim. Wir sehen uns jetzt in Ruhe alle Kinder auf der Station an, einverstanden?« Er legte seine Hand leicht auf ihren Ellenbogen und führte sie durch die Tür.
Felicitas war nicht bei den Kindern, die dort lagen.
»Das ist nicht möglich«, sagte Carla und ging jedes einzelne Bettchen ab. »Wo ist meine Tochter?«
Die Schwester hatte sich mit dem Säugling zu ihnen gesellt. Das Kind war ruhig, die Schwester streichelte ihm den Rücken und sah Carla wieder aus riesigen, ängstlichen Augen an.
»Sie haben doch hier irgendeinen Mist gebaut, und jetzt wollen Sie mir ein falsches Kind unterjubeln, hab ich recht?«
»Bitte«, sagte der Arzt und legte diesmal seine Hand auf ihre Schulter. »Ich gebe Ihnen am besten eine kleine Spritze, und dann unterhalten wir uns im Behandlungszimmer. Einverstanden?«
Carla starrte ihn an. Sah noch einmal zu dem fremden Kind, das von der Schwester in sein Bettchen gelegt wurde, dann wieder zu ihm. »Sie wollen mich ruhigstellen?«, fragte sie, nun ganz leise. »Die Spritzen der letzten Tage, damit haben Sie mich auch ruhiggestellt, richtig?«
Er hob die Hände und schüttelte den Kopf. »Da verstehen Sie jetzt aber wirklich etwas ganz falsch. Wir haben …«
»Sie haben mein Kind entführt!«, schrie sie. »Oder ist etwas passiert? Ist Felicitas gestorben, und Sie wollen es mir nicht sagen? Was haben Sie getan?« Tränen strömten über ihr Gesicht.
»Kommen Sie, wir gehen ins Behandlungszimmer.« Jetzt packte der Arzt fester zu, schob sie aus dem Raum, schloss die Tür eilig hinter sich. »Und schreien Sie bitte nicht so. Denken Sie an die Kinder!«
Sie schüttelte ihn ab. »Ich denke an mein Kind! Sie haben mir mein Kind weggenommen!« Ohne nachzudenken, fing sie an, auf den Mann einzuschlagen. Blind trat sie nach ihm, schlug immer wieder zu. Sie sah, wie er schützend die Arme hob, er konnte nicht fliehen, sie hatte ihn in eine Ecke zwischen der Umkleide und dem Untersuchungsstuhl gedrängt. Sie erwischte seine Nase, landete einen Schlag auf seinen Mund, er blutete.
Jemand packte sie von hinten und zog sie von ihm weg. Zwei mussten es sein, sie hatte keine Chance, sich gegen sie zu wehren, sie sah sie nicht einmal. Carla schrie nach ihrer Tochter, sah den Arzt auf dem Boden liegen, das Gesicht voller Blut, sah die Schwester, die sich über ihn beugte und sich dann zu Carla umdrehte, Entsetzen im Blick. Dann spürte sie, wie eine Nadel in ihre Haut eindrang, merkte, wie ihre Glieder schwer wurden, wie alles um sie herum verschwamm, wie ihre Stimme versagte, weil sie zu müde war, auch nur zu flüstern. Und jetzt war alles weich und schwarz und lautlos.
1
Alles, was einem die Leute über Blut erzählten, war Quatsch. Von wegen ganz egal, wie oft man schon umgekippt war, weil andere irgendwas vollgeblutet hatten, sein eigenes Blut könnte man sich immer ansehen, kein Problem.
Dazu müsste man aber erst wissen, dass es das eigene Blut war.
Fiona wusste nicht mal, dass es überhaupt Blut war. Sie dachte an Tinte, weil sich die dunkle Flüssigkeit gar nicht mit dem Wasser vermischte, sondern ganz nach dickem, dunklem Zigarettenrauch aussah, der sich in einem viel zu kleinen Raum verteilte. Eben wie Tinte in Wasser. Sie wäre fast wieder eingeschlafen. Dann verstand sie doch, dass sie eigentlich nicht in ihrer Badewanne schlief, wenn sie mit Wasser voll war, schon gar nicht in Unterwäsche.
Sie blinzelte, bis sie klarer sehen konnte: Rosenblätter auf der Wasseroberfläche, Teelichte auf dem Wannenrand. Aus dem Radio in der Küche plätscherte kitschiger Romantikpop. Nicht ihre Welle, aber ihre Wanne. Sie spürte, wie an ihren nassen Händen etwas entlanglief, das wärmer war als das Wasser. Ihre Handgelenke juckten. Sie wollte sich kratzen, aber sie sah, dass die Tinte aus ihren Unterarmen lief. Sie fühlte keinen Schmerz, keine Panik, dachte: Okay, ich war wohl etwas zugedröhnt, aber ein Krankenwagen könnte eine gute Idee sein. Dann machte es klick in ihrem Kopf, und sie kotzte über den Wannenrand.
Sie konnte nämlich kein Blut sehen. Schon gar nicht ihr eigenes.
Bis zum Telefon schaffte sie es, auch wenn sie zwei Mal auf dem Weg dorthin umfiel, ihr Blut vom Bad über den Flur bis in die Küche verteilte, wo ihr immerhin einfiel, dass sie sich die Handgelenke besser abbinden sollte. Fiona nahm zwei Geschirrtücher, die seit Tagen auf dem Boden lagen, um einen Liter Cola aufzusaugen, schaffte es aber kaum, einen Knoten zu machen. Am Boden zusammengekauert wählte sie die Notrufnummer. Sie konnte der freundlichen Dame am anderen Ende der Leitung nicht genau sagen, was los war, weil ihre Zunge viel zu schwer war und außerdem komisch schmeckte. Bekam zum Glück aber ihren Namen und ihre Adresse heraus. Vielleicht hatte sie auch gar nichts gesagt, und die in der Notrufzentrale hatten rausgefunden, woher sie anrief.
Sie vertrieb sich die Zeit damit, einen anderen Sender im Küchenradio zu suchen. Dann fielen ihr die Augen zu, aber sie sang den Song mit, der gerade lief, um nicht einzuschlafen.
Falling about … You took a left off Last Laugh Lane …
Knappe zehn Minuten später trat jemand die Tür zu ihrer Wohnung ein und stürmte in die Küche. Und da fand sie, dass ein bisschen Schlaf nicht schaden könnte.
New York, Berlin, September 1978
Sie sagten es ihm erst, als er die Kadenz zum dritten Satz zu seiner Zufriedenheit eingespielt hatte. Vielleicht war es auch Zufall gewesen, und die Nachricht war erst in diesem Moment eingetroffen. So oder so, er war froh, es nicht vorher erfahren zu haben. Lange genug hatte er an der Kadenz gearbeitet, damit sie nicht zu sehr nach Wilhelm Kempff klang, aber auch nicht zu sehr nach Brendel. Und schon gar nicht nach Buchbinder. Überhaupt, Buchbinder. Wo immer Frederik hinkam, Buchbinder war bereits dort gewesen. Dabei war dieser nur wenige Jahre älter als Frederik. War ihm zum Beispiel zuvorgekommen mit der Gesamtaufnahme von Haydn. Dieser Buchbinder … Im Grunde spielte er so banal, dass es einem hochkam. Aber alle stürzten sich darauf.
Frederik fragte sich nicht zum ersten Mal, ob er weg von den Klassikern sollte. Oder weg von den großen Konzertsälen, untertauchen, selbst komponieren. Kammermusik vielleicht. Eine Weile nicht der Mittelpunkt sein.
Er verwarf diese Gedanken, wie üblich. Er wollte ja im Mittelpunkt stehen. Brauchte es. Für ausverkaufte Konzerthäuser wollte er auch weiterhin sorgen. Für hohe Verkaufszahlen bei seinen Schallplatten. Er wollte im Radio rauf und runter gespielt werden. Aber es fraß ihn langsam auf, dass er nicht wusste, wie er die absolute Spitze ein für alle Mal erreichen konnte. Exzentrik vielleicht? Wie Glenn Gould, der besessene Perfektionist, der barfuß aufgetreten war, bei den Aufnahmen mitsang und seine Verachtung für Mozarts Spätwerk öffentlich äußerte? Mozart und Beethoven. Genau Buchbinders Kragenweite, nicht wahr? Buchbinders wie auch seine eigene. Wobei sich Frederik von Mozart fernhielt. Alle liebten Mozart, und nichts fiel ihm leichter, als Mozart zu spielen. Aber sein Professor, sein größtes Vorbild, hatte gesagt: »Mozart ist was für Kinder und Anfänger. Mozart spielen wir nicht.« Einmal gesagt, galt es für die Ewigkeit. Frederik hatte sich immer gewünscht, mehr von der Genialität dieses Mannes in sich zu haben, der Rachmaninow und Ravel mit einer nie gehörten Brillanz spielte, nachdem er sich die Noten nur einmal kurz angesehen hatte. Exzentrik, da war sie wieder: Sein Professor lebte einzig von Kaffee und Zigaretten, man munkelte, dass er nicht mehr auftrat, weil er ein Alkoholproblem hatte, es war bekannt, dass er bei seinem letzten Auftritt in den frühen 1960er Jahren schreiend zusammengebrochen war, weil jemand im Publikum raschelnd das Jackett ausgezogen hatte. Exzentrik. Frederik sehnte sich nach ihr. Er war bei den gefälligen Komponisten hängengeblieben, spielte sie perfekt und sauber und genau so, wie alle es hören wollten. Im Grunde war er nicht viel anders als Buchbinder. Nur, dass dieser eben schon überall dort gewesen war, wo er hinkam. Und er deshalb an den Haydn-Kadenzen herumschraubte, als hinge die Glückseligkeit des Planeten davon ab.
Froh, die Aufnahme beendet zu haben, bat er den Tontechniker, ihm die Stelle noch einmal vorzuspielen, und erst dann nahm er die Nachricht entgegen und suchte sich ein Telefon. Wie gut, dass er da schon alles hinter sich hatte. Jetzt war ein guter Zeitpunkt, nach Deutschland zurückzufliegen. Gestern noch wäre es katastrophal gewesen.
Es war nicht so, dass Frederik Arnim seine Frau nicht liebte oder sich keine Sorgen um sie machte. Es war vielmehr so, dass er es nicht gewohnt war, sich Sorgen zu machen. Sie war immer gesund und stark und selbstständig, sie ließ ihm den Freiraum, den er für seine Arbeit brauchte, weshalb er es sich überhaupt nur erlauben konnte, seit einem knappen halben Jahr in Kanada und den USA zu sein. Und deshalb verstand er nicht recht, was ihm dieser Arzt am Telefon hatte sagen wollen. Carla hatte einen Nervenzusammenbruch? Musste psychiatrisch betreut werden?
Selbst, als er im Flieger saß, konnte er nicht recht dran glauben. Etwas anderes steckte vielleicht dahinter. Ein Vorwand? Nein, so makaber war Carla nicht, ihn unter Vortäuschung einer Krankheit nach Hause zu locken. Andererseits – ein Nervenzusammenbruch? Carla hatte keine Nervenzusammenbrüche. Sicher ging es darum, ihn mit etwas zu überraschen. Alles war in Ordnung, und sie wusste genau, dass er sich nicht ängstigen würde, weil er wiederum genau wusste, dass Carla keine Nervenzusammenbrüche hatte.
Carla hatte im Abitur gesteckt, er im Studium, als sie sich kennenlernten. Ihre Eltern waren mit seinem Professor befreundet und hatten gefragt, ob er jemanden wüsste, der oder die bei einem Gartenfest Klavier spielen könnte. Sein Professor hatte ihn geschickt. Die Besitzer des bekannten Auktionshauses Mannheimer! Wie hätten sich seine Kommilitonen darüber gefreut! Er hingegen nahm nur an, weil er das Geld dringend brauchte. Nicht, weil er besonders scharf drauf war, im Wintergarten einer Dahlemer Villa zu sitzen und den ganzen Nachmittag Gershwin und Porter zu klimpern. Damals war sein Anspruch noch ein anderer gewesen. Damals wollte er noch berühmt werden mit einem außergewöhnlichen Stil (den er jedoch nie bei sich fand). Mit unerhörtem Repertoire (das er sich dann doch nicht aneignete). Mit selbst komponierten Meisterwerken (die er nie schrieb). Er wurde zu einem der meistgebuchten und bestbezahlten Pianisten der Welt, seinen Namen kannte jeder, dem klassische Musik nicht ganz fremd war, man schätzte sein präzises, sauberes, eingängiges Spiel.
Ging es noch langweiliger?
Er hoffte es. Er glaubte fest daran. Er klammerte sich an diesen Gedanken. Er konnte nicht der langweiligste Pianist der Welt sein.
Damals, als er noch Träume gehabt hatte, lernte er Carla Mannheimer kennen, verliebte sich in sie wie in keine andere Frau zuvor, rannte ihr hinterher, sodass er sich selbst kaum mehr wiedererkannte. Natürlich waren ihre Eltern nicht nur diskret skeptisch, sondern offen gegen ihn. Talent hin oder her, er kam zwar aus gutem Hause mit gutem Namen, aber ohne Vermögen. Carla war das egal. Sie würde erben, als einziges Kind. Und natürlich beschloss Frederik, es ihnen zu zeigen. Vergaß seine Träume und tat, was er am besten konnte: Beethoven, Haydn, Chopin, Liszt. Ach, und Brahms, mit ihm hatte er auch Erfolge. Manchmal schob er es auf Carla und ihre Eltern, dass er nicht ein zweiter Glenn Gould war. Manchmal war er ehrlich mit sich selbst und gestand sich ein, dass er dazu niemals getaugt hätte, weil er eben nicht genial war. Nur begabt, aber nicht genial. Er war einfach zu spießig. Nicht exzentrisch genug. Carla war bald schwanger geworden, aber sie hatte ihm weiter den Rücken freigehalten. Sie hatte Kind und Studium gemeistert, und da ihre Eltern noch vor ihrem Abschluss kurz nacheinander starben, führte sie das Auktionshaus weiter. Mit Kind und Magisterarbeit und einem Mann, der den ganzen Tag am Klavier verbrachte, und das oft genug weit weg von Berlin. Frederik erhöhte: Carla hatte ihm nicht nur den Rücken freigehalten, sondern gestärkt. Über Geld und Zeit hatte er nie nachdenken müssen. Er hatte, dank ihr, alle Möglichkeiten. Und bekam, dank ihr, Verbindungen in die besten Kreise, um dahin zu gelangen, wo er heute war. Immer war sie stolz auf ihn gewesen. Nie hatte sie ihm in den Ohren gelegen, er möge doch mehr Zeit bei Frau und Kind verbringen. Durch die größte Krise seines Lebens hatte sie ihn manövriert. Als seine Nerven drohten, nicht mehr mitzumachen. Als seine Hände den Dienst verweigerten. Seine Frau war immer seine Stütze gewesen.
Und diese Frau sollte nun einen Nervenzusammenbruch gehabt haben? Es war lächerlich.
Sie hatte gerade ihr zweites Kind bekommen. Sie hatte starke Nerven, doch. Sie war nicht ängstlich wie andere Mütter, von denen Frederik manchmal hörte. Nicht nur, weil es ihr zweites Kind war. Sie war schon bei Frederik juniors Geburt gelöst und entspannt gewesen. Carla bekam keine Nervenzusammenbrüche. Er war der Typ, der zusammenklappte. Nicht Carla.
Als ihn am Flughafen in Berlin-Tegel niemand abholte, regten sich erste Zweifel. Falls es eine Überraschung hätte geben sollen, hätte ihn jemand abholen müssen. Der Arzt hatte ihm die Adresse der Psychiatrischen Abteilung des Benjamin-Franklin-Krankenhauses gegeben. Unwahrscheinlich, dass Carla mit einer Überraschung zu Hause auf ihn wartete. Es war also doch etwas passiert. Vielleicht mit den Kindern? Aber von seinem Sohn war nicht die Rede gewesen. Auch nicht von seiner Tochter. Für Frederik ergab all das keinen Sinn.
Er nahm sich ein Taxi und ließ sich zum Hindenburgdamm bringen. Fragte sich durch zu dem Arzt, der ihn angerufen hatte. Fand sich einem Psychiater gegenüber, der ihm erzählte, dass seine Frau einen Kollegen angegriffen hatte. Dass die Staatsanwaltschaft deshalb wegen Körperverletzung gegen sie ermittelte.
Und dass sie sich weigerte, ihre sechs Monate alte Tochter anzuerkennen.
Der Arzt brachte ihn zu seiner Frau. Sie war in einem Einzelzimmer untergebracht, saß im Bett und blätterte in einem Ausstellungskatalog. Sie arbeitete. Wie konnte sie einen Nervenzusammenbruch gehabt haben, wenn sie schon wieder arbeitete?
Als sie ihn sah, legte sie den Katalog weg, sprang aus dem Bett und lief auf ihn zu, um ihn zu umarmen. Er hielt sie fest, sie roch anders als sonst. Ein anderes Shampoo vielleicht. Der Psychiater blieb bei ihnen im Zimmer und hörte mit unbewegter Miene und verschränkten Armen zu, als sie ihm erzählte, dass das Kind, das ihr gebracht worden war, nicht Felicitas sein konnte. Dass es offenbar eine Verwechslung gegeben haben musste. Sie sprach mit ruhiger, fester Stimme und klang so vernünftig und rational wie immer. Oder fast.
Er konnte unterdrückte Angst hören. Es war eine Klangfarbe, die er bisher noch nie bei ihr gehört hatte.
Eine andere Frau hätte Felicitas, sagte sie. Diese andere Frau würde es bemerken, nicht wahr, und sie dann zurückbringen?
Frederik sah den Psychiater an. Der hob nicht einmal die Augenbrauen.
Später zeigte er ihm Felicitas. Er hatte Carla versprochen, sie sich genau anzusehen, und das tat er auch. Ein Foto hatte er dabei, es zeigte Felicitas, als sie gerade zwei Wochen alt war. Da hatte er seine Tochter zum letzten Mal gesehen. Frederik zeigte dem Arzt das Foto, der es sich ebenfalls genau ansah. Er reichte es einer Krankenschwester, die noch genauer hinsah, bis sich alle einig waren, dass das sechs Monate alte Kind, das hier vor ihnen in seinem Bettchen lag, kein anderes als Felicitas sein konnte. Ganz so, wie es das Bändchen an ihrem Handgelenk bestätigte. Er suchte nach Familienähnlichkeit in ihrem Gesicht, fand durchaus Züge, die ihn an seine Mutter erinnerten, fand, dass es sich außerdem um ein reizendes, nettes Kind handelte, und sagte Carla genau das. Da verlor sie alle Haltung und schrie ihn an. Zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Zeit schrie sie ihn an. Sie sprang sogar auf ihn zu, die Hände zu Fäusten geballt, und er konnte nicht anders als sich umdrehen und das Zimmer verlassen, aus Angst, sie würde ihm etwas antun.
Auf dem Flur rieb er sich die Handgelenke. Erst noch unbewusst, dann fiel es ihm schließlich auf, wahrscheinlich, weil der Psychiater, der ihm nach ein paar Minuten gefolgt war, ihn beobachtete. Keine Zwangsneurose, sagte Frederik, halb im Scherz, aber der Psychiater wusste, wer er war, und wollte wissen, ob alles in Ordnung sei mit seinen Gelenken. Er wusste offenbar noch mehr, wusste von den Schmerzen, die er vor sechs Jahren gehabt hatte und die bis heute kein Arzt erklären konnte, denn Rheuma und Arthrose hatten sie ausschließen können. Trotzdem hatte es zwölf lange Wochen gedauert, bis die Schmerzen vollständig abgeklungen waren, und nun tastete er an den Gelenken herum und horchte in sich hinein, ob sie zurückkommen würden, die Schmerzen, aber alles schien in Ordnung. Mit ihm jedenfalls. Er wollte wissen, was mit seiner Frau war, und der Psychiater sagte etwas von einer postpartalen Depression. Die sei weit verbreitet, er habe viele solcher Patientinnen und wisse gut damit umzugehen.
Ein paar Fragen musste er allerdings noch stellen. Sie gingen in sein Zimmer am Ende des Flurs, es war ein großes, helles Zimmer, und er hatte auch ein Vorzimmer mit einer Sekretärin, die sehr modisch gekleidet und frisiert war. Der Psychiater stellte einfache Fragen, ob Felicitas ein Wunschkind war und ob sie sich lieber einen Jungen gewünscht hätten. Und er stellte Fragen nach sexueller Traumatisierung bei Carla, ob es Hinweise darauf gäbe. Frederik hatte keine Ahnung, worauf das alles hinauslaufen sollte. Ihn interessierte gerade viel mehr, wann er seine Frau zurückbekommen würde und was er mit den Kindern machen sollte, wenn sie im Krankenhaus war. Er sagte dem Psychiater, dass er ohne Carla nicht zurechtkäme, dass er sie dringend bräuchte und sie das auch wüsste. Dass er sich deshalb nicht vorstellen könnte, wie sie aus dem Nichts diesen Zusammenbruch gehabt haben könnte, sie wüsste doch, dass sie geliebt und gebraucht würde, sie hätte noch nie jemanden im Stich gelassen.
Und dann sagte der Psychiater, ja, vielleicht ist das der Grund, warum sie hier ist. Irgendwann ist das Maß voll. Vielleicht hat sie einfach gesehen, wie es ist ohne Kinder, frei und ungezwungen. Die Zeit nur für sich. Schließlich war sie über eine Woche in Quarantäne gewesen, wegen der Gürtelrose, damit sich Felicitas nicht ansteckte. Der Sohn bei Frederiks Eltern in Westdeutschland, der Mann in New York, die Tochter auf der Säuglingsstation, und Carla endlich mal für sich allein.
Die Frau, die mit ihr in einem Zimmer gelegen hatte, bevor das alles passiert war, hatte berichtet, dass sich Carla mit ihr über die Arbeit unterhalten wollte. Fehlte ihr die Arbeit?
Frederik schüttelte den Kopf. Carla arbeitete schon längst wieder. Sie hatten nach Juniors Geburt ein Kindermädchen gehabt, sie würden wieder eins nehmen. Sie wusste, dass sie von anderen Müttern schief angesehen wurde, dass sie sie heimlich als Rabenmutter beschimpften, aber sie sagte immer: Wenn die Großmutter bei uns im Haus wohnen würde, wäre es in Ordnung, aber wenn ich für eine Frau bezahle, die viel besser als jede Großmutter auf das Kind aufpasst, weil sie jünger ist und ihren Beruf gelernt hat und Kinder einfach gernhat, dann ist es schlecht?
Er erzählte dem Psychiater von seiner wunderbaren Carla, die immer alles im Griff hatte, die nie von etwas überfordert war, die jede Sekunde in ihrem Leben wusste, was richtig war, und das wusste sie dann nicht nur für sich, sondern gleich noch für alle, die ihr am Herzen lagen. Diese Frau hatte nicht irgendwelche Zusammenbrüche und Depressionen.
Aber der Psychiater schüttelte nur traurig den Kopf. »Die Hormone«, sagte er, »die kann man nicht so einfach beeinflussen, da muss man sich Hilfe holen, und wir helfen Ihrer Frau. Wir sind hier sehr modern.«
Und was konnte Frederik schon tun, er nickte und überlegte, wo Carla die Telefonnummer der Kinderfrau notiert haben könnte, denn in ein paar Tagen würde Junior aus Frankfurt am Main von den Großeltern kommen, und Felicitas konnte nicht ewig im Krankenhaus bleiben.
Bevor er ging, ließ er sich noch einmal Felicitas zeigen. Wieder hielt er das Foto, das er vor über fünf Monaten von ihr gemacht hatte, neben ihr Gesichtchen und horchte in sich hinein. Hörte nichts. Keine Dissonanzen, entschied er. Sicher ein gutes Zeichen. Dann beugte er sich zu dem Kind und strich ihm vorsichtig über das Köpfchen. »Meine Tochter«, sagte er leise. »Meine Tochter. Das nächste Mal nehm ich dich einfach mit auf die große Reise.«
2
»Doch. Ihre Freundin hat mich gebeten, Sie anzurufen.«
Ben versuchte, sich auf die Stimme zu konzentrieren. »Das kann nicht sein«, wiederholte er, langsam und deutlich, und überlegte, wen er in der letzten Zeit verärgert hatte. Zu viele. Aber keiner von denen würde auf so eine Schwachsinnsidee kommen, um sich an ihm zu rächen.
»Ich verstehe, es ist für Sie sicher ein Schock. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie braucht jetzt nur jemanden, der für sie da ist.«
Die Frau machte eine kurze Pause, um Ben Gelegenheit zu geben, das zu sagen, was man in so einer Situation normalerweise sagte: Selbstverständlich komme ich sofort vorbei; in fünf Minuten bin ich da; sagen Sie ihr, dass sie keine Angst haben muss. Aber Ben sagte nichts.
»Der behandelnde Arzt würde sich gerne mit Ihnen darüber unterhalten, ob es eine Vorgeschichte gibt«, fuhr sie schließlich fort.
Ben ließ sich auf sein Kissen zurückfallen. »Hören Sie, sind Sie ganz sicher, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben?«, fragte er.
»Ben Edwards«, sagte die Frau und las ihm seine Handynummer vor. Kein Fehler. Keine Verwechselung. »Bitte, Mr Edwards. Ihre Freundin braucht Sie jetzt. Sie hat angegeben, dass sie keinerlei Angehörige hat – nur Sie. Wir glauben, dass es ein Hilferuf war. Sie hat selbst die 999 gewählt. Sie hat mir gesagt, dass Sie noch nicht sehr lange zusammen sind, aber …« Sie beendete den Satz nicht.
Ben schloss die Augen. »Okay.« Er wählte die nächsten Worte sehr sorgfältig. Sie klangen gestelzt, aber es ging nicht anders. »Sie … ähm … Es gibt einen Vater. Vielleicht … erkundigen Sie sich nach ihm?« Er hasste komplizierte Telefonate, wenn er nicht allein im Zimmer war.
»Sie hat gesagt, sie hätte keine Angehörigen.«
»Das stimmt nicht.«
»Kommen Sie vorbei?«
»Ich beeil mich«, behauptete er und beendete das Gespräch.
»Ist was passiert?« Nina war natürlich hellwach und knipste die Lampe auf dem Nachttisch an.
Er hätte mit dem Handy rausgehen sollen. Ben überlegte, was Nina gehört hatte und welche Geschichte er daraus machen konnte.
»Ein Freund ist im Krankenhaus, und sie haben offenbar nur meine Nummer bei ihm gefunden.« Er sagte es im Aufstehen, damit sie sein Gesicht nicht sah.
»Soll ich mitkommen? Wer ist es?« Sie schlug ihre Decke zurück.
»Jemand von früher.« Er fand ihre erste Frage damit ebenfalls ausreichend beantwortet, sammelte seine Kleidung vom Boden auf und beeilte sich, aus dem Schlafzimmer zu kommen. Erleichtert sah er aus dem Augenwinkel, wie sie sich wieder zudeckte.
»Ruf mich an, wenn du mehr weißt!«
Ja. Genau.
Fiona hatte eine wundervolle Altstimme. Meistens. Wenn sie sich aufregte, rutschte ihre Stimme eine Oktave höher und verlor alles Wundervolle. Ben konnte sie schon hören, bevor er die Notaufnahme betrat. Er folgte ihrer Stimme, dachte an die Sirenen, dachte an Odysseus und wie dämlich Männer doch waren; dachte daran, dass Fiona mit Sicherheit keine Himeropa gewesen wäre, jedenfalls nicht, wenn sie so rumbrüllte. Eher Ligeia.
Die Tür, hinter der Fiona jemandem erklärte, warum sie ihn für ein komplettes Arschloch hielt, war nur angelehnt. Ben trat ein, ohne anzuklopfen, blieb im Türrahmen stehen. Teils hielt ihn die Überraschung zurück. Teils die Tatsache, dass der kleine Behandlungsraum übervoll mit Menschen war. Eine junge Ärztin, zwei nicht mehr ganz so junge Schwestern, ein attraktiver, dunkelhaariger Mann und eine große, dünne Frau quetschten sich um Fiona. Eine Infusion tropfte in ihren rechten Arm. Beide Handgelenke waren bandagiert. Ihr Gesicht war schneeweiß, trotz ihrer offensichtlichen Aufregung. Sie trug nichts außer einem dunkelroten, locker zusammengebundenen Bademantel, den Ben noch gut kannte. Fiona verstummte, als sie ihn sah, und der Mann, das komplette Arschloch, wollte ihn rauswerfen.
»Das ist mein Verlobter«, sagte Fiona, nun wieder ganz in ihrer Altstimme.
Der Mann sah ihn an, als wollte er sagen: Herzliches Beileid.
Ben lächelte schwach in die Runde, blieb mit dem Blick an ihren bandagierten Handgelenken hängen, um ihr nicht in den offenen Bademantel zu starren, und fragte: »Was ist passiert?«
»Sie können ruhig zu ihr gehen.« Eine der Schwestern zog ihn in den Raum. Unwillig setzte er sich neben Fiona, die sofort seine Hand nahm.
»Was ist passiert?«
Der Mann stellte sich als Detective Constable Frank Black vor. Die dünne Frau war seine Vorgesetzte. Detective Sergeant Isobel Hepburn. Sie schüttelten ihm die Hand.
»Sir, wenn wir vielleicht einen Moment alleine mit Ihnen …«, begann DC Black.
»Jemand wollte mich umbringen«, sagte Fiona laut und deutlich.
Die Ärztin verließ den Raum, murmelte dabei etwas, das nicht sehr freundlich klang, und wurde von der ihr folgenden Schwester daran gehindert, die Tür zuzuknallen.
»Sir?« DC Black machte eine Kopfbewegung in Richtung Tür.
Ben drückte Fionas Hand, um ihren Klammergriff zu lösen.
Auf dem Flur wartete die Ärztin. Sie bat Ben zu sich.
»Dr. Randolph« stand auf ihrem Kittel. Sie stellte sich ihm nicht vor. »Pulsadern an beiden Armen geöffnet. Anschließend selbst versucht, die Blutung zu stoppen. Den Notruf gewählt. Bewusstlos aufgefunden. Blutverlust groß genug für Transfusion, aber sie weigert sich. Ungewöhnlich hohe Werte von Diazepam im Blut. Normalerweise wäre sie nicht aufgewacht. Ist sie abhängig?«
Ben zuckte die Schultern. »Wahrscheinlich«, sagte er vorsichtig.
»Sie gehört unter Beobachtung«, sagte die Ärztin. »Am besten gleich mit einem Entzug verbunden. Wobei, der könnte über Monate gehen. Man würde mit Ihnen einen Plan ausarbeiten, wie das Medikament abzusetzen ist.« Dr. Randolph verschwand, ohne sich zu verabschieden. Ben blieb mit den Polizisten zurück.
»Das war nicht das erste Mal, richtig?«, sagte DS Hepburn. Sie klang sachlich, nicht mitfühlend.
Ben nickte.
»Hören Sie auf die Ärztin. Eine … Pause würde Ihrer Verlobten guttun.«
»Sie ist nicht meine Verlobte.«
Die beiden Polizisten sahen sich ohne Überraschung an.
»Hat sie Angehörige, die verständigt werden müssen?«, fragte Hepburn.
»Ihren Vater. Aber ich habe keine Telefonnummer. Was passiert jetzt mit ihr? Kann sie nach Hause gehen?«
Hepburn überließ die Antwort ihrem Constable.
»Wir wurden gerufen, weil sie behauptet, jemand habe versucht, sie umzubringen.«
Ben hatte gehofft, sie hätte nur einen Scherz gemacht. »Nehmen Sie das ernst?« Er versuchte, neutral zu klingen.
»Würden Sie uns zur Wohnung Ihrer Freundin begleiten?«, fragte Hepburn anstatt einer Antwort.
Bevor Ben etwas sagen konnte, klingelte sein Handy. Nina. Er drückte sie weg und schaltete das Telefon aus. Die Polizistin hob die Augenbrauen.
»Ich komme mit«, sagte er.
Sie mussten Fionas Schlüssel gar nicht benutzen, um in ihre Wohnung in der Forth Street zu gelangen. Das gesamte erste Stockwerk war hell erleuchtet, und an einem der Fenster stand Fiona und telefonierte. Nur, dass es nicht Fiona sein konnte. Sie behielten sie noch mindestens bis zur nächsten Visite im Krankenhaus, hatte ihm eine Schwester versichert. Aber dort stand sie, in ihrem grünen kurzen Kleid, den kastanienbraunen langen Haaren, dem zu dunklen Lippenstift, drückte ihr Handy ans Ohr und sah auf die Straße, ohne dem kleinen Grüppchen vor dem Haus Beachtung zu schenken.
»Ist das nicht …«, begann Hepburn.
»Nein, das ist Mòrag«, unterbrach Ben. »Mòrag Friskin. Hoffentlich.«
»Ihre Schwester?«
»Ihre Mitbewohnerin.«
»Aber sie …«, murmelte Hepburn, sprach aber nicht weiter. Ben beschloss, nichts zu sagen. Erst abzuwarten, ob es wirklich Mòrag war, die am Fenster stand.
Sie war es. Und sie schien nicht überrascht darüber, dass morgens um halb sieben Ben mit zwei Kriminalbeamten vor der Tür stand.
»Ich habe gerade mit Fiona telefoniert«, sagte sie und ließ sie herein. »Leider zu spät. Wenn ich gewusst hätte, was passiert ist …« Sie deutete mit einer vagen Handbewegung auf einen Putzeimer, der im Flur stand. »Ich dachte, jemand hätte mit Wasserfarben rumgesaut.«
»Sie haben die Wohnung sauber gemacht? Mitten in der Nacht?«, fragte Constable Black und klang erschüttert.
»Sie können doch trotzdem noch Spuren sichern. Ich hab schließlich nicht mit Bleiche geputzt. Bleiche macht die DNS-Struktur kaputt, stimmt doch, oder? Hab ich bei CSI gesehen.« Mòrag presste die Lippen zusammen und sah herausfordernd von einem zum anderen. »Aber die Tür hab ich nicht angerührt.« Sie zeigte auf die Wohnungstür, aus der das Schloss herausgebrochen war.
»Prima. Da find ich jetzt bestimmt raus, welche Schuhgröße der Rettungsassistent hatte. Durchaus ermittlungsrelevant«, ätzte Black.
Mòrag zuckte nur mit den Schultern.
Ben konnte sehen, dass sich Hepburn im Moment vor allem eins fragte: Warum trug Mòrag Friskin ein extravagantes, tief dekolletiertes Kleid, wenn sie gerade geputzt hatte? Sie fragte Mòrag aber nur, ob ihr beim Nachhausekommen etwas Ungewöhnliches aufgefallen war (war es nicht), während sich Black nach etwas umsah, das Mòrag noch nicht geschrubbt hatte. Dann inspizierte Hepburn eingehend die kaputte Wohnungstür, sah sich das Bad und Fionas Zimmer an, die Küche, das gemeinsame Wohnzimmer und zum Schluss auch noch Mòrags Zimmer, bedankte sich und schob Black und Ben nach draußen. Das Einzige, was sie eingesteckt hatte, war die Mülltüte aus dem Bad. Dort hinein hatte Mòrag die Rasierklingen entsorgt, offenbar ohne sich mit der Frage aufzuhalten, was blutige Rasierklingen auf dem Badewannenrand zu suchen hätten.
»Was ist mit dieser Mòrag los?«, fragte Hepburn, als die drei im Auto saßen.
Sie fuhren Ben zurück zum Krankenhaus, wo sein Wagen noch stand.
»Kommt nach Hause, die Wohnung ist blutverschmiert, im Bad eine Wanne voller Rosenblätter und Blut und Wasser, und sie fängt erst mal an, im Designerkleid zu putzen? Und warum zum Teufel sieht sie aus wie Fiona? Oder ist es umgekehrt? Ich dachte, das hört irgendwann in der Pubertät auf, dass sich beste Freundinnen anziehen wie Zwillinge.«
»Tja«, sagte Ben.
Hepburn drehte sich vom Beifahrersitz so, dass sie ihm ins Gesicht sehen konnte. »Warum behauptet Fiona, mit Ihnen verlobt zu sein?«
Ben überlegte, wie viel er DS Hepburn über Fiona erzählen sollte. Und wie viel er selbst eigentlich über sie wusste.
Kennengelernt hatten sie sich auf Mòrags Geburtstagsfeier. Ein Kollege von früher, als Ben noch beim Scottish Independent als Gerichtsreporter angestellt gewesen war, hatte ihn mitgenommen. Marcus und er hielten noch sporadisch Kontakt, und manchmal, wenn Marcus, der Kulturredakteur, eine Einladung hatte, die nicht allzu trocken zu werden versprach, rief er Ben an, um ihn mitzunehmen. Mòrags Party war keine berufliche Einladung gewesen, aber Marcus kannte Mòrag von einigen Vernissagen und schien scharf auf sie zu sein. Er stellte auch gleich klar, dass er unmöglich allein erscheinen konnte, das sei viel zu uncool und offensichtlich. Weshalb Ben nicht anders konnte, er musste mit. Klarer Fall.
Die Party fand in Mòrags Wohnung in der Forth Street im Edinburgher Stadtteil Broughton statt. Broughton, gehobene, gezähmte Bohème, die ihre fair gehandelten Biosachen bei Real Foods kaufte, um anschließend um die Ecke glutenfreien Biokuchen im Urban Angel mit koffeinfreiem Biokaffee runterzuspülen, das musste man sich erst mal leisten können. Politisch korrekt statt politisch: Broughton, das pink triangle der Stadt, was glamouröser und größer klang, als es war. Hatte man die Bars und Cafés der Broughton Street hinter sich gelassen, landete man in ruhigen Seitenstraßen. Die imposante georgianische Architektur der New Town hatte großzügige Wohnungen entstehen lassen mit großen, teils bis zum Boden reichenden Fensterfronten. Ben konnte von der Straße aus sehen, dass Mòrags Party längst begonnen hatte: Er sah hinter jedem Fenster Menschen, die ausgelassen tanzten. An dem offenen Fenster über ihm stand eine junge Frau, rauchte und sah ihm direkt in die Augen. Auch wenn ihr Gesicht im Schatten lag, war Ben in dieser Sekunde davon überzeugt, noch nie so viel Schönheit gesehen zu haben, noch nie einen solchen Zauber verspürt zu haben. Er wusste, dass dieser Moment eine Illusion war. Er sah diese Frau nicht einmal richtig. Er projizierte einen Wunschtraum in den Schatten und das Zwielicht. Und er genoss den Schauer, der ihn dabei überlief. Dann legten sich zwei Arme um ihre Hüften, und sie wurde in den Raum zurückgezogen. Der Moment war vorbei.
Marcus hatte sie ebenfalls gesehen. Er schnappte kurz nach Luft, und Ben schloss, dass es Mòrag gewesen sein musste. Und vielleicht hatte sie gar nicht zu ihm hinuntergesehen, sondern zu Marcus.
Er war enttäuscht, als er wenige Minuten später vor der Gastgeberin stand: Mòrag Friskin war vollkommen reizlos. Sie sah aus wie eine Frau, die sich zu viel Mühe gab. Das Make-up zu dick aufgetragen, die Kleidung zu sexy für ihre schlanke Figur, die Haare einige Nuancen zu dunkel gefärbt für den Teint einer Naturblondine. Mòrag, das war sein erster Gedanke, wirkte irgendwie nicht echt. Von Marcus hatte er erfahren, dass sie Film studiert und darin sogar promoviert hatte, dass sie Kurse an der Uni gab und wohl schon das eine oder andere preisgekrönte Filmprojekt auf den Weg gebracht hatte. Gerade bereitete sie etwas für das in Edinburgh jährlich im August stattfindende Fringe Festival vor. Er überlegte, ob ihre künstliche Ausstrahlung etwas damit zu tun haben könnte, dass sie selbst vielleicht gerne Schauspielerin geworden wäre, sich gerne verkleidete und anders gab.
Ben schämte sich für den verlorenen Moment des Zaubers, für die Illusion, der er aufgesessen war. Und langweilte sich entsetzlich auf dieser Party. Während Marcus seine Chancen bei Mòrag offensichtlich richtig eingeschätzt hatte und mit ihr spurlos verschwand, geriet Ben in der Küche in eine Diskussion zwischen zwei Fotokünstlern und einem älteren Herrn, der eine kleine Galerie in Stockbridge hatte. Nicht, dass Ben Ahnung von Kunst gehabt hätte, aber irgendwie hatten sie ihn zum Schiedsrichter auserkoren, und nach dem fünften Bier schwirrte sein Kopf nicht mehr ganz so schlimm von den Ausflügen seiner neuen Freunde in die Ikonographie, denen er nicht folgen konnte. Unter anderem, weil er noch nie etwas von Erwin Panofsky gehört hatte. Das Künstlerpärchen und der Galerist sahen sich daraufhin bemüßigt, ihn umfassend über Panofsky aufzuklären, was dazu führte, dass sie sich mehr oder weniger zusammenrotteten und endlich über eine gemeinsame Ausstellung nachdachten. Mission erfüllt, dachte Ben, suchte die Toilette und musste warten.
Er überlegte, ob er zurück in die Küche gehen und sich noch ein Bier holen sollte, aber die Fotokünstler und der Galerist standen direkt vorm Kühlschrank, also wartete er, starrte auf seine Schuhspitzen, starrte an die Stuckdecke, fragte sich, ob Marcus und Mòrag gerade in einem der Schlafzimmer Sex hatten, als sich die Toilettentür öffnete und die Frau vor ihm stand, die er von der Straße aus am Fenster gesehen hatte. Sie sah Mòrag auf den ersten Blick sehr ähnlich. Aber an ihr stimmte alles, was an Mòrag gestört hatte. Er verstand: Diese Frau war das Original und Mòrag die Fälschung.
Er musste sie lange angestarrt haben. Sie lächelte, nicht aufreizend, nicht verführerisch, eher müde. »Fiona«, sagte sie. »Ich wohne auch hier.«
»Ben«, sagte er, und das Gefühl, das der Moment der Illusion in ihm ausgelöst hatte, kam mit voller Wucht zurück.
»Du kennst Mòrag?«, fragte sie ihn.
Er schüttelte den Kopf. »Eben zum ersten Mal gesehen.«
»Ach, ein gatecrasher bist du?«
»Oh. Nein. Mein Freund Marcus, er kennt Mòrag.«
»Und wo ist dieser Marcus jetzt?«
»Er unterhält sich mit Mòrag«, improvisierte er.
»Ist Marcus der Typ von der Zeitung?«
Ben nickte.
»Dann vögelt sie ihn wahrscheinlich gerade. Sie hat mich die ganze Woche wegen ihm genervt.«
Irgendetwas veränderte sich in ihr, aber er konnte nicht sagen, was es war. Er würde mehr über Fiona erfahren müssen, um das herauszubekommen. Er würde auch mehr über Fiona erfahren wollen. Er würde diesen Moment des Zaubers zwischen ihnen wiederholen wollen. Auch wenn der Zauber wohl nur einseitig war.
»Die Toilette wäre dann frei«, sagte Fiona und trat zur Seite, um ihn durchzulassen.
Er spürte, wie ihre Hand seine streifte, als er an ihr vorbeiging. Und als er eingetreten war, glaubte er, ein Brennen auf der Haut zu spüren.
Er hatte zu viel getrunken. Obwohl, fünf Bier brachten ihn normalerweise nicht in einen solchen Zustand der offensichtlichen geistigen Umnachtung. Aber seine Hand schien noch immer zu brennen. Er ließ kaltes Wasser drüberlaufen, es hörte nicht auf. Vielleicht hatten sie ihm etwas ins Bier gekippt. Man konnte nie wissen, bei den ganzen Filmnasen und Kunsttypen, die hier herumhingen. Fiona war wahrscheinlich auch eine von ihnen. Vielleicht war sie gar nicht echt, nur eine Illusion. Ben schüttelte sich, schloss fest die Augen, um sich zu konzentrieren. Es gelang ihm nicht. Jemand hatte ihm etwas ins Bier gekippt, was sonst.
Als er das Bad verließ, brannte sein Arm bis hoch zur Schulter. Es war Zeit zu gehen. Marcus würde ihn nicht vermissen. Die Fotografen auch nicht, sie knutschten gerade miteinander in der Garderobe, und der Galerist schielte heimlich zu ihnen rüber, während er vorgab, sich mit einer anorektischen Frau um die vierzig zu unterhalten. Die Musik hatte von Sonic Youth zu den Einstürzenden Neubauten gewechselt, während er im Bad gewesen war. Er sah sich nach Fiona um, konnte sie aber nirgendwo entdecken. Er holte sich noch ein Bier, trank es viel zu schnell aus, und mit dem letzten Schluck – wer zum Henker hatte die Musik zusammengestellt? – holperte »Feurio« über in Belle and Sebastians »Get Me Away From Here, I’m Dying«. So schlimm ist es auch nicht, dachte Ben, griff das Stichwort trotzdem auf und verließ die Wohnung.
Es war drei Uhr. Ein Taxi wollte er sich nicht leisten, und für Marcus’ Wagen hatte er keinen Schlüssel, außerdem war er weit über dem Limit. Er könnte zu Fuß nach Hause gehen. Es war ein warmer Frühlingstag, die Luft war noch immer angenehm, und wenn er schnell ging, wäre er in weniger als einer Stunde in Duddingston. Die Bewegung würde ihm guttun. Er musste den Kopf frei bekommen. Fiona vertreiben und sich überlegen, wie es sein konnte, dass ihm eine rauchende, telefonierende Gestalt am Fenster, die er nur schemenhaft erkannt hatte, so den Kopf verdreht hatte. Das konnte nicht an der Frau liegen. Das waren ganz bestimmt Drogen. Vielleicht hatte sogar Marcus ihm irgendwas untergejubelt.
Ben kam nicht weit. Er war noch nicht am Picardy Place Roundabout angekommen, als ihm jemand eine Hand auf die Schulter legte.
»Auch auf der Flucht?«, fragte Fiona.
Er lachte. »Jemand hat ›Get Me Away From Here, I’m Dying‹ aufgelegt.«
»Ja, Mòrags Partys können ganz schön anstrengend sein. Und wo gehst du jetzt hin?«
Er antwortete nicht. Er sah ihr in die Augen, die irgendwie traurig wirkten, traurig und endlos und voller Geheimnisse, und fragte: »Wohin gehst du jetzt?«
Und dann küsste er sie.
DS Hepburn erzählte er nur von ausgelassenen Mottopartys und spontanen Treffen, die gerne mal damit endeten, dass jemand Filmblut verschmierte oder Möbel mit Aquarellfarben verzierte. Er erzählte von Mòrags Filmen und Fionas Künstlerfreunden, fand knappe Worte, die der Polizistin schnell klarmachten: Bei so viel gelebtem Wahnsinn durfte man sich über nichts wundern.
Auch nicht darüber, dass Fiona ihn als ihren Verlobten ausgab.
»Reden Sie noch mal mit ihr?«, fragte DC Black, als er neben Bens Wagen parkte.
»Vielleicht«, sagte er vage.
»Es wäre besser, wenn sie sich ein paar Tage Ruhe gönnt«, fand Hepburn.
Er wartete, bis ihm Black die Tür geöffnet hatte. »Ich bin kaum derjenige, der sie dazu überreden könnte«, sagte er im Aussteigen.
»Versuchen Sie’s«, rief Black ihm hinterher.
Er wartete neben seinem Auto, bis die Polizisten gefahren waren. Dann ging er zum Haupteingang.
Berlin, November 1978
»Mein Kind wurde entführt«, wiederholte Carla, als man sie endlich zu einem Beamten der Kriminalpolizei gebracht hatte.
Der Mann hieß Köhler, war noch sehr jung für einen Kriminalbeamten, wie sie fand, und machte ein wichtiges Gesicht. »Hier steht«, sagte er und tippte mit dem Zeigefinger auf den Bogen, den sie hatte ausfüllen müssen, »dass Sie Ihre Tochter seit zwei Monaten vermissen. Warum kommen Sie erst jetzt?«
»Weil ich im Krankenhaus war.«
Er spitzte die Lippen und versuchte, zu dem Kollegen rüberzuschielen, mit dem er das vor Mobiliar, Akten und Krams überquellende Büro teilte. »Und Ihr Mann?«
»Glaubt nicht, dass unsere Tochter entführt wurde.«
Es war nicht schwer zu erraten, was der Kriminalbeamte Köhler gerade dachte: Wer von seinen Kollegen erlaubte sich einen Riesenspaß mit ihm? Oder, zweite Möglichkeit: Warum bekam immer er die Verrückten?
Also würde sie es ihm genau so erklären, wie sie es sich Tag für Tag in den vergangenen Wochen zurechtgelegt hatte.
»Passen Sie auf. Ich musste im September ins Krankenhaus wegen einer Gürtelrose. Meine Tochter Felicitas war zu der Zeit sechs Monate alt und durfte sich nicht anstecken. Deshalb wurden wir voneinander getrennt. Ich war über eine Woche lang sehr geschwächt und habe sie nicht gesehen. Als es mir besser ging, brachte mir die Krankenschwester ein Mädchen im Alter meiner Tochter und behauptete, es handle sich um Felicitas. Aber es war nicht Felicitas. Und da mein Mann nicht bestätigen konnte, dass es sich um ein fremdes Kind handelte, glaubte man mir nicht und steckte mich mit der Diagnose postpartale Depression in die psychiatrische Abteilung. Gestern durfte ich wieder nach Hause. Dort fand ich das fremde Kind vor, von dem man behauptet, es sei Felicitas. Eine Kinderfrau kümmert sich um das Kind, und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.« Sie war froh und erleichtert, dass sie einen ruhigen, sachlichen Tonfall behalten hatte. Zumindest bis zu dem Moment, bis sie »mein Mann ist ein Idiot« hinzufügte. »Wenn ich sage, das ist nicht mein Kind, ist es nicht mein Kind, oder?«
Köhler kaute auf seiner Unterlippe herum. »Ihr Mann sagt also, dass das Kind seine Tochter ist?«, fragte er vorsichtig, und sein Blick glitt wieder zu seinem Kollegen.