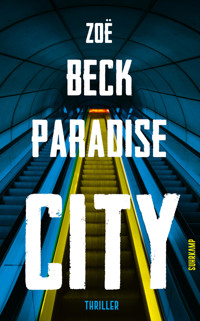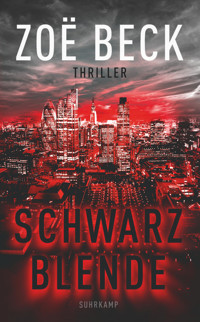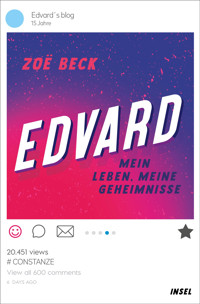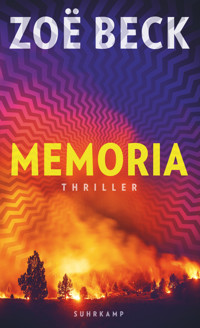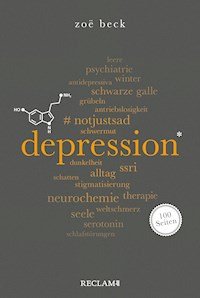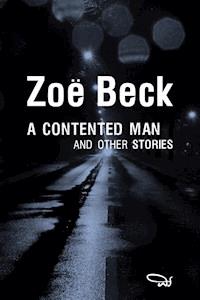11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Schottland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Unidozentin Mina Williams wacht auf und kann sich an nichts erinnern. Woher kommen diese Schmerzen? Und warum ist sie nackt? Neben ihr liegt ein Mann, ebenfalls nackt – und tot. Kurze Zeit später verschwindet aus dem Haus des Elitestudenten Cedric Darney ein Au-Pair-Mädchen. Sowohl Mina als auch Cedric geraten in das Visier der Polizei von St. Andrews – und eines Unbekannten, der ihnen wie ein Schatten folgt. Um sich selbst zu retten, müssen Mina und Cedric die Wahrheit finden. Doch manchmal sind Lügen gnädiger als die grausame Wahrheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Zoë Beck
Das falsche Leben
Thriller
Suhrkamp
Der vorliegende Text ist eine durchgesehene Version des 2008 unter dem Titel Wenn es dämmert bei Bastei Lübbe, Köln, erschienenen Romans.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5198.
Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildungen: Susanne Neumann/iStock/Getty Images (St. Andrews); FinePic(c), München (Wolken, Rastertexture)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
eISBN 978-3-518-76999-7
www.suhrkamp.de
Das falsche Leben
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Cover
Titel
Impressum
1
Berlin, September 1948
1
2
3
4
5
6
7
Berlin, November 1948
8
9
10
11
12
Berlin, Februar 1949
13
14
15
16
17
2
Berlin, Juli 1949
1
2
3
4
5
6
7
8
Berlin, August 1949
9
10
11
12
Berlin, September 1949
13
14
15
3
Kirkcaldy, Januar 1950
1
2
3
4
Kirkcaldy, März 1950
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kirkcaldy, April 1950
14
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
1
»I incline to Cain’s heresy«, he used to say quaintly: »I let my brother go to the devil in his own way.«»Ich verstehe Kains Ketzerei«, pflegte er mit seiner etwas gezierten Art zu sagen. »Ich lasse meinen Bruder auf seine Weise zum Teufel gehen.«Mr Utterson in »Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde«
Berlin, September 1948
»Dann lass ihn dafür bezahlen.«
»Wofür?«
»Du hast gesagt, er interessiert sich für dich. Lass ihn dafür bezahlen!«
»Was meinst du? Wofür bezahlen?«
»Das merkst du schon, wenn es so weit ist. Was weißt du über ihn?«
»Ich weiß nicht … Er ist Offizier. Bei den Fliegern.«
»Wie alt?«
»Ich weiß nicht …«
»Vierzig? Fünfzig?«
»Nein, nein, jünger …«
»Sieht er gut aus?«
»Ich weiß nicht …«
»Ichweißnichtichweißnicht! Kannst du auch etwas anderes sagen als immer nur Ichweißnicht? Ständig jammern! Sollen wir verhungern? Stell dich nicht so an. Mach, was er von dir will, und lass dich dafür bezahlen. Zigaretten, Schokolade, Strümpfe, alles, was du von ihm bekommen kannst.«
»Er denkt, ich bin schon viel älter.«
»Natürlich denkt er das. Du hast ja allen erzählt, du wärst älter. Sonst hättest du nicht im Kasino arbeiten können. Oder denkst du, sie hätten einer Vierzehnjährigen diese Arbeit gegeben?«
»Du hast mir gesagt, ich soll sagen, ich sei älter.«
»Und? Haben sie es dir geglaubt? Na also. Und ohne deine Zöpfe siehst du wirklich viel älter aus. Du hast doch gesagt, dir gefällt deine neue Frisur?«
Sie zuckte die Schultern.
»Du hast jetzt Locken wie eine erwachsene Frau, und du hast Arbeit wie eine erwachsene Frau. Also benimm dich auch wie eine erwachsene Frau. Ist sonst noch was?«
Sie schwieg. Malte mit dem Zeigefinger Figuren auf den leeren Küchentisch, ohne Spuren zu hinterlassen. Malte ein Herz auf den Tisch, das niemand sehen konnte. Wischte es schnell wieder weg.
Ihre Tante fragte wieder: »Ist sonst noch was?«
»Muss ich alles machen, was er von mir will?«
»Mach einfach mit, denk nicht darüber nach, denk nur daran, dass er dir immer etwas dafür gibt.«
»Und wie lange …«
Ihre Tante antwortete mit einem kurzen, trockenen Lachen. »Frag die Russen, wann sie die Blockade aufheben!«
»Machen das alle Frauen?«
»Ja, Schätzchen, das machen alle Frauen.«
Wieder schwieg sie, und als ihre Tante schon aus der Küche gehen wollte, fragte sie: »Glaubst du, er liebt mich?«
Ihre Tante blieb stehen, aber sie drehte sich nicht zu ihr um. »Egal, was er sagt, er wird dich nicht heiraten.«
»Wieso …«
»Verstehst du denn gar nichts? Wir sind immer noch der Feind.«
1
Die schwarze Wolke hob sich langsam und wurde zu einem Raben, der mit ausgebreiteten Schwingen in den Nebel flog. Sie hörte ihn rufen, selbst dann noch, als ihn der Nebel verschluckt hatte und sie ihn nicht mehr sehen konnte. In die Rufe des Raben mischte sich ein Knall, und jetzt lag der Rabe vor ihr auf dem Rasen, die Flügel gebrochen. Dickes Blut quoll über sein nachtschwarzes Gefieder, und er starrte sie mit toten Augen an. Sie hörte seine Rufe noch immer, und da begriff sie, dass etwas nicht stimmte. Mit ihr. Sie wand sich vor Schmerz, als sie zu sich kam.
Der Schmerz saß in ihrem Unterleib, stechend und krampfend. Sie fühlte, dass ihr Körper mit Schweiß bedeckt war, obwohl sie fror. Sie konnte den Schweiß riechen, es war nicht ihr Geruch. Als sie mit der linken Hand nach ihrem Bauch tastete, bemerkte sie etwas Klebriges, Feuchtes, das langsam an ihr herunterlief. Ihre Hand zuckte zurück, und sie drehte sich von der Seite auf den Rücken.
Das war besser. Die Schmerzen ließen etwas nach, aber sie fror noch immer. Der Boden, auf dem sie lag, fühlte sich wie Teppich an: etwas rau. Sie winkelte ihre Beine an und konzentrierte sich auf die Schmerzen, um herauszufinden, woher sie kamen.
Es kam ihr vor, als hätte sie ein Messer verschluckt. Aber der Schmerz in ihrem Unterleib war nicht der einzige.
Zwischen ihren Beinen war noch ein anderer. Viel dumpfer. Mit der rechten Hand tastete sie hinab zu ihren Schamlippen: Sie waren geschwollen und wund. Im selben Moment fiel ihr noch ein Geruch auf – erst jetzt, weil ihre Sinne sich entschieden hatten, sie nicht weiter zu betrügen. Erbrochenes. Das also war das feuchte Zeug auf ihrem Körper.
Sie öffnete vorsichtig die Augen. Ihre Lider waren so schwer wie der Samtvorhang einer alten Theaterbühne. Die Haut in ihrem Gesicht spannte. Sie sah sich um, konnte aber gerade mal erkennen, dass sie in einem Badezimmer war. Es war zu dunkel. Durch das Milchglasfenster drang kaum Licht. Sie war irgendwo zwischen Tag und Nacht. Oder Nacht und Tag.
Unsicher stemmte sie sich vom Boden hoch und setzte sich auf. Musste sich an den Badewannenrand lehnen und warten, bis das Summen in ihren Ohren nachließ und keine Heerscharen von Sternschnuppen mehr vor ihren Augen herunterfielen, bis die Dunkelheit in ihrem Kopf aufhörte, sich zu drehen, und die Badewanne keine Nussschale auf offener See mehr war.
Sie stellte sich hin, hielt sich aber noch fest, denn der Boden wankte hinterhältig. Eine Hand legte sie auf das Waschbecken, die andere auf den Wannenrand. Vor dem Milchglasfenster hing eine weiße Gardine, und hinter dem Fenster wurde es ein klein wenig heller. Hell genug, um zu erkennen, was sie schon die ganze Zeit wusste, aber nicht erklären konnte: Dies war nicht ihr Badezimmer.
Sie kletterte in die Wanne, ihre Knie knickten ein, und sie setzte sich hin. Sie duschte sich im Sitzen ab, drehte dabei das Wasser immer heißer, bis sie es nicht mehr aushielt. Noch ein bisschen mehr, und ihre Haut würde Blasen schlagen.
Goldene Wasserhähne, dachte sie, auch wenn sie sie nicht richtig sehen konnte. Dann dachte sie an das Erbrochene und überlegte, warum sie solche Schmerzen hatte, aber diese Gedanken wollten nicht den ganzen Weg gehen, nahmen eine Seitenstraße, verliefen sich in Sackgassen, kehrten wieder um und verschmolzen mit den goldenen Wasserhähnen.
Als sie den Duschvorhang wegschob, sah sie wieder den Nebel und bekam Angst vor dem toten Raben, bis sie begriff, dass es nur Wasserdampf war und alles andere ein Traum. Sie wischte den beschlagenen Spiegel nicht frei, wozu auch, es war zu dunkel. Sie wusste nicht, wo hier ein Lichtschalter war. Wo hier überhaupt irgendetwas war. Wo hier war.
Als Nächstes suchte sie Handtücher und fand keine. Vielleicht draußen. Langsam und leise öffnete sie die Tür. Sie wollte nicht, dass jemand sie hörte, obwohl sie nicht wusste, wer da sein könnte, um sie zu hören. Oder warum es nicht gut war, gehört zu werden.
Vor dem Badezimmer war es totenstill. In ihren Ohren rauschte es dumpf. Sie ging den Flur entlang, die Schmerzen ließen nur vorsichtige Schritte zu. Durch das Fenster am Ende des Gangs sah sie, wie ein dunkelblauer Himmel versuchte, sich von schwarzen, hohen Bäumen abzuheben. Die Äste bewegten sich ganz leicht, als würden sie dirigieren.
Alle Türen, die von dem Flur abgingen, waren geschlossen. Sie wusste nicht, was sich hinter ihnen befand, wusste nur, dass es schwere, dunkle Holztüren waren. An den Wänden hingen Ölgemälde, doch nur die vergoldeten Rahmen traten eitel aus dem Dämmerlicht hervor, die Leinwände wollten nicht gesehen werden und drückten sich in den Schatten.
Sie hinterließ kleine Wasserpfützen, während sie sich langsam vorarbeitete. Sie fror jetzt wieder. Verdunstungskälte, dachte sie und wunderte sich, während sie eine Treppe hinunterging, über diesen Gedanken. Auf der Hälfte blieb sie stehen, direkt vor einem der Ölbilder, und starrte es so lange an, bis sie etwas erkennen konnte. Ein blasser Mann mit dunklem Spitzbart starrte zurück, nein – knapp an ihr vorbei. Als gäbe es hinter ihr etwas Wichtiges zu sehen. Sie konnte nicht anders und drehte sich um, aber sie sah nichts.
Sie ging hinunter in eine Halle, fand einen Schalter, klickte ihn nach oben, dann wieder nach unten. Die Dunkelheit blieb.
Es roch komisch, aber sie konnte den Geruch nicht einordnen. Die Haustür war nur angelehnt. Vielleicht kam der Geruch von draußen. Sie versuchte, sich zu orientieren, ohne darauf zu achten, wo ihre Füße Halt fanden. Sie stolperte, fing sich, trat in etwas Klebriges, Feuchtes.
Nicht schon wieder, dachte sie, hab ich hier auch hingekotzt? Roch es deshalb so komisch? Nein, es roch anders. Sie wollte sich hinknien und nachsehen, worüber sie gestolpert war, als sie der Strahl einer Taschenlampe ins Gesicht traf.
Die Tür. Jemand musste die Tür leise aufgedrückt haben. Sie hatte nichts gehört. Sie stand nur da und bewegte sich nicht. Dachte daran, dass sie Schmerzen hatte. Fühlte sich so elend, dass sie sich wieder hinlegen wollte, gleich hier auf den Boden. Der Lichtstrahl wanderte an ihr herab. Sie folgte ihm mit den Augen, dachte: Ich bin immer noch nackt, ich wollte doch ein Handtuch holen. Bis der Lichtstrahl an ihren Füßen angelangt war und sie sah, was das Klebrige, Feuchte unter ihren Füßen war. Kein Erbrochenes, sondern Blut. Es sickerte aus dem, was vor ihr lag. Es war nicht der Rabe aus ihrem Traum. Das Rauschen in ihren Ohren wurde lauter, das Licht der Taschenlampe schien sich zu verdunkeln.
Der Mann hinter der Lampe kam in die Halle. Er trug eine Uniform und bewegte seinen Mund. Dabei sah er aus, als hätte er Angst vor ihr. Hinter ihm standen noch mehr Männer, auch sie bewegten ihre Münder, wie ein Chor, aber sie hörte nichts, immer noch nichts, außer dem Rauschen, das sie so wohlig umschloss, als käme es direkt von den Wellen der Nordsee. Ihr Blutdruck sank weiter ab, die Sternschnuppen fingen wieder an zu tanzen, und sie fiel zu Boden.
2
Es wurde gerade erst hell, und der Hafen von Rosyth war noch nicht aufgewacht, als der Mann seinen Range Rover bis zu dem Gebäude der Zollbehörde fuhr und davor anhielt. Er liebte den Anblick der schlafenden Kräne und lächelte, als er sein Autoradio andrehte. Nikolai Tokarew spielte »La Campanella« von Franz Liszt. Er ließ das Fenster einen Spaltbreit herunter und wartete darauf, dass sich die Beifahrertür öffnete.
Es dauerte nicht lange, bis der andere kam. Er drehte das Radio aus. »Setz dich«, forderte er ihn auf. »Schön, dich zu sehen.«
»Guten Morgen, Art, du bist früh dran.«
Art nickte. »Viel zu tun, Duncan. Bin gerade aus Newcastle hochgekommen. Aber ich wusste ja, dass ich dich hier treffe. Sag mal, mein Freund, wie war dein Kurzurlaub in Brighton?«
Duncans Grinsen war eine Meile breit. »Hervorragend. Hätte nicht besser sein können.«
Nun grinste auch Art. »Es hat die ganze Zeit geregnet, wenn man dem Wetterbericht für Südengland glauben darf! Ein Scheißwetter hattet ihr da unten an der Küste, mein Freund!«
»Keine Ahnung, ich war nicht ein einziges Mal vor der Tür.«
Beide Männer lachten.
»Dann war deine … Begleitung also ganz zu deiner Zufriedenheit?«
»Art, du weißt, was mich glücklich macht.«
Art nickte. »Nachher kommen drei LKW aus Deutschland. Holzmüller International Transports, schwarze Schrift auf Gelb. Die Kennzeichen beginnen mit F, für Frankfurt. Diese Deutschen mit ihren seltsamen Nummernschildern! Musst du sonst noch irgendetwas wissen?«
Duncan schüttelte den Kopf. »Geht alles klar. Wie viele sind drin?«
Art sah ihn tadelnd an. »Keine Details, mein Freund, daran hat sich nichts geändert.«
Der andere Mann war mit den Gedanken längst woanders. Er fuhr nervös mit dem Zeigefinger eine unsichtbare Linie auf dem Armaturenbrett nach. »Sag mal, Art, ich hätte am Dienstag frei, meinst du, ich könnte wieder …«
Duncan unterbrach sich, weil Arts Handy klingelte. Art nahm den Anruf entgegen, hörte zu, steckte das Handy wieder weg, ohne ein Wort gesagt zu haben. Dann sah er Duncan an und legte Trauer, tiefer als Loch Ness, in seinen Blick.
»Das wird heute das letzte Mal sein«, sagte er und erkannte, dass Duncans Überraschung echt war.
»Was ist passiert?«
»Mir scheint, jemand ist unruhig geworden und will, dass deine Leute ab sofort gründlicher vorgehen.«
»Da … davon weiß ich nichts«, stotterte Duncan, und von dem Grinsen, mit dem er Art begrüßt hatte, war nichts mehr übrig.
»Nein? Das hoffe ich für dich. Denn wenn heute einer von meinen Fahrern kontrolliert wird, sind wir keine Freunde mehr.«
»Was … willst du jetzt machen?«, fragte Duncan.
»Es gibt mehr als einen Weg auf diese Insel. Und immer dran denken, mein Freund: Neugier ist der Katze Tod!«
Duncan zögerte. »Also wird es nichts mit Dienstag.« Es klang kleinlaut und war mehr Feststellung als Frage.
»Wenn heute alles glattgeht …«, begann Art.
»Das wird es! Verlass dich auf mich! Ich … ganz ehrlich, von mir hat niemand was erfahren.«
Art bedeutete ihm auszusteigen. Duncan gehorchte und trabte zurück in Richtung seines Büros.
Er wusste, dass Duncan nichts verraten hatte, weil er sonst alles verlieren würde. Nicht nur seinen Job, seine Frau, seine Kinder. Vor allem würde er nie wieder so ein Rendezvous haben, wie Art sie ihm vermittelte. Stattdessen würde er wegen Unzucht ins Gefängnis kommen. Die Männer im Gefängnis würden nicht seinem Geschmack entsprechen. Sie würden alle um einiges zu alt für ihn sein.
Unzucht. Was für ein seltsames Wort, dachte Art, aber es passte zu Duncan, in dessen Keller sich die Leichen nur so stapelten. Nein, Duncan hatte nichts verraten.
Er sollte ruhig schwitzen, das schadete ihm nicht. Art würde herausfinden, wo das Leck war. Und keine Stelle war so undicht, dass er sie nicht flicken konnte. Außerdem hatte er bereits einen Verdacht. Er öffnete sein Handschuhfach und kontrollierte den Inhalt. Ein kurzer Schlagstock aus Eisen. Eine Pistole. Pfefferspray. Ein Schlagring. Ein Klappmesser. Für jede Gelegenheit das Richtige. Zufrieden schloss er es wieder, startete den Wagen und verließ das Hafengelände.
Die Küstenstraße, dachte er. Das ist der beste Weg nach Leven − und in diesem Licht auch die schönste Strecke. Er ließ Hillend und Aberdour hinter sich und war kurz vor Kirkcaldy, als er Polizeisirenen hörte. Art sah in den Rückspiegel: Ein Streifenwagen war hinter ihm. Er blinkte links und hielt an.
Die beiden Polizisten stiegen aus und kamen auf seinen Range Rover zu. Einer blieb im Hintergrund, ging um das Auto herum, notierte sich das Kennzeichen und kontrollierte die Beleuchtung. Der andere beugte sich zu ihm hinunter.
»Officer, was kann ich für Sie tun?«, fragte Art liebenswürdig.
»Ihre Papiere bitte.«
Er gab sie ihm und wartete mit einem Lächeln.
»Haben Sie etwas getrunken?«
»Ich trinke nie.«
»Dann wären Sie mit einem Test einverstanden?«
»Natürlich.« Art stieg aus und blies in das Testgerät. Null Komma null. Er trank wirklich nie.
»Vielen Dank, Sir. Sie sind ein wenig zu schnell in die Kurve gefahren, deshalb haben wir uns Sorgen gemacht. Es gab gestern Nacht auf dieser Strecke einen schlimmen Unfall. Zwei Jugendliche sind gestorben.«
»Schrecklich«, murmelte Art. »Es ist aber auch eine vertrackte Kurve.«
»Fahren Sie bitte vorsichtig, Sir.«
»Das werde ich. Danke, Officer. Einen schönen Tag noch.«
Art ließ sich seine Papiere zurückgeben und stieg ein. Er startete den Range Rover. Da er nicht wusste, ob ihn die Polizisten beobachteten, fuhr er zunächst weiter in Richtung Kirkcaldy. Von dort aus würde er eine Straße nehmen, die ihn auf die Autobahn brachte.
Da man ihn kontrolliert hatte, konnte er nicht mehr nach Leven fahren. Das musste er verschieben. Aber bei Art hatte noch jeder Verräter seine Strafe bekommen. Auf einen Tag kam es nicht an.
Eine Stunde später war er in seinem Haus in Corstorphine angekommen. In den klaren frühen Morgenstunden, wenn noch alles ruhig war, aber die ersten Sonnenstrahlen bereits über die Stadt krochen, konnte man die Tiere im Zoo besonders gut hören. Sie wachten gerade auf. Art liebte diese Geräusche.
Er fühlte sich wohl in dieser ruhigen Mittelklassegegend im Westen Edinburghs. Von hier aus war er schnell auf der Autobahn in Richtung Glasgow oder in die Highlands, schnell auf der Straße zur Forth Road Bridge, die ihn nach Fife brachte, schnell auf dem City Bypass, falls er nach England wollte. Und es gab keinen besseren Unterschlupf als zwischen Doppelverdienern – mit oder ohne Nachwuchs –, die in ihrem durchgeplanten Alltag keine Zeit hatten, sich um das Kommen und Gehen der Nachbarn zu kümmern.
Art schloss seine Haustür auf, ließ die Alarmanlage wissen, dass er wieder zurück war, und ging in die Küche, um sich einen Kaffee zu kochen. Er schaltete das Radio ein und wartete auf die Fünf-Uhr-Nachrichten.
Die erste Meldung galt dem Tod des amerikanischen Spitzengolfers Matthew Barnes. Er war in dieser Nacht von einem oder mehreren unbekannten Tätern in seinem Haus in St Andrews ermordet worden. Verwundert schüttelte Art den Kopf: Matt? Warum Matt? Wer würde denn ausgerechnet Matt …?
Er schaltete das Radio aus und seufzte kopfschüttelnd.
Ein sehr guter Kunde weniger.
Armer Matt.
Nun, es würden neue kommen.
3
Als sie diesmal zu sich kam, waren die Schmerzen ganz weit weg. Sie waren hinter der Nebelwand verschwunden und trieben dort irgendwo herum. Jemand hatte sie auf ein Sofa gelegt und eine Decke über sie gebreitet. In ihrer Armbeuge sah sie ein Heftpflaster: Sie hatte eine Spritze bekommen. Sie blinzelte, sah einen Mann, der in dem Zimmer umherging, sich bückte und etwas aufhob. Sie versuchte, sich zu bewegen, gab einen Laut von sich, und sofort kam er zu ihr. Das, was er aufgehoben hatte, ließ er in einer schwarzen Arzttasche verschwinden. Sie deutete auf ihre Armbeuge.
»Bleiben Sie ruhig« sagte der Mann, nahm ihre Hand und fühlte den Puls. »Noch ein bisschen schwach. Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus.«
»Nein, nicht …«. Es bereitete ihr Mühe zu sprechen, und ihre Stimme klang ungewohnt tief und rau. »Was ist passiert?«
»Der Krankenwagen steht bereits draußen. Es ist das Beste. Wären Sie zwei Minuten später zu sich gekommen, hätten wir Sie bereits …«
»Aber jetzt bin ich wach«, sagte sie und bemühte sich, resolut zu klingen.
Der Mann sah sie an, holte Luft, um etwas zu sagen, überlegte es sich anders, holte wieder Luft und sagte: »Gut. Also dann. Der Chief Inspector will mit Ihnen reden.«
Chief Inspector? »Sie sind …?«
»Dr. Ian McCallum. Und Sie?«
Ein Arzt. Er war noch jung, braunes Haar zu hellen, grünen Augen. Das Gesicht aus Eis.
»Was ist passiert?«, fragte sie noch einmal.
»Ich hole Chief Inspector Brady«, sagte er. »Brady? Kommen Sie? Sie ist wach.«
Der Mann, der nun in das Zimmer kam, war sehr groß und breitschultrig. Auch er wirkte stark unterkühlt. »Wie heißt sie?«, fragte er McCallum, während er sie ansah.
»Hat sie mir noch nicht verraten.«
»Mina Williams«, sagte sie.
»Waren Sie seine … Freundin?«
»Wessen Freundin?«
Brady und McCallum warfen sich Blicke zu, die sie nicht deuten konnte. McCallum nahm daraufhin seine Arzttasche und verließ das Zimmer.
Mina sah sich um: zerschlissene Polstermöbel, Chippendale, sehr alt, irgendwann einmal sehr teuer. Ölgemälde an den Wänden. Nichts Bekanntes, aber Originale. Stofftapeten. Auf dem Boden dicke, weiche Orientteppiche, die – wie die Möbel – schon bessere Tage gesehen hatten. Das Fenster gab den Blick in einen wunderbaren Garten frei: perfekter Rasen, gepflegte Blumenbeete, alte Bäume. Die frühe Sonne setzte postkartentaugliche Lichteffekte. Der Ruf des Raben war den Schreien von Möwen gewichen – auch wenn sie einen großen schwarzen Vogel durch das Gras hüpfen sah.
Eine Erinnerung lugte durch den Nebel, nur um gleich wieder den Kopf einzuziehen, als Mina nach ihr greifen wollte.
»Ms Williams«, sagte Brady. »Sie kennen Matthew Barnes?«
»Den Golfer«, sagte sie. »Natürlich.«
»Ich meine persönlich.«
Mina dachte darüber nach, was er mit »kennen« wohl meinte, und entschied sich zu nicken. »Was ist mit ihm?«
Brady zögerte. Ging zur Tür, aus der McCallum verschwunden war, und rief einen Namen. Eine Frau in Minas Alter kam herein. Die beiden setzten sich auf ein Sofa, das jenem gegenüberstand, auf dem sie lag.
»Das ist Detective Sergeant Hepburn.«
Die Frau lächelte Mina zu, und schon stieg die Raumtemperatur.
»Audrey oder Katherine?«, fragte Mina, und die Frau lachte.
»Isobel. Weder verwandt noch verschwägert. Wie geht es Ihnen?«
»Ich weiß es nicht. Eben war mir schlecht, daran erinnere ich mich. Jetzt fühle ich mich noch ziemlich benebelt, aber nicht mehr so mies. Was ist passiert? Wo bin ich?«
Diesmal war es Hepburn, die Brady einen seltsamen Blick zuwarf, jedoch ganz ohne Temperaturverlust. Hepburn glaubte ihr.
»Das ist das Haus von Mr Barnes. Wissen Sie noch, wie Sie hierhergekommen sind?«
Mina schüttelte langsam den Kopf. Wieder trat eine Erinnerung aus dem Nebelvorhang hervor. Diesmal blieb sie etwas länger, entwischte dann aber zurück in den Dunst, als wäre sie nie da gewesen.
»Woher kannten Sie ihn?«
»Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Wo ist er?«, fragte sie und hob die Decke, unter der es ihr mittlerweile zu warm geworden war. Sie sah an sich herunter: Sie war immer noch nackt, die Beine voller Blut.
Sie ließ die Decke schnell wieder fallen und spürte Panik in sich aufsteigen. Voller Angst sah sie die beiden Detectives an. »Ich muss mich waschen«, sagte sie.
»Eine Minute noch, Ms Williams«, sagte Brady. »Sie müssen uns sagen, was heute Nacht passiert ist.«
»Ich kann mich an nichts erinnern!«
»Hören Sie, DS Hepburn bleibt bei Ihnen. Sie gibt Ihnen etwas zum Anziehen und fährt mit Ihnen nach Hause, und dann …«
»Wo sind meine Sachen?«
»Die müssen wir noch eine Weile behalten, für die forensische Untersuchung.«
»Kann ich ins Bad?«
»Das ist noch nicht freigegeben. Sie haben heute Nacht schon einmal geduscht? Sie waren ganz nass, als wir Sie gefunden haben.«
Mina nickte langsam und tastete mit einer Hand nach ihrem Kopf. Ihre Haare waren noch feucht.
»Wann und warum?«
»Ich weiß nicht. Ich war ohnmächtig und bin im Bad zu mir gekommen. Ich fürchte, ich hatte mich übergeben, und deshalb musste ich duschen.«
Brady sah sie an, und Mina wurde es wieder kalt. »Gut. Hepburn kümmert sich um Sie.«
Hepburn kümmerte sich. Sie ließ sich Minas Hände zeigen und erklärte, dass der Mann in dem seltsamen weißen Anzug einen Test auf Schmauchspuren machen musste. Sie sprach beruhigend auf Mina ein, erklärte ihr, was mit Matt passiert war, klang verständnisvoll, sagte, Mina solle sich Zeit lassen, es sei in Ordnung, wenn sie sich jetzt noch nicht erinnern konnte. Wollte Mina ins Krankenhaus? Oder erst nach Hause, ein paar Sachen holen? Oder zu Hause bleiben? Dr. McCallum könnte dort nach ihr sehen.
Die Polizistin hatte Kleidung für sie. Einen Trainingsanzug, den sie noch von ihrer letzten Joggingrunde im Auto hatte, erklärte sie, als Mina ihn anzog.
»Ich fahre Sie nach Hause. Wenn Sie ein bisschen schlafen, kommt Ihre Erinnerung sicher zurück. Wenn Sie wollen, bleibe ich so lange bei Ihnen. Bestimmt wird alles wieder gut«, sagte DS Hepburn.
Etwas tief in ihr wusste, dass nur dann alles wieder gut werden würde, wenn ihre Erinnerungen für immer im Nebel versteckt blieben.
»Ich kenne Sie«, sagte Hepburn, als Mina aus ihrem Bad kam, noch in Handtücher und Bademantel gewickelt.
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, sagte Mina, während sie ihre Haare trockenrieb.
»Doch, wir können lesen bei der Polizei.« Hepburn lächelte. »Also, manche können es.«
»Und dann gleich so was Langweiliges.« Mina probierte ebenfalls ein Lächeln.
»Ich bin nicht die Einzige, die ihre Bücher liebt. Ich dachte, Sie seien mittlerweile in Hollywood und würden über große Verträge verhandeln.« Sie zwinkerte Mina zu.
»Tja. Ich fand es dann offensichtlich doch spannender, im Haus eines Weltranglistengolfers in St Andrews ohnmächtig zu werden, während dieser sich ermorden ließ.« Sie verzog das Gesicht. »Streichen Sie das.«
»Der Schock«, sagte Hepburn verständnisvoll. »Können Sie sich wirklich an nichts erinnern?«
Mina schloss die Augen, zuckte die Schultern.
»Hat er Sie …«, begann Hepburn leise, ohne den Satz zu beenden.
Mina setzte sich auf ihr Sofa. Auf ihr Sofa. Gut zu wissen, dass sie nicht alles vergessen hatte.
»Hören Sie, ich hab ihn gestern im Bertrand Hotel an der Bar getroffen, wir haben geredet und etwas zusammen getrunken. Dann sind wir zu ihm gegangen, haben weitergeredet, und ungefähr ab da verschwimmt so ziemlich alles bis zu dem Zeitpunkt, als Ihre Kollegen mit den Taschenlampen aufgetaucht sind.« Mina hob die Schultern, merkte, dass Tränen in ihr aufstiegen, und wusste, dass sie nicht länger die Starke spielen konnte. Also ließ sie den Tränen freien Lauf, das feuchte Handtuch, mit dem sie sich eben noch die Haare getrocknet hatte, vor dem Gesicht.
»Ich schicke Dr. McCallum noch mal zu Ihnen.«
Mina schüttelte den Kopf, das Gesicht noch immer in das Handtuch gepresst.
»Das dumme Gerede von wegen Hollywood … Es tut mir leid. Ich dachte nur, ich lenke Sie ein bisschen ab«, murmelte die Polizistin.
Mina nahm das Handtuch herunter. »Ich weiß schon. Danke. Ich würde jetzt gerne ein wenig schlafen. Das werde ich schon ohne McCallums Spritze hinbekommen.«
Hepburn stand unschlüssig auf. Blieb stehen, statt zur Tür zu gehen, und sah Mina an.
»Ich freue mich, Sie persönlich kennengelernt zu haben«, sagte sie und klang ein bisschen ehrfürchtig.
Mina musste lächeln, trotz allem.
Hepburn ging zur Haustür.
»Was hat mir Ihr Doktor eben eigentlich gespritzt?« Sie hatte es die ganze Zeit schon fragen wollen.
Hepburn drehte sich zu ihr um und sah sie mit zusammengezogenen Brauen an. »Gespritzt?«
Mina zeigte auf den Einstich in ihrer Armbeuge.
»Er hat Ihnen Blut abgenommen.«
Mina schluckte. »Darf er das? Ohne Einverständnis?«
Hepburn sah sie lange an, jetzt ganz Polizistin und gar nicht mehr Fan. »Gibt es etwas, worüber Sie mit mir reden möchten?«
»Er darf das gar nicht«, sagte Mina leise.
»Doch, Ms Williams. Doch.« Hepburn drehte sich um und ging zu ihrem Auto.
4
Sie war in seinem Haus, und er hatte keine Ahnung, wie er sie wieder herausbekommen sollte. Zwei Wochen schon. Seit zwei Wochen wohnte sie in einem der vier Schlafzimmer des Hauses, und er wurde sie nicht wieder los. Ihre Haare klebten auf den Polstern der Sofas. Der Geruch ihres viel zu süßen Parfüms hing im Flur. Ihre schmuddelige Jacke, wahrscheinlich von Woolworth oder Asda, die seit ihrer Herstellung noch keine Reinigung von innen gesehen hatte, hing an der Garderobe. Und dann diese Stiefel: Plastik. Schlangenlederimitat. Kein Tag, an dem sie sie nicht voller Stolz trug, und er hatte noch nie gesehen, dass sie sie geputzt hätte. Entsetzlich.
Entsetzlich auch, was sie mit der Küche machte. Überhaupt mit jedem Raum, den sie betrat. Sie machte nicht sauber, sie verteilte nur den Dreck und half den Bakterien, sich zu vermehren.
Es ging einfach nicht, und er hatte keine Ahnung, wie er es seinem Vater sagen sollte. Oder ihr. Aber sie musste raus aus diesem Haus. Er konnte sie nicht mehr ertragen.
Vor zwei Wochen war sein Vater in dem herrschaftlich anmutenden viktorianischen Haus in Donaldson Gardens vorbeigekommen. Am Steuer des Bentleys saß Malcolm, auf dem Rücksitz ein junges Mädchen. Lord Darney war zunächst alleine hereingekommen, um mit seinem Sohn zu sprechen. Ein Gesicht wie Weihnachten hatte er gemacht: strahlend vor Verlogenheit.
»Ich hab was für dich. Eine Überraschung.« Er hatte gegrinst und sich die Hände gerieben. »Du hast es zwar nicht verdient, aber du bist mein einziger Sohn, und da jetzt hoffentlich das Ende deines Studiums naht … Es sind doch nur noch drei Monate? Nicht wahr?«, hatte er begonnen.
Cedric hatte nur genickt und abgewartet.
»Jedenfalls dachte ich mir, ihr mit eurem Junggesellenhaushalt, ihr lebt ja nun sehr studentisch, sicher könntet ihr etwas Hilfe vertragen. Und bevor ich euch eine dicke, alte polnische Putzfrau zweimal die Woche vorbeischicke«, er grinste verschwörerisch und klopfte seinem Sohn auf die Schulter, »da dachte ich mir, ein nettes, hübsches Au-pair ist euch sicher lieber, nicht wahr?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er hinaus, um das Mädchen aus dem Bentley hereinzuholen. »Das«, sagte sein Vater, »ist Pepa. Sie kommt aus Rumänien. Heißen wir unsere neue EU-Mitbürgerin herzlich willkommen.« Er schob Pepa in Cedrics Richtung.
Das Erste, was ihm auffiel, war ihr Geruch, das billige, süßliche Parfüm, das für ihn schon bald das aufdringlichste Zeichen ihrer Anwesenheit werden würde. Dann, dass ihre langen dunklen Haare wohl nur schwer zu bändigen waren. Zwei einzelne Haare hatten sich gelöst, als sie sich mit einer Hand durch die Mähne gefahren war, eine Geste der Unsicherheit, während sie ohne Freude vage in seine Richtung lächelte. Er sah den Rest ihrer Kleidung an: eine Fliegerjacke mit groben Reißverschlüssen, ein kurzer Jeansrock, schwarze Strumpfhosen, die an den Knien ausgebeult waren, und die Pseudo-Schlangenlederstiefel. Alles in allem wirkte sie irgendwie schmutzig. Ihr Make-up ließ sie wie einen kleinen, hilflosen Clown aussehen: dunkelrote Lippen mit einem noch dunkleren Lipliner, der weit über die natürliche Form ihres Munds hinausging. Ein dicker schwarzer Strich um die Augen. Dunkelblauer Lidschatten. Zu viel Mascara. Noch viel mehr Puder und Abdeckcreme, die die Reste einer Pubertätsakne verschwinden lassen sollten.
Ohne die Farbe im Gesicht würde sie wahrscheinlich jünger aussehen. Wie fünfzehn. Mit Farbe sah sie aus wie knapp achtzehn.
»Cedric«, sagte Cedric und entschied sich dagegen, ihr die Hand zu geben. Seine Hände blieben tief in den Hosentaschen verborgen und umklammerten zur Sicherheit die Desinfektionstücher, die er immer bei sich trug.
Sein Vater hatte Cedrics Mitbewohner geholt, Pete und Doug. »Das ist Pepa«, sagte er stolz, als zeigte er den beiden ein neues Auto. »Sie geht euch von nun an im Haushalt zur Hand.«
»Hey, cool!«, rief Doug und sah sie von oben bis unten an. »Nur im Haushalt?«, fragte er mit einem anzüglichen Grinsen und zwinkerte Cedrics Vater zu, während er Pepa die Hand schüttelte.
Lord Darneys Augen verengten sich. »Sie ist in erster Linie dazu da, Cedric das Leben zu erleichtern. Vielleicht habe ich mich gerade etwas unklar ausgedrückt.«
Doug zwinkerte wieder, und Pete stand noch immer in der Tür zum Wohnzimmer, wo die Begrüßungszeremonie stattfand. Er starrte das junge Mädchen unverwandt an. Cedric spürte, wie sich Pepa unter Petes Blick zunehmend unwohl zu fühlen begann. Noch unwohler, als ihr vermutlich ohnehin schon zumute war. Kein Wunder, Pete sabberte bereits. Wie immer. Pete war nicht wählerisch.
Cedric bemühte sich um Höflichkeit. »Vater, ich habe nie etwas Derartiges …«, begann er, aber wie immer kam er nicht dazu auszureden.
»Vier Wochen Probezeit, in Ordnung?«, sagte sein Vater und klopfte ihm wieder auf die Schulter. Dann drehte er sich zum Fenster und gab Malcolm ein Zeichen, woraufhin dieser mit dem Koffer des Mädchens hereinkam. »Erster Stock, erste Tür links.«
Malcolm nickte, bevor er nach oben verschwand.
»Spricht sie Englisch?«, fragte Cedric, dem aufgefallen war, dass das Mädchen noch keinen einzigen Ton von sich gegeben hatte.
»Geht so. Sie ist natürlich unter anderem hier, um die Sprache zu lernen. Das ist der Sinn eines Au-pair-Aufenthalts, wir verstehen uns?«, sagte sein Vater, wartete noch kurz auf Malcolm und verschwand.
Doug nahm das Mädchen an die Hand und führte sie durchs Haus, als gehörte es ihm. Pete trottete den beiden hinterher und versuchte, nicht zu sabbern. Und Cedric setzte sich vorsichtig auf eines der Sofas. Genau in die Mitte. Gerader Rücken, die Hände noch immer in den Hosentaschen. Und dachte nach.
Sie war noch keine zehn Minuten im Haus, da wusste er schon, dass er sie loswerden musste. Seither war in den zwei Wochen kein Tag vergangen, an dem er nicht darüber nachgedacht hatte, aber er war noch zu keinem Ergebnis gekommen.
Doug riss ihn aus diesen Gedanken, als er in die Küche gepoltert kam.
»Ah, der kleine Lord, wieder bei der Arbeit?«
Cedric sah kurz vom Bildschirm seines Laptops hoch, auf den er die ganze Zeit gestarrt hatte, ohne etwas zu sehen. Dougs Haare waren triefnass. Er bemerkte, wie die Tropfen auf den Küchenboden fielen, als Doug den Kühlschrank öffnete und wieder einmal Sachen herausnahm, die ihm nicht gehörten. Dabei ging es Cedric gar nicht um das Geld. Er konnte es nur nicht ertragen, wenn ein anderer seine Sachen anfasste. Ein eigener kleiner Kühlschrank in seinem Zimmer wäre die Lösung. Wenn das mit Doug so weiterging, würde er sich irgendwann einen kaufen.
»Wo ist denn unser Sonnenschein, schläft sie immer noch?« Doug warf zwei Scheiben Weißbrot in den Toaster und fing an, sich Spiegeleier zu machen.
Cedric klappte seinen Laptop zu. Er konnte sich ohnehin auf nichts konzentrieren. Nicht mit ihr im Haus. Als seien Doug und Pete nicht schon schlimm genug. Er musste mit seinem Vater reden.
»Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber ich frage mich, was dich davon abhält, in ihr Zimmer zu gehen.«
»Eifersüchtig?« Doug schob die Pfanne mit den Eiern auf der Herdplatte herum. Das Fett spritzte auf Herd, Wand und Boden.
»Machst du nachher sauber, bitte?«, sagte Cedric während er aufstand, den Laptop nahm und die Küche verließ. »Und ich meine sauber.«
»Das macht Sonnenschein!«, rief Doug ihm nach.
Sonnenschein. Doug hatte für jeden einen Namen, so subtil wie die Leuchtreklame am Piccadilly Circus: »Der kleine Lord« für Cedric. »Working Class Hero« für Pete. Warum ausgerechnet »Sonnenschein« für das Mädchen?
Cedric brachte den Laptop in sein Zimmer, nahm seine Schlüssel und verließ das Haus. Sein Wagen stand direkt vor der Tür. Er fuhr langsam vom Grundstück. Vor dem Nachbarhaus standen Polizeiautos. Vielleicht hatte jemand versucht, bei Matt einzubrechen, was ungewöhnlich wäre. Vielleicht hatten sich Nachbarn über seine laute Musik beschwert, was normal wäre.
Er machte sich auf den Weg in Richtung Largo, wo sein Vater ein Cottage hatte, wie er es euphemistisch nannte. Er verbrachte hier hin und wieder die Wochenenden. Keine halbe Stunde von St Andrews entfernt, wo er für Cedric das Haus gekauft hatte. »Eine Investition nicht nur in deine Zukunft«, hatte er gesagt. »Wenn du dort nicht mehr studierst, vermiete ich es an diese schwachsinnigen Amerikaner. Sie zahlen jeden Preis für ein paar Tage Golf.«
Wie wahr. Cedric wusste nicht, wem das Haus neben ihm in Donaldson Gardens gehörte, aber darin wohnten tatsächlich immer Amerikaner, die Golf spielten. Seit einem halben Jahr Matthew Barnes, Weltrangliste Platz zwei, aber bald Platz eins, wie er Cedric erklärt hatte. Nächstes Jahr würde er einfach alle Turniere gewinnen, und das wäre es dann mit Tiger Woods.
Wie eine Schmeißfliege war Matthew Barnes immer wieder in Cedrics Garten aufgetaucht, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. »Echte Engländer, wann trifft man die schon mal?«, hatte er gesagt und versucht, Cedrics Akzent nachzumachen.
»Es soll, abgesehen von mir, vereinzelt noch lebende Exemplare in einem fernen Land mit Namen England geben. Man sagt, es liegt südlich von hier hinter den Hügeln, aber vielleicht ist das auch nur eine schottische Legende. Du weißt sicher, dass wir hier in Schottland sind?«
Aber Matthew hatte sich nicht provozieren lassen, er hatte immer nur gelacht und gelacht. Ein einfaches Hallo von Cedric reichte, und der Golfer hatte Tränen in den Augen.
»Ihr seid echt genau so, wie sie es im Fernsehen immer zeigen«, hatte Matthew sogar einmal gesagt.
»Du meine Güte, Fernsehen? So etwas kennen wir hier gar nicht. Bei Gelegenheit solltest du mir mehr davon erzählen.«
»Ich wette, du warst auf einer dieser uralten Schulen«, hatte Matt geantwortet, »so eine mit Uniformen, wo auch die Kinder der Königin hingehen.«
»Eton?«
»Von mir aus auch Eton.«
»Da war ich, ja.«
»Nur Jungs, was? Keine Mädchen erlaubt. Da wundert es doch niemanden, dass ihr alle so schwul drauf seid!« Und dann hatte er sich vor Lachen kaum mehr halten können. »Nichts für ungut, Kumpel, ich mach nur Spaß«, hatte er noch gesagt, aber Cedric war schon gegangen.
Cedric schüttelte sich, um diese Gedanken loszuwerden, blinzelte, achtete konzentriert auf den Verkehr.
Das Landhaus seines Vaters lag etwas außerhalb von Kirkton of Largo und war von der Hauptstraße aus nicht gleich zu sehen. Lediglich zwei Steinpfosten markierten die Zufahrt. Dazwischen verlief ein Schotterweg, der über grüne Felder und Hügel hinführte. Cedric bog in den engen Weg ein und fuhr etwa eine Meile an der großzügigen Pferdekoppel vorbei, bis er vor dem Landhaus hielt. Sooft er auch herkam, der weite Blick über den Firth of Forth, der sich von dem sanften Hügel bot, auf dem das Cottage lag, bereitete ihm jedes Mal Unbehagen. Bevor ihm schwindlig wurde, sah er schnell wieder weg.
Sein Vater hatte ihn gehört und kam ihm entgegen.
»Malcolm, fahr das Auto meines Sohnes in die Garage«, rief er, nickte Cedric zu und ging wieder ins Haus. Dort bat er seinen Sohn in den Salon und goss beiden einen Whisky ein.
»Was führt dich zu mir, so ganz ohne Vorwarnung?«, fragte er und kippte den Whisky herunter, als sei es Wasser. Er schenkte sich gleich wieder nach.
Cedric stellte sein Glas auf den Tisch, steckte die Hände zurück in die Hosentaschen und setzte sich auf eines der Sofas. Genau in die Mitte. »Es ist wegen …«, begann er und wusste nicht weiter.
Sein Vater wartete einen Moment, ob Cedric noch etwas sagen würde, dann setzte er sich ihm gegenüber. »Schaffst du deinen Abschluss nicht?« Die Hoffnung in seiner Stimme war kaum zu überhören. »Sind doch nur noch …? Was? Etwas über zwei Monate? Bis Ende August?«
Cedric nickte, dann schüttelte er sofort wieder den Kopf. »Darum geht es nicht. Es ist wegen des Hauses.«
»Ist etwas kaputt?«
Cedric konnte den Whisky riechen, obwohl das Glas noch auf dem Tisch stand: Er roch torfig. Am Glasrand sah er die Spur eines Fingerabdrucks, nicht von ihm.
»Es funktioniert nicht«, sagte er vorsichtig.
»Mit dem Mädchen?«
Cedric zuckte vage die Schultern.
»Macht sie ihren Job nicht? Oder meinst du – mit dir und dem Mädchen?«
»Ich will, dass sie geht.«
Sein Vater zog die Augenbrauen hoch. »Sie gefällt dir nicht? Ist sie unhöflich zu dir? Oder …«
»Nein, sie ist nett.«
»Machen sich deine Freunde an sie heran?«
»Das ist nicht der Punkt.«
»Sag ihnen, sie sollen sie in Ruhe lassen. Ich habe sie für dich eingestellt. Nicht für die anderen.«
»Vater, ich will einfach nur …«
»Wir haben gesagt vier Wochen. Jetzt sind erst zwei um.«
»Wo hast du sie eigentlich her?«, fragte Cedric.
»Au-pair-Agentur. Wieso interessiert dich das?«
Cedric zuckte die Schultern. »Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn sie da ist.«
Sein Vater lächelte. »Ach? Liegt da etwas in der Luft? Sind die … Spannungen zwischen euch ganz besonderer Natur? Ich sag dir was, Junge. Sprich sie ruhig darauf an. Ich wette, da lässt sich was machen.«
Cedrics Augen weiteten sich. »Du schlägst mir nicht im Ernst vor, mit diesem Mädchen«, er brachte es kaum über die Lippen, »etwas anzufangen?«
Lord Darney zuckte nur die Schultern. »Die Studentenzeit ist dazu da, sich richtig auszutoben. Und du studierst nun wahrlich schon länger, als vorgesehen war. Vor allem solltest du auch daran denken, dass ich dich etwas studieren lasse, von dem ich ganz und gar nichts halte.«
»Danke, dass du mich daran erinnerst. Fast hätte ich es vergessen«, gab Cedric kühl zurück.
»Ich erwarte von dir, dass du nach diesem … Abschluss, von dem ich wohl nie wissen werde, was du dir davon erhoffst, in einer meiner Redaktionen in London anfängst und das Geschäft von der Pike auf kennenlernst.«
»Ich weiß.«
»Und ich will nicht, dass du mir in dieser Zeit mit irgendwelchen Skandälchen das Leben schwer machst. Also tob dich aus, solange du noch kannst.«
»Bist du sicher, dass wir verwandt sind?«
»Cedric!«, brüllte Lord Darney, wurde aber sofort wieder ganz still und erhob sich.
Irritiert erhob sich auch Cedric und folgte dem Blick seines Vaters: Lillian stand in der Tür. Wie lange schon, war schwer zu sagen. Cedric nickte ihr zu, sah wieder zu seinem Vater, dessen Blick weiter auf Lillian ruhte.
»Ich fahre jetzt. Ich bin verabredet«, log er und ging.
Als er in der Garage seinen Wagen startete, klopfte sein Vater gegen die Scheibe. Er hinterließ Abdrücke darauf. Cedric ließ sie herunter.
»Wir sprechen uns in zwei Wochen«, sagte sein Vater. »Und bis dahin hast du dich besser an sie gewöhnt. Glaub mir, es ist die beste Lösung für dich. Schließlich hast du bisher noch kein Mädchen gefunden, das zu dir …«
»Ich muss los«, sagte Cedric, ließ die Scheibe wieder hochfahren und trat auf das Gaspedal.
Er würde sie nie loswerden, er wusste es. Als er von dem Privatweg auf die Straße in Richtung St Andrews abbiegen wollte, fielen ihm wieder die Fingerabdrücke ein, die sein Vater an der Scheibe hinterlassen hatte.
Die Waschstraße bei Morrisons war sonntags zum Glück geöffnet.
5
Gegen halb fünf parkte er seinen Wagen wieder vor der Haustür. Die Polizeiautos standen noch immer vor dem Nachbargrundstück. Er ging ins Haus, wo alle Türen offenstanden. Wie oft musste er es Doug und Pete noch sagen: Der Wind würde Dreck und Laub hereinwehen, und an die Tiere, die hineinkriechen und hineinfliegen könnten, wollte er erst gar nicht denken.
»Cedric«, rief Doug aus dem vorderen Wohnzimmer, das links von der Eingangshalle abging. Doug musste ihn durch das Fenster gesehen haben. Cedric zog seine Straßenschuhe aus, die Hausschuhe an, ging zum Wohnzimmer und blieb abrupt in der Tür stehen.
»Guten Tag«, sagte er zu den beiden Fremden, die dort mit Doug und Pete saßen. »Cedric Darney, was kann ich für Sie tun?« Er ließ die Hände in den Hosentaschen und bewegte sich keinen Schritt auf sie zu. Nicht bevor er wusste, wer sie waren.
»Chief Inspector Brady«, sagte der Mann und zeigte dann auf die Frau, die neben ihm saß. »Das ist Sergeant Hepburn. Würden Sie sich bitte zu uns setzen?«
Mein Haus, dachte Cedric. Und er sagt mir, was ich tun soll. Widerstrebend betrat er den Raum. Die beiden Polizisten saßen auf einem Sofa, Doug und Pete auf dem anderen, das rechtwinklig dazu stand. Die Polizisten saßen näher zusammen als Doug und Pete. Keine Symmetrie. Cedric blieb nur der Sessel. Er schob ihn so zurecht, dass er dem Winkel, den die beiden Sofas bildeten, direkt gegenüberstand.
Seine beiden Mitbewohner sahen schlecht aus: blass und mit tiefen Rändern unter den Augen. Sie hatten letzte Nacht wohl sämtliche Abschlusspartys mitgenommen, die es gab. Ihr Restalkohol würde reichen, um ein gesamtes Studentenwohnheim betrunken zu machen. Hatte Doug heute Morgen in der Küche schon so ausgesehen? Er hatte ihn nicht richtig angesehen. Pete sah schlimmer aus als Doug, aber Pete trank immer viel mehr als alle anderen, obwohl er weniger vertrug.
Sergeant Hepburn hatte ein hübsches rundes Gesicht mit blassen Sommersprossen, eingerahmt von fransig geschnittenen, kinnlangen dunklen Haaren. Sie war sehr groß und dünn.
Chief Inspector Brady trug einen schlecht sitzenden, billigen Anzug und ein Hemd, das eine Nummer zu klein war. Es spannte über dem Bauch, und die Krawatte schaffte es nicht ganz bis zum Hosenbund. Das Jackett glänzte speckig an den Ellenbogen. Die Schuhe waren staubig. Sein Gesicht war übersät mit alten Aknenarben.
Life on Mars, dachte Cedric. Der Mann sah aus wie DCI Gene Hunt in Life on Mars, einer Fernsehserie, die in den 1970er-Jahren spielte. Hunt war darin der harte Cop, aber ein harter Cop mit Humor. Cedric überlegte, ob Brady es auf diese Ähnlichkeit anlegte. Das würde das enge Hemd erklären: Er probierte den 70er-Stil.
Und er sagte Cedric, dass Matt tot war.
Beobachtete ihn dabei genau.
Cedric jedoch war zu keiner Reaktion in der Lage. Er wusste, er musste etwas sagen. Sie warteten. Er fühlte vier Augenpaare auf sich gerichtet.
»Das ist unfassbar«, sagte er endlich. »Sind Sie sicher?«
Was für ein Unsinn. Natürlich waren sie sich sicher, sonst wären sie nicht hier.
»Kannten Sie ihn gut? Sein Tod scheint Sie sehr zu berühren, Sie alle hier«, sagte die Frau, die neben Brady wirkte, als käme sie aus einem anderen Universum.
»Nun, wir haben ihn öfter getroffen. Auf Partys.«
»Ich hab schon gesagt, dass wir mit ihm gefeiert haben«, sagte Doug, schniefte und hustete kurz.
»Wie ist er gestorben?«
»Er wurde erschossen«, sagte Brady.
Cedric schluckte. »Erschossen. Das erscheint mir …« Er suchte ein passendes Wort.
»Ja?«
»Ungewöhnlich.«
Brady zog die Augenbrauen hoch und beugte sich vor. »Das erklären Sie mir mal, Mr Darney.«
Cedric sah zu Doug und Pete hinüber, die ihn mit großen Augen anstarrten. Schnell sah er wieder weg. »Erschießen setzt den Besitz einer Waffe voraus, und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich dachte immer, es sei nicht besonders leicht, an eine Waffe heranzukommen. Besonders hier in St Andrews finde ich das sehr – ja, ungewöhnlich. Oder ist es das nicht? Wer hat ihn erschossen? Ein Einbrecher?«
»Mr Darney, wer eine Waffe haben will, kommt auch an eine ran. Was ich«, er zögerte effektvoll, »ungewöhnlich finde, ist, dass Sie als Erstes auf einen solchen Gedanken kommen. Wo waren Sie gestern Nacht? Offenbar ja nicht auf derselben Party wie Ihre Freunde.«
»Ich bezweifle, dass meine Mitbewohner nur auf einer Party waren. Aber, ja, es ist richtig, ich war nicht mit ihnen unterwegs. Ich war hier zu Hause.«
»Klar. An einem Samstagabend.« Brady klang jetzt auch noch wie eine schlechte Parodie von Life on Mars. Fehlte nur noch der Manchester-Akzent.
»Ich bin als Engländer offen gestanden mit der schottischen Gesetzgebung nicht vertraut. Gibt es Gesetze, die einem untersagen, den Samstagabend zu Hause zu verbringen?«
»Ein Student, der am Samstagabend zu Hause herumsitzt? Sie verstehen schon, dass mich das wundert. Es ist aber gut für unsere Ermittlungen. Dann haben Sie sicher etwas gehört oder gesehen?« Brady lächelte kalt.
»Nein, tut mir leid. Mein Zimmer geht nach hinten raus. Ich kann nur den Garten des anderen Nachbargrundstücks sehen. Da ist mir nichts aufgefallen.«
»Haben Sie sich gut mit Barnes verstanden?«, fragte Brady weiter. Sergeant Hepburn machte Notizen. Sie sah manchmal auf, so auch jetzt. Cedric spürte, wie auch Pete und Doug ihn wieder anstarrten.
»Matt war ein interessanter Kerl, doch. Wir haben uns in dem halben Jahr, in dem er mein Nachbar war, öfter gesehen und auch gut verstanden.«
»Kein Streit?«
»Warum sollte …?«
»Nun, ich frage nur. Mr Darney, Sie haben dieses Haus gemietet?«
»Es gehört meinem Vater.«
»Ah, ihm scheint halb St Andrews zu gehören.«
»Weil er dieses Haus gekauft hat? Er sieht es als Spekulations- oder Abschreibungsobjekt, ich kenne mich damit nicht aus. Er benutzt die Mieteinnahmen, um die Hypothek zu tilgen, sonst würde ich kaum Mitbewohner haben.« Er hörte, wie Doug laut schnaufte, sprach aber einfach weiter. »Als ich anfing, hier zu studieren, kaufte er es. Wenn ich hier raus bin, vermietet er es wohl an Golfer wie Matt.«
»Dessen Haus gehört ihm auch.«
Cedric schwieg einen Moment und versuchte zu verstehen. »Das Haus, in dem Matt wohnte?«, fragte er dann und hatte das Gefühl, auf Glatteis gelandet zu sein.
»Mr Darney, zwei Dinge: Die Vergangenheitsform geht Ihnen verdammt leicht über die Lippen, wenn Sie von Ihrem Nachbarn sprechen. Und dass das Haus nebenan Ihrem Vater gehört, scheint Sie mehr zu beeindrucken als der Tod von Mr Barnes. Was sagt mir das jetzt?«, fragte Brady und legte den Kopf schief.
»Dass Sie aufgrund unzusammenhängender Informationen und völlig haltlos ein haarsträubendes Motiv zusammenzubasteln versuchen, damit Sie Ihre schlechte Laune an einem Vertreter der englischen Oberschicht auslassen können?«, sagte Cedric und legte ebenfalls den Kopf schief, mehr aus Gründen der Symmetrie als der Provokation. Sein Blick fiel wieder auf Bradys staubige Schuhe, dann auf die zu kurze Krawatte, und nun entdeckte er darauf etwas, was wie ein Ketchupfleck aussah. Er ertrug Brady nicht mehr. Er wollte ihn aus dem Haus haben.
Brady presste die Lippen fest zusammen und dachte über eine angemessene Erwiderung nach, aber dazu gab Cedric ihm keine Gelegenheit. »Ich verstehe mich mäßig mit meinem Vater, weil ich etwas studiere, was mir Spaß macht, und nicht das, was er für mich vorgesehen hatte. Das kommt, wie Sie sehen, in den besten Familien vor.« Brady holte tief Luft, aber Cedric sprach weiter: »Ich habe mich mit Matt nicht so gut verstanden, dass es für eine Freundschaft gereicht hätte, weil er sich deutlich mehr für Partys und Ähnliches interessierte als ich. Aus diesen beiden Umständen können Sie sich gerne zusammenreimen, was Ihnen Freude bereitet.«
»Große Freude«, betonte Brady.
»Dass ich eine andere Art habe, auf mir überbrachte Nachrichten zu reagieren als andere Menschen, und dass ich in der Lage bin, die grammatikalisch richtige Vergangenheitsform zu benutzen, hängt unter anderem damit zusammen, dass ich einen deutlich höheren IQ habe als andere Menschen, inklusive Ihnen.«
Hier fing Sergeant Hepburn an zu husten.
Unbeirrt fuhr Cedric fort: »Aber das wissen Sie vielleicht auch schon, wo Sie doch sonst so viel über mich und meine Familie wissen. Und da keiner von uns etwas zu Ihren Ermittlungen beitragen kann, bitte ich Sie, dieses Haus zu verlassen. Ich habe Sie nicht hereingebeten, und ich denke, dass selbst die Polizei kein Recht hat, in fremden Häusern herumzusitzen, solange sie will. Guten Tag.« Cedric erhob sich.
Es war vermutlich ein Höflichkeitsreflex, dass auch die beiden Polizisten aufstanden. Widerwillig gingen sie zur Tür, Brady mit rotem Gesicht, Hepburn mit einem Ausdruck von Mitleid. Für wen?
»Ist Ihr Zimmer eigentlich schalldicht?«, fragt Brady, als er schon in der Eingangshalle war.
»Leider nicht, aber es ist sehr gut isoliert. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.« Cedric schloss die Tür hinter den beiden. Als er sich umdrehte, sah er Pete und Doug hinter sich.
»Bist du wahnsinnig, so kannst du doch nicht mit den Cops reden?«, rief Doug. »Die buchten dich noch ein!«
»Ihr seht alle zu viel fern«, sagte Cedric nur und dachte dabei an Life on Mars. Er überlegte gerade, warum er diese Serie so gut kannte, als es klingelte. Er öffnete die Tür. Es war Hepburn, und sie war allein. Aber Cedric konnte sehen, dass Brady in einem Wagen auf sie wartete.
»Entschuldigen Sie, Sir«, sagte Hepburn. »Nur noch eins. Kennen Sie eine Mina Williams?«
»Natürlich.«
»Persönlich oder aus der Presse?«
»Sie hat den Creative-Writing-Kurs von Professor Scott übernommen und betreut damit auch meine Abschlussarbeit.«
»Wussten Sie, dass Sie Matthew Barnes kannte?«
Cedric zuckte die Schultern. »Das Privatleben von Ms Williams hat mich bisher nur mäßig interessiert. Wenn noch etwas ist, rufen Sie bitte vorher an.«