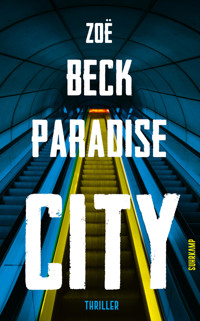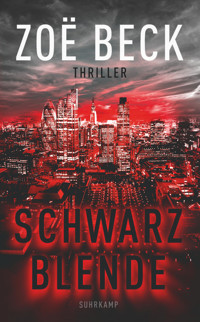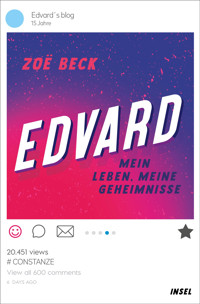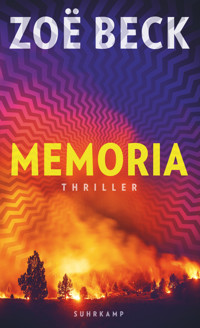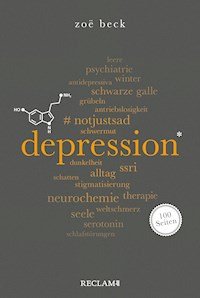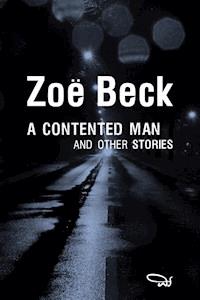11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Schottland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Schneechaos in Schottland. Auf einem einsam gelegenen Anwesen wird die Leiche einer Frau gefunden. Wenig später meldet sich bei der Polizei in Edinburgh Philippa Murray, die behauptet, ihr Freund Sean habe die Tat in seinem Notizbuch angekündigt. Doch bei der Überprüfung des mutmaßlichen Täters kommt heraus, dass Sean Butler vor sieben Jahren verschwunden und inzwischen für tot erklärt worden ist. Als die Polizei Philippa zu Hause aufsucht, ist die junge Frau spurlos verschwunden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Zoë Beck
Das zerbrochene Fenster
Thriller
Suhrkamp
Der vorliegende Text ist eine durchgesehene Version des 2012 unter demselben Titel bei Bastei Lübbe, Köln, erschienenen Romans.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5196.
Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildungen: bluefinart/Getty Images (Edinburgh Carlton Hill); FinePic(c), München (Wolken, Rastertexture).
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
eISBN 978-3-518-76997-3
www.suhrkamp.de
Das zerbrochene Fenster
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Cover
Titel
Impressum
Philippa Murrays Tagebuch
Donnerstag, 11.12.2003
Montag, 29. November 2010
1
Philippa Murrays Tagebuch
Freitag, 12.12.2003
Sonntag, 14.12.2003
Dienstag, 30. November 2010
2
Philippa Murrays Tagebuch
Montag, 15.12.2003
Nachtrag:
Nachtrag 2:
Donnerstag, 18.12.2003
3
Philippa Murrays Tagebuch
Sonntag, 21.12.2003
Nachtrag:
4
Philippa Murrays Tagebuch
Montag, 22.12.2003
Donnerstag, 25.12.2003
Mittwoch, 1. Dezember 2010
5
Philippa Murrays Tagebuch
Freitag, 26.12.2003
6
Philippa Murrays Tagebuch
Samstag, 27.12.2003
Sonntag, 28.12.2003
Nachtrag:
Nachtrag 2:
7
Philippa Murrays Tagebuch
Dienstag, 30.12.2003
Nachtrag:
Donnerstag, 2. Dezember 2010
8
Philippa Murrays Tagebuch
Mittwoch, 31.12.2003
Donnerstag, 1.1.2004
Freitag, 2.1.2004
Samstag, 3.1.2004
Sonntag, 4.1.2004
Montag, 5.1.2004
Dienstag, 6.1.2004
9
Philippa Murrays Tagebuch
Montag, 9.2.2004
Freitag, 13.2.2004
Sonntag, 15.2.2004
Montag, 16.2.2004
10
Scottish Independent Online, 18.2.2004. Missglückte Geldübergabe endet mit Blutbad
Freitag, 3. Dezember 2010
11
Philippa Murrays Tagebuch
Mittwoch, 31.3.2004
Donnerstag, 8.4.2004
Sonntag, 25.4.2004
Samstag, 1.5.2004
12
Philippa Murrays Tagebuch
Samstag, 8.5.2004
Nachtrag:
Montag, 1. November 2004
13
Notizzettel in Philippa Murrays Tagebuch
Montag, 3. Januar 2005
14
Philippa Murrays Tagebuch
Montag, 21.11.2005
Nachtrag:
Mittwoch, 30.11.2005
Freitag, 2.12.2005
Montag, 5.12.2005
Dienstag, 6.12.2005
Mittwoch, 7.12.2005
15
Philippa Murrays Tagebuch
Freitag, 9.12.2005
Dienstag, 14.3.2006
Samstag, 22.7.2006
16
Auszug aus Philippa Murrays Tagebuch
Sonntag, 13.5.2007
Montag, 14.5.2007
17
Philippa Murrays Tagebuch
Dienstag, 15.5.2007
Nachtrag:
Nachtrag 2:
18
Philippa Murrays Tagebuch
Dienstag, 29.5.2007
19
Philippa Murrays Tagebuch
Freitag, 1.6.2007
20
Philippa Murrays Tagebuch
Samstag, 1.9.2007
Samstag, 4. Dezember 2010
21
Philippa Murrays Tagebuch
Montag, 29.11.2010
22
Pippa
Philippa Murray
†30. November 2010
Freitag, 5. März 2011
23
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Philippa Murrays Tagebuch
Donnerstag, 11.12.2003
Ich muss die kaputte Scheibe endlich austauschen. Man kann noch das Blut sehen, wenn man genau hinsieht. Aber mir haben bisher die Nerven dazu gefehlt.
Seit Dienstag ist er nicht mehr nach Hause gekommen.
Ich habe in drei Tagen Geburtstag.
Kein guter Zeitpunkt, um sitzen gelassen zu werden.
Die Arbeit lenkt mich ab. Ich bin den ganzen Tag unterwegs. Alle lassen ihre Klaviere und Flügel vor Weihnachten stimmen. Ich habe sogar den Auftrag für die Instrumente der Universität bekommen. Sehr kurzfristig, vermutlich, weil jemand abgesprungen ist. Kann mir egal sein.
Ich komme erst abends zum Nachdenken. Natürlich schlafe ich schlecht. Aber ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich habe alle Krankenhäuser abtelefoniert, sogar bis runter nach Newcastle. Ich habe bei der Polizei nachgefragt, ob bei ihnen ein Unfall gemeldet wurde. Heute war ich bei seinen Kollegen und habe nach ihm gefragt. Er ist seit zwei Tagen nicht zur Arbeit erschienen. Sie sagten, er habe sich krankgemeldet. Ich habe daraufhin noch einmal alle Krankenhäuser in Edinburgh angerufen. Nichts.
Ich werde noch wahnsinnig.
Vorhin war Pete da und hat nach ihm gefragt. Normalerweise meldet sich Sean einmal in der Woche bei seinem Vater, mindestens. Als ich Pete sagen wollte, was los war, musste ich weinen. Zum ersten Mal, seit er weg ist, habe ich geweint, und es hat gutgetan.
»Ich glaube nicht, dass er dich verlassen hat«, sagte Pete. »Bestimmt gibt es eine ganz einfache Erklärung. Und wenn ihm was wirklich Schlimmes zugestoßen wäre, hätte man uns doch informiert.«
Das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um mit ihm darüber zu reden, was wirklich passiert war, aber ich schaffte es nicht. Stattdessen sagte ich nur: »Nein. Er ist einfach weg.«
Pete sagte mir, dass mich Sean viel zu sehr liebt, um mich zu verlassen, und irgendwie will ich ihm das auch glauben. Er ist jetzt bei der Polizei, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Ich habe mich nicht getraut, das zu tun. Schon als ich mich danach erkundigt habe, ob ein Sean Butler einen Unfall gehabt haben könnte, weil er nicht nach Hause gekommen ist, haben die Polizisten die Augenbrauen hochgezogen. Sie dachten sicher: Das ist eine von diesen hysterischen Weibern, die nicht wahrhaben wollen, dass sie sitzen gelassen wurden.
Telefon!
Es war meine Mutter.
»Du hast in drei Tagen Geburtstag«, sagte sie.
»Gut, dass du mich erinnerst«, sagte ich.
Sie stöhnte, und ich konnte mir vorstellen, wie sie sich mit dem Zeigefinger die Schläfe massierte, die Augen geschlossen. »Ich rufe an, weil ich wissen will, ob du dir etwas von uns wünschst.«
»Nein.«
»Gut. Dein Vater hat nämlich ausdrücklich gesagt, er wird dir dieses Jahr kein Geld überweisen, weil du es sowieso wieder zurückschickst.«
»Da hat er in den letzten zehn Jahren tatsächlich was dazugelernt.«
»Du bist wirklich nicht normal.«
»Danke.« Nein, wirklich, es freut mich. Ihre Definition von »normal« ist nicht erstrebenswert.
Sie seufzte wieder. »Du feierst mit … Sean?«
»Höchstwahrscheinlich.«
Noch zwei, drei Floskeln, ein angeblicher Gruß von »deiner lieben Schwester« (Dana lässt mich nie grüßen, Mutter tut aber immer so), und wir beendeten die Quälerei in beidseitigem Einvernehmen. Ich hasse es, mit ihr zu telefonieren, und sie hat schließlich auch interessantere Zeitvertreibe. Sich mit ihren Freundinnen im Golfclub an der Bar festhalten, zum Beispiel.
Ich habe ihr nicht gesagt, dass Sean verschwunden ist, sie hätte sonst nur wieder angefangen mit dem Üblichen »Ich hab dir doch gleich gesagt, er wird nur Ärger machen«-Mist.
Montag, 29. November 2010
1
Menschen, die seine Privatnummer kannten: fünf.
Davon Menschen, über deren Anruf er sich freuen würde: null.
Schon gar nicht abends um halb zehn. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine gute Nachricht handelte, war: keine. Normalerweise rief man ihn auf seinem Handy an oder schrieb ihm eine Mail auf seinen geschäftlichen Account.
Cedric sah auf das Display: seine Stiefmutter. Er wünschte sich, er könnte neben dem Telefon sitzen und es ignorieren, bis Lillian aufgab. Zwei Dinge, die nicht passieren würden: Erstens, Lillian gab auf, obwohl sie die Gelegenheit hatte, ihm auf die Nerven zu gehen. Zweitens, Cedric ignorierte einen Anruf. Das Gefühl, etwas Wichtiges verpasst zu haben, würde ihn die ganze Nacht wachhalten. Gegen besseres Wissen.
Also ging er ans Telefon.
»Sean«, sagte sie. Oder etwas, das so ähnlich klang. Ihre Stimme war rau und dunkel.
»Lillian, was soll das? Bist du betrunken?« Nicht unwahrscheinlich.
Lillian sagte nichts. Oder vielleicht sagte sie so etwas wie »Oh«, er war sich nicht ganz sicher und drückte den Hörer fester gegen sein Ohr.
»Lillian? Was ist los?«
Nichts.
»Ist jemand bei dir?«
Nichts.
»Würdest du bitte antworten? Wenn du schon bei mir anrufst, könntest du wenigstens was sagen.«
Er hörte sie schwer atmen. Dann war es still, und die Leitung war tot.
Schlimmer noch, als nicht ans Telefon zu gehen, fand Cedric Fragen, auf die man ihm keine Antwort gab. Es brachte ihn um den Schlaf. Das, und abgebrochene Gespräche. Und noch einiges mehr.
Cedric rief zurück, aber Lillian ging nicht dran. Nach einer Minute rief er noch mal an. Zehn Mal hintereinander, immer mit einer Pause von etwa einer Minute. Dann versuchte er es auf Lillians Handy. Auch da bekam er keine Antwort.
Er versuchte es wieder auf dem Festnetz. Wieder zehn Mal hintereinander. Noch mal das Handy.
Eine halbe Stunde später saß er in seinem Mercedes, ließ Edinburgh hinter sich und fuhr auf die Forth Road Bridge zu, die ihn nach Fife brachte.
Fife, Halbinsel zwischen dem Firth of Forth und dem Firth of Tay, nördlich von Edinburgh und südlich von Dundee. Eintausenddreihundert Quadratkilometer Fläche (ungefähr), knapp über dreihundertfünfzigtausend Einwohner. Verwaltungssitz: Glenrothes, keine vierzigtausend Einwohner.
Fakten beruhigten ihn.
Lillian hatte sich wenige Monate nach der Geburt mit dem Baby in ihr Landhaus in Fife zurückgezogen. Nach dem Verschwinden seines Vaters war sie so gut wie nie da gewesen, nach seinem Tod hatte sie davon gesprochen, es zu verkaufen, weil sie es, Zitat, garantiert nie wieder betreten würde. So viel zu dem Thema. Etwa eine Stunde rechnete Cedric für die Fahrtzeit, was ihm sein Navigationsgerät bestätigte.
Mit Schnee rechnete er nicht.
Er reagierte so gut wie nie auf die Wettervorhersage. BBC Weather hatte seinem Empfinden nach eine Trefferquote von deutlich unter fünfzig Prozent, und da er selten das Haus verließ, interessierten ihn die Witterungsverhältnisse nur mäßig. Heute hatte er sich mit dem Thema noch gar nicht befasst. Andererseits: Er wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch losgefahren, wenn man eisglatte Straßen und hühnereigroße Hagelkörner vorhergesagt hätte.
Eine unbeantwortete Frage konnte er nicht aushalten.
Er war davon überzeugt, dass Lillian nur deshalb aufgelegt hatte, um ihn zu provozieren. Sicher hatte sie getrunken, und dann war ihr – nach fast einem Jahr des Schweigens – eingefallen, dass sie ihren Stiefsohn auf dieselbe Art quälen könnte, wie es sein Vater manchmal getan hatte. Sein Vater hatte, wenn er sich einen anderen Gesprächsverlauf gewünscht hätte, einfach mitten im Satz aufgelegt und war anschließend nicht mehr ans Telefon gegangen. Seine Art, Cedric dazu zu bringen, persönlich aufzutauchen und das Gespräch von Angesicht zu Angesicht weiterzuführen. Ein einfaches »Bitte komm vorbei« hätte Cedric ablehnen können.
Aber warum wollte sie ihn sehen? Gab es etwas zu bereden, von dem die Anwälte nichts erfahren sollten? War die Frau bereit zu verhandeln?
Cedric hatte sich dem Tempo der anderen Fahrzeuge angepasst und war langsam über die Brücke gerollt. Als er auf die Autobahn kam, war nur noch Schritttempo möglich, und wenige hundert Meter weiter kam der Verkehr ganz zum Stillstand.
Cedric sah aus dem Seitenfenster. Die dicht fallenden Schneeflocken hatten einen Durchmesser von zwei Zentimetern.
Alle Schneeflocken bestehen aus durch Wassertropfen miteinander verklebten Eiskristallen. Eiskristalle sind streng hexagonal und allein durch ihre Perfektion das Schönste auf dieser Welt. Schneeflocken fallen unabhängig von ihrer Größe mit einer Geschwindigkeit von vier Kilometern pro Stunde. Ihr Gewicht müsste man in Milligramm messen. Wenn sie auf Wasser treffen, klirren sie wie zerschellendes Glas. Allerdings in einer Frequenz von circa einhundert Kilohertz, was Menschen nicht hören können.
Die Welt um Cedric herum versank in Watte, die aus dem schwarzen Himmel fiel. Er sah den Flocken zu, wünschte sich, von ihnen hypnotisiert zu werden, wünschte sich auch, alle würden die Lichter und die Motoren ausschalten, aber nichts davon geschah.
Hinter ihm hupte jemand. Niemand ging darauf ein. Danach wirkte das Rattern der Motoren wie ein sanftes Schnurren. Cedric schaltete das Radio ein und erfuhr, dass ein LKW querstand. Es musste eben erst passiert sein und war von jemandem gemeldet worden, der mit ihm festsaß. Er schloss die Augen und dachte an Lillian und warum er sie noch nie hatte leiden können. Die beste Antwort? Instinkt. Wie ein Tier, das den Feind roch, hatte er sie von dem Moment an abgelehnt, als sein Vater sie ihm vorgestellt hatte. Sie passt zu ihm, hatte er damals gedacht.
Aber Instinkt war etwas, das nicht zu Cedric passte, weshalb ihm die spontane Antipathie bis heute ein Rätsel blieb.
Die Schneeflocken wurden blau. Von hinten kamen Rettungsfahrzeuge und Polizei. Sie fuhren langsam an ihm vorbei, und er schätzte, dass der LKW gute fünfhundert Meter vor ihm stehen musste. Einige Minuten später färbten sich die Flocken orange. Ein Abschleppwagen schob sich in Zentimeterarbeit durch die wartenden Autos. Im Radio sprachen sie über den überraschenden Wintereinbruch und wann es zuletzt in einem November so heftig geschneit hatte. Cedric hörte nur halb zu, während er in die Schneeflocken starrte, bis sie ihn doch endlich in eine Art Trance versetzten.
Als er aus ihr erwachte, bemerkte er, dass sich weitere Wünsche wenigstens ein bisschen erfüllt hatten: Die meisten Motoren waren abgestellt worden. Der Schnee fiel weiter, ohne dass sich etwas geändert hätte. Der Durchmesser blieb bei zwei Zentimetern, die Fallgeschwindigkeit änderte sich nicht. Und es war windstill.
Es war in Schottland nie windstill.
Er sah, wie die Schneeflocken immer langsamer fielen, bis sie in der Luft schweben blieben.
Er spürte, wie sein Körper nur noch Herzschlag war. Laut, fest und langsam.
Er wusste nicht mehr, wie man atmete.
Und dann hörte er die Schneeflocken. Sie klirrten auf die Windschutzscheibe und ließen sie zerspringen. Sein Herz raste, er atmete zu schnell, sah Schwarz, fühlte, wie der Fahrersitz anfing zu schwanken.
Routine: auf die Atmung achten. Mit beiden Füßen Kontakt zum Boden. Die Hände flach irgendwo auflegen. Atmen. Atmen, bis die Welt aufhörte zu tanzen.
Die Schneeflocken klirrten nicht mehr. Die Windschutzscheibe war vollkommen in Ordnung. Wie um es sich endgültig zu beweisen, ließ Cedric die Scheibenwischer an. Dann tastete er nach dem Handschuhfach, zwang seine Finger, es zu öffnen. Er musste die Handschuhe ausziehen, die Flasche mit seinen Tabletten aufschrauben und sich eine davon unter die Zunge zu legen.
In ein paar Minuten würde sie wirken. Bis dahin musste er sich konzentrieren. Er ballte die Hände zu Fäusten und spannte einige Sekunden lang die Muskeln im Unterarm an, dann entspannte er sie und atmete tief aus. Als Nächstes spannte er die Oberarmmuskeln an. Dann die Muskulatur an den Schultern. Er ging seinen gesamten Körper bis zu den Füßen durch, so lange, bis er die Wirkung des Medikaments spüren konnte.
Der Westwind ließ die Schneeflocken tanzen, und Cedrics Puls war wieder normal. Er nahm sein Handy, prüfte, ob er Empfang hatte, versuchte wieder, Lillian anzurufen. Immer noch ohne Erfolg. Dann ging er ins Internet und checkte seine Mails. Während es nur fünf Leute gab, die seine private Telefonnummer hatten, war er mit seiner privaten Mailadresse etwas freigiebiger. Sie bestand aus einer komplizierten Abfolge von Zahlen und Buchstaben, die keine Rückschlüsse auf seine Identität zuließen, was ihm erlaubte, sich für Newsletter einzutragen, die ihn interessierten. Es waren nicht viele.
Gegen zwölf setzten sich die Wagen vor ihm langsam in Bewegung. Er startete den Motor und folgte. Die Polizei hatte die Unfallstelle abgesperrt, der LKW stand noch immer quer, aber eine kleine Gasse am Mittelstreifen entlang war frei. Cedric manövrierte seinen Mercedes hindurch und sah, wie sich der Fahrer des Abschleppwagens mit jemandem unterhielt, der im offenen Rettungswagen saß. Der Pannenfahrer sprang auf der Stelle, um sich warm zu halten. Er hielt eine Hand schützend über die Augen.
Cedric nahm die Ausfahrt zur A 92 in Richtung Kirkcaldy, vorbei an Cowdenbeath, Lochgelly und Cardenden, Ortschaften, von denen er nichts sah, weil es zu dunkel war und der Schnee immer noch dicht und unablässig fiel. Er stellte das Fernlicht an, weil er keinen Gegenverkehr hatte, aber dadurch schienen die Flocken nur noch schneller auf ihn zuzurasen, obwohl er kaum mehr als zwanzig fuhr. Also machte er es wieder aus. Er quälte sich weiter Richtung Leven, kam endlich nach Upper Largo, die Straßen wurden schmaler, er musste noch langsamer fahren. Mittlerweile war außer ihm niemand mehr unterwegs. Die kurvige, ansteigende Strecke, die zu dem Landhaus führte, das einmal seinem Vater gehört hatte, ließ ihn fast scheitern. Zweimal drehten die Reifen durch, weil die Straße vereist war, und die Privatstraße zum Anwesen wäre noch eine Tablette wert gewesen. Er redete sich ein, es gleich geschafft zu haben. Die geschlossene, unberührte Schneedecke strahlte eine Ruhe aus, die langsam Besitz von ihm ergriff. Das Landhaus wirkte friedlich, und Cedric hielt an, bevor er auf den Hof fuhr, um den Anblick wirken zu lassen. Reiner, weißer, unberührter Schnee machte ihn glücklich. Er verbarg Dreck und Unordnung.
Bis die ersten Fußspuren gemacht waren, bis der Dreck sich an die Oberfläche gearbeitet und den Schnee graubraun gemacht hatte.
Cedric fuhr auf das Haus zu. Im Wohnzimmer brannte warmes Licht: eine Stehlampe und eine Tischlampe, so viel konnte er von außen sagen. Eines der oberen Zimmer war hell erleuchtet. Lillian war also noch wach. Es war mittlerweile fast halb zwei. Er parkte, öffnete die Fahrertür, wusste nicht, wie er aussteigen sollte, weil er den Schnee nicht stören wollte, stieg dann endlich aus und vermied es, auf den Boden zu schauen. Auf dem Weg zur Tür musste er sich gegen den plötzlich auffrischenden Wind stemmen.
Das Landhaus lag zwischen zwei Hügeln mit Blick auf die Mündung des Firth of Forth, aber der Wind wurde nur zum Problem, wenn er drehte und aus Osten kam. Noch kam er aus Westen.
Lillian reagierte nicht auf sein Klopfen. Er wartete, klopfte wieder, wartete, klopfte, benutzte den Schlüssel, den er immer noch hatte. Streifte die Sohlen an der Fußmatte ab, bis sie trocken waren und keine Abdrücke mehr hinterließen. Er rief ihren Namen, bekam keine Antwort. Der Gedanke, dass etwas nicht stimmte, kam ihm erst in diesem Moment. Lillian bedeutete immer eine Katastrophe. Für ihn. Sie selbst schien unantastbar. Immer im richtigen Moment am richtigen Ort.
Auch nachdem der Tod seines Vaters festgestellt worden war: Fast der gesamte Besitz ging an sie. Sie würde die Macht haben, Cedric alles zu nehmen, ihn aus dem Haus zu werfen, in dem er lebte, ihn auf direktem Weg ins Elend zu stürzen. Er ertrug sein Leben, wie es war, gerade so. Sie wusste, welcher Veränderungen es bedurfte, um ihn zu quälen. Einer ihrer Anwälte hatte sogar durchblicken lassen, Lillian sei in Besitz medizinischer Gutachten, die besagten, dass Cedrics Gesundheit eine führende Rolle in den Firmen seines Vaters nicht zuließe. Jede Entscheidung, die er in den vergangenen Jahren getroffen hatte, sollte neu bewertet werden. Seine Stiefmutter war in den Krieg gezogen und hatte nicht nur eine Schlacht gewonnen, sondern alles für sich entschieden.
Er rief wieder nach ihr. Nichts. Nur Musik aus dem Wohnzimmer. Er ging hinein, sah, dass der Fernseher angeschaltet war. Das Menü irgendeiner DVD hing auf dem Bildschirm in einer Endlosschleife. Cedric sah die grinsenden Hauptdarsteller und den Titel des Films, konnte aber nichts damit anfangen. Die Titelmusik plärrte ihn an. Er sah sich nach der Fernbedienung um und fand seine Stiefmutter.
Lillian lag in einem Sessel und schlief.
Er wollte glauben, dass sie schlief.
Ihr Kopf war auf die rechte Schulter gefallen, das Haar hing vor ihrem Gesicht, die Arme lagen schlaff in ihrem Schoß, die Beine hatte sie weit von sich gestreckt.
Er sagte ihren Namen, trat näher an sie heran. Sah die Fernbedienung und schaltete den Ton ab. Dann überlegte er es sich anders und schaltete die gesamte Anlage aus. Die Fernbedienung legte er exakt auf die Stelle, von der er sie genommen hatte. Er schob sie noch zwei Millimeter zurück, um ganz sicher zu sein, dass sie richtig lag. Jetzt gab es nichts mehr, das ihn davon abhielt, Lillian anzusehen.
Wieder sagte er ihren Namen.
Er kam noch näher, er hätte sie berühren können, wenn er den Arm ausstreckte. Aber er berührte nicht sie, sondern den Sessel.
Sagte ihren Namen.
Cedric rüttelte am Sessel. Zögerte, ging um den Sessel herum und berührte ihren Knöchel mit der Schuhspitze. Einer ihrer Pumps fiel vom Fuß. Sie schlief weiter. Wobei er längst wusste, dass sie nicht schlief.
Er sah sich im Zimmer um: Es hatte sich vieles verändert, seit er das letzte Mal hier gewesen war. Lillian hatte die Einrichtung der Londoner Wohnung herschaffen lassen. Teppiche lagen übereinandergestapelt, Bilder standen gegen die Wand gelehnt am Boden, zu viele Lampen, Uhren, Spiegel, Stühle, Kommoden, zu viel von allem. Als hätte sie die Dinge gehortet, um sie vor ihm zu verstecken.
Er trat näher heran, beugte sich über sie, streckte seine Hand nach ihrem Gesicht aus und schob das blonde Haar zur Seite.
Zunächst sah er nur eine weitere Schicht ihres Haars, doch die klebte an Lillians Kopf fest.
War sie es überhaupt?
Er sah die blutige Masse, aus der ein Auge hervortrat, gleich unter dem freiliegenden Stück Knochen, wo die Braue hätte sein müssen. Nase und Mund waren verschoben, oder es war das Blut, das die Perspektive verzerrte. Er war längst zurückgewichen, stand gegen den Kamin gepresst, das blonde Haar verdeckte wieder, was er gerade gesehen hatte, und doch sah er es noch immer vor sich.
»Lillian«, sagte er. Natürlich war sie es, wer sonst. Er wandte den Blick ab, drehte sich weg, sah auf die Steinkante des Kamins. An ihr klebte Blut. Auf dem Boden war Blut. Er war hineingetreten, hatte sich dagegengelehnt, hatte ihr Blut nun an den Schuhen und am Mantel. Cedric rannte aus dem Wohnzimmer, schaffte es bis an den Fuß der Treppe, danach keinen Zentimeter weiter. Er ließ sich auf die unterste Stufe fallen und weinte.
»Sir, wir werden eine Weile brauchen«, sagte ihm die Frau von der Notrufzentrale, nachdem er alles erklärt, alles beantwortet hatte.
»Ja, das Wetter«, sagte er.
»Bitte rühren Sie nichts an.«
»Das haben Sie schon gesagt. Ich habe bereits alles berührt.«
»Ist noch jemand bei Ihnen?«
»Ich bin allein.«
»Können Sie abschließen und bei Nachbarn warten? Ist das möglich?«
»Es gibt keine Nachbarn.«
»Und Sie sind sicher, dass niemand mehr im Haus ist?«
»Ich werde hier warten, ich werde nichts weiter anrühren«, sagte er ungeduldig. Er beendete das Gespräch und sah auf seine Füße. Die Schuhe hatte er neben die Treppe gestellt, den Mantel zusammengefaltet und daraufgelegt. Man würde ihm die Sachen abnehmen, um sie zu untersuchen. Man würde sie ihm dann vielleicht zurückgeben, aber er könnte sie nie wieder tragen …
Und dann fiel es ihm ein: das hell erleuchtete Fenster im ersten Stock.
Er ging hinauf. Die Tür zum Kinderzimmer stand offen, und er sah William im Bett. Es war das erste Mal, dass er ihn sah.
William saß mit dem Rücken zur Tür und schien still zu spielen. Cedric klopfte an den Türrahmen, aber das Kind reagierte nicht. Er ging auf sein Bettchen zu und sagte: »William?«
Erst als er aus Versehen mit dem Fuß gegen das Bett stieß, drehte sich das Kind zu ihm um. Lachte ihn an. Streckte ihm die Puppe entgegen, mit der es gespielt hatte. William sah aus wie sein Vater. Stolz wäre er gewesen, wenn er das noch hätte erleben können, dachte Cedric. Wenigstens einer seiner Söhne sah ihm ähnlich. Dieselben Augen, dieselben Gesichtszüge. Derselbe Vorname.
»William, musst du nicht schlafen?«, fragte Cedric. Er brachte es nicht über sich, die Puppe entgegenzunehmen. Oder das Kind anzufassen. Obwohl er immer noch Handschuhe trug. Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück, als William sich aufrichtete und mit der Puppe bis an die Gitterstäbe des Bettchens kam.
»Gleich kommt jemand, der sich um dich kümmert«, sagte Cedric und merkte selbst, wie fremd er klang.
William schwenkte die Puppe und sah verunsichert aus.
»Es kommt bestimmt jemand«, sagte Cedric, diesmal ganz langsam und deutlich, und wunderte sich, warum das Kind nicht reagierte. Er hatte keine Ahnung, ab wann Kinder zu sprechen lernten. Anderthalb schien ihm aber das richtige Alter zu sein, um Verständnis zu signalisieren. Vielleicht irrte er sich auch.
Der Junge gab es auf, Cedric die Puppe hinzuhalten. Er ließ sie auf den Boden vor dem Gitterbett fallen und verzog das Gesicht.
»Ich bin sicher, dass es nicht mehr lange dauert, bis jemand kommt und mit dir spielt«, sagte Cedric und verfluchte sich dafür, das Fläschchen mit den Tabletten im Wagen gelassen zu haben. Seine Hände fingen an zu zittern, sein Herz schlug zu schnell, und das Rauschen in den Ohren wurde lauter.
Aber das Rauschen war nicht nur in seinen Ohren. Er hörte wirklich den Wind, wie er draußen aufheulte. Ostwind. Äste schlugen gegen das Fenster. Cedric ging auf den Flur und sah in die anderen Zimmer. Überall war es dunkel, und es schien sich niemand mehr im Haus aufzuhalten. Jedenfalls nicht hier oben. Er musste zum Wagen. Es würde nicht lange dauern. Er brauchte Schuhe. Er könnte seine Schuhe noch einmal anziehen, nur um die Tabletten zu holen. Wenn er es über sich bringen konnte, die Schuhe anzuziehen.
Schuhe mit Lillians Blut.
Im Wagen waren Tabletten, die ihm halfen, das alles durchzustehen.
Aber Schuhe mit Lillians Blut …
Die zweite Tablette dämpfte ihn noch mehr, sodass die Angst und die Aufregung etwas von ihm wegrückten. Er zog die Schuhe aus, stellte sie neben die Treppe, legte seinen Mantel darauf, ging die Treppe hinauf, zurück ins Kinderzimmer. Ihm fiel ein, was sie am Telefon gesagt hatte: Sean. War das der Name ihres Mörders? Er konnte sich nicht richtig konzentrieren, weil er langsam müde wurde. William spielte jetzt mit einem Teddy und machte schmatzende Geräusche mit seinen Lippen. Ob sich Cedric einfach auf das Sofa legen konnte, bis die Polizei kam? Es war ein großes, weißes Sofa, überladen mit Kissen, Kinderspielzeug und Stofftieren. Daneben ein Schaukelpferd, das einmal ihm gehört hatte. Eine Holzeisenbahn. Noch mehr Stofftiere, alte und neue. Lillian hatte nicht nur die Londoner Wohnung, sondern auch noch den Speicher leergeräumt, in dem die Sachen aus seiner Kindheit gelagert waren. Er fragte sich, ob sie die Finger von den Erinnerungen an seine Mutter gelassen hatte. Ob es diese Dinge noch gab. Er starrte auf das Sofa, sehnte sich danach, sich zurückzulehnen, auszuruhen, konnte sich aber nicht überwinden, weil er daran denken musste, dass Lillian dort gesessen hatte. Die Kissen, das Spielzeug berührt hatte.
Und dann klirrte Glas. Keine Schneeflocken, die auf die Frontscheibe fielen. Ein dicker Ast hatte das alte Fenster zerschlagen. Eisige Luft blies in das Zimmer.
Cedric sah nach William und sagte: »Wir gehen besser raus, du wirst sonst krank.« Aber der kleine Junge saß friedlich in seinem Bettchen und ließ den Teddy über seine Beine hopsen. Erst als ein kalter Windstoß über sein Haar wehte, sah der Kleine verwundert auf und drehte seinen Kopf in alle Richtungen.
»William?«, rief Cedric.
William lachte seinen Teddy an.
»William!«
Der Junge spielte weiter.
Verstört sah er das Kind an, starrte so lange, bis es nach einem weiteren Windstoß endlich doch den Kopf hob und in Richtung des kaputten Fensters sah. Dann drehte es sich zu Cedric und zeigte auf das Fenster.
Und er sagte immer noch keinen Ton.
Philippa Murrays Tagebuch
Freitag, 12.12.2003
Die Polizei war bei mir. Sie kamen in die Werkstatt. Angeblich haben sie versucht, mich anzurufen, um sich anzukündigen. Ich hatte gerade einen Kunden da. Der ältere der beiden Polizisten stellte sich und seinen Kollegen vor (ich habe die Namen wieder vergessen, aber ein Sergeant und ein Constable, glaube ich) und sagte: »Philippa Murray? Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen, Sie wissen, worum es geht?« Und schon hatte ich keine Kundschaft mehr.
Sie wollten wissen, wer der Mann gewesen war.
»Ein Kunde«, sagte ich.
»Hat der einen Namen?« Der Ältere sprach mit mir, von dem anderen hörte ich kein Wort. Er schlenderte nur herum und schaute in jede Ecke, ohne etwas anzufassen. Er könnte in meinem Alter gewesen sein, vielleicht auch zwei, drei Jahre jünger. Sein Kollege ist schätzungsweise Mitte dreißig.
»Professor McLean.«
»Und Sie stimmen sein Klavier?«
»Alle seine Klaviere. Und auch die Flügel.«
Das Gesicht des Sergeants wurde für eine Sekunde komisch, aber dann traute er sich bei allem Machogetue doch nicht nachzufragen, sondern nickte nur, als wüsste er genau, worum es geht.
Ich erlöste ihn: »An der Uni.«
»Ah. Also, wir sind hier wegen Sean Butler. Ihr Freund, richtig?«
Ich nickte und setzte mich auf eine Klavierbank, weil ich merkte, wie meine Knie weich wurden. Hatten sie ihn gefunden? Der Gedanke kam mir erst in diesem Moment.
»Ist er … Ist ihm etwas zugestoßen?«, fragte ich.
»Glauben Sie das?«
Da wusste ich, dass sie nicht hier waren, um mir die Nachricht von Seans Tod zu überbringen. Ich sagte nichts.
»Sein Vater hat ihn als vermisst gemeldet. Er sagt, Sie hätten ihm mitgeteilt, dass Sean bereits seit dem 9. verschwunden ist, richtig?«
Ich nickte.
»Warum sind Sie nicht zu uns gekommen?«
»Ich war bei der Polizei.« Ich erzählte es ihm.
»Sie hätten gleich eine Vermisstenanzeige aufgeben können. Falls ihm tatsächlich etwas zugestoßen ist, haben wir wertvolle Zeit verloren. Wir müssen aber zunächst prüfen, ob es wirklich Gründe gibt, sich Sorgen zu machen.« Er setzte sich auch auf eine Klavierbank. Ich schaffte es nicht, ihm zu sagen, dass das Ding jeden Moment zusammenkrachen konnte.
Der Sergeant stellte viele Fragen. Er wollte herausfinden, ob Sean mich sitzen gelassen hat. Natürlich sagte er das nicht so. Aber er stelzte umständlich um diese Formulierung herum. Sagte was von »ausschließen, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist« und »prüfen, welche Schritte einzuleiten sind«.
»Sean hat nichts von seinen persönlichen Sachen mitgenommen«, sagte ich.
»Wie lange wohnen Sie schon zusammen?«
»Ein halbes Jahr etwa.«
»Das ist noch nicht sehr lange.«
»Wir kennen uns schon länger.«
»Hatte Ihr Freund Probleme auf der Arbeit? Er ist Aushilfe bei Tesco, richtig?«
Ich nickte. Schüttelte dann den Kopf. »Ja, bei Tesco. Nein, keine Probleme. Er hatte auch mit niemandem Streit, und ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum er einfach so gegangen sein sollte.« Ich wollte nicht.
Der Sergeant drückte seinen Rücken durch, und die Klavierbank unter ihm fing an zu knarzen. Sein Kollege hatte den Kopf in einen offenen Flügel gesteckt und zupfte an den Saiten herum. Es war ein dreißig Jahre alter Yamaha, und ich hatte ihn noch nicht neu temperiert. Von mir aus konnte er ruhig weiterzupfen. Den Sergeant schien es auch nicht zu stören.
»Erzählen Sie mir von Ihrer Beziehung? Wie haben Sie sich kennengelernt?« Jetzt lehnte sich der Sergeant zurück, und wieder knarzte die Klavierbank. Ich stellte mir vor, wie sie unter ihm zusammenbrechen würde.
»Ich war einige Jahre im Ausland. Dann bin ich zurück nach England gekommen, wohnte bei meinen Eltern in Plymouth und lernte Sean kennen. Er jobbte in der Firma meines Vaters. Wir verliebten uns, er ging zurück nach Schottland, eine Weile hatten wir eine Fernbeziehung, und dann erzählte er mir, dass es hier in Edinburgh einen älteren Herrn gäbe, der seine Klavierwerkstatt verkaufen wollte und einen Nachfolger suchte. Wir zogen zusammen in die Wohnung, die zur Werkstatt gehört, waren sehr glücklich, und jetzt ist er verschwunden.«
Der Sergeant nickte gedankenverloren. »Ja, ja … klingt plausibel …«, murmelte er. Und dann: »Mehr haben Sie uns nicht zu sagen?«
»Ich habe ihn zuletzt am Dienstag gesehen, als er morgens zur Arbeit gegangen ist.«
»Und als er abends nicht zurückkam, haben Sie versucht, ihn anzurufen?«
Ich zögerte, vielleicht etwas zu lange. »Nein. Ich dachte, vielleicht ist er mit Freunden unterwegs.«
»Und als er die ganze Nacht nicht nach Hause kam?«
»Ich bin irgendwann eingeschlafen und habe es erst am nächsten Morgen bemerkt. Ich dachte, er hätte zu viel getrunken und bei einem Freund übernachtet.«
Der Sergeant lächelte sanft und sah zu, wie der Constable die Finger über die schwarzen Tasten eines Steinways gleiten ließ, ohne sie herunterzudrücken. »Wann haben Sie versucht, ihn anzurufen?«
»Gleich am Mittwochmittag.« Zu schnell gesagt. »Nachmittag vielleicht. Er ging nicht ran, ich dachte, er sei auf der Arbeit.«
»Lassen Sie mich mal so fragen: Wann haben Sie angefangen, sich wirklich Sorgen zu machen?«
Ich hob die Schultern. »Mittwochabend. Ich habe alle Krankenhäuser durchtelefoniert …«
»Am Donnerstag.«
»Nein, am Mittwoch. Krankenhäuser bis runter nach Newcastle, bis Glasgow, bis Inverness, einfach überall.«
Er stand auf, und die Klavierbank krachte zusammen. Die beiden Polizisten starrten auf die Trümmer.
»Dann sind wir fertig?«, fragte ich.
Der Sergeant überlegte offenbar, ob er den Vorfall ansprechen sollte, aber da ich es nicht tat, sagte er: »Ja, sicher, also dann, danke, Ms Murray. Wir melden uns wieder bei Ihnen.«
Ich stand auf, um die beiden hinauszubegleiten. Der Constable schnippte mit den Fingern gegen eine Stimmgabel. Und jetzt sagte er zum ersten Mal etwas. Er sagte: »Oder wollen Sie uns noch erzählen, warum Sie sich am Montag mit ihm gestritten haben?«
Sonntag, 14.12.2003
Die schwachsinnigste aller Ideen: mit achtundzwanzig den Geburtstag mit der Familie zu feiern.
Ich hatte es zu Hause nicht mehr ausgehalten und war zum Flughafen gefahren. Es gab noch einen Flug nach Exeter, und meine Mutter holte mich dort ab. Erst sprachen wir nur über ganz belanglose Dinge. Neutrale Themen. Wie der Flug war. Ob ich mir etwas Besonderes zum Essen wünsche. Und wie das Wetter in Edinburgh so war.
Das Wichtige überließ sie wie immer meinem Vater.
»Wo ist dein nutzloser Freund?«, fragte er, noch bevor er mir zur Begrüßung die Hand schüttelte.
Ich ging rauf in mein altes Kinderzimmer, stellte meine Tasche ab, setzte mich aufs Bett und atmete ganz tief und ruhig durch. Es sind meine Eltern, dachte ich. Es sind immer noch meine Eltern. Sind Familienbindungen nicht die stärksten, wenn es drauf ankommt? Ich versuchte, mir Mut zu machen, dann ging ich runter. Maria servierte gerade Tee und Kuchen. Mutter saß auf dem Sofa und rieb sich die Schläfen. Sie bekommt von mir seit achtundzwanzig Jahren Kopfschmerzen. Ich hätte daran gewöhnt sein müssen. Vater stand vor dem Panoramafenster, die Hände in den Hosentaschen, und starrte auf die grauen Wellen des Ärmelkanals. Erst als Maria gegangen war und ich mich gesetzt hatte, drehte er sich zu mir um.
»Hat er dich sitzen lassen?«, fragte er.
»Er wird vermisst.«
Mutters angestrengter Gesichtsausdruck veränderte sich kein bisschen.
»Was soll das heißen, er wird vermisst?«, fragte Vater ungeduldig.
»Er ist weg. Ging zur Arbeit und tauchte nicht mehr auf. Das war am Dienstag. Sein Vater war schon bei der Polizei. Ich habe alle Krankenhäuser angerufen, aber …«
»Hat er eine andere?« Jetzt stand er wieder mit dem Rücken zu mir und sah aufs Wasser. »Wahrscheinlich hat er eine andere, bei der schneller was zu holen ist. Hat ihm wohl zu lange gedauert, bis du dein Erbe antrittst. Hat ihm wohl nicht gepasst, dass dir dein Daddy nicht das Geld hinterherwirft, damit der feine Herr ein schönes Leben hat. Ich hab’s ja von Anfang an gesagt.«
»Ich auch«, sagte Mutter. Langer Seufzer, Augen geschlossen.
»Deshalb bekommst du dieses Jahr auch kein Geld von mir zum Geburtstag. Wäre ja noch schöner.«
»Mutter hat gesagt, du schickst mir dieses Jahr kein Geld, weil ich es sowieso immer zurückschicke«, sagte ich, aber solche Sachen prallen an ihm ab wie Fett an Teflon.
»Wenn du ein bisschen mehr wie deine Schwester wärst«, sagte Vater.
»Tablettenabhängig und kaufsüchtig?«
Meine Mutter hörte auf, an ihrer Schläfe herumzureiben, und sah mich an, als würde sie mir am liebsten eine Ohrfeige verpassen. Vater drehte sich zu mir um und herrschte mich an: »Wenigstens ist sie verheiratet und bringt sich in die Firma ein. Genau wie ihr Mann. Und das ist mehr, als man von dir behaupten kann!«
»Ist das jetzt unser Thema?«
»Ja«, sagte Vater. »Das ist immer unser Thema. Was denkst denn du, warum dir dieser Idiot durchgebrannt ist? Er wollte an unser Geld und hat es nicht bekommen. Ende der Geschichte. Sei froh, dass du ihn los bist.«
»Ich glaube, ihm ist etwas zugestoßen«, sagte ich. »Nein, wirklich, du musst gar nicht so das Gesicht verziehen. Er hat nichts mitgenommen, als er gegangen ist. Alles ist noch in der Wohnung. Sein Ausweis, seine Kleidung, alles. Er hat nur sein Handy mitgenommen und seinen Geldbeutel, mehr nicht.«
»Reicht doch. Wenn er eine Neue hat, die ihm finanziell mehr bieten kann als du, braucht er seinen alten Plunder nicht mehr. Das kommt davon, wenn man unter seinen Möglichkeiten bleibt, mein liebes Kind. Das habe ich dir von Anfang an gesagt.«
Er sagte genau das, woran ich auch schon gedacht hatte. Mal abgesehen von dem Teil, ich sei unter meinen Möglichkeiten geblieben.
»Ich bin kein Kind mehr.«
»Dann benimm dich entsprechend.«
»Ich habe einen eigenen Betrieb.«
»Einen Ein-Frau-Betrieb. Das ist wohl kaum mit dem zu vergleichen, was du bei uns hättest haben können.«
»Ich habe zwei Geschwister, beide arbeiten für dich.«
Und so weiter. Seans Verschwinden war kein Thema mehr, ich musste mir nur anhören, dass ich mein Leben an ihn verschwendet hatte, dass ich überhaupt mein Leben verschwendet hatte. In den Augen meiner Eltern war ich eine einfache Handwerkerin (was auch stimmte) und Sean nur eine ungelernte Hilfskraft (was nicht stimmte, er hatte nach der Schule Tischler gelernt, nur in den letzten Monaten hatte er eben bei Tesco Regale eingeräumt). Irgendwann seufzte Mutter laut auf und erklärte, ihre Migräne sei so schlimm, wir müssten leider das Zimmer verlassen.
An diesem Abend sprachen Vater und ich kein Wort mehr miteinander.
Am Samstag traf ich beim Spazierengehen meinen Bruder mit seiner Frau und den beiden Kindern. Er hing am Telefon, sie tat so, als würde sie sich um die Kleinen kümmern. Ich hatte die Jungs nicht mehr gesehen, seit ich nach Schottland gezogen war. Sie rannten sofort auf mich zu und klammerten sich lachend an mich. Matt beendete hastig sein Telefonat.
Sarah war wie üblich nicht begeistert, mich zu sehen. Sie nickte mir mit einem falschen Lächeln zu.
Matt umarmte mich, dann hakte er sich bei mir unter.
»Erzähl mir, was los ist«, sagte er, und ich erzählte es ihm. Er hörte zu, ohne mich zu unterbrechen, und als ich fertig war, drückte er meinen Arm und sagte: »Vielleicht braucht er nur ein paar Tage für sich. Es wird alles gut.« Und als ich nichts sagte: »Was glaubst du, wo er ist?«
Ich zuckte die Schultern. »Na, Jungs, morgen hab ich Geburtstag! Malt ihr mir ein Bild?«, rief ich seinen Söhnen zu.
Sarah versuchte gar nicht erst vor mir zu verbergen, wie dämlich sie meinen Vorschlag fand, und rollte mit den Augen. Die Kleinen hängten sich sofort an ihre Beine und brüllten, dass sie ihr beim Malen helfen sollte. Sarahs Konzept »Reich heiraten, Kinder kriegen und nie mehr arbeiten müssen« ist nicht ganz so aufgegangen, wie sie es sich vorgestellt hat. Matt bezahlt ihr zwar eine Haushaltshilfe und ein Kindermädchen, aber ein paar Dinge bleiben doch noch an ihr hängen, die sie möglicherweise vom Cappuccinotrinken und Reiten abhalten. Dass ihre Söhne trotz allem die eigene Mutter dem Kindermädchen vorziehen, stört sie am meisten.
Ich vertrieb mir faul den Tag. Ich machte einen langen Spaziergang, mied allerdings die Werft meines Vaters, schaute am Nachmittag noch mal bei meinem Bruder vorbei, sah fern, las in einem Buch, und abends erschien Dana, der man offensichtlich nicht mitgeteilt hatte, dass ihre kleine Schwester zu Besuch war. Als sie mich bei Maria in der Küche sah, wurde sie blass und erstarrte.
»Vergiss nicht zu atmen«, sagte ich.
»Ist die Hölle zugefroren?«, fragte sie.
»Muss wohl, ich rieche gar keinen Schwefel, obwohl ich dich sehen kann«, sagte ich.
»Wo ist dein Spielzeug?«
Sean, das Spielzeug. »Nicht da. Ich habe morgen Geburtstag, du hast hoffentlich schon was anderes vor.«
»Oh!« Hände vors Gesicht, gespieltes Entsetzen im Blick. »Da hab ich schon was anderes vor!« Umdrehen und brüllen: »Dad, warum hast du nichts gesagt? Ich wäre nicht gekommen, wenn ich das gewusst hätte!«
Er brüllte zurück: »Ihr seid erwachsen, macht das unter euch aus!«
Schwager Simon schaute unsicher in meine Richtung und nickte mir zu, dann verzog er sich schnell wieder. Dana stiefelte ihm hinterher.
Maria sagte: »Muss sie gleich wieder einkaufen gehen.«
Ich lachte zum ersten Mal seit Tagen.
Matt kam kurz vor Mitternacht rüber, um mit mir anzustoßen. Wir saßen in der Küche, und die Eltern ließen uns in Ruhe. Er erzählte von den Jungs und von der Arbeit. Ich erzählte von Edinburgh und der Arbeit. Matt findet es großartig, dass ich als Ein-Frau-Betrieb den Auftrag für die Tasteninstrumente an der Universität bekommen habe, und ich erzählte ihm von der Frau aus Merchiston, die ein Tafelklavier von 1820 bei sich zu Hause herumstehen hat und nicht weiß, ob sie es restaurieren lassen soll oder nicht. Es ist ein so wundervolles altes Stück, aber es wieder spielbar zu machen und das Holz aufzuarbeiten, kostet viele tausend Pfund, die sie nicht hat.
Gegen vier Uhr morgens klingelte sein Handy. Sarah war wach geworden und wollte, dass er endlich nach Hause kam.
»Wie läuft es bei euch?«, fragte ich, bevor er ging.
»Wie immer«, sagte er.
Er hat mir Karten für die Royal Albert Hall geschenkt, inklusive Flugtickets und einer Übernachtung im Savoy. Völlig übertrieben.
Von den Eltern bekam ich einen Blumenstrauß und ein Buch, das mich nicht interessiert, sich aber gerade auf der Bestsellerliste befindet. Ich werde es weiterverschenken. Die Blumen habe ich am Flughafen entsorgt.
Dienstag, 30. November 2010
2
Sein Vater wartete in der Ausnüchterungszelle auf ihn. Behauptete jedenfalls der Polizist, der Ben anrief.
»Mein Vater lebt in England«, sagte Ben. »Das muss ein anderer John Edwards sein.« Der ebenfalls einen Sohn namens Ben hatte.
»Ist Ihr Vater Fan von den Magpies?«
Ben starrte fünf Sekunden lang ins Leere, bevor er sagte: »Bin unterwegs.«
Er brauchte mit dem Auto fast eine Dreiviertelstunde für eine Strecke, die er sonst in fünfzehn Minuten zurücklegte. Es war nur wenig Verkehr wegen des Schnees, aber das Taxi vor ihm fuhr extrem langsam, und er hielt großen Abstand. Kaum jemand mit Winterreifen. In anderen Ländern Europas waren sie gesetzlich vorgeschrieben. Hier rutschte man lieber im Schritttempo herum. Unterwegs versuchte er, bei seiner Mutter anzurufen, aber niemand ging ans Telefon. Sie schlief vielleicht noch.
Ben parkte vor der Polizeiwache am Gayfield Square, ging hinein und fragte nach seinem Vater.
»Er will nicht nach Hause«, sagte ihm der Polizist. »Hat uns verboten, seine Frau anzurufen. Freut sich drauf, Sie zu sehen.«
»Ich wusste nicht mal, dass er in Schottland ist. Er war noch nie hier«, sagte Ben.
»Noch nie? Wie lange leben Sie schon hier?«
»Ein paar Jahre?«
Der Mann lachte. »Als ich von Kelso hier raufgezogen bin, hat es keine drei Tage gedauert, und meine Eltern standen auf der Matte, um nachzusehen, ob ich auch genug zu essen im Kühlschrank hatte. Da haben Sie echt Glück, dass Ihre Sie in Ruhe lassen.«
Ben erwiderte nichts. Er erledigte den Papierkram, wartete, bis sie seinen Vater geholt hatten. Kein schöner Anblick: alter Militärparka, am rechten Oberarm ein Aufnäher in den Farben der deutschen Flagge, Mütze und Schal der Magpies, fleckige braune Hosen, ausgetretene braune Halbschuhe. Er sah aus, als hätte er tagelang in den Klamotten geschlafen, und er roch auch so. Die grauen Bartstoppeln ließen ihn älter aussehen, als er war. Wäre Ben ihm auf der Straße begegnet, er hätte ihn nicht erkannt, ihm nicht mal einen zweiten Blick gegönnt. Irgendein Penner, der zur Vorweihnachtszeit zum Betteln in die Innenstadt kommt. In den Eingängen der Geschäfte schläft. Keine feste Nahrung mehr braucht, weil ihm die flüssige reicht.
»Junge, dass du da bist.« Er lallte.
Ben packte seinen Vater am Arm, nickte den Polizisten zu, sagte »Danke« und schob John Edwards zum Ausgang.
»Jetzt sag doch mal was«, beschwerte er sich und blieb stehen. »Hast du deine Mutter angerufen? Ruf bloß nicht deine Mutter an.«
»Dad, wir reden später in Ruhe. Nicht hier.« Er schob seinen Vater weiter. Der stolperte und fiel gegen eine große, dünne Frau.
»Woah, langsam«, rief sie, fing ihn souverän auf und sorgte dafür, dass er aufrecht an der Wand zu stehen kam.
»Detective Sergeant Isobel Hepburn.«
Ben musste grinsen. »Was für eine Freude.«
Hepburn grinste ebenfalls, aber nur kurz. »Wo haben Sie diesen verirrten Newcastle-Fan her, und wie lange hat er nicht mehr geduscht?« Sie wedelte sich mit einer behandschuhten Hand vor der Nase herum. »Ein Informant von Ihnen?«
»Ich bin sein Vater«, kam es laut und vernehmlich von der Wand.
Hepburn wurde rot. »Oh, tut mir …«
»Schon okay«, sagte Ben. »Die Familienähnlichkeit hält sich ja in Grenzen.«
Sie lächelte, wieder nur kurz. »Sind Sie nicht in Fife?«
»Was soll ich in Fife?«
»Cedric …?«
Er hob die Augenbrauen.
»Heute noch keine Nachrichten gehört?«
»Ich dachte, sie bringen sowieso nur, dass die Straßenverhältnisse schlecht sind und die Schulen geschlossen. Und außerdem habe ich frei. Überstunden abbauen. Ihr Kollege hat mich gerade erst geweckt, damit ich …« Er zeigte vage auf seinen Vater. »Was hab ich verpasst?«
Isobel räusperte sich. »Lillian Darney ist tot. Cedric wird gerade vernommen.«
Ben lachte. Es war ein unsicheres Lachen. »Hey, Sergeant, schräge Scherze am frühen Morgen … Ich dachte, Sie warten mit so was wenigstens, bis es hell ist.«
Sie sagte nichts, sah ihn nur an.
»Kein Scherz?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Wer ist Cedric?«, fragte sein Vater.
Ben ignorierte ihn. »Was ist passiert?«
»Ich kann Ihnen nur sagen, was schon an die Presse raus ist. Erkundigen Sie sich bei Ihren Kollegen.«
»Isobel, bitte …«
»Schöner Name. I-so-bel.« John Edwards zog die drei Silben in die Länge.
Hepburn sah nachdenklich von Ben zu seinem Vater und wieder zurück. »Verdammt, kommen Sie mit rein. Und verraten Sie mir, wie viel Ihr alter Herr getankt hat? Muss beachtlich gewesen sein, bei dem Restalkohol.«
»Seine Stiefmutter wurde gestern Nacht auf ihrem Landsitz ermordet. Er fand sie, verständigte die Kollegen, und als sie eintrafen, saß er schlafend neben einem vielleicht anderthalbjährigen Kind in einem Zimmer im ersten Stock und war nicht in der Lage, seine Anwesenheit vor Ort zu erklären. Also nahmen sie ihn mit. Der zuständige Detective ließ einen Bluttest anordnen, da Cedric unter Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand.«
»Medikamente. Er nimmt was gegen seine Angstzustände«, sagte Ben.
»Dann muss er gestern sehr große Angst gehabt haben. Nach allem, was ich gehört habe, war er nicht mehr von dieser Welt.«
»Wann ist er das schon?«
Sie hob nur kurz die Augenbrauen. »Jetzt muss man kein Genie sein, um rauszufinden, dass sich Cedric mit seiner Stiefmutter nicht gut verstanden hat. Sie behalten ihn also noch eine Weile zur Vernehmung.«
»Das wird ihm nicht gefallen. Was sagt sein Anwalt?«
»Ich stehe auf der falschen Seite, wissen Sie.«
»Sie wissen genauso gut wie ich, dass Cedric …« Er brach ab. Wussten sie es wirklich? Wusste er es? Cedric Darney war labil, phobisch, neurotisch. Seit einigen Jahren war er in Therapie, vor ein paar Monaten hatte er sich dazu überreden lassen, unterstützende Medikamente zu nehmen. Wusste er, wie Cedric auf die Medikamente wirklich ansprach? Wie er mit ihnen umging?
So wie Isobel ihn ansah, dachte sie genau dasselbe. Ben hatte selbst schon über Skandale im Zusammenhang mit Psychopharmaka berichtet, die neu auf den Markt gekommen waren: Selbstmorde bei jugendlichen Patienten und Autoaggressionen waren signifikante Nebenwirkungen gewesen, die der Hersteller zu verschweigen versucht hatte. Warum sollte es nicht auch Medikamente geben, die einen ansonsten friedlichen, dazu noch stark introvertierten Menschen zum Mörder machten?
Hepburn sagte: »Die Kollegen kommen in ein abgelegenes Haus und finden dort eine Frau vor, die ermordet wurde …«
»Wie?«
»Erschlagen.«
»Einbrecher?«
»Ihr fehlt das halbe Gesicht. Aber lassen Sie mich weiterreden. Sie kommen also dorthin, es handelt sich offensichtlich um einen Täter, der eine Rechnung mit ihr offen hatte, und im Haus sitzt ein zugedröhnter junger Mann, er trägt Handschuhe, aber keine Schuhe und keinen Mantel. Die liegen blutverschmiert neben der Treppe. Draußen im Schnee gibt es nur seine Reifenspuren und seine Fußspuren. Was glauben Sie, was die Leute vor Ort denken?«
Bens Vater war eingenickt, aber als Hepburn mit Nachdruck »Eben!« sagte, schreckte er auf und murmelte etwas, das Ben nicht verstand.
»Ich versuche, ihn anzurufen«, sagte Ben.
»Versuchen Sie’s lieber über seinen Anwalt. Die werden ihn nicht so gern telefonieren lassen.«
Ben schob seinen Vater aus dem Büro, und Hepburn begleitete die beiden nach vorne. Er wollte sich gerade bedanken, als ihm einer der Uniformierten ins Wort fiel.
»Sergeant, ich komm hier nicht weiter. Die Frau will jemanden von der Mordkommission sprechen.«
Er zeigte auf eine Gestalt: dicke Daunenjacke, Wollhandschuhe und Mütze. Das Gesicht kaum zu erkennen. Als die Gestalt mitbekam, dass man über sie sprach, schoss sie auf Hepburn zu.
»Langsam«, sagte Hepburn, und der Uniformierte stellte sich der Frau in den Weg.
»Ich muss einen Mord melden«, sagte sie laut und versuchte, sich an dem Polizisten vorbeizuschieben. Was nicht gelang. »Lassen Sie mich los, verdammt!« Eine klare, kräftige Stimme mit Befehlscharakter. Der Akzent kaum zuzuordnen. Vielleicht amerikanische Oberschicht der Ostküste. Vielleicht eine Engländerin, die zu lange in New York gelebt hatte. »Ich bin Philippa Murray. Es geht um diese Lillian Darney. Ich weiß, wer sie getötet hat.«
»Hey, junge Frau. Machen Sie kein Theater. Ganz ruhig bleiben, okay?« Aber der Polizist hätte sich seine Ermahnung sparen können. Die Frau wehrte sich nicht und war auch nicht laut geworden. Sie hatte Hepburns Aufmerksamkeit, das reichte ihr.
»Darney«, sagte John Edwards und klang erstaunlich nüchtern. »Den Namen hab ich doch schon mal irgendwo gehört.«
Ben nahm seinen Vater am Arm und zog ihn ein Stück von Hepburn weg.