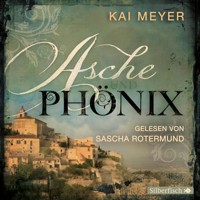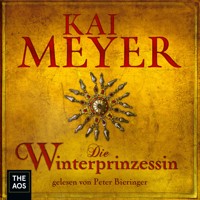17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geheimnisse des Graphischen Viertels
- Sprache: Deutsch
Freundschaft und Verrat im Bann der Bücher – die Geheimnisse des Graphischen Viertels Die Bücherstadt Leipzig, 1930: Inmitten unruhiger Zeiten versammeln sich vier junge Männer in einem Antiquariat im Graphischen Viertel. Alle sind Söhne aus gutem Haus, alle sind vom Leben gelangweilt. Statt ihrem Studium nachzugehen, gründen Felix, Vadim, Julius und Eddie den "Club Casaubon". Getrieben von ihrer Leidenschaft für Literatur und der Lust am Abenteuer werden sie zu Bücherdieben, spezialisiert auf kostbare, okkulte Bände. Doch als Eddies rätselhafte Schwester Eva zum Club stößt, werden sie immer tiefer in die Pläne erbarmungsloser Mächte hineingezogen. Fünfzehn Jahre später, 1945: Nach dem Krieg arbeitet Felix als Bibliothekar für die Amerikaner, um Millionen von geraubten Büchern zu katalogisieren. Seine Mission führt ihn zurück in das zerstörte Leipzig. Die Freunde von damals sind verschollen – oder nicht wiederzuerkennen. Und ist Eva wirklich tot? Während die Stadt unter dem Druck der nahenden sowjetischen Besatzung steht, gerät Felix in ein Netz aus Verrat und tödlichen Geheimnissen, das seinen Ursprung in den finstersten Winkeln seiner Vergangenheit hat. SPIEGEL-Bestsellerautor Kai Meyer erzählt einmal mehr von Freundschaft, Liebe und dunklen Verbrechen in den nebelverhangenen Gassen des Graphischen Viertels. Lesen Sie auch die anderen Teile der historischen Roman-Reihe»Die Geheimnisse des Graphischen Viertels«. Alle Teile sind unabhängig voneinander lesbar. - Die Bücher, der Junge und die Nacht - Die Bibliothek im Nebel - Das Haus der Bücher und Schatten - Das Alphabet der Masken
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kai Meyer
Das Antiquariat am alten Friedhof
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Bücherstadt Leipzig, 1930: Inmitten unruhiger Zeiten versammeln sich vier junge Männer in einem Antiquariat im Graphischen Viertel. Alle sind Söhne aus gutem Haus, alle sind vom Leben gelangweilt. Statt ihrem Studium nachzugehen, gründen Felix, Vadim, Julius und Eddie den „Club Casaubon“. Getrieben von ihrer Leidenschaft für Literatur und der Lust am Abenteuer werden sie zu Bücherdieben, spezialisiert auf kostbare, okkulte Bände. Doch als die rätselhafte Eva zum Club stößt, werden sie immer tiefer in die Pläne erbarmungsloser Mächte hineingezogen.
Fünfzehn Jahre später, 1945: Nach dem Krieg arbeitet Felix als Bibliothekar für die Amerikaner, um Millionen von geraubten Büchern zu katalogisieren. Seine Mission führt ihn zurück in das zerstörte Leipzig. Die Freunde von damals sind verschollen – oder nicht wiederzuerkennen. Und ist Eva wirklich tot? Während die Stadt unter dem Druck der nahenden sowjetischen Besatzung steht, gerät Felix in ein Netz aus Intrigen und tödlichen Geheimnissen, das seinen Ursprung in den finstersten Winkeln seiner Vergangenheit hat.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Das Graphische Viertel
AmalfiküsteKampanien
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Erster Teil
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Zweiter Teil
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Epilog
Nachwort des Autors
Das Graphische Viertel
Im frühen 20. Jahrhundert gab es in der alten Literaturstadt Leipzig über zweitausend Betriebe, die von der Herstellung und Verbreitung von Büchern lebten – Verlage, Druckereien, Buchbindereien, Schriftsetzereien und eine Vielzahl von Buchhandlungen und Antiquariaten, zuweilen bis zu zweihundert.
Die meisten dieser Unternehmen waren in einem Stadtteil östlich der historischen Innenstadt angesiedelt: dem Graphischen Viertel.
Eingehüllt in einen ewigen Nebel – in Wahrheit der Smog der Dampfmaschinen –, zusammengesetzt aus neugotischen Schmuckfassaden und ziegelbraunen Fabrikbauten, beschaulichen Buchläden und brutaler Zweckarchitektur, hat es einen solchen Ort nirgends auf der Welt ein zweites Mal gegeben.
Bei einem Luftangriff im Dezember 1943 wurde das Graphische Viertel fast vollständig zerstört.
AmalfiküsteKampanien
Er betrachtet sie und denkt: Sie hat so viele ungeöffnete Seiten, die sie mich nicht sehen lässt. Bald ist es vielleicht zu spät dafür.
Sie schläft tief und atmet langsam, während durchs Fenster das nächtliche Rauschen des Mittelmeers hereinweht und der Mond den weißen Leinenvorhang zum Leuchten bringt. Sie hat sich vorhin, noch verschwitzt und ein wenig erschöpft, ein dünnes Hemd übergezogen, kein Nachthemd, sondern etwas Kurzes, das im Schlaf nach oben gerutscht ist. Jetzt liegt sie auf der Seite, deshalb schimmert das Mondlicht auf der sanften Rundung ihrer Hüfte. Ihre Beine sind leicht angewinkelt, die Arme hat sie vor die Brust gezogen.
Er findet sie unfassbar schön, wie sie so neben ihm liegt, und für einen Augenblick glaubt er, dass er sie kennt, wirklich kennt, dass er ihre Gedanken liest und Gefühle versteht.
Nur dass es wohl in Wahrheit seine Gedanken sind, die er auf sie projiziert, und seine Gefühle, von denen er verzweifelt hofft, sie möge sie teilen. Aber auch diese Illusion ist etwas wert, denn es ist die Illusion, die sie ihm gestattet, und dass sie das tut, hätte er vor Kurzem kaum für möglich gehalten.
Er liegt nicht wach, um sie beim Schlafen zu beobachten, das wäre merkwürdig. Aber weil er wach liegt, sieht er sie an. Er kann gar nicht anders.
Wie alles Übrige ausgehen wird, weiß er nicht. Aber ihm ist bewusst, dass dies hier bald endet, und der Gedanke daran schnürt ihm die Kehle zu. Sie können nicht ewig in Italien bleiben, von der Terrasse hinab auf die steilen Hänge der Küste und die tiefblaue See blicken, den Duft der Zitronen atmen, eiskalten Weißwein trinken, in die Sonne blinzeln, die Zukunft ignorieren und die Vergangenheit erst recht, einfach in den Tag hineinleben. Sie haben Bücher dabei, weil sie Bücher lieben, aber sie sind kaum zum Lesen gekommen. Weil sich das alles hier so sehr von ihrem bisherigen Leben unterscheidet. Das Licht, die Luft, sogar die Gespräche. Nichts ist wie zu Hause, und für ihn hätte es immer so weitergehen können.
Wäre da nicht das Telegramm.
In diesem Moment schlägt sie die Augen auf, diese Augen, die nie dieselbe Farbe haben, außer bei Mondschein. Sie sieht ihn an, ganz wach, ganz klar.
»Wie müssen zurück nach Leipzig«, sagt sie.
Ihre Worte hallen in seinem Kopf nach wie ein Urteilsspruch. Ihre Stimme kaschiert das Verhängnis, gibt der Bedrohung einen lockenden Klang. Sie wissen beide, was sie zu Hause erwartet.
Er will widersprechen, mehr als irgendetwas sonst, aber er bringt nur ein Nicken zustande in der gärenden Gewissheit, dass sie recht hat.
»Ja«, sagt er entgegen aller Vernunft. »Wir müssen zurück.«
Prolog
auf Patmos
1
1945
Im Mittagslicht waren die Häuser so weiß wie frisch geschöpftes Papier. Der gleißende Sonnenschein übertünchte die Einschusslöcher in den Wänden. Oben auf dem Berg stand das Kloster, hinter hundert Biegungen und Ecken, jenseits der argwöhnischen Blicke, die Felix durch die Spalten der Fensterläden trafen. Das Kloster – und darin die Bibliothek der Apokalypsen.
Felix wusste nicht, ob die Kerben in den Fassaden erst kurz vor der Kapitulation der Wehrmacht entstanden waren oder ob es hier während der zweijährigen Besatzung immer wieder Kämpfe gegeben hatte. Er hätte den britischen Offizier danach fragen können, der ihn durch das Gassenlabyrinth hinauf zum Johanneskloster führte, aber von Gesprächen mit Soldaten bekam er schlechte Laune. Lange würde es sich trotzdem nicht mehr vermeiden lassen.
Vor zwei Tagen hatten die Deutschen hier auf Patmos ihre Waffen niedergelegt und sich den Briten ergeben. Hitler war seit fünf Wochen tot. Während am anderen Ende Europas längst fremde Mächte auf den Trümmern des Tausendjährigen Reichs tanzten, verteidigten in der Ägäis deutsche Inselkommandanten ihre Felsen, als hinge von ein paar Ziegen die Reinheit der arischen Rasse ab.
»Wussten Sie«, fragte der Offizier, »dass hier auf Patmos die Bibel geschrieben wurde?«
»Nicht die ganze.« Felix lächelte in sich hinein. »Nur die Offenbarung des Johannes. Das ist das Stück ganz hinten, das keiner liest, aber von dem alle glauben, sie wüssten, was drinsteht. Die Apokalypse.«
Der Soldat nickte. »Das Tier mit den sieben Köpfen steigt aus dem Meer. Und irgendwer bläst dazu auf sieben Trompeten.«
»Ja, so ungefähr.«
»Ich schätze, als wir aus dem Meer kamen, hatten die Kerle hier auch Trompeten in den Ohren«, sagte der Soldat, die letzten Wörter auf Deutsch.
Tomaten auf den Ohren, dachte Felix entnervt. Es heißt Tomaten, nicht Trompeten. Und genau genommen waren die Engländer übers Meer gekommen, nicht daraus hervor. Aber er war zu müde, um den Soldaten zu verbessern, der wahrscheinlich nur witzig sein wollte und es nicht persönlich meinte. Und falls er in Felix noch immer einen Deutschen sah, ließ sich das ohne längere Erklärungen ohnehin nicht ändern.
Mit Vorurteilen hatte er gerechnet, erst recht von den Briten. Während des gesamten Fluges nach Griechenland, selbst noch auf den letzten Kilometern im Wasserflugzeug, hatte er gemischte Gefühle bei diesem Auftrag gehabt. Große Aufregung, aber auch Vorbehalte. Erst allmählich wurde ihm bewusst, wie dankbar er dem Verrückten dort oben in der Bibliothek sein musste. Dem Verrückten mit der Panzerfaust. Jenem Mann, der darauf bestanden hatte, einzig mit Felix zu sprechen, Auge in Auge.
Nun, mit jemandem wie Felix. Irgendwem, der Deutsch sprach und sich mit Büchern auskannte. Felix war kein Deutscher mehr, seit er Mitte der Dreißiger die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Aber er beherrschte die Sprache, und er wusste eine Menge über Bücher. Dahingehend war er der naheliegende Kandidat für diese Mission.
Ob er verhindern konnte, dass der Mann die Klosterbibliothek mit seiner Panzerfaust in Schutt und Asche legte, war eine andere Frage. Viele der Bücher waren uralt, vor allem die unbezahlbaren Ausgaben der Johannesapokalypse. Manche stammten aus dem Mittelalter, andere waren noch älter, antike Codices und Schriftrollen, und niemand wollte sie brennen sehen, nur weil sich ein Unverbesserlicher in der Bibliothek verbarrikadiert hatte und seine Niederlage nicht akzeptieren konnte.
»Haben Sie irgendeine Vorstellung, worüber er mit Ihnen reden will?« Dem Soldaten machte der Aufstieg durch die steilen Gassen nichts aus, während Felix längst schwer atmete.
»Nicht die geringste.«
»Die haben Sie doch nicht extra aus den Staaten hergebracht, oder?«
»Ich bin schon seit zwei Wochen in Deutschland«, sagte Felix. »Auf Schloss Hungen. Sagt Ihnen wahrscheinlich nichts.«
»Nie davon gehört.«
»Die Nazis haben dort zwei Millionen Raubbücher eingelagert, die meisten aus Wien und Prag. Sie hatten Experten für die Plünderung von Nationalbibliotheken, und die haben die Bücher in Lkw-Konvois nach Deutschland gebracht. Irgendwann waren es so viele, dass keiner mehr wusste, wohin damit, also landeten sie auf Schloss Hungen. Wir von der PCB sind vor zwei Wochen dorthin geschickt worden, um uns einen ersten Überblick zu verschaffen.«
Die Miene des Offiziers verriet, dass er nicht nachvollziehen konnte, warum sich jemand angesichts von Millionen Toten Gedanken über gestohlene Bücher machte. Felix verstand ihn. Aber irgendwer musste damit beginnen, hinter den Nazis aufzuräumen, und besser jetzt, da die endgültige Aufteilung Deutschlands noch nicht vollzogen war, als in ein paar Wochen, wenn neue Grenzen existierten, die man nicht mehr ohne Weiteres überqueren konnte.
Auf Schloss Hungen gab es genug zu tun für den kleinen Trupp vom Publication Control Branch, man brauchte dort jeden Mann. Dass man Felix dennoch auf diesen Abstecher in die Ägäis geschickt hatte, bedeutete, dass hier einiges auf dem Spiel stand, womöglich mehr als nur die obskure Bibliothek einiger Mönche. Oder aber es wollte nur keiner die Schuld daran tragen, dass einer der Geburtsorte christlicher Kultur in Flammen aufging.
»Es ist fantastisch hier, nicht wahr?«, sagte der Engländer, als zwischen zwei Häusern das Mittelmeer aufleuchtete. »Haben Sie gesehen, wie blau die See ist? Und dann diese Inseln. Ich kann mir kein schöneres Schlachtfeld vorstellen. Die Griechinnen sind auch nicht ohne. Und dankbar für ihre Befreiung.«
»Wir laufen jetzt seit einer Viertelstunde durch diese Gassen und ich habe außer Ihnen noch keinen Menschen gesehen.«
»Die meisten bleiben in ihren Häusern. Sie haben die Nase voll von fremden Uniformen. Man sieht mehr Katzen als Menschen, es wimmelt nur so von den Biestern. Wissen Sie, warum man hier alles so eng und verwinkelt gebaut hat?«
Felix schüttelte den Kopf.
»Wegen der türkischen Piraten. Sie sollten sich in den Gassen verlaufen, wenn sie mal wieder vorbeikamen, um das Kloster zu plündern.«
Plünderer sind wir doch alle, dachte Felix. Man hatte ihn und die anderen Bibliothekare schließlich nicht nach Deutschland geschickt, um den Nazis die Bücher abzustauben. In Wahrheit ging es darum, die besten Stücke in die Staaten zu verschiffen, ehe sich die Österreicher und Tschechen um die Reste balgen durften.
Hier auf Patmos war wenig von den Spannungen zu spüren, die anderswo in Europa zwischen den Siegermächten herrschten. Für die Rückeroberung der Ägäis von den Deutschen waren vor allem britische Kommandos zuständig, die eine Insel nach der anderen unter ihre Kontrolle brachten. Waren die Kämpfe erst einmal beendet, schärfte sich auch wieder der Blick für die natürliche Schönheit der Umgebung. Hier auf Patmos waren keine Bomben abgeworfen worden, hatten keine Feuerstürme die Bewohner ausgelöscht. Abgesehen von den Einschusslöchern erinnerte kaum etwas an den Krieg. Bald würden sich die Menschen wieder aus ihren weißen, zweistöckigen Häusern wagen, die Narben in den Fassaden verspachteln und zu ihrem alten Leben zurückkehren.
Viele Gassen waren mit polierten Bruchsteinplatten gepflastert. Die Enge tat ein Übriges, dass Felix sich kaum wie im Freien fühlte. Vielmehr schien es, als wären die Wege nur weitere Zimmer der Häuser, über denen sich ein endloser Himmel spannte statt einer Balkendecke. Die Luft roch blumig und nach salzigem Seewind. Von den Rändern der Flachdächer ergossen sich Blütenkaskaden, neben manchen Türen standen Feigenbäume in Töpfen. Zweifellos hatte es während der Besatzung durch die Deutschen Erschießungen und Folter gegeben, doch nicht einmal sie hatten die mediterrane Gelassenheit dieses Ortes für immer vergiften können.
»Wie merken Sie sich den Weg?«, fragte Felix. »Sie sind doch auch erst zwei Tage hier. Für mich sieht ein Haus wie das andere aus.«
»Die bunten Türen. Ich hab ein gutes Gedächtnis für Farben. Sehen Sie: erst blau, dann grün, dann wieder blau, die da ist rot … Das ist wie ein Morsecode, nur anders.«
»Morsecode.«
»Ja. Kurz – lang – lang – kurz. Hier dann blau – grün – blau – rot. Ist ein Kinderspiel, wenn man’s einmal raushat.«
Felix hob beeindruckt eine Braue. »Und darauf achten Sie, während wir reden?«
Der Offizier lachte leise. »Ist nicht meine erste griechische Insel in diesem Krieg.« Er deutete mit einem Nicken voraus. »Da vorn ist es.«
Oben auf dem Hügel öffneten sich die weißen Häuserreihen, und die Festungsmauern des Klosters wuchsen vor ihnen in den Himmel. Über den Zinnen ragten bogenförmige Glockentürme empor. Am Portal nahmen ein paar britische Soldaten Haltung an, als sie den Offizier entdeckten. Einer berichtete knapp, dass die Lage im Inneren unverändert sei. Der durchgedrehte Deutsche habe sich nach wie vor in der Bibliothek verschanzt, niemand komme an ihn heran. Die Mönche würden immer lauter über ihre kostbaren Bücher lamentieren und damit allen gehörig auf die Nerven gehen. Felix bekam mehr und mehr den Eindruck, dass er der einzige Ausländer auf der Insel war, der sich ernsthaft um die sagenumwobene Bibliothek sorgte. Die Soldaten wollten vor allem eines: schleunigst nach Hause.
In einem pittoresken Innenhof des Klosters, eingefasst von Rundbogen und kleinen Treppen, wurden sie von einem orthodoxen Geistlichen in schwarzen Gewändern empfangen. Er redete unablässig auf Griechisch auf sie ein, während der Engländer versuchte, ihn mit Gesten zu beschwichtigen. Andere Mönche traten aus Durchgängen und Türen, alle mit langen Bärten und schwarzen Kopfbedeckungen, und der Offizier musste schließlich die Stimme erheben, um dem Trubel ein Ende zu setzen. Die meisten zogen sich daraufhin zurück, und so wurde Felix nun endlich durch eine Reihe schattiger Höfe und düsterer Korridore zum Eingang der Bibliothek geführt. Ein Dutzend Soldaten stand bereit und wartete darauf, den Trakt zu stürmen.
Die Tür war aus massivem Eichenholz und mit schwerem Stahl beschlagen. Kein Laut drang von der anderen Seite herüber. Der verrückte Deutsche konnte nicht sehen, was hier draußen geschah. Vermutlich lag sein Finger nervös am Abzug seiner Panzerfaust.
»Wie viele Bücher sind da drinnen?«, fragte Felix.
»Über dreitausend, sagen die Mönche. Außerdem jede Menge Schriftrollen, Dokumente und ein Haufen Ikonen.« Der Offizier bemerkte, dass einer der jungen Soldaten abschätzig das Gesicht verzog. Gereizt fuhr er den Mann an: »Haben Sie etwas anzumerken, Lance Corporal?«
Der Mann versteifte sich. »Nein, Sir! Natürlich nicht, Sir!«
Einen Moment lang herrschte angespanntes Schweigen, dann gab der Offizier Felix einen Wink. »Das ist jetzt Ihr Job. Besser, Sie machen Ihre Sache gut. Sonst beenden wir das auf unsere Weise.«
»Der Generalstab hat Befehl gegeben, kein unnötiges Risiko für die Bücher –«
»Der Generalstab ist nicht hier. Und meine Männer werden noch auf anderen Inseln gebraucht. Das hier dauert schon viel zu lange.«
Felix glaubte, dass alle es lieber gesehen hätten, wäre die Mission einem Engländer anvertraut worden. Männer, die Deutsch sprachen, gab es in der britischen Armee zuhauf, aber gewiss nur wenige, die zudem auch ausgebildete Bibliothekare waren. Der Mann dort drinnen hatte auf einem Experten bestanden. Deshalb hatten die Briten die Amerikaner um Hilfe bitten müssen, die gerade erst mit einer Gruppe qualifizierter Fachleute in Deutschland aufgeschlagen waren.
Nach außen hin trat Felix auf, als wäre ihm die Sache lästig, doch in Wahrheit konnte er es gar nicht erwarten, die berühmte Bibliothek von innen zu sehen. Antike Ausgaben der Johannesoffenbarung waren eines seiner Steckenpferde. Er besaß eine bescheidene Sammlung, daheim in Georgetown, auch wenn das Haus, in dem sie sich befand, demnächst unter den Hammer kam. Vor einem Monat hatte Sadie ihm mitgeteilt, dass sie ein Kind von einem Kollegen aus dem Museum erwartete – was bei Weitem nicht die größte Überraschung in Felix’ Leben gewesen war, nicht einmal die mit den schlimmsten Konsequenzen. Und doch nagte diese Sache an ihm, je länger er von zu Hause fort war. Während er Sadie um sich gehabt hatte, war es leicht gewesen, sich auf Dinge zu konzentrieren, die ihn schon lange an ihr gestört hatten. Doch seit seiner Abreise verlieh Sadies Abwesenheit ihr einen schmerzlichen Glorienschein. Sich abzulenken, noch dazu mit einer Bibliothek, die viele Jahrhunderte alt war, war gerade das Beste, was ihm passieren konnte.
Vorausgesetzt, er verbrannte nicht darin, zusammen mit einem Narren, der den Briten nicht einmal seinen Namen nennen wollte. Den kannten sie von den gefangenen Wehrmachtssoldaten. Der Mann hieß Ludwig Hartmann, ein Bibliothekar, der von der Bücherverwertungsstelle des Reichspropagandaamtes hergeschickt worden war. Ironischerweise ähnelte seine Aufgabe jener, die Felix nach Deutschland geführt hatte: Katalogisierung und Bewertung des Bestands. In Wahrheit bedeutete das: Vorbereitung zum Raub von Büchern, die andere über Jahrhunderte zusammengetragen hatten.
Felix holte sich mit einem letzten Blick das Okay des Offiziers, dann trat er an die Tür und klopfte fest an. Die Soldaten brachten ihre Waffen in Anschlag. »Herr Hartmann?«, fragte er auf Deutsch. »Mein Name ist Felix Jordan. Man hat mir gesagt, Sie möchten mit einem Bibliothekar sprechen.«
Zwei, drei Atemzüge lang herrschte Stille, dann erklang durch das Holz eine gedämpfte Stimme. »Is unus bibliotheca magna.«
Der Offizier sah ihn verwirrt an. »Latein?«
Felix nickte. »Er selbst ist eine große Bibliothek«, übersetzte er so laut, dass der Mann im Inneren es hören musste.
»Was soll das?«, flüsterte der Soldat gereizt.
Wieder Schweigen.
»Erklären Sie’s ihnen«, rief der Deutsche.
Als Felix sich pflichtschuldig an die Engländer wandte, dämmerte ihm, dass seine Erläuterung das Sesam-öffne-dich zur Bibliothek sein sollte. »Is unus bibliotheca magna ist ein legendäres, wenn auch nicht ganz perfektes Anagramm des Namens Antonius Magliabechius. Das ist die latinisierte Form von Antonio Magliabechi, einem Bibliothekar im Florenz des siebzehnten Jahrhunderts. Nachdem ihn der Großherzog der Toskana zum Palastbibliothekar ernannt hatte, lebte Magliabechi nur noch für die Bücher. Er kannte die Bestände aller großen Bibliotheken auswendig. Fragte man ihn, ob ein bestimmtes Buch irgendwo zu bekommen sei, sagte er Dinge wie: ›Es steht als siebter Band im zweiten Regal in der Bibliothek des Sultans von Konstantinopel, gleich rechts, wenn man reinkommt.‹ Und das, obwohl er selbst nie dort gewesen war.«
Hartmann lachte leise hinter der Tür. »Der siebte Band im zweiten Regal«, wiederholte er auf Englisch. Natürlich kannte er die Anekdote.
»Eigentlich hätten Magliabechi Wohnräume im Palast zugestanden«, fuhr Felix fort, »aber er beharrte darauf, dass man ihm eine einfache Holzpritsche zwischen die Regale stellte. Als er in hohem Alter starb und man seine Leiche fand, saß er völlig verwahrlost, aber mit einem glücklichen Lächeln in seinem Sessel und hielt ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoß. Die dreißigtausend Bücher, die er über die Jahre für sich selbst angeschafft hatte, wurden später zum Grundstock der italienischen Nationalbibliothek.«
Die Soldaten wechselten verständnislose Blicke, während der Offizier ihn stirnrunzelnd ansah.
In diesem Moment rief der Deutsche durch das dicke Eichenholz: »Sagen Sie den Männern, sie sollen fünf Schritte zurücktreten. Und dann kommen Sie langsam rein.«
2
Hinter Felix fiel die Tür ins Schloss.
»Legen Sie den Riegel vor! Schnell!«
Er schob den breiten Stahlriegel in seine Verankerung und drehte sich um. Der lange Raum war von hellen Säulen flankiert, darüber spannten sich flache Steingewölbe. Es gab dämmeriges elektrisches Licht. Zudem hatte der Mann zahlreiche Kerzen in schweren Standleuchtern angezündet, wohl in der Sorge, die Briten könnten ihm den Strom abklemmen. Die meisten Kerzen waren bereits weit heruntergebrannt, die stickige Luft roch nach Ruß. Fenster gab es keine, um die kostbaren Bücher vor Tageslicht zu schützen. Womöglich hatten die Soldaten von außen die Luftschächte verstopft, damit der Mann müde und unaufmerksam wurde.
Hartmann saß am Ende eines langen Tisches, den er in die Mitte des Raumes gerückt hatte. Die Panzerfaust ruhte auf seiner Schulter, die rechte Hand lag am Abzug. Das primitive Visier an der Oberseite des Rohrs war nicht hochgeklappt. Treffsicherheit war nicht nötig, falls es ihm wirklich darum ging, die deckenhohen Bücherregale der Bibliothek in Brand zu schießen. Davon gab es an allen vier Wänden eine Menge, dicht bestückt mit braunen Buchrücken, großen und kleinen, breiten und schmalen. Ihr Geruch hätte den Raum wohl beherrscht, wären da nicht die Kerzen gewesen und ein Blecheimer in der Ecke.
»Legen Sie bitte den Mantel ab.«
»Ich bin nicht bewaffnet.«
»Tun Sie’s trotzdem.«
Felix gehorchte, zog langsam den braunen Militärmantel aus und ließ ihn am gestreckten Arm zu Boden fallen. Darunter trug er eine sandfarbene Hose und ein helles Hemd.
»Stülpen Sie Ihre Hosentaschen nach außen, und dann drehen Sie sich einmal im Kreis«, befahl Hartmann. »Gut, danke. Jetzt können Sie näher kommen.«
Felix ging langsam auf den zweiten Stuhl zu, den Hartmann an die vordere Seite des Tisches gestellt hatte, als wollte er einen Hilfsbibliothekar zum Vorstellungsgespräch empfangen. Der klobige Granatenkopf, der auf dem Rohr der Panzerfaust steckte, bewegte sich um keinen Millimeter. Die Engländer hatten angenommen, dass Hartmann seit mindestens zwei Tagen nichts gegessen und getrunken hatte, aber Felix sah am Boden eine offene Kiste mit Wehrmachtsrationen und einer Feldflasche. Er fragte sich, wie zuverlässig die anderen Informationen gewesen waren, die man ihm gegeben hatte. Viele waren es ohnehin nicht gewesen.
»Setzen Sie sich.«
Die lange Tafel zwischen ihnen maß fast drei Meter, trotzdem konnte Felix den Schweiß sehen, der auf Hartmanns ausgezehrtem Gesicht glänzte. In seinen Augen stand ein Flackern, das keine Reflexion der Kerzenflammen war. Felix hatte noch nie eine Panzerfaust gehalten, und er fragte sich, ob es auch für sein Gegenüber das erste Mal war. Kompliziert war die Bedienung nicht, die Deutschen hatten sogar Kinder damit ins Feld geschickt. Das Rohr wog zehn Kilo, die Granate gut drei. Auf die Dauer musste das Gewicht auf der Schulter sehr unbequem werden.
»Wollen Sie das nicht runternehmen?«
»Damit Ihre Freunde da draußen im selben Moment die Tür aufbrechen?«
»Die macht einen ziemlich massiven Eindruck«, sagte Felix kopfschüttelnd. »Und ich kann Ihnen versichern, dass die Soldaten keinen blassen Schimmer haben, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Sie haben Befehl, die Bücher zu retten, nicht mich.« Klang das plausibel genug? Er war nicht sicher.
Neugierig ließ er den Blick über die Regale wandern. Er fragte sich, ob es hier eine ganz bestimmte Variante der Johannesapokalypse gab. Die eine Ausgabe, die er vor langer Zeit verloren hatte.
Hartmann blinzelte, weil ihm Schweiß in die Augen lief, doch er ließ die Waffe nicht sinken. »Woher kommen Sie?«
»Ich bin vor zwei Wochen mit anderen Mitarbeitern des PCB aus Washington nach Deutschland eingeflogen worden. Sagt Ihnen das was, PCB?«
Hartmann schüttelte den Kopf.
»Publication Control Branch. Wir gehören zur ICD, das ist die Information Control Division. Deren Ziel ist es, den Deutschen und Italienern möglichst schnell den Faschismus auszutreiben. Der PCB ist nur ein winziger Teil davon. Die amerikanische Regierung ist der Ansicht, dass Umerziehung bei den Zeitungen und Verlagen beginnen muss. Und da kommen wir ins Spiel. Unsere Gruppe hat den Auftrag, das Bücherlager auf Schloss Hungen zu inspizieren. Das ist in der Nähe von –«
»Gießen. Ich weiß. Aber woher kommen Sie ursprünglich? Sie sind kein Amerikaner.«
»Auf dem Papier bin ich einer«, sagte Felix. »Ich bin vor fünfzehn Jahren in die Staaten ausgewandert.«
»Da müssen Sie noch sehr jung gewesen sein.«
»Vierundzwanzig.«
»In weiser Voraussicht?«
»Ich hatte keine Wahl.«
»Politisch verfolgt? Sind Sie Jude? Kommunist?«
»Weder noch.« Felix blickte Hartmann fest in die Augen. »War eine private Sache.«
»Aus welcher Stadt kommen Sie?«
»Leipzig.«
Hartmann stieß ein humorloses Lachen aus. »Genau wie diese Panzerfaust. Die HASAG hat letztes Jahr vom Rüstungsministerium den Auftrag erhalten, im Monat anderthalb Millionen von den Dingern herzustellen. Anderthalb Millionen! Um das zu bewerkstelligen, hätten sie wahrscheinlich halb Leipzig zur Arbeit im HASAG-Werk zwangsverpflichten müssen, nicht nur die armen Schweine aus den Lagern.«
Felix war überrascht, dass Hartmann sein Wissen über die Konzentrationslager so unumwunden eingestand. Die Deutschen, mit denen er im Schloss zu tun hatte, stritten jegliche Kenntnis über die Verbrechen des Regimes ab. Über die Vorgänge in Leipzig hatte Felix sich in internen Berichten der Army informiert, fast widerstrebend, weil er mit seinem alten Leben dort längst abgeschlossen hatte.
»Haben Sie vom letzten Abendmahl des HASAG-Generaldirektors gehört?«, fragte er.
Hartmann schüttelte den Kopf.
»Ich erzähl’s Ihnen. Wollen Sie das Ding da solange nicht weglegen?«
Der Granatenkopf der Panzerfaust zeigte weiterhin über den Tisch hinweg auf die Bücherregale neben dem Eingang, haarscharf an Felix’ Kopf vorbei.
»Wie Sie meinen«, sagte Felix mit einem Seufzen. »Als absehbar war, dass Leipzig fallen würde, hat der Direktor alle Menschen, die ihm nahestanden, zu einem Bankett in der HASAG-Verwaltung eingeladen. Die engste Familie, seine leitenden Angestellten, überhaupt alle, die ihm wichtig waren. Es gab einen fetten Festbraten, kistenweise französischen Wein und eine salbungsvolle Rede, wie sich das bei so einem Anlass gehört. Zum Dessert hat er dann eine Reihe von versteckten Sprengladungen gezündet. Das Gebäude ist in die Luft geflogen, und fast alle Menschen darin sind verbrannt. Kein schöner Tod.«
»Subtil sind Sie nicht gerade«, sagte Hartmann.
»Es ist die Wahrheit. Wobei sich Gerüchte halten, dass der Direktor alle anderen geopfert hat, um in dem Durcheinander unterzutauchen. Manche erzählen, er sei am nächsten Tag über die Schweiz nach Argentinien ausgereist. Er habe geheime Unterstützer gehabt, heißt es. Freimaurer, vor allem, weil er bis ’33 selbst einer war. Das ist natürlich immer eine dankbare Geschichte.«
»Sind Sie Freimaurer?«, fragte Hartmann.
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Ich habe eine Menge Bibliophile kennengelernt, die Freimaurer waren.« Er stieß ein leises Schnauben aus. »Vielleicht eine Frage des Einkommens. Hatten Sie anderweitig mal mit den Logen zu tun?«
»Nur mit einer.«
»Darf ich fragen, mit welcher?«
Felix fixierte den Mann auf der anderen Seite des Tisches. Es war an der Zeit, zur Sache zu kommen. Bevor er die Bibliothek betreten hatte, hatte der Offizier ihm eine Viertelstunde gegeben. Danach würden seine Leute Gas in den Raum pumpen, und falls Hartmann dann noch Gelegenheit hatte, alles in Brand zu schießen, sollte es eben so sein.
»Was genau wollen Sie, Herr Hartmann? Sie sind kein Soldat. Man hat Sie wegen der Bücher hergeholt, und ich nehme Ihnen nicht ab, dass Sie das alles hier wirklich verbrennen wollen. Sich selbst vielleicht, meinetwegen auch mich, aber doch nicht die Bücher.«
Hartmann schien kurz darüber nachzudenken, dann wuchtete er die Panzerfaust von seiner Schulter und legte sie quer auf den Tisch, die Hand weiterhin am Auslöser. Wenn er sie auf diese Weise abfeuerte, würde ihm der Rückstoß die Finger abreißen. »Was wissen Sie über die Johannesapokalypse?«, fragte er.
»Sie wurde angeblich hier auf der Insel verfasst«, sagte Felix. »Nicht vom Evangelisten Johannes, wie viele meinen, und auch nicht von Jesus’ Lieblingsjünger, sondern von irgendeinem obskuren Propheten. Das satanische Tier steigt aus dem Meer auf, stürzt die Welt ins Chaos und lässt sie nach allerlei Erscheinungen, Plagen und Katastrophen schließlich untergehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach meinte der Verfasser damit gar nicht den Teufel. Das Tier war wohl eine Metapher für einen Doppelgänger des Kaisers Nero, der im ersten Jahrhundert in Kleinasien eine Art Kult gründete, Tausende Anhänger um sich scharte und Unruhe stiftete.«
Hartmann klatschte langsam in die Hände. Dann deutete er hinüber zu den vollen Regalreihen. »Es gibt hier alle möglichen Bücher, darunter auch Hunderte Ausgaben der Apokalypse. Eigentlich ist das verwunderlich. Die Mönche hier auf Patmos sind orthodox, und in der Ostkirche hat man sich nie groß für die Offenbarung des Johannes interessiert. Sie ist eher ein Steckenpferd der Katholiken. Teufel und Verdammnis stehen bei uns hoch im Kurs, während man die Sache hier ein wenig gelassener sieht. Die Mönche halten das Ganze eher für eine Art Kuriosum, und unter ihnen ist es durchaus umstritten, dass man der Apokalypse in ihrer Bibliothek einen so großen Platz einräumt.«
»Der Prophet gilt nichts im eigenen Land«, sagte Felix ironisch. »Das scheint hier noch etwas passender zu sein als anderswo.«
Hartmann nickte. »Trotzdem gibt es diese spektakuläre Sammlung. Ich bin seit zehn Monaten auf der Insel und habe trotzdem erst einen Teil der Bücher durchgesehen. Es hat was Tröstliches, sich von morgens bis abends mit einem literarischen Weltuntergang zu beschäftigen, während da draußen die wirkliche Welt vor die Hunde geht.«
»Und dann kamen die Engländer und haben Ihre kleine apokalyptische Idylle gestört.« Felix warf einen verstohlenen Blick auf seine Uhr. Ihm blieben nur wenige Minuten, bis der Offizier seine Drohung wahr machen würde.
»Haben Sie es eilig?«, fragte Hartmann.
»Was glauben Sie denn? Das da draußen sind Soldaten. Die geben uns nicht ewig Zeit.«
»Sind Sie hier, um mich zu töten?«
»Ich sagte doch, ich bin nicht bewaffnet.«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage.«
»Nein.«
»Nein was?«
»Ich will Sie nicht töten.« Felix deutete mit einem Nicken auf die Panzerfaust. »Das schaffen Sie auch ohne mich. Ehrlich gesagt, war ich neugierig. Und wer sagt schon Nein zu einem Ausflug ans Mittelmeer.«
»Wer ist Ihr Vorgesetzter?«
»Gordon Maples.«
Hartmann wurde hellhörig. »Ich kenne Maples. Ich habe mal einen seiner Vorträge in Paris gehört, damals in den Dreißigern. Es ging um die Erforschung von Lesegewohnheiten und gedruckter Kommunikation.«
»Wollen Sie sich wirklich mit mir über Maples unterhalten?«
»Verzeihen Sie. Nein. Ich habe zehn Monate mit niemandem außer ungebildeten Wehrmachtssoldaten gesprochen … und, offen gesagt, habe ich das auf ein Minimum reduziert. Keiner von denen hatte auch nur eine Spur von Verständnis für das, was ich hier getan habe. Die meisten von denen konnten ein Buch nicht von einem Sandsack unterscheiden.«
»Ich fühle mit Ihnen.« Diesmal machte Felix sich nicht mehr die Mühe, den Blick auf die Uhr zu verheimlichen. Etwas verhaltener sog er die Luft ein und fragte sich, ob das Gas der Briten geruchsfrei war. Wohl kaum, sonst hätten sie es schon früher damit versucht.
»Die Geschichte des Christentums ist die Geschichte einer maßlosen Enttäuschung«, fuhr Hartmann ungerührt fort. »Seit zweitausend Jahren glauben die Christen fest daran, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht. Dabei geht es ihnen gar nicht darum, den Tod zu feiern, so wie Ihr Generaldirektor mit seinem Feuerwerk. Stattdessen zelebrieren sie, dass der Jüngste Tag immer näher kommt, mit all seinen Vergebungen, Segnungen und was der liebe Gott am Ende aller Zeiten sonst so in petto hat.«
»Die Apokalypse als Anlass zur Freude«, sagte Felix.
»Genau. Nur dass in den letzten zwei Jahrtausenden jeder einzelne Christ gestorben ist, ohne den Weltuntergang mitzuerleben. Das Ganze ist eine einzige leere Versprechung. Für einen Gläubigen muss das sehr desillusionierend sein.«
»Aber in Europa hat man zuletzt doch einen ganz guten Vorgeschmack darauf bekommen.«
Hartmann lächelte humorlos und geriet ins Dozieren. »Ein guter Christ ist immer der Überzeugung, auf der richtigen Seite zu stehen. Früher bedeutete das, dass er sich vor der Apokalypse nicht fürchten musste – sie war eine Verheißung, keine Drohung. Mit der Verbreitung des geschriebenen Wortes hat sich der Begriff dann allmählich gewandelt und bekam einen dunkleren Unterton. Die Apokalypse wurde gleichgesetzt mit einer allumfassenden Katastrophe. Die Gläubigen bekamen Angst bei der Vorstellung, die Apokalypse am eigenen Leib zu erfahren. Niemand, der bei Verstand ist, wünscht sich heute noch den Weltuntergang herbei.«
»Herr Hartmann«, sagte Felix angespannt, »das ist wirklich hochinteressant. Aber uns läuft die Zeit davon.«
»Für die wahren Apokalyptiker ist Zeit nichts anderes als die Dauer bis zum Eintritt des Endes«, redete Hartmann ungerührt weiter. »Wie ein Kind, das auf Weihnachten wartet: Es gibt das Jetzt und es gibt Heiligabend, und alles dazwischen sind nur lästige Wochen, die man irgendwie herumkriegen muss. So sieht der Apokalyptiker die Zeit. Auf der einen Seite würde er alles tun, um möglichst viel davon zu haben, damit er das Ende am eigenen Leib erfahren kann – und auf der anderen Seite würde er diese endlose Zeit am liebsten auf einen kurzen Augenblick zusammenschrumpfen, damit die Apokalypse schnellstmöglich eintritt. Das ist das Paradoxon, das ich hier auf Patmos entdeckt habe.«
»Sie hatten offenbar viel Zeit, sich Gedanken zu machen.«
»Und niemanden in meiner Gesellschaft, der auch nur ein Wort davon verstanden hätte. Nur einfältige Soldaten, unbedarfte Ziegenhirten und feindselige Mönche, die lieber ihre Mützen fressen würden, als ein Wort mit mir zu wechseln.«
Felix runzelte die Stirn. »Darum bin ich hier? Weil Sie das Paradoxon der Apokalyptiker erkannt haben und den Gedanken an jemanden weitergeben wollen?«
Er meinte plötzlich, etwas zu hören. Den Widerhall von Schritten. Schritte vieler Menschen, die sich im Kreis bewegten. Schneller und schneller. Keine Soldaten beim Sturm auf die Bibliothek, kein heimlicher Aufmarsch. Nur Schritte im Kreis, wie in einem bizarren Ritus. Und immer noch schneller, schneller, schneller.
»Hören Sie das auch?«, flüsterte er.
Hartmann ignorierte ihn. »Ich überlasse Ihnen meine Gedanken – und dazu diese Bibliothek. Die Mönche wissen nicht zu schätzen, was sie hier besitzen. Die Apokalypse bedeutet ihnen nichts. Wir Deutschen aber kennen den Untergang besser als jeder andere. Wir alle tragen etwas von diesem Generaldirektor in uns, das Zündeln liegt uns im Blut. Und am Ende sprengen wir den ganzen Laden in die Luft, weil es uns gar nicht schnell genug gehen kann. Vielleicht ist das die Erklärung für alles, was in den letzten zwölf Jahren geschehen ist: Wir Deutschen sind Apokalyptiker, die die Geduld mit der Zeit verloren haben. Darum haben wir die Apokalypse zu uns geholt.«
Vor wenigen Augenblicken hatte Felix zu schwitzen begonnen. Nun bekam er dazu einen Anflug Schüttelfrost, durchmischt mit Panik. Der Kreis aus Schritten schien sich zusammenzuziehen und um seinen Schädel zu rotieren, er hörte kaum noch etwas anderes. Es kostete ihn alle Kraft, Hartmanns Worten zu folgen, aber er war nicht sicher, ob er verstand, was der Mann ihm sagen wollte.
Hartmann zeigte ein rasiermesserscharfes Grinsen. »Die Wahrheit ist hier, in diesen Regalen. Alles, was man wissen muss – weil alles, was wir tun, immer nur der Griff nach dem Ende ist. Die Sehnsucht nach dem Weltgericht.«
Felix vernahm die Schritte nicht zum ersten Mal, und tatsächlich wusste er genau, dass Hartmann sie nicht hören konnte. Weil niemand sie hörte außer ihm selbst. Dennoch flehte er innerlich um eine Bestätigung, dass er gerade nicht den Verstand verlor.
Und dann, mit einem Mal, verstummten die Schritte. Das rasende Trippeln im Kreis brach ab, von einem Augenblick zum nächsten, genauso wie bei den vielen Malen zuvor.
Hartmanns Worte hallten wie ein Echo in seinen Gedanken nach. Wir Deutschen sind Apokalyptiker, die die Geduld mit der Zeit verloren haben. Alles, was wir tun, ist immer nur der Griff nach dem Ende. Er war nicht sicher, ob er das für die abgeschmackte Weisheit eines Spinners hielt oder die konsequente Philosophie eines Mannes, der sehr viele Stunden mit Grübeleien über diesen einen Gedanken verbracht hatte.
Hartmanns Hand ruhte noch immer am Abzug der Panzerfaust.
Draußen auf dem Gang wurde ein Generator angeworfen.
Felix deutete auf die Waffe. »Ist das da Ihr Griff nach dem Ende?«
Hartmann folgte seinem Blick, schien fast erstaunt über das, was er sah, und zog die Hand langsam zurück. Dann richtete er sich auf und schob dabei den Stuhl nach hinten. Mit einem Lächeln kam er am Tisch entlang auf Felix zu, der aufsprang, bevor der andere bei ihm war.
Hartmann reichte ihm die Hand. »Es war mir eine Freude und eine besondere Ehre.«
Felix blickte ihn an, dann seine Hand. Zögernd ergriff er sie und schüttelte sie. Hartmanns Griff war fest und entschlossen.
»Was haben Sie jetzt vor?«
»Ich begebe mich in Kriegsgefangenschaft.« Hartmann ließ los, ging zur Tür und pochte heftig mit der Faust dagegen. Auf Englisch ließ er die Soldaten wissen, dass er sich stellte.
Das dumpfe Getöse des Generators brach ab.
Hartmann schob den Riegel zurück.
Felix trat mit raschen Schritten neben ihn. »Dafür haben Sie Ihr Leben aufs Spiel gesetzt?«
»Zwischen Menschen, die Bücher schätzen, gibt es immer ein Verständnis, eine Art wissende Übereinkunft. Sie verstehen mich, oder Sie werden es irgendwann tun. Leben Sie wohl, Herr Jordan. Und sorgen Sie gut für die Bibliothek.«
Er zog die Tür auf, blickte in ein Dutzend Gewehrmündungen und ließ sich mit erhobenen Händen festnehmen.
3
Drei Tage lang widmete Felix sich ungestört der Bibliothek der Apokalypsen. Nur frühmorgens unternahm er ausgedehnte Spaziergänge durch die berauschende Hügellandschaft jenseits des Klosters. Er wanderte durch Haine aus Zypressen und Eukalyptusbäumen, genoss den Geruch von Oleander und Jasmin, hielt zwischen knorrigen Olivenbäumen inne und horchte hinaus in die Stille. Keine rasenden Schritte, die ihn umkreisten. Dafür eine makellose Ruhe, hier draußen und auch in der Bibliothek. Im Kloster hatte er mit wehklagenden Mönchen gerechnet, doch genau wie Hartmann gesagt hatte, sprachen sie kein Wort mit ihm und beobachteten ihn aus den Schatten, während ihre Finger lautlos über die Knoten ihrer Gebetskordeln glitten.
Am vierten Tag landete ein amerikanisches Wasserflugzeug unten am Hafen von Skala, und ein Besucher in Trenchcoat und Hut ging an Land. Wie sich herausstellte, hatte der Mann den ganzen Weg nur für Felix auf sich genommen.
»Gordon? Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen?«
Gordon Maples, sein Chef beim PCB, betrat das Kloster durch das Hauptportal, als Felix aus der Bibliothek hinaus auf den vorderen Hof eilte. Man hatte ihn eben erst über die Ankunft des Amerikaners in Kenntnis gesetzt, und vor seinen Augen tanzten noch griechische Lettern und illuminierte Initialen.
Maples nahm den Hut ab und klopfte den Inselstaub herunter. »Ich dachte, ein vertrautes Gesicht reißt Sie aus Langeweile und Trübsal an diesem schrecklichen Ort.«
Felix schüttelte ihm die Hand. »Das würde ich Ihnen nicht mal abnehmen, wenn ich nicht wüsste, dass Sie eigentlich gerade in Rom sein müssten. Und dass zwischen Rom und Patmos über tausend Meilen liegen.«
»Kein Weg ist mir zu weit, um meine Mitarbeiter zu drangsalieren. In meinem Alter ist das eine der letzten großen Freuden, die mir den Alltag erträglich machen.«
»Wie war der Flug?«
»Welcher? Der in dem überfüllten Truppentransporter von Rom nach Athen oder der mit qualmendem Propeller von Athen nach Mykonos oder vielleicht der in einem fliegenden Schlauchboot von Mykonos bis zu diesem Stein am Ende der Welt?«
»Ich vertraue darauf, dass das hoch qualifizierte Personal der U.S. Army alle drei Flüge für Sie zu einer Erfahrung aus amerikanischem Sitzkomfort und feinster europäischer Cuisine gemacht hat.«
»Noch ein einziges Wort, Felix, und ich versetze Sie auf die Äußeren Hebriden.«
»Haben wir die auch erobert?«
Maples blickte sich im Innenhof um, während Mönche halb verborgen in Türrahmen lauerten wie Gespenster aus schwarzem Rauch. »Mein Rücken tut weh, ganz zu schweigen von meinem Arsch. Ich vermute mal, hier gibt es keine samtweiche Chaiselongue für meinen geplagten Steiß?«
»Hocker und Holzschemel hätte ich anzubieten. Dafür aber mit einer Aussicht, die sich gewaschen hat.«
»Falls es Ihnen nichts ausmacht, dass ich mich seit vorgestern nicht mehr gewaschen hab – gern.«
Maples musste um die sechzig sein, vielleicht auch älter, erfüllt von tiefster Gleichgültigkeit gegenüber dem schnöden äußeren Schein – was seine leidgeprüfte Sekretärin gern Verwahrlosung nannte. Sein graues Haar war strähnig, seine Brille schief, ein Schneidezahn halb abgebrochen. Eine Kriegsverletzung, behauptete er, aber jeder wusste, dass Maples nie selbst gekämpft und den gesplitterten Zahn dem Zusammenstoß mit einer Tischkante zu verdanken hatte. In einer Armeekneipe fernab der Front war er ruhmlos vom Stuhl gefallen, während er mit dem Barkeeper das Nachfüllen seines zerbeulten Flachmanns erörtert hatte. Ein missgünstiger Neider hatte das entsprechende Protokoll der Militärpolizei in den Abteilungen der ICD kursieren lassen, was Maples lediglich dazu ermunterte, seine Mär vom Feindkontakt mit abenteuerlichsten Arabesken auszuschmücken.
Heute blieb Felix davon verschont, denn Maples war erschöpft vom Weg den Hügel herauf und wurde noch kurzatmiger, als sie über enge Steintreppen auf die Flachdächer des Klosters stiegen. Die hohe Ummauerung der Anlage war aus dunklem Stein, während sich die Gebäude im Inneren kaum von den weißen Würfeln unterschieden, die den Hang unterhalb des Klosters bedeckten. Nur waren sie hier noch enger ineinander verschachtelt, kein Haus war so hoch wie das andere. Felix und Maples überquerten diese Dachlandschaft aus Quadern und Rechtecken auf allerlei Stufen und Rampen und gelangten schließlich auf den Wehrgang mit seinen geschwungenen Kerbzinnen.
Felix hatte nicht zu viel versprochen, als er seinen Chef auf einem wackligen Schemel platzierte, für sich einen zweiten heranzog und dann gut fünf Minuten lang zusah, wie dem missmutigen Alten die Spucke wegblieb beim Blick über das azurblaue Meer und die braunen Inselhöcker. Seeschwalben kreisten vor dem Panorama, einmal zog ein Mönchsgeier an den Zinnen vorüber.
»Ganz hübsch hier«, sagte Maples.
»Sie sind ein Mann von leidenschaftlicher Ausdruckskraft und unverbrämter Sinnenfreude«, erwiderte Felix.
Maples’ Mundwinkel zuckte, aber das bekam er sogleich unter Kontrolle. »Kommen wir zu den wichtigen Dingen: Sie haben das hier gut gemacht.«
»Eigentlich hab ich überhaupt nichts gemacht. Hartmann hat aus freien Stücken aufgegeben.«
»Was wir allein Ihrem Fingerspitzengefühl zu verdanken haben. Jedenfalls ist es das, was ich in den Bericht schreiben werde. Und natürlich auch, dass Sie Ihre ausgezeichneten Fertigkeiten von mir gelernt haben.«
»Natürlich.«
»Tatsächlich bräuchten wir hier auf der Insel jemanden wie Sie.«
»Ich bin gern bereit, mich –«
»Zu opfern, jaja. Nun übertreiben Sie’s mal nicht mit Ihrer Großmut. Das Problem ist leider, dass ich Sie anderswo viel dringender brauche.«
Felix versuchte, seine Enttäuschung zu überspielen, aber Maples hatte einen scharfen Blick für jegliche Form von Schwäche.
»Ihnen war doch klar, dass das hier nur ein kurzer Abstecher sein würde«, sagte er.
»Sicher«, bestätigte Felix.
»Ich hätte Ihnen das auch per Telegramm oder sonst wie mitteilen können, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, selbst einen Blick auf die legendäre Bibliothek von Patmos zu werfen.«
»Ich führe Sie herum, wenn Sie möchten.«
»Erst mal hören Sie mir zu. Also, Folgendes ist passiert: Vor zwei Tagen hat sich unserer Truppe in Deutschland ein Mann gestellt, der behauptet, er sei jahrelang der persönliche Vorleser Adolf Hitlers gewesen.«
»Ich vermute mal, es haben sich auch Männer gestellt, die behaupten, Adolf Hitler zu sein.«
»Nun seien Sie kein Spielverderber. Alle sind schrecklich stolz auf diesen Fang.«
»Dann gibt es Beweise, dass er die Wahrheit sagt?«
»Das ist es, was die Sache interessant macht. Vor ein paar Wochen haben amerikanische und französische Einheiten Hitlers privates Anwesen am Obersalzberg besetzt. Der größte Teil lag bereits in Trümmern. Es gab ein ziemliches Gerangel um Zuständigkeiten, wie überall, deshalb hat es eine Weile gedauert, bis wir verlässliche Informationen bekommen haben, was dort oben noch erhalten war und was nicht. Wie sich herausgestellt hat, waren vor unseren Soldaten bereits Plünderer im Gebäude, und die SS hat das Ganze danach in Brand gesetzt. Wir sind davon ausgegangen, dass dem Feuer auch Hitlers Bibliothek zum Opfer gefallen ist.«
Felix hatte davon gehört und fragte sich, worauf Maples hinauswollte. Weil keine Bücher gefunden worden waren, hatte er sich mit Hitlers Berghof nicht weiter beschäftigt, zumal die zwei Millionen Bände auf Schloss Hungen für den PCB genug Arbeit bedeuteten.
»Vergangenen Monat haben unsere Leute in einer Salzmine bei Berchtesgaden Kisten mit ein paar Tausend Büchern entdeckt«, fuhr Maples fort. »Mittlerweile wurden sie grob durchgesehen, in einer ganzen Reihe davon klebten Hitlers Exlibris. Wir nehmen an, dass es sich um Teile der Bibliothek vom Obersalzberg handelt. Vermutlich haben die Plünderer sie von dort mitgenommen und in der Mine zwischengelagert. Es gab dort auch allerlei anderes Gerümpel, aber für uns sind vor allem die Bücher interessant.«
»Warum weiß ich davon nichts?«
»Weil die Library of Congress bereits ihre Finger danach ausgestreckt hat und alles unter höchster Geheimhaltung steht. Insofern könnte uns das egal sein, aber nun kommen wir wieder zu unserem mysteriösen Vorleser. Er behauptet, mehrfach am Obersalzberg gewesen zu sein, wo er Hitler, Eva Braun und dem innersten Zirkel vorgelesen hat. Er hat uns ein paar obskure Titel genannt, die er angeblich dort in Händen hatte, und nun dürfen Sie raten.«
»Die lagen alle in dieser Salzmine.«
Maples’ Grinsen entblößte seinen zerbrochenen Zahn. »Jedenfalls die meisten. Er sagt, er sei außerdem in der Wolfsschanze und in der Reichskanzlei gewesen, aber das können wir nicht überprüfen, weil dort die Sowjets alles kurz und klein geschlagen haben und wahrscheinlich noch immer Wodka saufend in den Ruinen liegen. Das ist aber auch egal, weil der Mann behauptet, die wichtigsten und wertvollsten Bücher aus Hitlers Privatbibliothek seien Anfang des Jahres von dort abtransportiert und an einem geheimen Ort versteckt worden.«
Felix seufzte. »Also geht es schon los.«
»Was meinen Sie?«
»Die Mythenbildung. Bald werden Sammler Fantasiesummen für jeden alten Schinken bezahlen, den der selige Führer irgendwann mal in den Fingern hatte.«
»Na, kommen Sie! Hitlers geheime Bibliothek! Wie könnte uns das nicht neugierig machen? Wir wissen, dass er und seine Führungsriege Strohmänner zu Buchauktionen in alle Welt geschickt haben, um gewisse Exemplare zu ersteigern. Diese Leute hatten nahezu unbegrenzte Budgets und haben stapelweise die ältesten und seltensten Bände zurück nach Deutschland gebracht. Kaum etwas davon ist bisher wieder aufgetaucht, auch nicht in der Salzmine.«
Felix begriff, worauf das hinauslief. »Und nun hofft die Library of Congress, dass dieser Vorleser, der auf wundersame Weise wie aus dem Nichts aufgetaucht ist, ausgerechnet uns verrät, wo das ganze Zeug liegt.«
»Nicht uns«, sagte Maples. »Ihnen, Felix.«
»Mir?«
»Ja, natürlich. Deshalb besuche ich meinen besten Mitarbeiter.«
»Ich denke eher, die haben Sie hergeschickt, und Sie konnten nicht Nein sagen.«
Maples gab sich ertappt und zuckte die Schultern. »Am Ende bin ich auch nur ein kleiner Angestellter, der auf seine Rente wartet. Und die werde ich mir nicht mehr vermiesen lassen. Wenn diese Leute sagen, ich soll springen, dann springe ich. Oder fliege von einem Ende Europas zum anderen, um hier mit Ihnen in der Sonne zu sitzen.«
»Aber warum ausgerechnet ich? Auf Schloss Hungen gibt es ein halbes Dutzend PCBler, die genauso qualifiziert sind wie ich. Und sagen Sie nicht, wegen der Sache mit Hartmann.«
Maples schüttelte den Kopf. »Darüber wissen die noch gar nichts, bevor ich nicht meinen Bericht getippt habe. Und dafür bräuchte ich erst mal Ihren.«
»Noch mal: Warum ich?«
Maples blickte sehnsüchtig zu einem Fischerboot vor der Küste. Weiter draußen gab es noch mehr davon, winzige Punkte auf dem atemberaubenden Blau. »Weil er mit niemandem außer Ihnen sprechen will.«
»Er hat meinen Namen genannt?«
»O ja.«
»Wieso das, um Himmels willen?«
»Sagen Sie’s mir. Vielleicht ist es jemand, den Sie von früher kennen.«
Felix hob hilflos die Hände. »Wie heißt der Kerl?«
»Verrät er uns nicht.«
»Woher kommt er?«
»Zuletzt aus Berlin. Er wurde an einem Bahnhof aufgegriffen. Als er sich ausweisen sollte, hat er es vorgezogen, sich zu stellen. Papiere hatte er keine dabei, auch sonst nichts, das geholfen hätte, ihn zu identifizieren.«
»An welchem Bahnhof?«
»Leipzig.«
Felix schloss für einen Moment die Augen. »Er sitzt in Leipzig in Haft?«
»Allerdings.«
»Verlangen Sie nicht von mir, dass ich dorthin zurückgehe.« In einem schwachen Augenblick hatte er Maples gegenüber einmal erwähnt, dass er um keinen Preis der Welt in seine Geburtsstadt zurückkehren wollte.
»Sorry, Felix.«
»So ein Bullshit.«
»Man nennt es Krieg, mein Junge.«
»Im Ernst, Gordon. Das ist so gottverdammt unfair.«
»Dieser Bastard besteht nun mal darauf, nur mit Ihnen zu reden. Ich kann’s nicht ändern. Jemand muss die Suppe auslöffeln, und es sieht ganz danach aus, als würden Sie das sein.«
»Haben Sie ein Foto von ihm dabei?«
»Ich hab nicht mal Fotos von meinen Kindern.«
»Sie haben Kinder?«
»Nun werden Sie mal nicht frech.«
»Wie sieht der Kerl denn aus?«
»Schwer zu sagen. Von seinem Gesicht ist nicht viel übrig.«
»Was?«
»Brandwunden. Ziemlich heftige, hat man mir gesagt. Er trägt eine von diesen Ledermasken, die man in Deutschland jetzt oft auf den Straßen sieht. Bei all den Kriegskrüppeln.«
»Herrgott, Gordon.«
»Sehen Sie’s als Herausforderung: Sie werden mit dem Phantom der Oper reden.«
Felix presste die Lippen aufeinander und schwieg.
»Das ist noch nicht alles«, sagte Maples.
»Ich kündige«, sagte Felix.
»Tun Sie nicht.«
»Was denn noch?«
»Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Der Alliierte Kontrollrat hat die exakte Einteilung der vier Besatzungszonen festgelegt. Leipzig ist im Augenblick noch von amerikanischen Truppen besetzt, aber das wird sich bald ändern. Sachsen gehört zur sowjetischen Zone, und spätestens in ein paar Wochen, vielleicht früher, wird jeder Amerikaner die Stadt verlassen. Dann übernehmen dort die Russen das Ruder, und wir wissen ja, wie gut das gerade in Berlin funktioniert.«
»Warum schaffen Sie den Mann nicht vorher nach München oder Hamburg oder sonst wohin?«
»Weil die Russen über ihn Bescheid wissen. Sie machen schon Ansprüche geltend und werden uns unter einem Scheißhaufen von diplomatischen Verwicklungen begraben. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass das Versteck von Hitlers Bibliothek irgendwo im Osten Deutschlands liegt. Wir müssen seine Bücher also finden und abtransportieren, ehe die Sowjets dort das Sagen haben.«
Erst allmählich begriff Felix das Ausmaß der Verantwortung, die Maples ihm gerade in den Schoß kübelte wie eine Schüssel Essensreste. Sein Magen zog sich zusammen, und ihm wurde schwindelig, als wäre der Abgrund jenseits des Wehrgangs auf einen Schlag sehr viel tiefer als noch vor wenigen Minuten.
»Was, wenn ich ablehne?«
»Als hätten Sie eine Wahl.«
»Ich bin kein Angehöriger des Militärs.«
Maples seufzte. »Wir beide sind Regierungsangestellte. Das ist noch viel schlimmer. Wenn die Bosse mit Ihnen fertig sind, wird Ihnen Leipzig wie das Paradies vorkommen.«
Felix wandte sich ab und blickte über die Zinnen. Er hatte einen ähnlichen Anblick schon einmal aufgeben müssen, damals in Amalfi, und der Gedanke, es ein zweites Mal zu tun, schmerzte ihn fast körperlich. »Sehen Sie sich das Meer an. Sie verlangen, dass ich auf das hier verzichte für eine deutsche Stadt in Trümmern?«
»Von mir aus hole ich Sie danach nach Rom. Oder an jeden anderen Ort, an dem es etwas für den PCB zu tun gibt. Raus aus Deutschland jedenfalls, falls es Ihnen darum geht.«
»Ich könnte trotzdem Nein sagen. Einfach auf alles pfeifen, auch auf die Wünsche der Regierung. Sogar auf Sie.«
Kurz blitzte Wut in Maples’ grauen Augen auf. »Wollen Sie mich dazu zwingen, Ihr Gepäck durchsuchen zu lassen? Was würden wir wohl finden? Möglicherweise ein besonders seltenes Exemplar der Johannesapokalypse, das Sie mitgehen lassen wollen? Sie möchten doch nicht, dass in Ihrer Akte etwas von Bücherdiebstahl steht.«
Felix starrte ihn mit versteinerten Zügen an. Er war tatsächlich einmal ein Bücherdieb gewesen, vor vielen Jahren, in einem anderen Leben. »Sie haben das längst veranlasst, oder? Einer von diesen Engländern hat in Ihrem Auftrag in meinem Koffer rumgewühlt.«
»Nehmen Sie’s nicht persönlich. Ich bekomme auch nur Druck von oben.«
Eine Weile lang sagte Felix kein Wort, schmeckte die salzige Luft und roch den harzigen Nadelduft der Zypressen. Er sah hinaus aufs Mittelmeer, auf die Boote, die Inseln, auf diesen Ort, der seiner Vorstellung vom Paradies so verteufelt nahekam.
»Jeden Ort«, wiederholte er so leise, dass es fast nur ein Flüstern war. »Sie versetzen mich danach an jeden Ort, an den ich will?«
Maples’ Züge zeigten den Schatten eines Lächelns. »Sie wollen hierher zurück?«
»Sobald die Sache in Leipzig beendet ist«, sagte Felix. »Und ich will darauf Ihr Ehrenwort.«
Erster Teil
Die Lebenden
4
1930
Wie immer trafen sie sich zu viert in Vadims Antiquariat.
Der Laden befand sich im Erdgeschoss eines prachtvollen Stadtpalais an der Ecke Rabensteinplatz und Täubchenweg. Seine Fenster blickten zum Alten Johannisfriedhof auf der anderen Straßenseite, Leipzigs ältestem Gottesacker. Im Mittelalter waren dort Tausende Leprakranke verscharrt worden. Viel später, während der Völkerschlacht von 1813, hatten Soldaten die steinernen Grufthäuser besetzt und die morschen Särge als Feuerholz benutzt. Als der junge Goethe während seiner Leipziger Studienzeit einmal gekränkelt hatte, hatte er sich ein Grab auf dem Johannisfriedhof gewünscht, und auch deshalb sah man bis heute Melancholiker und verlorene Seelen unter den uralten Bäumen schlendern, einsame Schemen im Nebel des Graphischen Viertels.
Vadim behauptete, dass er im Dunst dort drüben manchmal die Geister der Toten aus den geschändeten Grüften sähe. Felix hegte den Verdacht, dass dabei eher ein hochprozentiger Geist von der Schlehe sein Unwesen trieb.
Das Antiquariat war behaglich und übervoll mit Büchern. Vadim hatte wenig daran verändert, seit er es drei Jahre zuvor von seinem greisen Vorbesitzer übernommen hatte. Hätte er es versucht, hätten die anderen ihn wohl davon abgehalten. Die Tische mit den hochtürmenden Tempeln aus Bücherstapeln, die knarzenden Sessel, das breite Samtsofa oben auf der Empore über dem Verkaufsraum – wenn die Freunde sich hier trafen, und das taten sie oft, musste das alles an seinem Platz sein und nur ja nicht belagert von lästigen Kunden.
Zwischen den Regalen hing ein Kalender, erstarrt in der Zeit, weil Vadim seit Monaten die Seiten nicht umschlug. Fünf Wörter füllten das vordere Blatt, schwarze Lettern auf vergilbtem Grund.
Geh nie in dunkle Kammern.
Felix wusste nicht, ob es sich um ein Zitat, ein Motto oder einen mysteriösen Sinnspruch handelte. Er gefiel ihm als Rätsel, deshalb hatte er Vadim nie danach gefragt. Julius mit seiner Scheu vor allem Mystischen verlangte wohl vorsichtshalber keine Erklärung, und Eddies Gedanken irrlichterten zu sehr, um den Wörtern an der Wand mehr als ein paar Sekunden seiner Aufmerksamkeit zu schenken.
Felix und Vadim, Julius und Eddie.
Vier Freunde von Kindheit an. Heute waren sie Erwachsene, und ihre Freundschaft widersetzte sich standhaft der Erkenntnis, dass sie eigentlich längst hätte enden müssen. Felix, Vadim und Julius waren vierundzwanzig Jahre alt, Eddie zwei Jahre jünger. Das war das Alter, in dem Schulfreunde getrennte Wege gingen, Sandkastenkumpeleien an Ansprüchen, Berufen und Frauen zerbrachen. Und doch war es ihnen gelungen, trotz aller Widrigkeiten Freunde zu bleiben, was nicht zuletzt an den Büchern lag. Den besonderen Büchern, die sie gemeinsam stahlen und die Vadim unter dem Ladentisch an seine Kundschaft verkaufte.
»Wir müssen uns irgendwann entscheiden«, sagte Felix, der das Thema als Einziger gelegentlich anschnitt. »Wollen wir einfach nur gelangweilte Söhne reicher Eltern sein oder echte Verbrecher?«
»Wie meinst du das?«, fragte Eddie. Er verstand die Frage auch beim wiederholten Male nicht, während Vadim und Julius ganz genau wussten, wovon Felix sprach. Sie alle waren Söhne wohlhabender Eltern – wobei der Begriff sämtliche Schattierungen von Reichtum umfasste, mit Felix am unteren Ende der goldenen Leiter, während Eddie und Julius um die Plätze auf den höchsten Sprossen konkurrierten.
Vadim Seewald war ein Sonderfall. Vom Vater ignoriert, der mit einigen der größten Leipziger Antiquariate seine zahllosen Liebschaften und vielen Nachkommen finanzierte, betrieb Vadim sein eigenes Antiquariat in erster Linie, um seinem alten Herrn Konkurrenz zu machen. Wovon er bislang weit entfernt war, denn der Laden warf kaum etwas ab. Immerhin erkannte er – vielleicht erblich bedingt –, wenn jemand Geld hatte, und so verkaufte er gelegentlich einem Kunden ein wertloses Buch zu einem Preis, der den Laden zwei weitere Wochen über Wasser hielt.
»Tun wir das, was wir tun, nur aus Langeweile«, formulierte Felix seinen Gedanken neu, »oder weil wir es als kriminelle Genies noch weit bringen wollen?«
»Du hast zu oft den Mabuse gelesen.« Julius streckte sich gähnend in dem Ledersessel, den er bei ihren Zusammenkünften auf der Empore des Antiquariats stets für sich beanspruchte. Felix und Vadim saßen an entgegengesetzten Enden des abgewetzten Sofas mit kupferfarbenen Fransen, während Eddie, der nie still sitzen konnte, am Geländer der Galerie lehnte. Er hielt die Griffleiste mit beiden Händen umfasst und bewegte sich langsam daran entlang, bis wieder einem von ihnen der Kragen platzen und er Eddie mit einem Stoß über die Reling drohen würde, falls er nicht endlich stillhielte.
»Ich hab Mabuse nur als Film gesehen«, sagte Eddie, der die eigene Frage schon wieder vergessen hatte. »Angeblich wollen sie einen zweiten drehen, jetzt mit Ton.«
Ton oder kein Ton war ein Thema, das Eddie beschäftigte, weil er häufiger ins Kino ging als die anderen. Felix hatte nichts gegen Filme, aber er hatte es aufgegeben, sie gemeinsam mit Eddie anzusehen, weil der dabei herumhampelte wie ein Kind oder gedankenverloren gegen die Rückenlehne seines Vordermannes trat.
»Wir tun, was wir tun, weil wir es können«, sagte Vadim mit der beneidenswerten Süffisanz eines Mannes, der schon vor dem Abitur beschlossen hatte, dass nichts und niemand an seinem Selbstwertgefühl kratzen konnte. Während die anderen zumindest nach außen hin Studenten waren und gelegentlich zum Zwecke des Selbstbetrugs und schönen Scheins durch die Universität schlenderten, hatte Vadim entschieden, dass er höhere Bildung für Dekadenz der schlechtesten Sorte hielt. Die beste, also seine, hatte mit Mädchen, Wein und Spielschulden zu tun.
Felix stand auf, trat neben Eddie an das Geländer und blickte von der Empore hinab in Vadims Laden, einen quadratischen Raum mit hohen Schaufenstern und dicht bestückten Bücherregalen. Neben dem kleinen Kassentresen standen ein Hocker und ein Kontrabass, auf dem Vadim manchmal spielte. Er war ein besserer Bassspieler als Buchhändler, auch wenn er selbst behauptete, mit dem Instrument nur die jungen Frauen beeindrucken zu wollen, die dann und wann mit roten Wangen den Laden des schönen Antiquars betraten. Der blonde, stattliche Vadim neigte dazu, ihren Wunsch nach literarischen Liebesgeschichten mit Verwicklungen in reale Romanzen zu stillen. Allerdings hielten sie nie lange, weil Vadim außer einem angenehmen Äußeren, großen Reden und einem alten Kontrabass wenig zu bieten hatte.
Der wogende Nebel vor den Schaufenstern des Antiquariats hatte sich während der letzten Stunde zu einer schwefeligen Mauer verdichtet. Manchmal krochen hauchdünne Schwaden unter der Tür hindurch und mäanderten über das abgewetzte Parkett. Auf einem großen Tisch in der Mitte des Raumes waren zahlreiche Bücher mit dem Rücken nach oben aufgereiht und sahen von der Empore aus wie ein Block aus braunem Mauerwerk, eine Ausgrabungsstätte der Literatur, so antik wie viele der Geschichten an den Wänden.
Vadim verkaufte ausschließlich Erzählungen und Romane, weil er sich – was er nur Felix gestanden hatte – ohne akademischen Hintergrund nicht an die Fachliteratur heranwagte. Über Belletristik urteilte er hart und gnadenlos, und Felix hatte den Eindruck, dass Vadim sich seine Meinungen bestenfalls nach wenigen Seiten bildete. Im Grunde spiegelte dies Vadims Haltung in allen Lebenslagen wider: Er vertrat oft extreme Ansichten und polarisierte aus Lust an der Provokation. Mit vierzehn war das bewundernswert gewesen, mit vierundzwanzig wurde es anstrengend.
»Gehen wir’s noch mal durch«, sagte Vadim. »Heute Abend ist die letzte Gelegenheit, um die Sache durchzuziehen.«
»Woher willst du das wissen?«, fragte Julius, der dem Plan von Anfang an mit Skepsis begegnet war. »Vielleicht bleibt Crowley ja noch länger in der Stadt.«
»Bleibt er nicht«, sagte Felix, der die Recherche im Hotel übernommen hatte. »Das Zimmer im Sedan ist nur für drei Nächte gebucht. Morgen reist er ab, der Wagen zum Bahnhof ist schon bestellt. Angeblich zieht’s ihn zurück zu seiner Geliebten nach Berlin. Die, nebenbei bemerkt, gerade mal neunzehn ist.«
»Und Crowley?«, fragte Eddie.
»Mitte fünfzig.«
Eddie verzog das Gesicht.
»Er ist Aleister Crowley.« Julius fummelte an seiner schweren Hornbrille herum, als wäre ihm das Thema unangenehm. »Der Mann hat in seinem Leben mehr nackte Frauen gesehen, als du dir je vorstellen wirst.«
»Eddie wird bestimmt daran arbeiten«, sagte Vadim ungeduldig. »Wirst du doch, Eddie, oder?«
Der Jüngste in der Runde nickte beflissen.
»Gut, können wir dann jetzt bitte beim Thema bleiben?«
Felix ging noch einmal alle wichtigen Punkte durch: »Crowley wird zum Abschluss seines Besuchs in Leipzig heute Abend ein Dinner für einige seiner Anhänger geben, unten im Restaurant des Sedan. Damit sollte er ausreichend beschäftigt sein, während wir in sein Zimmer einbrechen und alle Bücher mitnehmen, die mit seinem Exlibris gekennzeichnet sind. Alle anderen lassen wir liegen, weil sie keinen Pfifferling wert sind.«
Vadim blickte ernst in die Runde. »Die Sammler nehmen uns die Bücher nur ab, wenn wir beweisen können, dass sie aus Crowleys Bibliothek stammen.« Er sagte uns, meinte aber mir, denn am Ende war er derjenige, der das Diebesgut an den Mann bringen musste. Allerdings war Felix sicher, dass Vadim längst einen Abnehmer hatte. Vermutlich denselben mysteriösen Käufer wie bei all den anderen okkulten Bänden, die sie im Laufe der letzten beiden Jahre herangeschafft hatten.
Für Julius und Eddie spielte Geld keine Rolle, selbst Felix ging es nicht um den Wert der Bücher. Für Vadim stand deutlich mehr auf dem Spiel. Er brauchte die Einkünfte aus ihren Buchdiebstählen, um den Laden und seinen Leumund zu retten. Keiner der anderen hatte je einen Anteil am Erlös verlangt, es ging ihnen allein um die Herausforderung. Schließlich taten sie nur so, als wären sie Diebe. Solange sie ihr Treiben mit einer gesunden Portion Selbstironie betrachteten, blieb alles ein Spiel.
»Wir sind nicht dämlich«, sagte Julius. Er gab sich gelassen, aber Felix spürte, dass der Einbruch in Crowleys Hotelzimmer ihn nervös machte. Julius studierte Philosophie und Religionslehre, und er beschäftigte sich schon seit einigen Jahren mit devianten Strömungen, Neuheidentum und Geheimlehren. So war er es gewesen, der ihnen den Namen Club Casaubon