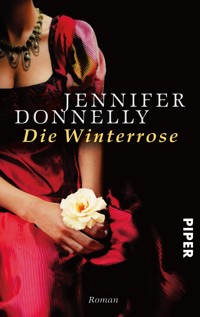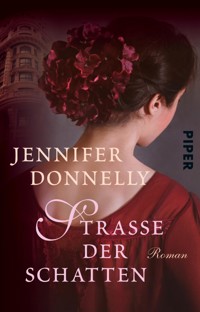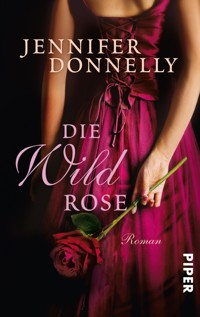19,23 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch einmal sah sie das Leuchten in seinen Augen, bevor er sie für immer schloss. An dem Tag, an dem ihr kleiner Bruder Truman starb, starb auch das Herz in Andis Brust. Und seit er nicht mehr da ist, ist ihr alles egal. Nur wenn sie Gitarre spielt, ahnt sie, dass es so etwas wie Gefühle noch gibt. Als sie auf einer Reise nach Paris in einem alten Gitarrenkoffer das geheimnisvolle Tagebuch einer jungen Frau findet, die einst den Kronprinzen Louis Charles betreute, weiß sie, dass ihre beiden Schicksale untrennbar miteinander verbunden sind. Denn auch die Französin konnte den Tod des geliebten kleinen Jungen nicht verhindern. Und so begleitet Andi Alexandrine auf deren gefahrvollen Wegen durch die Wirren der Französischen Revolution – in der Hoffnung, dort den Schlüssel zur Rückkehr ins Leben zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Daisy, die mein Herz weit geöffnet hat
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Angelika Felenda
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95315-3
© Jennifer Donnelly 2010
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2011
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: Alan Jenkins / Trevillion Images
Ich fand mich in einen finstren Wald verschlagen,
Weil ich vom geraden Weg mich abgewandt.
Wie schwer ist’s doch von diesem Wald zu sagen,
Wie wild, wie rau und dicht er war, voll Angst und Not,
Schon der Gedanke nur erneuert noch mein Zagen;
Hölle
Und zu einem Ort ich komme, wo nichts glänzt
Dante
1
Wer’s kann, der kann’s.
Wer’s nicht kann, legt Platten auf.
Wie Cooper van Epp. Er steht in seinem Zimmer – das den gesamten fünften Stock eines schönen alten Hauses in der Hicks Street einnimmt – und versucht, die Beats von John Lee Hooker an irgendeinen Hip-Hop-Horror anzugleichen. Er hat Equipment für zwanzigtausend Dollar, aber keinen Schimmer, wie man es benutzt.
»Das ist der Blues, Mann«, kräht er. »Das ist Memphis-Stil.« Er hält inne, um sich den zweiten Scotch an diesem Morgen einzugießen. »Das ist früher und heute zusammen. Brooklyn und Bale Street gleichzeitig. Kents rauchen und zum Frühstück Bourbon trinken. Das alles fehlt uns jetzt. Alles, was wir brauchen …«
»… ist Hunger, Krankheit und keine Aussicht nach oben zu kommen«, sage ich.
Cooper schiebt seinen Filzhut zurück und lacht wiehernd. Er trägt ein Muskelshirt und eine alte Anzugweste. Er ist siebzehn, weiß wie Schnee, stinkreich, und versucht, wie ein Blues-Man aus dem Mississippi-Delta auszusehen. Was ziemlich daneben geht. Er sieht eher aus wie Ed Norton aus der Fünfziger-Jahre-Comedyshow Honeymooners.
»Armut, Coop«, füge ich hinzu. »Die brauchst du. Das ist der Ursprung des Blues. Aber das wird schwierig für dich. Ich meine, du als Sohn eines Top-Bankers und so.«
Sein blödes Grinsen verblasst. »Mann, Andi, wieso machst du mich immer so an? Warum bist du immer so …«
Simone Canovas, die Tochter eines Diplomaten, unterbricht ihn. »Ach, lass gut sein, Cooper. Du weißt, warum.«
»Wir alle wissen das. Es wird langsam langweilig«, sagt Arden Tode, Kind eines Filmstars.
»Und noch was«, sage ich, ohne auf sie einzugehen, »Talent. Du brauchst Talent. Weil John Lee Hooker ganze Wagenladungen davon hatte. Schreibst du überhaupt Musik, Coop? Spielst du selber welche? Oder stöpselst du bloß das Zeug von anderen Leuten zusammen und reklamierst den Mist, der dabei rauskommt, als eigenes Werk?«
Coopers Blick wird eisig. Sein Mund zuckt. »Du bist wirklich ätzend. Weißt du das?«
»Weiß ich.«
Das bin ich. Ganz zweifellos. Es gefällt mir, Cooper zu demütigen. Ich würge ihm gern eins rein. Es fühlt sich gut an. Besser als der Whiskey seines Dads, besser als das Gras seiner Mom. Weil ein paar Sekunden lang auch ein anderer leidet. Ein paar Sekunden lang bin ich nicht allein.
Ich nehme meine Gitarre und spiele die ersten Akkorde von Hookers Boom Boom. Schlecht, aber es funktioniert. Cooper flucht und stürmt hinaus.
Simone funkelt mich böse an. »Das war gemein, Andi. Er hat doch so eine empfindsame Seele«, sagt sie und rennt ihm nach. Arden hinter ihr her.
Simone schert sich einen Dreck um Cooper oder seine Seele. Sie sorgt sich bloß, er könnte unsere freitagmorgendliche Frühstücksparty kippen. Sie geht nie in die Schule ohne Dröhnung. Keiner tut das. Wir alle brauchen was, irgendein drogengesättigtes Kraftfeld, um die harte Hand der Erwartung abzuwehren, die uns wie Bierdosen zu zerquetschen droht, sobald wir einen Fuß an diesen Ort setzen.
Ich höre mit Boom Boom auf und gleite langsam zu Tupelo über. Keiner schenkt mir die geringste Beachtung. Weder Coopers Eltern, die in Cabo in den Ferien sind, noch das Dienstmädchen, das rumrennt und die Fenster aufreißt, um den Rauch abziehen zu lassen. Auch meine Klassenkameraden nicht, die iPods tauschen und sich einen Song nach dem anderen reinziehen. Wir laden keine Hits aus den Charts runter. Dafür sind wir uns zu schade. Solche Songs sind für Kids in der staatlichen Schule. Aber egal. Wir sind auf der St. Anselm, der angesehensten Privatschule von Brooklyn. Wir sind was Besonderes. Was Außergewöhnliches. Wir sind wie eine Supernova, jeder Einzelne von uns. Das sagen jedenfalls unsere Lehrer, und das kriegen unsere Eltern eingebleut, die 30000 Dollar im Jahr dafür zahlen.
In diesem Jahr, unserem letzten, geht’s um den Blues. Und um William Burroughs, Balkan Soul, deutsche Counter-Tenöre, japanische Girlbands und New Wave. Diese Mischung ist wohl überlegt. Wie alles andere, was wir tun. Je abwegiger unsere Interessen, desto mehr zeugen sie von unserem Genie.
Während ich hier sitze und Tupelo klimpere, schnappe ich ein paar Gesprächsfetzen auf.
»Also wirklich, man kann sich A Flock Of Seagullsnicht mal annähern, ohne sich in metafiktive Paradigmen zu verheddern«, sagt jemand.
Und: »Plastic Bertrand kann meiner Meinung nach am besten als postironischer nihilistischer Referentialist verstanden werden.«
Und: »Aber, vergiss nicht, New Wave hat seine Bedeutung aus der eigenen Bedeutungslosigkeit bezogen. Mann, die Tautologie war absolut beabsichtigt.«
Und dann: »Wasn’t that a mighty time, wasn’t that a mighty time …«
Ich blicke auf. Der Junge, der die Strophe aus Tupelo singt, ein berüchtigter Aufreißer aus der Slater, einer weiteren Schule in den Heights, sitzt plötzlich am anderen Ende des Sofas. Grinsend rutscht er immer näher, bis sich unsere Knie berühren.
»Du bist gut«, sagt er.
»Danke.«
»Bist du in einer Band?«
Ich spiele mit gesenktem Kopf weiter, also schlägt er eine forschere Gangart an.
»Was ist das?«, fragt er und beugt sich vor, um an dem roten Band um meinen Hals zu ziehen, an dem ein silberner Schlüssel hängt. »Der Schlüssel zu deinem Herzen?«
Ich könnte ihn umbringen, weil er ihn berührt hat. Ich würde gern etwas sagen, das ihn zu Staub zermalmt, aber ich kriege nichts raus. Die Worte bleiben mir im Hals stecken. Ich kann nicht sprechen, also hebe ich die Hand – die mit den vielen Totenkopfringen – und balle sie zur Faust.
Er lässt den Schlüssel los. »Hey, tut mir leid.«
»Lass das«, sage ich und schiebe den Schlüssel unter mein Hemd. »Mach das nie wieder.«
»Okay, okay. Bleib locker, du Irre«, sagt er und geht auf Abstand.
Ich lege die Gitarre in den Koffer und mache mich auf den Weg zu einem Ausgang. Vordertür. Hintertür. Fenster. Egal. Als ich das Wohnzimmer halb durchquert habe, spüre ich eine Hand auf meinem Arm.
»Jetzt komm. Es ist Viertel nach acht.«
Es ist Vijay Gupta. Präsident der Ehrengesellschaft, des Debattierclubs, des Schachclubs und der Nachbildung der Vereinten Nationen. Diakon seiner Kirche. Freiwilliger in einer Suppenküche, Mitglied in einem Literaturzirkel und beim Tierschutzverein. Fellow des Davidson-Instituts, Stipendiat der nationalen Hochbegabtenstiftung, Gewinner des Poesie-Preises der Universität Princeton, aber leider kein Krebsüberlebender.
Orla McBride ist eine Krebsüberlebende, sie hat in ihren College-Apps darüber geschrieben und bekam eine vorzeitige Zulassung für Harvard. Chemotherapie, Haarausfall und heftiges Erbrechen schlagen außergewöhnliche Zusatzleistungen um Längen. Vijay kam bloß auf die Warteliste, also ist er immer noch in unserer Klasse.
»Ich gehe nicht«, sage ich zu ihm.
»Warum nicht?«
Ich schüttle den Kopf.
»Was ist denn?«
Vijay ist mein bester Freund. Mein einziger Freund im Moment. Ich habe keine Ahnung, warum er noch zu mir hält. Wahrscheinlich bin ich eine Art Resozialisierungsprojekt für ihn, wie die Loser-Typen, um die er sich im Obdachlosenasyl kümmert.
»Andi, jetzt komm«, sagt er. »Du musst den Entwurf für deine Abschlussarbeit abgeben. Beezie schmeißt dich raus, wenn du’s nicht tust. Letztes Jahr hat sie zwei Schüler aus der Abschlussklasse rausgeschmissen, weil sie keinen Entwurf abgegeben haben.«
»Ich weiß. Aber ich mach’s nicht.«
Vijay sieht mich besorgt an. »Hast du heute schon deine Medikamente genommen?«, fragt er.
»Ja.«
Er seufzt. »Wir sehen uns später.«
»Ja, V. Bis später.«
Ich verlasse das Château van Epp und gehe die Promenade hinunter. Es schneit. Hoch über dem Brooklyn-Queens-Expressway setze ich mich hin, starre eine Weile auf Manhattan hinüber und spiele dann. Stundenlang. Ich spiele, bis meine Finger wund sind. Bis mir ein Nagel einreißt und das Blut auf die Saiten tropft. Bis meine Hände so wehtun, dass ich vergesse, wie sehr mein Herz schmerzt.
2
»Als Kind hab ich alles geglaubt, was man mir erzählt hat«, sagt Jimmy Shoes, während wir einen kleinen Jungen vorbeitapsen sehen, der eine Grinch-Figur an sich drückt. »Jeden Mist. Ich hab an den Nikolaus geglaubt, den Osterhasen, den Schwarzen Mann. Und an Eisenhower.« Er nimmt einen Schluck aus der Bierflasche, die in einer Papiertüte steckt. »Und du?«
»Ich bin immer noch ein Kind, Jimmy.«
Jimmy ist ein alter Italiener. Manchmal sitzt er mit mir auf der Promenade. Er ist nicht ganz dicht im Kopf. Er glaubt, LaGuardia sei noch immer Bürgermeister und die Dodgers hätten Brooklyn nie verlassen. Er trägt diese alten Schuhe. Daher sein Nachname. Es sind Schuhe aus den Fünfzigern, wie die Hipster sie damals trugen, rot lackiert.
»Wie sieht’s aus mit Gott? Glaubst du an Gott?«, fragt er.
»Wessen Gott?«
»Sei nicht so oberschlau.«
»Tut mir leid. Zu spät.«
»Du gehst doch auf die St. Anselm, oder? Bringt man euch dort denn keine Religion bei?«
»Die Schule heißt bloß so. Den heiligen Anselm haben sie in die Wüste geschickt, aber seinen Namen behalten.«
»Mit Betty Crocker haben sie’s auch so gemacht, die Mistkerle. Also, was bringt man euch dort bei?«
Ich lehne mich auf der Bank zurück und denke einen Moment lang nach. »Sie fangen mit griechischer Mythologie an – mit Zeus, Poseidon, Hades, mit diesen Typen eben«, antworte ich. »Ich hab noch den ersten Aufsatz, den ich je geschrieben habe. In der Vorschule. Mit vier. Er ging über Polyphem. Der war Schafhirte. Und Zyklop. Und Kannibale. Er wollte Odysseus fressen, aber Odysseus ist entkommen. Er hat ihm mit einen Stock das Auge ausgestochen.«
Jimmy schenkt mir einen Blick, der höchsten Unglauben ausdrückt. »Solchen Mist bringen sie euch im Kindergarten bei? Du nimmst mich wohl auf den Arm?«
»Ich schwör’s. Danach haben wir die römische Mythologie durchgenommen. Dann die Nordischen Sagen. Die Gottheiten der amerikanischen Eingeborenen. Heidnische pantheistische Überlieferungen. Keltische Gottheiten. Buddhismus. Jüdisch-christliche Traditionen. Und islamische Studien.«
»Wozu das denn, zum Teufel?«
»Weil sie wollen, dass man die Welt durchschaut. Für sie ist es wichtig, dass man Bescheid weiß.«
»Worüber Bescheid weiß?
»Dass es ein Mythos ist.«
»Was ist ein Mythos?«
»Alles, Jimmy. Das Ganze.«
Jimmy schweigt eine Weile, dann sagt er: »Dann kommst du also aus dieser noblen Schule raus und hast nichts? Rein gar nichts, woran du dich halten kannst? Nichts, woran du glauben kannst?«
»Na ja, vielleicht an eines …«
»Woran?«
»An die transformative Kraft der Kunst.«
Jimmy schüttelt den Kopf. »Das ist ein Verbrechen. Das sollten sie einem Kind nicht antun. Das ist Kindesmissbrauch. Möchtest du, dass ich sie anzeige?«
»Könntest du das?«
»Um so was kümmert man sich. Ich hab Freunde bei der Polizei«, sagt er und nickt vielsagend.
Ja, denke ich. Dick Tracy wird sich gleich an den Fall machen.
Ich packe meine Sachen ein. Meine Füße sind fast erfroren. Ich war stundenlang hier draußen. Jetzt ist es halb drei. Noch ein halbe Stunde bis zum Unterricht. Es gibt nur eine einzige Sache, die mich dazu bringt, in die Schule zu gehen: Nathan Goldfarb, der Leiter des Musikbereichs in St. Anselm.
»Hey, Kleine«, sagt Jimmy, als ich aufstehe, um zu gehen.
»Was?«
Er fischt einen Vierteldollar aus seiner Tasche. »Kauf dir eine Eiersahne. Eine für dich und eine für deinen Schatz.«
»Ach komm, Jimmy. Das kann ich nicht annehmen.«
Jimmy hat nicht viel. Er lebt in einem Asyl auf der Hicks Street und kriegt bloß ein paar Dollar Taschengeld die Woche.
»Nimm es. Ich will, dass du es nimmst. Du bist ein Kind. Du solltest mit deinem Liebsten in einer Milchbar sitzen, nicht in der Kälte rumhängen, als hättest du kein Zuhause, und mit Pennern wie mir reden.«
»Also gut. Danke«, sage ich und versuche zu lächeln. Es bringt mich um, sein Geld zu nehmen, aber es nicht zu nehmen, würde ihn umbringen.
Jimmy erwidert mein Lächeln. »Lass dir einen Kuss geben von ihm. An meiner Stelle.« Er hebt den Finger. »Aber bloß einen. Auf die Wange.«
»Das mach ich«, antworte ich. Ich habe nicht den Mut, ihm zu gestehen, dass ich schon ein Dutzend Typen hatte. Oder dass es so was wie Wangenküsse nicht mehr gibt. Wir sind im einundzwanzigsten Jahrhundert, und da heißt es mitmachen oder du bist weg vom Fenster.
Ich strecke die Hand aus, um den Vierteldollar zu nehmen. Jimmy stößt einen leisen Pfiff aus.
»Was?«
»Deine Hand.«
Ich sehe sie an. Mein eingerissener Nagel blutet immer noch. Ich wische das Blut an meiner Hose ab.
»Das solltest du behandeln lassen. Es sieht schlimm aus«, sagt er.
»Ja, wahrscheinlich schon.«
»Du musst doch Schmerzen haben, Kleine. Tut’s weh?«
Ich nicke. »Ja, Jimmy. Die ganze Zeit.«
3
»Miss Alpers?«
Erwischt.Ich bleibe stehen. Dann drehe ich mich langsam um. Ich kenne diese Stimme. Jeder in St. Anselm kennt sie. Es ist Adelaide Beezemeyer, die Direktorin.
»Haben Sie einen Moment Zeit?«
»Nicht wirklich, Miss Beezemeyer. Ich bin auf dem Weg zum Musikunterricht.«
»Ich rufe Mr. Goldfarb an und lasse ihn wissen, dass Sie sich verspäten. In mein Büro bitte.«
Sie winkt mich nach drinnen und ruft Nathan an. Ich stelle meinen Gitarrenkoffer ab und setze mich. Die Uhr an der Wand zeigt 15.01. Eine kostbare Minute meines Unterrichts einfach vergeudet. Sechzig Sekunden Musik, die unwiederbringlich verloren sind für mich. Meine Beine beginnen zu zittern. Ich drücke auf die Knie, damit es aufhört.
»Kamillentee?«, fragt Beezie beim Auflegen. »Ich habe gerade eine Kanne gemacht.«
»Nein, vielen Dank.«
Ich sehe einen Ordner auf ihrem Schreibtisch. Mein Name steht darauf – Diandra Xenia Alpers. Nach meinen beiden Großmüttern. Ich habe ihn in Andi abgeändert, sobald ich sprechen konnte.
Ich wende den Blick von dem Ordner ab – er kann nichts Gutes heißen – und beobachte Beezie, die geschäftig umhergeht. Sie sieht aus wie ein Hobbit – klein und struppig. Sie trägt immer Birkenstocksandalen, egal zu welcher Jahreszeit, und lila Wechseljahre-Klamotten. Unerwartet dreht sie sich um und sieht, dass ich sie beobachte, also lasse ich den Blick durch den Raum schweifen. Auf dem Fensterbrett stehen Vasen, von der Decke hängen Pflanzgefäße, auf einem Sideboard stehen Schalen – alle in verschiedenen Erdtönen lasiert.
»Gefallen sie Ihnen?«, fragt sie und macht mit dem Kopf ein Zeichen in Richtung der irdenen Schalen.
»Ziemlich beeindruckend.«
»Sie sind von mir. Ich töpfere.«
Wie meine Mom. Sie wirft das Zeug allerdings an die Wand.
»Sie sind das Ventil für meine Kreativität«, fügt sie hinzu. »Meine Kunst.«
»Wow.« Ich deute auf ein Pflanzgefäß. »Das erinnert mich an Guernica.«
Beezie lächelt. »Wirklich?«
»Natürlich nicht.«
Das Lächeln rutscht von ihrem Gesicht, fällt auf den Boden und zerbricht.
Jetzt schmeißt sie mich sicher raus. Ich würde es tun. Aber sie tut es nicht. Sie stellt einen Teebecher auf den Schreibtisch und setzt sich. Ich sehe wieder auf die Uhr. 15.04. Mein Bein zittert stärker.
»Andi, ich komme gleich zur Sache. Ich mache mir Sorgen«, beginnt sie und öffnet den Ordner. »Morgen fangen die Winterferien an und Ihr Berater sagt, Sie hätten noch keine Collegebewerbung eingereicht. Keine einzige. Sie haben auch noch keinen Entwurf zu Ihrer Abschlussarbeit abgegeben. Hier sehe ich, dass Sie ein Thema gewählt haben … einen französischen Komponisten aus dem achtzehnten Jahrhundert, Amadé Malherbeau … einer der ersten Komponisten, der Gitarrenstücke verfasst hat.«
»Für die sechssaitige Gitarre«, antworte ich. »Andere haben für Lauten, Mandolinen, Vihuelas und Barockflöten komponiert.«
»Interessant«, sagt Beezie. »Mir gefällt der Titel der Arbeit … Wer ist dein Daddy? Auf der Suche nach der musikalischen DNA von Malherbeau bis Jonny Greenwood.«
»Danke. Er stammt von Vijay. Er meinte, mein früherer Titel – Amadé Malherbeaus muskikalisches Vermächtnis – sei nicht ansatzweise anspruchsvoll genug.«
Beezie geht darüber hinweg. Sie legt den Ordner beiseite und sieht mich an. »Warum gibt es keinerlei Fortschritte?«
Weil ich kein Interesse mehr daran habe, Miss Beezemeyer, möchte ich sagen. Weder an Amadé Malherbeau, der Schule, dem College noch an sonst einer Sache. Weil die graue Welt, in der ich die letzten zwei Jahre mühsam überlebt habe, an den Rändern schwarz zu werden beginnt. Aber das kann ich nicht sagen. Weil ich mir damit nur eine Überweisung in Dr. Beckers Praxis für die nächste Runde geistabtötender Medikamente einhandeln würde. Ich wische mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht, um Zeit zu schinden, und versuche, mir eine Antwort einfallen zu lassen.
»Mein Gott, Andi. Deine Hand«, sagt sie. »Was ist passiert?«
»Bach.«
Sie schüttelt den Kopf. »Es geht in erster Linie um den Schmerz, nicht wahr? Das Schulschwänzen, die schlechten Noten, und jetzt hast du auch noch eine Möglichkeit gefunden, deine wundervolle Musik zu benutzen, um dir selbst Schmerz zuzufügen. Es ist, als wolltest du ewig Buße tun. Du musst damit aufhören, Andi. Du musst Vergebung finden für das, was passiert ist. Vergebung für dich selbst.«
Erneut steigt Wut in mir auf, eine rasende und mörderische Wut. Genau wie in dem Moment, als der Typ aus der Slater-Schule den Schlüssel berührt hatte. Ich wende den Blick ab, versuche, diese Wut niederzukämpfen, wünschte, Beezie würde einfach mitsamt ihren grässlichen Töpfen aus dem Fenster springen und ich könnte Noten und Akkorde hören statt ihre Stimme. Bachs Suite Nr. 1, für Cello komponiert und für Gitarre transskribiert. Die sollte ich eigentlich mit Nathan spielen. Genau jetzt.
»Wie geht’s meinem Crazy Diamond?«, fragt er immer, wenn ich ins Klassenzimmer komme. Seine Lieblingsmusiker sind Bach, Mozart und die Jungs von Pink Floyd.
Nathan ist alt. Er ist fünfundsiebzig. Als Kind hat er seine Familie in Auschwitz verloren. Seine Mutter und Schwester wurden gleich nach ihrer Ankunft vergast, weil sie nicht stark genug zum Arbeiten waren. Nathan überlebte, weil er ein Wunderkind war, ein Achtjähriger, der wie ein Engel geigen konnte. Die Offiziere mochten seine Musik, also durfte er essen, was an ihrem Tisch übrig blieb. Spät in der Nacht ging er in seine Baracke zurück und erbrach sein Essen, damit sein Vater auch etwas hatte. Das versuchte er leise zu tun, aber eines Nachts erwischten ihn die Wachen. Sie schlugen ihn blutig und nahmen seinen Vater mit.
Ich wusste, was Nathan zu meiner Hand sagen würde. Er würde sagen, dass Bluten für Bach keine große Sache sei. Er würde sagen, dass Leute wie Beethoven, Billie Holiday und Syd Barrett alles für ihre Musik gegeben hätten, also was sei da schon ein Fingernagel? Er würde keine Tragödie daraus machen. Er wusste es besser. Er wusste, was eine Tragödie ist. Er kannte sich aus mit Verlusten. Und er wusste, dass es so etwas wie Vergebung nicht gibt.
»Andi? Andi, hören Sie mir überhaupt zu?«
Beezie ist immer noch beim selben Thema.
»Ja, Miss Beezemeyer«, antworte ich ernst und hoffe, genügend zerknirscht auszusehen, um noch vor Mitternacht hier rauszukommen.
»Ich habe Briefe zu Ihnen nach Hause geschickt. Weil sie noch keinen Entwurf für Ihre Abschlussarbeit eingereicht haben. Vermutlich wissen Sie davon. Einen habe ich an Ihre Mutter und einen an Ihren Vater geschickt.«
Von dem an meine Mutter wusste ich. Der Postbote hatte ihn durch den Briefkastenschlitz geworfen. Eine Woche lag er auf dem Dielenboden, bis ich ihn beiseite kickte. Dass Beezie auch an meinen Vater geschrieben hatte, wusste ich nicht, aber das macht nichts. Er öffnet seine Post sowieso nicht. Post ist etwas für Normalsterbliche.
»Haben Sie etwas dazu zu sagen, Andi? Irgendetwas?«
»Nun, ich glaube … ich meine, ich sehe nicht, wie ich das schaffen soll, Miss Beezemeyer. Die Abschlussarbeit. Nicht wirklich. Kann ich im Juni nicht einfach mein Diplom kriegen und gehen?«
»Die Abgabe der Abschlussarbeit in zumindest zufriedenstellender Form ist die Voraussetzung für den Erhalt des Diploms. Das wissen Sie. Ohne die kann ich Sie nicht erfolgreich entlassen. Das wäre unfair gegenüber ihren Klassenkameraden.«
Ich nicke. Es interessiert mich nicht. Nicht im Geringsten. Ich will bloß unbedingt zu meinem Unterricht.
»Und wie sieht es mit Ihren Collegebewerbungen aus? Für Juilliard? Crane? Die Eastman School?«, fragt Beezie. »Haben Sie die notwendigen Aufsätze schon geschrieben? Irgendwelche Vorstellungstermine vereinbart?«
Ich schüttle den Kopf und schneide ihr so das Wort ab. Inzwischen zittern meine beiden Beine. Ich schwitze. Bibbere. Ich brauche mein Klassenzimmer. Meinen Lehrer. Ich brauche meine Musik. Dringend. Sehr dringend. Jetzt.
Beezie seufzt tief. »Sie brauchen einen Abschluss, Andi«, sagt sie. »Ich weiß, es ist immer noch schwierig. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Wegen Truman. Wegen dem, was passiert ist. Aber hier geht es nicht um Truman. Hier geht es um Sie. Um Ihr bemerkenswertes Talent. Ihre Zukunft.«
»Nein. Nein, das stimmt nicht, Miss Beezemeyer.«
Ich möchte die Worte zurückhalten, kann es aber nicht. Beezie meint es gut. Sie ist nett auf ihre Art. Sie kümmert sich. Das weiß ich. Aber ich kann mich nicht mehr beherrschen. Sie hätte Truman nicht erwähnen sollen. Seinen Namen nicht aussprechen. Erneut steigt Wut in mir auf, schwillt immer mehr an, und ich kann sie nicht stoppen.
»Es geht nicht um mich. Es geht um Sie«, sage ich. »Es geht um Zahlen. Wenn es letztes Jahr zwei Absolventen nach Princeton geschafft haben, möchten Sie dieses Jahr vier dort unterbekommen. Darum geht’s hier, und wir alle wissen das. Niemand zahlt Ausbildungskosten in Höhe des durchschnittlichen Jahresgehalts in New Hampshire, damit sein Kind am Ende auf einer miesen Uni landet. Die Eltern wollen Harvard, das MIT, die Brown. Die Juilliard macht sich gut für Sie. Für Sie, Miss Beezemeyer, nicht für mich. Darum geht’s hier.«
Beezie sieht aus, als hätte sie eine Ohrfeige bekommen. »Mein Gott, Andi«, sagt sie. »Sie hätten nicht verletzender sein können, wenn Sie es darauf angelegt hätten.«
»Ich habe es darauf angelegt.«
Sie schweigt ein paar Sekunden. Ihre Augen werden wässrig. Sie räuspert sich und sagt: »Die Skizzen für die Abschlussarbeit sind fällig, wenn die Schule wieder beginnt – am 5. Januar. Ich hoffe wirklich, dass die Ihre darunter sein wird. Wenn nicht, werden Sie die Schule verlassen müssen, fürchte ich.«
Ich höre sie jetzt kaum mehr. Ich löse mich auf. In meinem Kopf, in meinen Händen ist Musik, und ich habe das Gefühl zu explodieren, wenn ich sie nicht rauslassen kann.
Ich packe den Gitarrenkoffer. 15.21 sagt die Uhr. Mir bleiben nur noch neununddreißig Minuten. Glücklicherweise sind die Gänge fast leer. Wie eine Verrückte fange ich an zu rennen. Ohne aufzupassen, rase ich los, als mein Fuß plötzlich an etwas hängen bleibt und ich durch die Luft wirble. Hart schlage ich auf dem Boden auf, spüre, wie meine Knie, meine Brust, mein Kinn aufknallen. Mein Gitarrenkoffer donnert auf den Boden und schlittert davon.
Mein rechtes Knie brennt. Ich schmecke Blut im Mund, aber das kümmert mich nicht. Mich interessiert bloß die Gitarre. Es ist eine Hauser aus dem Jahre 1920. Aus brasilianischem Rosenholz. Sie gehört Nathan. Er hat sie mir geliehen. Ich krieche zu dem Koffer. Brauche eine Weile, um den Verschluss zu öffnen, weil meine Hände so stark zittern. Als ich den Deckel schließlich hebe, sehe ich, dass alles in Ordnung ist. Nichts gebrochen. Ganz kraftlos vor Erleichterung mache ich den Koffer wieder zu.
»Hoppla.«
Ich blicke auf. Es ist Cooper. Grinsend geht er rückwärts den Gang hinunter. Arden Tode ist bei ihm. Ich hab’s kapiert. Er hat mir ein Bein gestellt. Als Rache für heute Morgen.
»Pass auf, Andi. Du könntest dir auch den Hals brechen«, sagt er.
Ich schüttle den Kopf. »Nein, das kann ich nicht«, antworte ich. »Das ist nicht so einfach. Ich hab’s probiert. Aber danke,dass du’s versucht hast, Coop. Ich schätze deinen Einsatz.« Blut tropft mir beim Sprechen aus dem Mund.
Cooper bleibt wie angewurzelt stehen. Sein Grinsen verblasst. Zuerst wirkt er verwirrt, dann ängstlich.
»Kranke Missgeburt«,zischt Arden. Sie zieht ihn am Arm.
Ich stehe auf und humple davon. Den Gang hinunter. Um die Ecke. Und dann bin ich da. Endlich da. Ich reiße die Tür auf.
Nathan blickt von einem Notenblatt auf. Er lächelt. »Wie geht’s meinem Crazy Diamond?«
»Crazy«, antworte ich mit brechender Stimme.
Seine buschigen weißen Augenbrauen schießen nach oben. Der Blick seiner Augen, die hinter den dicken Gläsern riesig wirken, gleitet von meinem blutigen Mund zu meiner blutigen Hand. Er geht durch den Raum und nimmt eine Gitarre aus der Halterung.
»Wir spielen jetzt, ja?«, sagt er.
Ich wische mir den Mund am Ärmel ab. »Ja, Nathan«, antworte ich. »Wir spielen jetzt. Bitte. Lassen Sie uns spielen.«
4
Ich nehme immer den langen Weg nach Hause.
Von der Pierrepont Street die Willow Street hinauf. Durch die Straßen des alten Brooklyn. Oder was noch übrig ist davon. Dann biege ich normalerweise in meine Straße ein, in die Cranberry Street. Aber heute Abend habe ich wegen der Kälte die Schultern hochgezogen, den Kopf gesenkt, meine Finger greifen Akkorde in der Luft, und ich bin so versunken in die Suite Nr. 1, dass ich stattdessen die Henry Street hinaufgehe.
Nathan und ich haben stundenlang gespielt. Bevor wir anfingen, zog er ein Taschentuch heraus und reichte es mir.
»Was ist passiert?«, fragte er.
»Ich bin gefallen.«
Er sah mich über den Rand seiner Brille hinweg mit seinem Balsamblick an.
»Miss Beezemeyer hat über Truman geredet. Und dass ich einen Abschluss machen müsste. Von da an ging alles schief«, erklärte ich.
Nathan nickte, dann sagte er: »Dieses Wort ›Abschluss‹ … das ist ein dummes Wort, nicht? Bach hat nicht an Abschlüsse geglaubt. Beethoven auch nicht. Bloß Amerikaner glauben an Abschlüsse, weil Amerikaner wie kleine Kinder sind – leicht zu täuschen. Bach glaubte ans Musikmachen, oder nicht?«
Er sah mich weiterhin an und wartete auf eine Antwort.
»Ja«, sagte ich leise.
Dann spielten wir. Er zeigte keinerlei Nachsicht wegen meiner Verletzungen und fluchte wie ein Seeräuber, wenn ich einen Triller verpfuschte oder eine Passage verholperte. Es war schon acht, als ich ging.
Die winterlichen Straßen, die ich jetzt hinuntergehe, sind kalt und dunkel. Um mich herum blinken nur die Lichter für die Feiertagsgötter. Grün und Rot für den Nikolaus. Blau für Judas Makkabäus. Weiß für Maria Stuart. Die kalte Luft in meinem Gesicht fühlt sich gut an. Ich bin erschöpft. Ich bin ruhig. Und ich passe nicht auf.
Denn plötzlich ist es da, direkt vor mir – das Templeton.
Das Apartmenthaus, das früher einmal, vor dem Umbau, das alte Hotel St. Charles war. Es ist acht Stockwerke hoch, zwei Blocks lang und wirft seinen hässlichen Schatten auf alles, sogar bei Nacht. Die Läden im Erdgeschoss sind immer beleuchtet, selbst nach Geschäftsschluss. Darin wird Basilikumsorbet und Quittengelee verkauft und eine Menge anderes Zeug, das keiner will. Die oberen Stockwerke sind Eigentumswohnungen, die ab einer halben Million Dollar zu haben sind.
Es ist fast zwei Jahre her, dass ich so nah an das Gebäude herangekommen bin. Ich bleibe stehen, starre es an, sehe es aber nicht. Stattdessen sehe ich das St. Charles. Jimmy Shoes hat mir erzählt, dass es früher einmal todschick gewesen sei. Damals in den Dreißigern. Er sagte, auf dem Dach hätte es einen Salzwasserpool und Spotlights gegeben. Die Dodgers hätten hier gegessen, Gangster seien mit Tänzerinnen am Arm hineingeschlendert und Swing Bands hätten bis zum Morgengrauen gespielt.
Vor zwei Jahren war das Gebäude längst nicht mehr so elegant gewesen. Sondern heruntergekommen und verfallen. Ein Teil davon ausgebrannt. In dem Teil, der noch übrig war, hausten Sozialfälle und Säufer. Drogendealer standen am Eingang. Straßendiebe trieben sich in den Gängen herum. Die Türen standen immer offen wie ein lüsternes Maul, und ich konnte den schlechten Atem riechen, wenn ich vorbeiging – eine Mischung aus Schimmel, Katzenpisse und Traurigkeit. Ich konnte sie auch hören. Ich hörte wüste Musik aus Lautsprechern dröhnen, Mrs. Ortega, die ihre Kinder anschrie, das Yankee-Spiel auf Mrs. Fleets altem Radio und Max. Ihn höre ich immer noch. Er ist in meinem Kopf, und ich kriege ihn nicht mehr raus.
»Maximilien R. Peters! Unbestechlich, unausweichlich, unbezwingbar!«, schrie er immer. »Höchste Zeit für die Revolution, Baby!«
Ich bleibe wie angewurzelt stehen und starre auf den Gehsteig. Ich will das zwar nicht, kann aber nicht anders. Es war hier, genau hier, etwa fünf Meter vor mir, bei dem langen zerklüfteten Riss, wo Max auf der Straße aufschlug. Mit Truman.
Schon vor Langem hat Regen das Blut weggewaschen, aber ich kann es immer noch sehen. Wie es sich unter dem kleinen, zerschmetterten Körper meines Bruders ausbreitet wie die Blütenblätter einer Rose. Und plötzlich schwillt der Schmerz, der immer in mir, aber fest verkapselt ist, so stark und mächtig an, dass ich meine, er wolle mein Herz zersprengen, meinen Schädel spalten, mich in Stücke reißen.
»Aufhören«, flüstere ich und kneife die Augen zu.
Als ich sie wieder öffne, sehe ich meinen Bruder. Er ist nicht tot. Er steht auf der Straße und beobachtet mich. Das kann nicht sein. Aber es ist so. Mein Gott, es ist so! Ich lasse meine Tasche fallen und laufe auf die Straße.
»Truman! Es tut mir leid, Tru! Es tut mir leid«, schluchze ich und greife nach ihm.
Er soll mir sagen, dass alles in Ordnung ist, dass es nur ein dummes Missverständnis war, dass es ihm gut geht. Aber statt seiner Stimme höre ich Reifen quietschen. Ich drehe mich um und sehe einen Wagen auf mich zurasen.
Alles in mir befiehlt mir zu rennen, aber ich bewege mich nicht. Weil ich es genauso will. Weil ich will, dass der Schmerz ein Ende hat. Der Wagen wird heftig herumgerissen und kommt quietschend zum Stehen. Ich rieche verbrannten Gummi. Leute kreischen.
Im nächsten Moment ist die Fahrerin bei mir. Sie weint und zittert. Sie packt mich an der Jacke und schreit mich an. »Du verrücktes Gör!«, schreit sie. »Ich hätte dich totfahren können!«
»Tut mir leid«, sage ich.
»Tut dir leid?«, schreit sie. »Du siehst nicht aus, als ob’s dir leid täte. Du …«
»Tut mir leid, dass Sie mich verfehlt haben«, sage ich.
Daraufhin lässt sie mich los. Tritt einen Schritt zurück.
Hinter uns stauen sich Autos. Jemand fängt an zu hupen. Ich sehe nach Truman, aber er ist fort. Natürlich. Er war nicht real. Es sind die Pillen, die mir solche Streiche spielen. Dr. Becker sagte, möglichwerweise würde ich Dinge sehen, wenn ich zu viele schluckte.
Ich versuche weiterzugehen, von der Straße wegzukommen, aber meine Beine zittern so heftig, dass ich mich kaum bewegen kann. Auf dem Gehsteig steht ein Mann, der mich anglotzt. Ich zeige ihm den Mittelfinger, nehme meine Tasche und wanke nach Hause.
5
»Mom?«, rufe ich, als ich die Haustür öffne. Keine Antwort. Das ist nicht gut.
Ich kicke den Berg Briefe auf dem Fußboden beiseite. Rechnungen. Noch mehr Rechnungen. Briefe von Maklern, die unser Haus verkaufen wollen. Postkarten von Kunstgalerien. Eine Ausgabe von Immolation, dem Literaturblatt der Schüler von St. Anselm. Briefe an meinen Vater von Leuten, die immer noch nicht wissen, dass er vor über einem Jahr nach Boston gezogen ist, um in Harvard den Lehrstuhl für Genetik zu übernehmen. Mein Vater ist Experte für Genetik. Er ist weltberühmt. Meine Mutter hat den Verstand verloren.
»Mom? Mom!«, rufe ich.
Noch immer keine Antwort. In meinem Kopf läuten Alarmglocken. Ich renne ins Wohnzimmer. Da ist sie. Sie steht nicht barfuß im Hinterhof und drückt Hände voller Schnee an sich. Sie zerschlägt nicht jeden Teller im Haus. Sie liegt nicht starr zusammengerollt in Trumans Bett. Sie sitzt einfach an ihrer Staffelei und malt. Erleichtert küsse ich sie aufs Haar.
»Alles in Ordnung mit dir?«, frage ich.
Sie nickt und lächelt, drückt meine Hand an ihre Wange und wendet den Blick kein einziges Mal von der Leinwand.
Ich möchte, dass sie mich fragt, ob es mir gut geht. Ich möchte ihr sagen, was ich fast getan hätte. Vor ein paar Minuten auf der Henry Street. Ich möchte, dass sie mir verbietet, so etwas je wieder zu tun. Dass sie mich anschreit. Die Arme um mich legt und mich festhält. Aber das tut sie nicht.
Sie arbeitet an einem weiteren Bild von Truman. Davon gibt es schon jede Menge. Sie hängen an Wänden, lehnen an Stühlen, stehen auf dem Klavier, stapeln sich im Gang. Er ist überall, wohin ich auch sehe. Auf dem Boden liegt Werkzeug. Eine Säge. Schrauben und Nägel. Leinwandfetzen. Sie zieht ihre Leinwände gern selbst auf. Überall liegen zusammengeknüllte Lappen und ausgedrückte silberne Tuben herum, und auf dem Boden sind Farbspritzer. Ich kann die Ölfarbe riechen. Es ist mein absoluter Lieblingsgeruch. Eine Sekunde lang bleibe ich stehen, atme ihn ein, und es ist wie früher. Bevor Truman starb.
Es ist ein kalter Herbstabend, es regnet, und wir sitzen im Wohnzimmer, wir drei, Mom, Truman und ich. Im Kamin brennt ein Feuer und Mom malt. Sie malt ihre Stillleben. Sie sind sehr gut. Der Kritiker der Times meinte, dasjenige, das im Metropolitan hängt, sei »die Welt im Kleinen«. Einmal hat sie ein winziges Nest mit einem blauen Ei darin gemalt, das unter dem Gestänge einer alten schwarzen Nähmaschine liegt. Ein anderes Mal war es ein umgekippter roter Nähkorb, aus dem der Inhalt herausgerollt ist, daneben eine angeschlagene Kaffeetasse. Und mein Lieblingsbild – eine rote Amaryllis neben einer Musikbox. Truman ist wie sie, er zeichnet, während sie malt. Ich spiele Gitarre. Der Regen wird heftiger, es wird dunkel. Wir achten nicht darauf. Wir sind zusammen in unserem Haus, beim Kaminfeuer, wir sind die Welt im Kleinen.
Ein paar Mal war mein Vater bei uns. Wie immer kam er spät nach Hause, zerzaust und übernächtigt und roch nach Labor. Geräuschlos kam er herein und setzte sich auf die Sofakante, als wäre er nur zu Besuch. Distanziert. Abgesondert von uns. Ein scheuer Bewunderer.
»Moo-Shu-Schweinefleisch?«, frage ich jetzt meine Mutter.
Sie nickt, dann runzelt sie die Stirn. »Die Augen stimmen nicht«, sagt sie. »Ich muss die Augen richtig hinkriegen.«
»Das wirst du, Mom«, antworte ich.
Aber das wird sie nicht. Vermeer, Rembrandt und da Vinci zusammen würden das nicht schaffen. Selbst wenn sie die Farbe träfen – ein klares, verblüffend helles Blau –, würden sie es nicht hinkriegen, weil Trumans Augen vollkommen durchsichtig waren. Wie sagt man so schön? Das Fenster zur Seele? Genauso war es. Wenn man in seine Augen blickte, konnte man alles sehen, was er dachte, fühlte und liebte. Man sah Lyra und Pan. Den Tempel von Dendur. Feuerwerksraketen. Garri Kasparow. Beck. Kyuma. Hotdogs mit Chili. Derek Jeter. Und uns.
Ich gehe in die Küche und gebe unsere Bestellung auf: Moo Shu, zwei Eiersandwiches, Sesamnudeln. Willie Chen bringt das Essen. Ich kenne die Lieferanten inzwischen und rede sie mit dem Vornamen an. Ich richte zwei Teller her und stelle Moms Teller neben ihre Staffelei. Sie beachtet ihn nicht, aber mitten in der Nacht wird sie ein bisschen davon essen. Das weiß ich, weil ich gewöhnlich gegen zwei aufwache und hinuntergehe, um nach ihr zu sehen. Manchmal malt sie noch. Manchmal starrt sie aus dem Fenster.
Heute Abend esse ich allein wie jeden Abend. In unserem großen, leeren Esszimmer. Das ist gar nicht so schlecht. Ich kann mich mit meiner Musik beschäftigen, niemand fragt mich nach meiner verpatzten Mathearbeit, niemand schreibt mir vor, wann ich zu Hause zu sein habe, keiner interessiert sich für Name, Adresse und Absichten des Kleinkriminellen, der zufällig in meinem Bett gelandet ist.
»Iss etwas«, sage ich eine halbe Stunde später, als ich meiner Mutter einen Gutenachtkuss gebe.
»Ja. Ja. Das werde ich«, antwortet sie auf Französisch, während sie immer noch mit gerunzelter Stirn auf Trumans Augen starrt. Sie ist Französin, meine Mutter. Sie heißt Marianne LaReine. Machmal spricht sie Englisch, manchmal Französisch. Die meiste Zeit spricht sie gar nicht.
Ich gehe nach oben mit dem iPod in der Hand. Ich habe vor, mit Pink Floyd einzuschlafen. Das ist meine Hausaufgabe.
Vor ein paar Tagen habe ich Nathan ein paar Stücke von mir gegeben. Demos von Songs, die ich geschrieben habe. Ich habe einen Mix aus verschiedenen Taktarten und ein paar coole Effekte eingebaut. Die verschiedenen Gitarren- und Gesangsteile habe ich gesampelt und einen Bass Loop darunter gelegt. Das Ganze habe ich Plaster Castle genannt. Ich fand die Songs ganz okay. Irgendwas in der Richtung von »Sonic Youth trifft Dirty Projectors«. Nathan fand sie nicht okay.
»Grässlich«, sagte er zu mir. »Ein lärmiger Mischmasch. Du musst lernen, mit weniger mehr zu erreichen.«
»Danke, Nathan. Vielen herzlichen Dank«, antwortete ich wirklich eingeschnappt. »Hätten Sie vielleicht die Güte, mir zu sagen sagen, wie ich das machen soll?«
Sein großartiger Rat bestand darin, der Gitarrenphrase am Anfang von Shine On You Crazy Diamond zu lauschen. Die habe David Gilmore geschrieben, sie sei nur vier Noten lang, klinge aber genau so, wie Traurigkeit sich anfühlt. Ich erwiderte, ich bräuchte keinen alten Kiffer, der mir sagt, wie sich Traurigkeit anfühlt. Das wisse ich selbst.
»Das reicht nicht«, sagte er. »Mein Hund weiß auch, wie sich Traurigkeit anfühlt. Worauf es ankommt, ist: Kannst du dieses Wissen ausdrücken? Dieses Gefühl? Das ist es, was euch unterscheidet.«
»Wen unterscheidet? Mich von einem Hund?«
»Einen Künstler von einem Schwachkopf.«
»Also bin ich ein Schwachkopf? Das ist das letzteMal, dass ich Ihnen was von mir zu hören gebe.«
Nathans Antwort lautete: »Eines Tages im Jahr 1975 war ein Mann namens David Gilmore traurig. Na und? Wen interessiert das schon? Mich. Warum? Wegen dieser einen unglaublichen Phrase. Weil sie Bestand hat. Wenn du Musik schreiben kannst, die Bestand hat – bravo! Bis dahin sei still und studier die Werke von Leuten, die es können.«
Die meisten meiner Lehrer im St. Anselm behaupten, ich sei ein Genie. Ich könnte alles tun und alles werden. Mein Potenzial sei grenzenlos, ich könnte nach den Sternen greifen. Nathan ist der Einzige, der mich einen Schwachkopfnennt und mir aufträgt, die Sarabande in Bachs Lautensuite in e-Moll pro Nacht fünfhundert Mal zu spielen, wenn das nötig sei, um sie endlich in meinen Schädel zu kriegen. Und das ist eine solche Erleichterung, dass ich weinen könnte.
Oben in meinem Zimmer lasse ich Jeans und Gürtel zu Boden fallen. Ich schlafe in Unterwäsche. Beim Durchqueren des Raums sehe ich kurz mein Spiegelbild. Ich bin dürr wie ein Junge, blass, hohläugig, mit strähnigem braunem Haar, das in kurze Rattenschwänze geflochten ist, und an mir ist so viel Metall, dass es klappert, wenn ich gehe.
Arden Tode hat ein Spiel namens Bei der Geburt vertauscht erfunden. Dabei schickt sie per SMS einen Namen an die ganze Klasse und behauptet, gerade sei entdeckt worden, dass diese Person adoptiert worden sei. Dann müssen ihr alle per SMS die Namen der wirklichen Eltern dieser Person zurückschicken. Sie pickt sich die beiden besten Namen heraus und veröffentlicht sie dann zusammen mit dem Bild ihres Opfers auf ihrer Facebook-Seite. Meine Eltern sind Marilyn Manson und Captain Jack Sparrow. Kein Wunder, dass sie in Biologie durchfallen wird.
Ich ziehe mein T-Shirt aus, und der Schlüssel, den ich um den Hals trage, verheddert sich in meinem Haar. Ich zerre ihn heraus, und er blitzt vor mir auf. Er leuchtet. Selbst im dämmrigen Licht meines Zimmers leuchtet er. Genau wie Truman früher.
Ich erinnere mich an den Moment, als er diesen Schlüssel fand. Am Vorabend – einem Samstagabend – hatten unsere Eltern einen schrecklichen Streit gehabt. Es wurde geweint und geschrien. Ausgiebig. Ich war nach oben in mein Zimmer geflüchtet und schaltete den Fernseher ein, um sie zu übertönen. Truman hatte ich mitgenommen, in der Hoffnung er würde die DVD von Verschollen zwischen fremden Welten mit mir ansehen, aber das tat er nicht. Er stand an der Tür und lauschte. Es ging wie immer um dasselbe. Mom war wütend auf Dad, weil er nie zu Hause war. Dad war wütend auf Mom, weil sie fand, dass er das sollte.
»Glaubst du, das Geld wächst auf den Bäumen?«, schrie er. »Ich arbeite hart für ein gutes Einkommen. Für dich. Für die Kinder. Um dieses Haus zu halten. Damit Andi und Truman auf die St. Anselm gehen können …«
»Das ist doch Blödsinn. Wir haben eine Menge Geld. Ich weiß das, die Bank weiß es, St. Anselm weiß es und du weißt es auch.«
»Hör zu, können wir das bitte lassen? Es ist schon spät. Ich bin müde. Ich hab den ganzen Tag gearbeitet.«
»Und die ganze Nacht! Das ist das Problem!«
»Verdammt. Marianne, was willst du von mir?«
»Nein, was willst du, Lewis? Ich dachte, es geht um mich. Um die Kinder. Aber ich hab mich getäuscht. Also sag’s mir. Sag’s. Rück endlich raus damit. Was willst du?«
Ich hatte Verschollen zwischen fremden Welten inzwischen abgehakt. Ich stand auch an der Tür. Ein paar Sekunden lang war es still, dann hörte ich seine Antwort. Seine Stimme war ruhig. Er schrie nicht mehr. Das brauchte er nicht.
»Ich möchte den Schlüssel«, sagte er. »Den Schlüssel zum Universum. Zum Leben. Zu Zeit und Raum, zur Zukunft und zur Vergangenheit. Zu Liebe und Hass. Zur Wahrheit. Zu Gott. Er ist da. In uns. Im Genom. Die Antwort auf alle Fragen. Wenn ich ihn nur finde. Das ist es, was ich will«, schloss er leise. »Ich will den Schlüssel.«
Danach machten Truman und ich meine Tür zu. Wir sagten kein Wort zueinander, wir saßen bloß auf meinem Bett und sahen zu, wie Dr. Smith seinen Velour-Raumanzug anzog. Was konnten wir auch sonst tun? Wie hätten wir es mit Zeit, Raum und Gott und der Wahrheit aufnehmen können? Mom mit ihren Bildern von Vogeleiern und Kaffeetassen, und Truman und ich mit unserem dummen, beschissenen Kinderkram. Es war lachhaft. Mein Vater scherte sich einen Dreck um die Bands, die ich mochte, genausowenig wie um die Cartoons, die Truman neuerdings liebte. Wozu auch? Er hatte Besseres zu tun. Ich meine, mit wem würdest du rumhängen, wenn du die Wahl hättest – mit Johnny Ramone, Magneto oder Gott?
Am nächsten Morgen war Mom früh auf. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt geschlafen hatte. Ihre Augen waren rot, und die Küche roch nach Zigaretten, als Truman und ich zum Frühstück herunterkamen.
»Wollen wir zum Flohmarkt gehen? Habt ihr Lust?«, fragte sie.
Sie liebt den Brooklyner Flohmarkt. Dort findet sie Inspiration. In all den traurigen und zerbrochen Dingen. In der ausgefransten Spitze, den zerkratzten Bildern und dem kaputten Spielzeug. Alles hat eine Vergangenheit, und sie stellt sich gern vor, wie die wohl gewesen sein mag, um uns dann ihre Geschichte zu erzählen.
Wir stiegen in den Wagen und fuhren nach Fort Greene. An diesem Tag fand sie einen alten, dreibeinigen Pflanzkübel, von dem sie behauptete, er sei der Nachttopf von Elisabeth Tudor gewesen, eine Lupe, die Sherlock Holmes in Baskerville Hall benutzt, und einen Silberring mit einem Drachen, den Mata Hari vor dem Erschießungskommando getragen habe. Ich fand ein altes Clash-T-Shirt. Und Truman, der jede Kiste mit altem Trödel durchstöberte, wühlte sich durch verrostete Schlösser, zerbrochene Füller, Korkenzieher und Flaschenöffner, bis er gefunden hatte, wonach er suchte – einen Schlüssel, ganz schwarz angelaufen, etwa sechs Zentimeter lang.
Ich war dabei, als er ihn fand. Er bekam ihn für einen Dollar. Die Händlerin sagte, sie habe ihn in der Bowery in einer Abfalltonne vor einem sehr alten Haus gefunden.
»Das Dach ist eingebrochen«, sagte sie. »Jetzt lässt die Stadt das ganze Ding abreißen, um Platz für ein Fitnessstudio zu schaffen. Dieser gottverdammte Bürgermeister. Das Haus wurde 1808 erbaut. Wer braucht denn überhaupt diese ganzen Fitnessstudios? Es sind doch sowieso alle fett wie Schweine.«
»Haben wir Silberpolitur?«, fragte Truman, als wir zu unserem Wagen zurückgingen.
»Unter der Spüle«, antwortete Mom. »Schau, Tru, auf dem Schlüssel ist eine Fleur-de-Lys, eine Lilienblüte. Das Zeichen der Königswürde. Ich wette, er gehörte Ludwig XIV.«
Sie begann uns eine Geschichte über den Schlüssel zu erzählen, aber Truman unterbrach sie. »Das ist kein Spielzeug, Mom. Der ist echt«, sagte er. Als wir zu Hause waren, polierte er ihn, bis er glänzte.
»Er ist wunderschön«, sagte Mom, als er blinkte. »Schau, da oben ist ein ›L‹ eingraviert. Ich hatte also recht! Das steht für Ludwig, glaubst du nicht?«
Truman antwortete nicht. Er steckte ihn in seine Tasche, und wir bekamen den Schlüssel erst zwei Tage später wieder zu Gesicht. Es war Dienstagabend. Wir saßen im Wohnzimmer, Truman und ich machten Hausaufgaben, Mom malte. Plötzlich hörten wir die Haustür aufgehen. Es war Dad. Wir blickten auf und sahen einander erstaunt an.
Er kam mit einem Blumenstrauß herein. Er wirkte unbeholfen. Als wäre er ein Müllersohn, der um die Prinzessin werben wollte und erwartete, mit Hohn und Spott aus dem Palast gejagt zu werden. Aber die Prinzessin lachte ihn nicht aus. Sie lächelte und ging in die Küche, um eine Vase zu holen. Während sie fort war, warf Dad einen Blick auf Trumans Bruchrechnungen und meine Algorithmen. Um etwas zu tun. Damit er nicht mit uns reden musste. Dann setzte er sich aufs Sofa und strich sich übers Gesicht.
»Müde, Dad?«, fragte Truman.
Dad nahm die Hände herunter und nickte.
»Zu viel ›T und A‹?«
Dad lachte. Als Truman noch klein gewesen war, hatte er Dad über die DNA sprechen hören, doch als er es selbst auszusprechen versucht hatte, hatte er nur »T und A« herausbekommen. Das war seitdem bei uns ein Art geflügeltes Wort.
»Viel zu viel, Tru. Aber wir sind nahe dran. Ganz nahe.«
»Woran?«
»Das Genom zu knacken. Die Antworten zu finden. Den Schlüssel.«
»Aber das musst du nicht mehr.«
»Was muss ich nicht mehr?«
Truman griff in seine Hosentasche, zog seinen kleinen silbernen Schlüssel heraus und legte ihn unserem Vater in die Hand. Dad starrte ihn an.
»Das ist ein Schlüssel«, sagte Truman.
»Das sehe ich.«
»Es ist ein besonderer Schlüssel.«
»Inwiefern?«
»Da ist ein ›L‹ darauf. ›L‹ für Liebe. Siehst du’s? Es ist der Schlüssel zum Universum, Dad. Du hast doch gesagt, dass du danach suchst. Das hast du zu Mom gesagt. Ich hab ihn für dich gefunden, damit du ihn nicht mehr suchen musst. Damit du abends heimkommen kannst.«
Der Schlüssel lag auf Dads Handfläche. Er schloss die Finger darum und drückte sie fest zu. »Danke, Tru«, sagte er mit belegter Stimme. Und dann zog er meinen Bruder an sich und umarmte ihn.
»Ich liebe dich. Euch beide. Das wisst ihr doch, nicht wahr?«, sagte er, während er Truman festhielt und mich ansah.
Von Truman kam ein gedämpftes Ja. Ich nickte irgendwie verlegen. Es fühlte sich komisch an, als hätte man ein zu kostbares Geschenk gekriegt von einem Verwandten, den man kaum kennt. Ich hörte ein Schniefen. Mom stand in der Tür. Ihre Augen waren feucht.
Einen oder zwei Monate lang ging es gut. Und dann schaffte er es – er knackte das Genom. Er bekam den Nobelpreis und kam praktisch überhaupt nicht mehr nach Hause. Er reiste nach Stockholm, Paris, London und Moskau. Selbst wenn er in New York war, kam er erst heim, wenn wir schon im Bett lagen, und war schon wieder fort, bevor wir aufstanden. Es gab noch mehr Streit. Und dann, eines Nachts, nachdem wir ihn zwei Wochen lang überhaupt nicht gesehen hatten, ging Truman in sein Arbeitszimmer und holte sich den Schlüssel zurück. Ich sah ihn draußen im Hinterhof, wie er ihn in der Hand hielt und zum Abendstern hinaufsah. Er musste mir nicht sagen, was er sich wünschte, ich wusste es. Ich wusste auch, dass sein Wunsch nie in Erfüllung gehen würde. Genies sind keine Teamspieler.
Er hatte den Schlüssel bei sich, als er starb. Er fiel aus seiner Kleidung, als ein Mitarbeiter des pathologischen Instituts uns seine Sachen übergab. Er war in der vorderen Tasche seiner Jeans. Ich wusch das Blut ab, hängte ihn an ein Band und legte es mir um den Hals. Ich habe ihn nie mehr abgenommen.
Jetzt nehme ich mein Medikament. Eine Pille mit 25 Milligramm Trimipramin – Handelsname Qwellify – zwei Mal am Tag. Das steht auf der Packung. Ich nehme 50 Milligramm zwei Mal am Tag. Manchmal 75. Weil 25 Milligramm nichts mehr unterdrücken – weder die Wut und die Traurigkeit noch den Drang, vor fahrende Autos zu laufen. Aber es ist tückisch. Nimmt man zu wenig, kommt man morgens nicht aus dem Bett, nimmt man zu viel, sieht man Dinge. Kleine Dinge meistens – Spinnen, die die Wand hinaufkriechen –, aber manchmal auch große – wie meinen toten Bruder, der auf der Straße steht.
Ich schalte das Licht aus, lege mich aufs Bett, klicke Pink Floyd auf meinem iPod an und lausche Shine On You Crazy Diamond, meine Hausaufgabe. Zuerst hört man etwa zwei Minuten lang irgendwelche fern klingenden Synthesizer, dann setzt eine melancholische Gitarre ein, dann vier klare und verblüffende Noten: B, F, G, E.
Auf einem fiktiven Griffbrett spiele ich im Dunkeln mit. Vier Noten. Nathan hatte recht. David Gilmore schafft es, Traurigkeit mit vier Noten auszudrücken.
Ich höre weiter zu. Den Songs über Wahnsinn, Liebe und Verlust. Ich höre sie mir wieder und wieder an. Bis ich einschlafe. Und träume.
Von meinem Vater, der ein Vogelnest mit blauen Eiern hält.
Von einem kleinen Jungen, der im Himmel für Männer mit Augen wie schwarze Löcher Geige spielt.
Von Truman.
Er ist im Wohnzimmer und steigt aus einem Gemälde. Er kommt auf mich zu, langsam, mit seltsamen Schritten. Sein Rückgrat ist gebrochen. Er beugt den Kopf und küsst mich auf die Wange. Seine Lippen, blutleer und kalt, flüstern mir ins Ohr: Come on you raver, you seer of visions, come on you painter, you piper, you prisoner, and shine …
6
»Hey, Ard! Wo ist dein Albtraum von Mutter?«, brüllt Tillie Epstein, eine Oberstufenschülerin von der Slater-Schule, über die Straße.
»Beim Toxen«, brüllt Arden zurück und wirft ihr blondes Haar über die Schulter.
Arden ist an diesem schönen Samstagnachmittag auf dem Heimweg, und wegen ihrer gebräunten Beine, ihrer Wildlederstiefel und ihres Mikro-Minis drehen sich alle Köpfe nach ihr um. Sie trägt einen breiten Gürtel um die Hüften. Er hat eine glänzende Schnalle, auf der PRADA steht, was italienisch ist und so viel wie »unsicher«bedeutet. Sie kommt gerade aus einem Laden und hat eine Diätcola, eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Evian im Arm. Die beiden ersten Dinge sind ihr Mittagessen, das Evian ist für ihre Wasserpfeife. Leitungswasser ist ja »totalgiftig«.
»Botoxen oder Detoxen?«, ruft Tillie.
»De.«
Botoxende Mütter sind schwer kalkulierbar. Die Injektionen dauern nicht lang. Eine halbe Stunde in der Arztpraxis, ein bisschen Shoppen und Lunchen, und schon sind sie wieder zu Hause und platzen in deine Nachmittagsparty hinein. Höchst unangenehm.
Detoxende Mütter, also solche, die eine Entgiftung machen, sind dagegen eine sicherere Sache. Entgiften bedeutet nämlich gewöhnlich ein Flug nach Kalifornien, Darmspülungen, Entspannen in einer Jurte, Salbei-Räucherungen und tränenreiche Auseinandersetzungen mit dem inneren Kind. Schmerzhaft, ja, aber tränenreichen Auseinandersetzungen mit dem äußeren Kind bei Weitem vorzuziehen.
»Cool! Party bei dir zu Hause?«
»Geht nicht. Der Fengshui-Mann ist da. Unser Karma ist irgendwie total blockiert, weißt du?«
Wohlstandsbuddhismus. Gibt’s nur in den Heights.
»Aber Nick hat heute Abend ein paar Leute eingeladen«, fügt Arden gleich hinzu.
Tillie verabschiedet sich mit erhobenem Daumen und verschwindet in ein Yogastudio.
Nick ist Ardens Lover. Er geht auch auf die St. Anselm. Während ich hinter Arden weitergehe, in ausreichendem Abstand, damit keine Gefahr besteht, mit ihr reden zu müssen, kommt er aus Mabruk’s Falafel heraus, packt sie und gibt ihr einen dicken, feuchten Kuss.
Sein vollständiger Name ist Nick Goode, auch »Nicht Schuldig« genannt, wegen der viele Male, die die Anwälte seines Vaters vor Gericht so plädiert haben. Wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Wegen Drogenbesitzes. Wegen Sich-Übergebens bei Starbucks an drei aufeinanderfolgenden Vormittagen. Wegen öffentlichen Pinkelns am Spielplatz in der Pierrepont Street. Er ist Engländer. Sein Dad und seine Stiefmutter, Sir und Lady Goode, halten Papageien.
Nicks zerzauste Locken glänzen golden in der Wintersonne. Sein Kinn ist voller Bartstoppeln. Er trägt Stiefel, einen Kilt und ein Shirt. Keinen Mantel, obwohl wir Dezember haben. Schöne Menschen brauchen keine Mäntel. Sie haben ihre Aura, die sie wärmt.
Als er wieder Luft holt, sieht er mich. Er springt herüber, nimmt meine Hand und singt den ersten Vers aus I Want Candy und ersetzt dabei Candy durch Andi.
Er hat eine tolle Stimme, einen Reibeisen-Bariton, bei dem einem die Knie weich werden. Er riecht nach Zigaretten und Wein. Plötzlich hört er auf zu singen und fragt mich, ob ich zu seiner Party komme.
»Nicky!«, ruft Arden alarmiert von weiter vorn.
»Bleib locker, Ard«, ruft er über die Schulter. »Ard – die Kurzform für ›anstrengend‹«, flüstert er mir grinsend zu.
Er nimmt mir meine Tüten aus der Hand und stellt sie auf den Gehsteig. In einer sind Sandwiches. In der anderen siebzehn verschiedene Tuben blaue Ölfarbe. Mom kämpft immer noch mit Trumans Augen. Heute Morgen ist sie deswegen total ausgerastet. Sie hat sich erst beruhigt, als ich ihr sagte, sie habe die falschen Farben, deswegen kriege sie die Augen nicht hin, und ihr dann versprach, zu Pearl Paint zu gehen und die richtigen zu kaufen.
Er nimmt meine Hand und berührt mit seiner Stirn die meine. »Komm zu meiner Party«, sagt Nick. »Schließlich bin ich von Adel und du bloß eine Leibeigene, also musst du tun, was ich sage. Spiel Gitarre. Unterhalt mich. Mein Leben ist so verdammt langweilig, dass ich weinen könnte.«
»Wow, das ist aber mal ein Angebot. Narr am Hof Seiner Langweiligkeit.«
»Na komm schon, du sexy Biest. Du scharfzüngige, hartherzige kleine Hexe. Du bist das einzig interessante Mädchen in ganz Brooklyn.«
Ich verdrehe die Augen. »Wie viel hast du heute geraucht? Ein Kilo?«
»Bitte komm. Ich will dich«, sagt er, streicht mit den Lippen über meinen Mund und versucht, mich zu küssen.
Keine gute Idee. Die schlechteste, tatsächlich. Ich stoße ihn weg. »Hey, Mann. Ich bin doch kein Radicchio.«
»Was?«
»Radicchio. Den kennst du doch? Den scheußlichen roten Salat? All die Göttinnen, mit denen du schläfst, Nick, verderben dir den Geschmack. Du hast dir zu viele Süßigkeiten gegönnt, und jetzt sehnst du dich nach was Bitterem.«
Nick lacht sich halb tot. Wenn man Shit geraucht hat, kommt einem jeder Langweiler komisch vor. Sogar TV-Talker Letterman.
»Ich muss weiter«, sage ich und mache mich los.
»Andi, warte.«
Aber ich warte nicht. Ich kann nicht. Hier auf der Henry Street mit ihm zu stehen, bringt alles wieder zurück. Er erinnert sich kaum. Zumindest sagt er das. Aber ich glaube, ihm ist alles noch ganz präsent und deswegen dröhnt er sich ständig zu.
Er lässt mich zehn Schritt weitergehen, dann ruft er: »Ich hol die Gitarre von meinem Paten raus.«
Wow. Die ganz großen Geschütze. Sein Pate ist zufällig Keith Richards.
Ich drehe mich um. »Was willst du von mir, Nick?«, frage ich leicht gereizt.
»Die ist super«, sagt er. »Er hat mit ihr Angie komponiert.«
»Was willst du? Sex kann’s nicht sein. Davon hast du genug. Drogen auch nicht. Du hast mehr Pillen als die Apothekervereinigung. Brauchst du Hilfe bei deinen Französischhausaufgaben? Ist es das?«
»Er hat sie mir letzten Monat geschenkt. Als ich in England war«, antwortet er. Seine Stimme klingt jetzt sanft. Flehend.
Fast hätte ich es laut ausgesprochen. Das Wort fast ausgespuckt, nach dem er sich so sehnt – Vergebung. Aber dann lüftet sich der Drogennebel, sein Blick trifft den meinen, und ich kann den Schmerz darin sehen. Also spreche ich es nicht aus. Ich lasse ihn nett zu mir sein. Das ist zwar nicht, was er will, aber das Beste, was ich tun kann.
»Du bluffst doch«, sage ich. »Sie ist nicht von Onkel Keith. Du hast sie bei Ebay gekauft.«
Er lächelt. »Nein. Es ist seine.«
»Ja? Was ist es denn für eine Marke?«, frage ich, um ihn zu testen.
»Es ist … ähm … eine Fender Bender … nein, irgendeine Paul Gibson … eine Art Stratoblaster. Ach, Scheiße, ich weißes nicht. Aber es ist seine, das schwöre ich. Wir rufen ihn an, und er wird es dir sagen. Er hat sie mir geschenkt. Wenn du kommst, lass ich dich darauf spielen.«
»Okay. Ich komme.«
Ich nehme meine Tüten, verabschiede mich von ihm und gehe dann an Arden vorbei. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich Staub. »Hey, danke für die Einladung«, sage ich zu ihr. Sie macht sich nicht die Mühe, mir zu antworten. Sie hebt ihre ganze Liebe für Nick auf.
»Warum hast du sie nicht gleich hier auf dem Gehsteig gevögelt, Nicky? Das wolltest du doch. Das konnte doch jeder sehen!«
»Hau ab, Arden, ja? Bei dir krieg ich Kopfweh.«
Ah, junge Liebe.
Lächelnd biege ich in meine Straße ein. Die Winterferien stehen vor der Tür. Ich beschließe, Vijay anzurufen und ihn zu fragen, ob er mitkommt. Abgesehen von der Gitarre, die ich sehr gern spielen möchte, verheißt diese Party Möglichkeiten: gelangweilte reiche Jungs, eifersüchtige reiche Mädchen, eine Menge illegaler Substanzen, vielleicht sogar eine geladene Waffe.
Wenn ich Glück habe.
7
Wie sich herausstellt, habe ich keines. Glück, meine ich. Kein bisschen.
Die Party ist Scheiße. Wortwörtlich. Ich bin noch keine zehn Sekunden in Nicks Haus, als ein feuchter weißer Haufen auf meiner Schulter landet.
Ich blicke hoch. Über mir sitzt ein großer grüner Papagei im Kronleuchter und putzt sich das Gefieder.
Rupert Goode, Nicks Dad, taucht humpelnd mit einem Lappen hinter mir auf. »Jago, du Halunke!«, ruft er und schwingt seinen Stock in Richtung des Vogels. »Ich dreh dir den Hals um. Ich rupf dich, nehm dich aus und schieb dich ins Backrohr!«
»Ach ja, du dummer Gentleman!«, krächzt Jago und fliegt davon, um den Nächsten zu bombardieren.
»Tut mir leid, meine Liebe«, sagt Rupert. »Er ist ein Schurke, dieser Vogel. Erlaube mir …«
Rupert Goode ist Schauspieler. Er hat jede männliche Hauptrolle gespielt, die Shakespeare je geschrieben hat, eine Unmenge Independentfilme gedreht und dann mit vier oder fünf Harry Potters Kasse gemacht. Jetzt kann er kaum noch arbeiten. Er zittert. Aber seine Stimme ist immer noch schön. Die hat die Parkinson-Krankheit noch nicht ruiniert.
Ich blicke mich um, während er mir die Scheiße abwischt, betrachte die Wasserflecken auf der Tapete in der Diele und die abbröckelnde Decke darüber. Ein verblichenes Gemälde in einem angeschlagenen Rahmen. Ein stinkender Terrier, der auf einem Mantel schläft. Halb umgekippte Manuskriptstapel. Wenn es das Haus von jemand anderem wäre, stünde es auf der städtischen Abrissliste, aber weil es Rupert Goode gehört, ist es in der Vogue.
»Ich sehe dich gar nicht mehr«, sagt Rupert. »Früher habe ich dich oft mit Marianne im Cranberry’s getroffen, wo ihr morgens Kaffee getrunken habt.« Er ist mit meiner Mom befreundet. Oder war es. Als sie noch Freunde hatte.
»Ich hatte viel zu tun. Abschlussarbeit. Collegebewerbungen. Sie wissen schon.«
Er weiß bloß, dass ich lüge.
»Wie geht’s dir, Andi? Ehrlich?«, fragt er und sieht mich prüfend an.
»Mir geht’s gut«, antworte ich und sehe weg. Er macht sich Sorgen. Das weiß ich. Deshalb sage ich ihm auch nicht, wie es wirklich um mich steht.
»Nein, das glaube ich nicht. Wie denn auch?«, antwortet er. »Ich kann nie an diesen Tag zurückdenken, ohne dass mir Lears Rede an seine arme verstorbene Cordelia einfällt: Warum sollt’ ein Hund, ein Pferd, eine Ratte leben / und du hast keinen Atemhauch mehr? Es ist ein Trost, das Werk des Dichters. Findest du nicht auch? Shakespeare stellt so monumentale Fragen.«
»Sponge Bob tut das auch. Das Problem ist bloß, dass beiden keine monumentalen Antworten einfallen.«
Rupert lacht, aber seine Augen sind traurig. »Nick vermisst dich. Ich dich übrigens auch«, sagt er. Dann umarmt er mich. Das tun die Leute oft. Es scheint zu helfen. Zumindest ihnen.
»Also, jetzt stürz dich ins Getümmel und vergnüg dich«, sagt er und reicht mir einen rosa Papiersonnenschirm.
»Ähm, Rupert? Hier scheint doch keine Sonne.«
»Es ist ein Schutzschild, meine Liebe. Jago ist schlimm, aber Edmund, der Neue, ist der Teufel in Person.«
Ich spanne den Sonnenschirm auf, gehe von Raum zu Raum und fühle mich wie Cho-Cho-San auf der Suche nach Pinkerton in Madame Butterfly. Meine halbe Klasse ist in der Küche. Überall liegen leere Flaschen und Zigarettenschachteln herum, ich sehe Papageien und Sonnenschirme, aber keinen Nick.
Jemand bietet mir ein Glas Wein an, aber ich lehne ab. Alkohol verträgt sich nicht gut mit meinen Pillen. Es kommt zu unangenehmen Nebenwirkungen.
Vor ungefähr einem Jahr habe ich angefangen, die Pillen zu schlucken. Ich habe Dr. Becker, einen Psychiater, aufgesucht, weil ich weder essen, schlafen, noch zur Schule gehen konnte. Beezie hatte ihn empfohlen, und mein Vater zwang mich hinzugehen, indem er mir drohte, dass ich andernfalls keinen Unterricht mehr bei Nathan nehmen dürfte. Ich sollte irgendwelche Dinge mit ihm besprechen, aber ich machte den Mund kaum auf – außer um zu sagen, was für eine Zeitverschwendung das Ganze sei. So vergingen ein paar Wochen, danach verschrieb Dr. Becker Paxil. Dann Zoloft. Als das nicht wirkte, setzte er mich auf Qwellify, ein trizyklisches Antidepressivum. Falls das nicht anschlagen sollte, würden Neuroleptika an die Reihe kommen.
Ich gehe weiter durch das Haus der Goodes, auf der Suche nach Nick. Ich wünschte, Vijay wäre mitgekommen, dann hätte ich jemanden zum Reden, aber es ist ein Samstagabend während der Winterferien, also arbeitet er natürlich an seinem Abschlussaufsatz – Atom und Eva: Technologie, Religion und der Kampf ums 21. Jahrhundert. Er hat es bereits geschafft, Beiträge von fünf weltbekannten Persönlichkeiten zu bekommen.