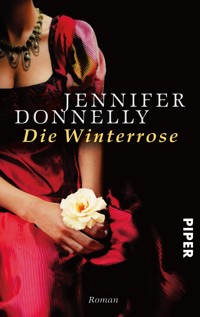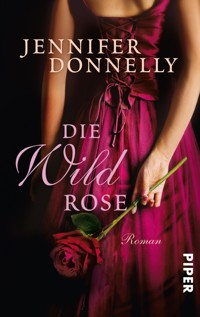
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Herzen von Willa Alden und Seamus Finnegan schlagen für die Gipfel der Welt – und füreinander. Doch auf einer schicksalhaften Bergtour erleidet Willa einen Unfall und ist fortan für ihr Leben körperlich gezeichnet. Voller Vorwürfe wendet sie sich von Seamus ab – die Trennung bricht ihm das Herz. Jahre später kreuzen sich ihre Wege ein zweites Mal, und ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Simon Lipskar und Maja Nikolic
Übersetzung aus dem Englischen von Angelika Felenda
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage April 2012
ISBN 978-3-492-95586-7
© 2011 Jennifer Donnelly Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Wild Rose«, Hyperion, New York 2011 © der deutschsprachigen Ausgabe: 2012 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlaggestaltung: Mediabureau Di Stefano, Berlin
Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen,
Prolog
August 1913 – Tibet
Verhielten sich alle englischen Frauen wie Männer beim Sex? Oder bloß diese hier?
Das fragte sich Max von Brandt, ein deutscher Bergsteiger, als er der jungen Frau, die neben ihm im Dunkeln lag, das Haar aus dem Gesicht strich. Er war mit vielen Frauen zusammen gewesen. Mit sanften, anschmiegsamen Frauen, die sich hinterher an ihn klammerten und ihm Schwüre und Zärtlichkeiten abrangen. Diese Frau war nicht sanft und genauso wenig ihr Sex. Er war hart, schnell und ohne Vorspiel. Und wenn es vorbei war wie jetzt, rollte sie sich auf die Seite und schlief ein.
»Ich schätze, es gibt nichts, was dich bewegen könnte, bei mir zu bleiben, oder?«, fragte er.
»Nein, Max, nichts.«
Er lag auf dem Rücken im Dunkeln und hörte zu, wie ihr Atem gleichmäßiger wurde, während sie einschlief. Er selbst konnte nicht schlafen. Wollte es nicht. Er wollte, dass diese Nacht niemals zu Ende ging. Um sie nie zu vergessen. Er wollte sich erinnern, wie sie sich anfühlte, wie sie roch. An das Geräusch des Windes. Die beißende Kälte.
Er hatte ihr gesagt, dass er sie liebte. Vor Wochen. Und es ernst gemeint. Zum ersten Mal in seinem Leben war er aufrichtig gewesen. Aber sie hatte nur gelacht. Und dann, als sie bemerkte, wie verletzt er war, den Kopf geschüttelt.
Die Nacht verging schnell. Noch vor Sonnenaufgang erhob sich die Frau. Während Max in die Dunkelheit starrte, zog sie sich an und verließ leise das gemeinsame Zelt.
Er fand sie nie neben sich, wenn er aufwachte. Immer verließ sie noch bei Dunkelheit das Zelt, die Höhle oder irgendeinen Unterschlupf, den sie gefunden hatten. Anfangs hatte er sie gesucht und sie immer irgendwo hoch oben gefunden, an einem einsamen, stillen Ort, wo sie dasaß, das Gesicht in den frühen Morgenhimmel mit den verblassenden Sternen erhoben.
»Wonach suchst du?«, fragte er stets und folgte ihrem Blick.
»Nach dem Orion«, antwortete sie.
In nur ein paar Stunden würde er ihr Lebewohl sagen. In der verbleibenden Zeit würde er an ihre ersten gemeinsamen Tage denken, denn an diese Erinnerungen würde er sich klammern.
Sie hatten sich vor ein paar Monaten kennengelernt. Er wollte unbedingt den Himalaja sehen und herausfinden, ob es möglich sei, den Everest zu bezwingen. Um den höchsten Berg der Welt für Deutschland, sein Vaterland, zu erobern. Der Kaiser wünschte Eroberungen, und er stellte ihn lieber mit einem herrlichen Berg zufrieden als mit der Teilnahme an einem erbärmlichen Krieg in Europa. Von Berlin aus war er nach Indien aufgebrochen, hatte das Land in nördlicher Richtung durchquert und dann heimlich Nepal betreten, ein Land, das westlichen Ausländern verboten war.
Bis nach Kathmandu war er gekommen, als er von Vertretern der nepalesischen Obrigkeit festgenommen und zum Verlassen des Landes aufgefordert wurde. Das versprach er, aber er brauche Hilfe, sagte er. Einen Führer. Er brauche jemanden, der ihn durch die Hochtäler des Solu Khumbu und über den Nangpa-La-Pass nach Tibet führe. Von dort wolle er nach Osten ziehen und den Fuß des Everest erkunden auf dem Weg nach Lhasa, der Stadt Gottes, wo er hoffe, vom Dalai Lama die Erlaubnis zur Besteigung zu bekommen. Er habe von einem Ort namens Rongbuk gehört und von jemandem, der ihm vielleicht helfen könne – von einer Frau, ebenfalls eine Ausländerin aus dem Westen. Ob sie etwas von ihr wüssten?
Die Vertreter der Obrigkeit sagten, sie sei ihnen bekannt, obwohl sie die Frau seit einigen Monaten nicht mehr gesehen hätten. Er gab ihnen Geschenke: Rubine und Saphire, Perlen und einen großen Smaragd, den er in Jaipur gekauft hatte. Als Gegenleistung erhielt er die Erlaubnis, auf die Frau zu warten. Einen Monat lang.
Max hatte von der Frau zum ersten Mal nach seinem Eintreffen in Bombay gehört. Westliche Bergsteiger, die er dort kennenlernte, erzählten ihm von einer jungen Engländerin, die im Schatten des Himalaja lebte. Sie hatte den Kilimandscharo bestiegen – den Mawenzi-Gipfel – und dort bei einem schrecklichen Unfall ein Bein verloren. Jetzt, sagten sie, fotografiere sie und zeichne Karten des Himalaja. Sie steige so hoch hinauf, wie sie könne, aber schwierige Kletterpartien seien ihr verwehrt. Sie lebe jetzt unter den Bergbewohnern. Sie sei genauso stark wie die Einheimischen und habe deren Respekt und Zuneigung gewonnen. Sie mache, was eigentlich kein Europäer tun könne – überschreite problemlos Grenzen und erfahre Gastfreundschaft von Nepalesen und Tibetanern gleichermaßen.
Aber wie sollte er sie finden? Es wimmelte vor Gerüchten. Sie sei in China und Indien gewesen, halte sich jetzt aber in Tibet auf, behaupteten einige. Nein, in Burma. Nein, in Afghanistan. Sie vermesse Land für die Briten. Spioniere für die Franzosen. Sie sei in einer Lawine umgekommen. Lebe wie eine Eingeborene. Habe einen Nepalesen geheiratet. Handle mit Pferden. Mit Yaks. Mit Gold. Auf dem Weg durch den Nordosten Indiens hörte er weitere Gerüchte. In Agra. In Kanpur. Und schließlich hatte er sie endlich gefunden. In Kathmandu. Oder zumindest eine Hütte, die sie benutzt hatte.
»Sie ist in den Bergen«, erklärte ein Dorfbewohner. »Sie wird kommen.«
»Wann?«
»Bald. Bald.«
Tage vergingen. Dann Wochen. Ein Monat. Die Nepalesen wurden ungeduldig. Sie wollten ihn loswerden. Immer wieder fragte er die Dorfbewohner, wann sie komme, und jedes Mal antworteten sie, bald. Er hielt dies für eine List des hinterhältigen Bauern, bei dem er wohnte, um noch ein paar Münzen mehr aus ihm herauszuschlagen.
Und dann kam sie. Zuerst hatte er sie für eine Nepalesin gehalten. Sie trug indigoblaue Hosen und eine lange Schaffelljacke. Ihre grünen Augen wirkten groß in dem eckigen Gesicht. Das Haar trug sie zu Zöpfen geflochten, die mit Silber und Glasperlen geschmückt waren – wie die einheimischen Frauen. Ihr Gesicht war von der Himalaja-Sonne gebräunt. Ihr Körper drahtig und stark. Sie humpelte beim Gehen. Später fand er heraus, dass sie eine Prothese aus Yakknochen trug, die ihr ein Dorfbewohner geschnitzt hatte.
»Namaste«,sagte sie zu ihm und neigte leicht den Kopf, nachdem der Bauer ihr erklärt hatte, was er wollte.
Namaste. Das war eine nepalesische Begrüßung, die bedeutete: Das Licht in mir verbeugt sich vor dem Licht in dir.
Er erklärte ihr, dass er sie anheuern wolle, um ihn nach Tibet zu führen. Sie erwiderte, dass sie gerade aus Shigatse zurückkomme und müde sei. Sie wolle zuerst schlafen, dann essen, und dann würden sie die Sache besprechen.
Am nächsten Tag bereitete sie ein Lammcurry für ihn zu, dazu gab es starken schwarzen Tee. Gemeinsam saßen sie auf dem teppichbedeckten Boden ihrer Hütte, unterhielten sich und teilten eine Opiumpfeife. Das vertreibe die Schmerzen, sagte sie. Damals dachte er, sie beziehe sich auf ihr verletztes Bein, aber später stellte er fest, dass der Schmerz, von dem sie sprach, viel tiefer ging und dass das Opium, das sie rauchte, wenig dazu beitrug, ihn zu lindern. Die Traurigkeit hüllte sie wie ein schwarzer Mantel ein.
Er war verblüfft von ihrem umfassenden Wissen über den Himalaja. Sie hatte einen größeren Teil der Gebirgskette vermessen, kartografiert und fotografiert als jeder westliche Ausländer vor ihr. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt mit Führungen und mit Arbeiten über die Topografie der Berge, die sie bei der Royal Geographical Society veröffentlichte. Sie würde bald auch ein Buch mit ihren Fotografien herausbringen. Max hatte einige davon gesehen. Sie waren erstaunlich gut. Sie fingen die wilde Pracht der Berge, ihre Schönheit und kalte Gleichgültigkeit ein, wie es bis dahin noch niemandem gelungen war. Persönlich tauchte sie nie im Sitz dieser Gesellschaft auf, weil sie ihre geliebten Berge nicht verlassen wollte. Stattdessen schickte sie ihre Arbeit zur Veröffentlichung an Sir Clements Markham, den Präsidenten der Royal Geographical Society.
Max war beim Anblick ihrer Fotografien und der Genauigkeit ihrer Karten in Begeisterungsrufe ausgebrochen. Sie war jünger als er – erst neunundzwanzig – und hatte dennoch schon so viel erreicht. Achselzuckend war sie über sein Lob hinweggegangen und meinte, es gebe noch so viel mehr zu tun, was sie aber nicht leisten könne – weil sie wegen ihres Beins nicht hoch genug hinaufkomme.
»Aber allein um das zu leisten, hast du doch klettern müssen«, wandte er ein.
»Nicht sonderlich hoch hinauf. Und nicht über schwieriges Gelände. Nicht über Eishänge oder Klippen oder Gletscherspalten.«
»Aber wie kannst du überhaupt klettern? Ohne … ohne zwei Beine, meine ich.«
»Ich klettere mit dem Herzen«, antwortete sie. »Kannst du das auch?«
Nachdem er bewiesen hatte, dass er tatsächlich mit Liebe, Ehrfurcht und Respekt vor den Bergen klettern konnte, willigte sie ein, ihn nach Lhasa zu führen. Mit zwei Yaks als Packtieren für Zelt und Proviant zogen sie durch Bergdörfer, Täler und über Pfade, die nur sie und eine Handvoll Sherpas kannten. Es war hart, ermüdend und unbeschreiblich schön. Zudem grauenvoll kalt. Unter Fellen, eng aneinandergeschmiegt, schliefen sie in einem Zelt, um sich warm zu halten. In der dritten Nacht sagte er ihr, dass er sie liebe. Sie lachte und wandte sich verärgert ab. Er hatte es ehrlich gemeint und fühlte sich von ihrer Ablehnung tief gekränkt in seinem Stolz.
»Tut mir leid«, sagte sie und legte die Hand auf seinen Rücken. »Tut mir leid, ich kann nicht …«
Er fragte, ob es jemand anderen gebe, was sie bejahte, dann nahm sie ihn in die Arme. Um ihm Trost, Wärme und Lust zu schenken – aber nicht aus Liebe. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass ihm das Herz gebrochen wurde.
Drei Wochen zuvor waren sie in Rongbuk, einem öden tibetanischen Dorf am Fuß des Everest, angekommen, wo sie lebte. Dort warteten sie, während die Frau, die über gute Verbindungen verfügte, ihren Einfluss nutzte, um ihm Papiere von tibetanischen Behörden zu beschaffen, die ihm gestatteten, Lhasa zu betreten. Er wohnte in ihrem Haus – einem kleinen, weiß gekalkten Steingebäude mit einem noch kleineren Anbau für ihre Tiere.
Einmal beobachtete er, wie sie zu klettern probierte. Die Kamera auf den Rücken geschnallt, versuchte sie, einen Gletscherhang hinaufzukommen. Aber irgendwann hielt sie inne und bewegte sich ganze zehn Minuten lang nicht mehr. Er konnte sehen, wie sie mit sich kämpfte. »Hol dich der Teufel!«, schrie sie plötzlich. »Hol dich der Teufel! Verdammt!«, und er befürchtete schon, sie würde eine Lawine auslösen. Wen schrie sie an?, fragte er sich. Den Berg? Sich selbst? Jemand anderen?
Schließlich trafen seine Papiere ein. Am Tag danach verließen sie Rongbuk mit einem Zelt und fünf Yaks. Gestern hatten sie die Außenbezirke von Lhasa erreicht. Es war ihr letzter gemeinsamer Tag. Die letzte gemeinsame Nacht. In ein paar Stunden würde er allein in die heilige Stadt einziehen. Er hatte vor, ein paar Monate zu bleiben, Lhasa und seine Bewohner zu studieren und Fotos zu machen, während er versuchte, eine Audienz beim Dalai Lama zu bekommen. Wie gering die Chancen dafür waren, wusste er. Der Dalai Lama tolerierte nur eine westliche Person – die Frau. Es hieß, gelegentlich würden sie gemeinsam trinken, singen und sich unzüchtige Geschichten erzählen. Diesmal jedoch würde sie nicht mit nach Lhasa kommen. Sie wollte nach Rongbuk zurück.
Als Max jetzt im kalten Morgengrauen aufstand, fragte er sich, ob er sie je wiedersehen würde. Er zog sich schnell an, packte ein paar Sachen in seinen Rucksack und verließ das Zelt. Vier Yaks – Geschenke für den Gouverneur von Lhasa –, deren Atem weiß in der Morgenluft stand, stampften und schnaubten, aber die Frau war nirgendwo zu sehen.
Er blickte sich um und entdeckte sie schließlich auf einem vorstehenden Felsen, wo sich ihre Silhouette vor dem Morgenhimmel abzeichnete. Still und einsam saß sie da, ein Knie an die Brust gedrückt, das Gesicht zu den verblassenden Sternen erhoben. Jetzt würde er sie verlassen. Mit dem anbrechenden Tag. Für immer mit diesem Bild in sich.
»Namaste,Willa Alden«, flüsterte er und berührte seine Stirn mit gefalteten Händen. »Namaste.«
Erster Teil
März 1914
London
1
Tante Eddie, halt! Du kannst da nicht reingehen!«
Seamus Finnegan lag nackt, der Länge nach ausgestreckt, auf seinem Bett und öffnete ein Auge. Er kannte diese Stimme. Sie gehörte Albie Alden, seinem besten Freund.
»Um Himmels willen, warum denn nicht?«
»Weil er schläft! Du kannst nicht einfach zu einem schlafenden Mann reinplatzen. Das gehört sich nicht!«
»Ach, Blödsinn.«
Seamie kannte auch diese Stimme. Er setzte sich auf und zog die Bettdecke zum Kinn.
»Albie! Unternimm was!«, schrie er.
»Das hab ich versucht, alter Junge. Jetzt bist du auf dich allein gestellt«, rief Albie zurück.
Eine Sekunde später riss eine kleine, korpulente Frau im Tweedkostüm die Tür auf und begrüßte Seamie mit lauter Stimme. Es war Edwina Hedley, Albies Tante, aber Seamie kannte sie seit seiner frühesten Jugend und nannte sie Tante Eddie. Sie setzte sich aufs Bett, sprang aber sofort wieder hoch, weil jemand aufkreischte. Eine junge Frau, zerzaust und gähnend, tauchte unter den Decken auf.
Eddie runzelte die Stirn. »Meine Liebe«, sagte sie zu dem Mädchen, »ich hoffe inständig, Sie haben Vorkehrungen getroffen. Ansonsten werden Sie feststellen, dass ein Baby unterwegs ist, während sich der Vater auf dem Weg zum Nordpol befindet.«
»Ich dachte, es sei der Südpol«, antwortete die Frau verschlafen.
»Hat er Ihnen von all seinen Kindern erzählt?«, fragte Eddie die junge Frau und senkte die Stimme verschwörerisch.
Seamie setzte zu einem Protest an. »Eddie …«
»Kinder? Was für Kinder?«, fragte die junge Frau, inzwischen nicht mehr verschlafen.
»Sie wissen doch, dass er vier Kinder hat? Alle unehelich. Er schickt den Müttern zwar Geld – er ist ja kein völliger Schuft –, will aber keine von ihnen heiraten. Sie sind natürlich absolut ruiniert. Alles Mädchen aus London. Drei sind aufs Land gezogen, weil sie sich nirgendwo mehr blicken lassen können. Das vierte ging nach Amerika, das arme Ding. Warum, glauben Sie wohl, ist die Sache mit Lady Caroline Wainwright in die Brüche gegangen?«
Das Mädchen, eine hübsche Brünette mit kurzem Pagenkopf, drehte sich zu Seamie um. »Stimmt das?«, fragte sie empört.
»Vollkommen«, warf Eddie ein, bevor Seamie den Mund aufmachen konnte.
Die junge Frau schlang die Daunendecke um sich und stand auf. Sie sammelte ihre Kleider vom Boden auf, stürmte wütend hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
»Vier Kinder, Tante Eddie?«, fragte Seamie, nachdem sie gegangen war. »Das letzte Mal waren es zwei.«
»Das war eine, die nur aufs Geld aus ist«, erwiderte Eddie verächtlich. »Ich habe dich gerade noch gerettet, aber ich werde nicht immer deinen Hals aus der Schlinge ziehen können.«
»Wie schade«, sagte Seamie.
Eddie beugte sich über ihn und küsste ihn auf die Wange. »Es ist schön, dich zu sehen.«
»Finde ich auch. Wie war es in Aleppo?«
»Absolut herrlich! Ich habe in einem Palast gewohnt und mit einem Pascha diniert. Außerdem die unglaublichsten Leute getroffen. Unter anderem einen gewissen Tom Lawrence. Er ist mit mir nach London zurückgereist und wohnt jetzt in meiner Wohnung in Belgravia und …«
Ein schepperndes Geräusch ertönte, als die schwere Haustür zuknallte.
Eddie lächelte. »Nun, mit der wär’s vorbei. Die kriegst du nicht mehr zu Gesicht. Du bist mir vielleicht ein Schürzenjäger. Ich habe übrigens von der Sache mit Lady Caroline erfahren. Ganz London redet davon.«
»Das habe ich gehört.«
Seamie war nach Highgate, in Eddies schönes georgianisches Haus in Cambridge gekommen, um sich von einer kurzen, aber stürmischen Liebesaffäre zu erholen. Lady Caroline Wainwright war eine junge Dame – reich, hübsch und verwöhnt – und gewohnt, alles zu bekommen, was sie wollte. Und sie wollte ihn – als Ehemann. Er hatte ihr erklärt, dass das nie funktionieren würde. Er tauge nicht zum Ehemann. Er sei zu unabhängig. Zu sehr gewohnt, seine eigenen Wege zu gehen. Zu viel auf Reisen. Alles Mögliche hatte er ihr erzählt – nur nicht die Wahrheit.
»Es gibt jemand anderen, nicht wahr?«, hatte Caroline unter Tränen gefragt. »Wer ist es? Sag mir ihren Namen.«
»Es gibt niemanden«, hatte er geantwortet. Was natürlich eine Lüge war. Es gab tatsächlich jemanden. Jemanden, den er vor Langem geliebt – und verloren – hatte. Eine Frau, die ihn für alle anderen verdorben hatte, wie es schien.
Er hatte mit Caroline Schluss gemacht und war dann nach Cambridge geflohen, um sich bei seinem Freund zu verstecken. Er besaß keine eigene Wohnung, und wenn er in England war, pendelte er meistens zwischen Highgate, dem Haus seiner Schwester und verschiedenen Hotels hin und her.
Albie Alden, ein brillanter Physiker, der im King’s College studiert hatte, lebte im Haus seiner Tante. Ständig boten ihm Universitäten in der ganzen Welt Stellen an – Paris, Wien, Berlin, New York –, aber er wollte in Cambridge bleiben. Im langweiligen, verschlafenen Cambridge. Keiner wusste, warum. Seamie jedenfalls nicht. Er hatte ihn oft gefragt, und Albie antwortete jedes Mal, dass es ihm hier am besten gefalle. Es sei ruhig und friedlich – zumindest wenn Seamie nicht da sei –, und das brauche er für seine Arbeit. Und Eddie, die selten zu Hause war, brauche jemanden, der sich um alles kümmere. Die Übereinkunft sei nützlich für sie beide.
»Was ist passiert?«, fragte Eddie jetzt. »Hat dir Lady Caroline das Herz gebrochen? Wollte sie dich nicht heiraten?«
»Nein, sie wollte mich heiraten. Das war das Problem.«
»Hm. Was erwartest du denn? So ist es eben, wenn man ein umwerfender, blendend aussehender Held ist. Die Frauen wollen sich dich eben unter den Nagel reißen.«
»Dreh dich bitte um, damit ich mich anziehen kann«, erwiderte Seamie nur.
Eddie kam der Bitte nach, Seamie stand auf und sammelte seine Kleider vom Boden auf. Er war groß, kräftig und gut gebaut. Seine Muskeln spannten sich unter der Haut, als er seine Hose anzog und sein Hemd überstreifte. Sein Haar, an den Seiten kurz geschnitten, oben lang und wellig, war kastanienbraun mit Reflexen. Sein Gesicht war von Sonne und Meer wettergegerbt. Seine Augen waren von einem verblüffenden Blau.
Im Alter von einunddreißig Jahren gehörte er weltweit zu den anerkanntesten Polarforschern. Schon als Teenager hatte er gemeinsam mit Ernest Shackleton einen Versuch zur Entdeckung des Südpols unternommen. Und vor zwei Jahren war er von der ersten erfolgreichen Expedition zum Südpol zurückgekehrt, die von dem Norweger Roald Amundsen geleitet worden war. Kurz nach seiner Rückkehr hatte er sich auf eine Vortragstour begeben und war fast zwei Jahre lang ununterbrochen durch die Welt gereist. Seit einem Monat war er wieder in London, aber die Stadt mitsamt ihren Bewohnern kam ihm schon jetzt grau und langweilig vor. Er fühlte sich ruhelos und eingesperrt und konnte es gar nicht erwarten, zu neuen Abenteuern aufzubrechen.
»Wie lange bist du schon in der Stadt? Wie gefällt es dir? Bleibst du diesmal ein bisschen länger?«, fragte Eddie.
Seamie lachte. So redete Eddie immer – sie stellte eine Frage, und bevor man sie beantworten konnte, folgten zehn weitere.
»Ich weiß nicht«, antwortete er und kämmte sich das Haar vor dem Spiegel über dem Sekretär. »Könnte sein, dass ich bald wieder fort bin.«
»Wieder eine Vortragsreise?«
»Nein. Eine Expedition.«
»Wirklich? Wie aufregend! Wohin?«
»Zurück in die Antarktis. Shackleton versucht, was auf die Beine zu stellen. Ihm ist es ziemlich ernst damit. Letztes Jahr hat er es in der Times angekündigt und inzwischen schon einen recht detaillierten Zeitplan aufgestellt. Jetzt muss er bloß noch das Geld dafür auftreiben.«
»Und was ist mit den ganzen Kriegsgerüchten? Bereitet ihm das keine Sorgen?«, fragte Eddie. »Die Leute auf dem Schiff redeten von nichts anderem. In Aleppo genauso.«
»Das schert ihn kein bisschen. Er schenkt der Sache keinen großen Glauben. Seiner Meinung nach verzieht sich das Gewitter bald wieder, und er will Ende Sommer lossegeln, wenn nicht schon früher.«
Eddie sah ihn lange an. »Wirst du allmählich nicht ein bisschen zu alt für dieses Draufgängerleben? Solltest du nicht sesshaft werden? Eine nette Frau finden?«
»Wie denn? Du verjagst sie doch alle?«, erwiderte Seamie neckend. Er setzte sich wieder aufs Bett und zog seine Socken an.
Eddie schlug mit der Hand nach ihm. »Komm runter, wenn du fertig angezogen bist. Ich mache Frühstück für uns alle. Eier mit Harissa-Soße. Ich hab ganze Töpfe von dem Zeug mitgebracht. Warte, bis du sie probiert hast. Einfach göttlich! Dann erzähle ich dir und Albie und seinen gelehrten Freunden von meinen Abenteuern. Und dann fahren wir nach London.«
»Nach London? Wann? Gleich nach dem Frühstück?«
»Na ja, vielleicht nicht direkt danach«, räumte Eddie ein. »Vielleicht in ein oder zwei Tagen. In meinem Stadthaus wohnt der faszinierendste Mann, den ich kenne, und ich will ihn dir unbedingt vorstellen. Mr Thomas Lawrence. Ich habe dir doch vorhin von ihm erzählt, bevor deine Mätresse meine Tür fast aus den Angeln gerissen hat. Ich habe ihn in Aleppo kennengelernt. Er ist ebenfalls Forschungsreisender. Und Archäologe. Er hat die ganze Wüste durchquert, kennt alle einflussreichen Leute dort und spricht fließend Arabisch.« Plötzlich hielt Eddie inne und senkte die Stimme. »Manche Leute behaupten, er sei ein Spion.« Das letzte Wort sagte Eddie im Flüsterton, dann sprach sie mit ihrer üblichen dröhnenden Stimme weiter. »Aber egal, was er sein mag, er ist jedenfalls absolut umwerfend.«
Eddies Bericht wurde plötzlich von einem Donnerschlag unterbrochen, dann prasselte Regen gegen die hohen Fenster, von denen eines eine kaputte Scheibe hatte.
»Oje, da kommt Wasser rein«, stellte sie fest. »Ich muss den Glaser anrufen.« Für einen Moment starrte sie in den Regen hinaus. »Ich hätte nie gedacht, dass ich das englische Wetter vermissen würde«, fügte sie wehmütig lächelnd hinzu. »Aber das war, bevor ich die arabische Wüste gesehen hatte. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Ich mag mein knarrendes altes Haus wirklich gern. Und das knarrende alte Cambridge.« Ihr Lächeln verblasste. »Obwohl ich mir wirklich wünschte, ich wäre aus anderen Gründen zurückgekehrt.«
»Es wird schon alles gut mit ihm, Eddie«, beruhigte Seamie sie.
Eddie seufzte. »Das hoffe ich. Aber ich kenne meine Schwester. Sie hätte mich nie gebeten zurückzukommen, wenn sie sich nicht schreckliche Sorgen machte.«
Seamie wusste, dass Albies Mutter, die Schwester von Eddie, dieser nach Aleppo telegrafiert und sie gebeten hatte, nach England zurückzukehren. Admiral Alden, ihr Ehemann, war an irgendwelchen Magenproblemen erkrankt. Seine Ärzte hatten noch nicht feststellen können, was ihm fehlte, aber was es auch sein mochte, es war es schlimm genug, um ihn mit schweren Schmerzen ans Bett zu fesseln.
»Der ist aus hartem Holz geschnitzt«, sagte Seamie. »Wie alle Aldens.«
Eddie nickte und versuchte ein Lächeln. »Du hast natürlich recht. Aber jetzt ist genug Trübsal geblasen. Ich muss mich ums Frühstück kümmern und den Glaser anrufen. Und den Gärtner. Und den Kaminkehrer. Albie hat in meiner Abwesenheit rein gar nichts getan. Das Haus ist staubig. Meine Post stapelt sich bis zur Decke. Und in der ganzen Küche gibt es keinen einzigen sauberen Teller. Warum lässt er nicht dieses Mädchen aus dem Dorf zum Saubermachen kommen?«
»Er sagt, sie stört ihn.«
Eddie schnaubte verächtlich. »Ich verstehe wirklich nicht, wie sie das könnte. Er verlässt sein Arbeitszimmer doch nie. Als ich vor zwei Monaten abfuhr, steckte er da drinnen. Und jetzt immer noch und schuftet härter als je zuvor, obwohl er eigentlich ein Freisemester hat. Und jetzt hat er noch zwei andere Superschlaue bei sich. Ich habe sie gerade kennengelernt. Dilly Knox heißt der eine. Und Oliver Strachey. Überall liegen Bücher, Tafeln und Schaubilder verstreut. Was, um alles in der Welt, machen die bloß da drinnen? Was kann denn so faszinierend sein?«
»Ihre Arbeit?«
»Wohl kaum. Es sind doch bloß Zahlen und Formeln«, sagte Eddie verächtlich. »Der Junge braucht eine Frau. Sogar noch dringender als du, würde ich sagen. Er ist viel zu versponnen und zerstreut. Wie kommt es bloß, dass hinter dir viel mehr Frauen her sind, als dir guttut, und hinter dem armen Albie keine einzige? Kannst du nicht ein paar von deinen Verehrerinnen an ihn abtreten? Er braucht eine gute Frau. Und Kinder. Ach, wie schön wäre es doch, wieder das Lachen von glücklichen Kindern in meinem Haus zu hören. Wie herrlich waren die Jahre, als Albie und Willa noch klein waren und meine Schwester sie herbrachte, als sie im Teich schwammen und an diesem alten Baum schaukelten – genau an dem da«, sagte Eddie und deutete auf die alte Eiche vor dem Schlafzimmerfenster. »Willa ist immer so hoch hinaufgeklettert. Meine Schwester flehte sie an runterzukommen, aber das tat sie nicht. Sie kletterte immer nur noch höher hinauf und …«
Eddie brach plötzlich ab, drehte sich um und sah Seamie an.
»Ach, du meine Güte. Ich hätte nicht von ihr sprechen dürfen. Verzeih mir bitte.«
»Ist schon gut«, erwiderte Seamie.
»Nein, ist es nicht. Ich … ich nehme nicht an, dass du in letzter Zeit einen Brief von ihr erhalten hast, oder? Ihre Mutter zumindest nicht. Jedenfalls nicht in den letzten drei Monaten. Dabei schreibt sie ihr zweimal die Woche. Um ihr Nachricht über ihren Vater zukommen zu lassen. Na ja, wahrscheinlich ist der Briefverkehr zwischen Tibet und England eine ziemlich knifflige Angelegenheit.«
»Wahrscheinlich. Und nein, ich habe nichts von ihr gehört«, sagte Seamie. »Aber das habe ich ja nie. Seit sie aus Afrika weggegangen ist. Ich weiß auch nicht mehr als du. Nur, dass sie in Nairobi fast gestorben wäre. Dass sie danach durch den Fernen Osten gereist ist. Und dass sie sich jetzt im Himalaja aufhält und nach einer Möglichkeit sucht, um die Sache zu Ende zu bringen.«
Eddie zuckte zusammen bei seinen Worten. »Du trauerst ihr immer noch nach, nicht wahr? Deshalb dein Verschleiß an Frauen. Eine nach der anderen. Weil du nach einer suchst, die Willas Platz einnehmen könnte. Aber die findest du nicht.«
Und das werde ich auch nie, dachte Seamie. Er hatte Willa, die Liebe seines Lebens, vor acht Jahren verloren und, sosehr er sich auch bemühte, nie eine Frau gefunden, die ihr hätte das Wasser reichen können. Keine andere Frau besaß Willas Lebens- und Abenteuerlust. Keine andere Frau besaß ihren Mut oder ihren leidenschaftlichen, kühnen Geist.
»Es ist alles meine Schuld«, sagte Seamie. »Sie wäre nicht dort, Tausende von Meilen von ihrer Familie, von ihrem Zuhause entfernt, wenn ich nicht schuld daran wäre. Wenn ich mich damals am Kilimandscharo richtig verhalten hätte, wäre sie jetzt hier.«
Er würde nie vergessen, was damals in Afrika geschehen war. Sie hatten gemeinsam den Kilimandscharo bestiegen, in der Hoffnung, mit der Besteigung des Mawenzi-Gipfels einen Rekord aufzustellen. Sie hatten beide unter Höhenkrankheit gelitten, Willa ganz besonders. Er wollte, dass sie umkehrte, aber sie weigerte sich. Also gingen sie weiter und erreichten den Gipfel viel später, als ratsam war. Dort auf dem Mawenzi gestand er ihr etwas, was er schon seit Jahren fühlte, aber immer für sich behalten hatte – dass er sie liebte. »Ich liebe dich auch«, erwiderte sie. »Schon immer. Und für immer.« Diese Worte hallten in ihm nach. Jeden Tag seines Lebens. In seinem Kopf und seinem Herzen.
Die Sonne stand schon hoch, als sie den Abstieg begannen, zu hoch, und ihre Strahlen brannten auf sie herab. Ein Felsblock, der vom Eis an seinem Platz gehalten wurde, löste sich in der Hitze und donnerte auf sie hinab, als sie durch eine Schlucht abstiegen. Er traf Willa, und sie stürzte ab. Nie würde Seamie den Widerhall ihrer Schreie vergessen, genauso wenig wie das verschwommene Bild ihres verdrehten Körpers, als er an ihm vorbei nach unten gerissen wurde.
Als er sie schließlich fand, sah er, dass ihr rechtes Bein gebrochen war und zersplitterte Knochen die Haut durchstoßen hatten. Er stieg zu ihrem Basislager ab, um Hilfe von den Massai-Führern zu holen, musste jedoch feststellen, dass sie von feindlichen Stammesangehörigen ermordet worden waren. Also musste er sie allein den Berg hinunter-, durch den Dschungel und die Ebene tragen. Tage später war er auf Zuggleise gestoßen, die zwischen Mombasa und Nairobi verliefen. Nachdem er einen Zug angehalten hatte, schaffte er es, Willa zu einem Arzt nach Nairobi zu bringen, doch als sie dort ankamen, war die Wunde brandig geworden. Es gebe keine Wahl, sagte der Arzt. Man müsse amputieren. Willa flehte ihn an, den Arzt davon zu überzeugen, dass sie ihr Bein behalten müsse. Sonst könne sie nicht mehr klettern. Aber Seamie hatte nicht auf ihr Flehen gehört. Er ließ den Arzt amputieren, um ihr Leben zu retten, und das hatte sie ihm nie verziehen. Sobald sie in der Lage dazu war, verließ sie das Krankenhaus. Und ihn.
Jeden Morgen wache ich verzweifelt auf und jeden Abend schlafe ich genauso verzweifelt ein, hatte sie in der Nachricht geschrieben, die sie für ihn zurückließ. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo ich hingehen, wie ich leben soll. Ich weiß nicht, wie ich die nächsten zehn Minuten überstehen soll, ganz zu schweigen vom Rest meines Lebens. Für mich gibt es keine Hügel mehr, die ich besteigen kann, keine Berge, keine Träume mehr. Es wäre besser gewesen, auf dem Kilimandscharo zu sterben, als so weiterzuleben.
Eddie griff nach seiner Hand und drückte sie. »Hör auf, dir die Schuld dafür zu geben, Seamie, du bist nicht schuld daran«, sagte sie entschieden. »Du hast alles Menschenmögliche getan und das einzig Richtige. Stell dir vor, du hättest meiner Schwester sagen müssen, du hättest nichts getan, du hättest ihr Kind sterben lassen. Ich verstehe dich, Seamie. Wir alle verstehen dich.«
Seamie lächelte traurig. »Aber das ist ja gerade das Schlimme dabei«, erwiderte er. »Alle verstehen es. Alle außer Willa.«
2
Entschuldigen Sie, Mr Bristow«, sagte Gertrude Mellors und steckte den Kopf durch die Tür ihres Vorgesetzten, »aber Mr Churchill ist am Telefon, und die Times möchte einen Kommentar zum Bericht des Handelsministers über Kinderarbeit in Ostlondon, und Mr Asquith bittet Sie, ihn heute zum Abendessen in den Reform Club zu begleiten. Punkt acht.«
Joe Bristow, Parlamentsabgeordneter für Hackney, hielt mit dem Schreiben inne. »Sagen Sie Winston, wenn er mehr Schiffe will, soll er sie selbst bezahlen. Die Leute in Ostlondon brauchen Kanalisationen und keine Schlachtschiffe. Der Times sagen Sie, dass die Londoner Kinder ihre Tage in der Schule und nicht in ausbeuterischen Betrieben verbringen sollen und dass es die moralische Pflicht des Parlaments ist, schnell und entschieden auf den Bericht zu reagieren. Und dem Premierminister richten Sie aus, er soll mir Perlhuhn bestellen. Danke, Trudy, meine Liebe.«
Er wandte sich wieder dem älteren Mann zu, der ihm gegenüber am Schreibtisch saß. Nichts, weder Zeitungen noch Einladungen, nicht einmal der Premierminister selbst, waren ihm wichtiger als seine Wähler. Denn diesen Männern und Frauen aus Ostlondon verdankte er es, dass er im Jahr 1900 Labour-Abgeordneter geworden war und dass sich daran seit vierzehn Jahren nichts geändert hatte.
»Tut mir leid, Harry. Wo waren wir stehen geblieben?«, fragte er.
»Bei der Wasserpumpe«, antwortete Harry Coyne, Bewohner von Nummer 31, Laurison Street, Hackney. »Wie ich gesagt hab, vor einem Monat etwa hat das Wasser angefangen, komisch zu schmecken. Und jetzt ist jeder in der Straße krank. Ich hab mit einem Burschen gesprochen, der unten in der Gerberei arbeitet, und der hat gesagt, sie kippen nachts hinter dem Gebäude fassweise Lauge aus. Weil sich der Meister die Kosten fürs Beseitigen der Brühe sparen will. Unter dem Gebäude verlaufen Wasserleitungen, und ich denke, die Abwässer von der Gerberei sind da reingelaufen. Muss wohl so sein. Es gibt keine andere Erklärung.«
»Haben Sie das dem Gesundheitsinspektor gesagt?«
»Dreimal. Der hat nichts getan. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Der Einzige, der je was getan kriegt, sind Sie, Mr Bristow.«
»Ich brauche Namen, Harry«, erwiderte er. »Von der Gerberei. Dem Verantwortlichen. Dem Burschen, der dort arbeitet. Von allen, die krank geworden sind. Werden die mit mir reden?«
»Bei dem Verantwortlichen aus der Gerberei weiß ich’s nicht, aber der Rest schon«, antwortete Harry. »Geben Sie mir bitte einen Stift.« Während Harry Namen und Adressen aufschrieb, schenkte Joe zwei Tassen Tee ein, schob eine zu Harry hinüber und leerte die andere in einem Zug. Seit acht Uhr morgens hatte er Wähler empfangen, ohne Mittagspause, und jetzt war es halb fünf.
»Da haben Sie’s«, sagte Harry und reichte Joe die Liste.
»Danke«, antwortete Joe und goss Tee nach. »Ich fange morgen an, von Tür zu Tür zu gehen. Dem Gesundheitsinspektor statte ich ebenfalls einen Besuch ab. Wir kriegen das geregelt, Harry, das verspreche ich. Wir werden …« Bevor er weitersprechen konnte, ging seine Bürotür abermals einen Spalt auf. »Ja, Trudy. Was ist, Trudy?«, fragte er.
Aber es war nicht Trudy, sondern eine junge Frau. Groß, mit rabenschwarzem Haar und blauen Augen – eine Schönheit. Sie trug einen elegant geschnittenen anthrazitfarbenen Mantel mit passendem Hut und hielt einen Reporterblock und einen Füller in der Hand.
»Dad! Mum ist wieder verhaftet worden!«, sagte sie atemlos.
»Verdammter Mist. Schon wieder?«, fragte Joe.
»Katie Bristow, ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass du zuerst anklopfen sollst!«, schimpfte Trudy, die ihr auf dem Fuß gefolgt war.
»Tut mir leid, Miss Mellors«, erwiderte Katie. Dann wandte sie sich wieder ihrem Vater zu. »Dad, du musst kommen. Mum war heute Morgen bei einer Demonstration von Frauenrechtlerinnen. Die sollte eigentlich friedlich verlaufen, ist dann aber in ein wüstes Gerangel ausgeartet, und die Polizei ist dazwischengegangen. Sie wurde festgenommen und angeklagt, und jetzt sitzt sie im Gefängnis!«
Joe seufzte. »Trudy, rufen Sie die Kutsche bitte. Mr Coyne, das ist meine Tochter, Katharine. Katie, das ist Mr Coyne, einer meiner Wähler.«
»Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir«, erwiderte Katie und reichte Mr Coyne die Hand. Zu ihrem Vater sagte sie: »Dad, jetzt komm schon! Wir müssen los!«
Harry Coyne erhob sich und setzte seinen Hut auf. »Gehen Sie nur. Ich find selbst raus«, sagte er.
»Morgen bin ich in der Laurison Street, Harry«, versprach Joe und wandte sich dann seiner Tochter zu. »Was ist passiert, Katie? Woher weißt du, dass sie im Gefängnis ist?«
»Mum hat einen Boten nach Hause geschickt. Ach, und Dad? Wie viel Geld hast du bei dir? Weil Mum sagt, du sollst die Kaution für sie und Tante Maud hinterlegen, damit sie entlassen werden können. Aber das kannst du im Gefängnis machen, weil sie direkt dort hingebracht wurden, nicht zum Gericht, und verdammt, ich bin völlig ausgedörrt! Trinkst du das noch?«
Joe reichte ihr seine Teetasse. »Bist du den ganzen Weg allein hergekommen?«, fragte er streng.
»Nein, Onkel Seamie ist bei mir und Mr Foster auch.«
»Onkel Seamie? Was macht der denn hier?«
»Er wohnt wieder bei uns. Nur für eine Weile, während er in London ist. Hat Mum dir das nicht gesagt?«, antwortete Katie zwischen ein paar Schlucken.
»Nein«, sagte Joe, beugte sich in seinem Rollstuhl nach vorn und spähte durch seine Bürotür hinaus. Zwischen fünf oder sechs Wählern seines Wahlkreises saß Mr Foster, sein Butler, kerzengerade aufgerichtet, mit geschlossenen Knien, die gefalteten Hände auf den Spazierstock gelegt. Als er bemerkte, dass Joe ihn ansah, nahm er den Hut ab und sagte: »Guten Tag, Sir.«
Joe beugte sich noch weiter vor und sah seine sonst so sachliche Sekretärin wie ein aufgescheuchtes Huhn um jemanden herumflattern. Ihre Wangen waren gerötet, sie zupfte an ihrem Halstuch und kicherte wie ein Schulmädchen. Dieser Jemand war sein Schwager. Seamie blickte auf und winkte ihm lächelnd zu.
»Ich wünschte, Mum hätte mich zu der Demonstration gehen lassen, wie ich es wollte. Aber sie meinte, ich dürfe mich unter keinen Umständen aus der Schule wegrühren«, sagte Katie.
»Nur allzu richtig«, antwortete Joe. »Das ist bereits die dritte Schule, in die wir dich dieses Jahr reingebracht haben. Wenn du aus der wieder rausfliegst, finden wir so leicht keine andere mehr, die dich aufnimmt.«
»Ach komm, Dad!«, sagte Katie ungeduldig, seine Warnung ignorierend.
»Wo wurden sie hingebracht?«, fragte er.
»Nach Holloway«, antwortete Katie. »Mum hat in ihrer Nachricht geschrieben, dass über einhundert Frauen festgenommen wurden. Es ist so ungerecht. Mum und Dr. Hatcher und Dr. Rosen – lauter kultivierte, gebildete und kluge Frauen. Klüger als viele Männer. Warum hört Mr Asquith nicht auf sie? Warum gesteht er ihnen das Wahlrecht nicht zu?«
»Weil er den Eindruck hat, dass dies bei den Wählern der Liberalen Partei nicht gut ankommen würde. Das sind schließlich alles Männer und die meisten von ihnen noch nicht bereit anzuerkennen, dass Frauen genauso intelligent, wenn nicht sogar intelligenter als sie selbst sind«, antwortete Joe.
»Nein, das glaube ich nicht. Das ist es nicht.«
Joe hob eine Augenbraue. »Nein?«
»Nein. Ich glaube, Mr Asquith weiß, wenn Frauen das Wahlrecht erhalten, dann werden sie es benutzen, um ihn abzuwählen.«
Joe brach in schallendes Lachen aus. Katie sah ihn wütend an. »Das ist nicht komisch, Dad. Das stimmt.«
»Das stimmt tatsächlich. Steck diese Akten in meine Tasche, und nimm sie bitte mit.«
Während Joe beobachtete, wie sie ihren Block und Füller ablegte und seine Sachen einpackte, empfand er große Liebe für sie. Er und Fiona hatten inzwischen sechs Kinder: Katie, fünfzehn; Charlie, dreizehn; Peter, elf; Rose, sechs, und die vierjährigen Zwillinge Patrick und Michael. Während er Katie jetzt ansah, die inzwischen so erwachsen wirkte und so schön war, erinnerte er sich an den Tag, als sie ihm in die Arme gelegt wurde. Von diesem Moment an, als er sie festhielt und in ihre Augen blickte, war er ein anderer Mensch geworden. Er hatte dieses kleine Wesen an sich gedrückt und gewusst, dass es für immer einen Platz in seinem Herzen haben würde.
Joe liebte alle seine Kinder und freute sich über ihre Eigenarten, Vorlieben, Ansichten und Fähigkeiten, aber Katie, seine Erstgeborene, stand ihm besonders nahe. Vom Aussehen her war sie eine jüngere Version ihrer Mutter. Sie besaß Fionas Schönheit, ihren schlanken Körperbau und ihre Anmut, aber das leidenschaftliche Interesse für Politik hatte sie von ihm. Sie war entschlossen, nach Oxford zu gehen, Geschichte zu studieren und dann in die Politik einzutreten. Sobald die Frauen volle Freiheitsrechte erlangt hätten, erklärte sie, würde sie für die Labour-Partei kandidieren und das erste weibliche Parlamentsmitglied werden. Ihr Ehrgeiz in dieser Hinsicht hatte sie bereits in Schwierigkeiten gebracht.
Vor sechs Monaten war sie aufgefordert worden, die Kensington-Schule für junge Damen zu verlassen, nachdem sie auf eigene Faust die Reinigungskräfte und den Gärtner überredet hatte, einer Labour-Gewerkschaft beizutreten. Er und Fiona hatten eine andere Schule für sie gefunden, aber nach drei Monaten wurde sie erneut aufgefordert, die Schule zu verlassen. Diesmal wegen dreimaligen unentschuldigten Fehlens beim nachmittäglichen Französisch- und Anstandsunterricht. Nach dem dritten Verstoß zitierte die Direktorin, Miss Amanda Franklin, Katie in ihr Büro. Sie wollte wissen, warum sie den Unterricht versäumt habe und was wichtiger sein könne als Französisch- und Anstandsunterricht.
Als Antwort reichte ihr Katie stolz eine Zeitung, die aus einem einzelnen, auf der Vorder- und Rückseite bedruckten Blatt bestand. Auf der Vorderseite stand in Großdruckbuchstaben das Wort SCHLACHTRUF, darunter, nur geringfügig kleiner, KATHARINE BRISTOW, CHEFREDAKTEURIN.
»Ich hätte Ihnen davon erzählen sollen, Miss Franklin. Aber ich wollte warten, bis sie fertig war, verstehen Sie«, sagte sie stolz. »Und hier ist sie, frisch aus der Druckerpresse.«
»Und was genau ist das, wenn ich fragen darf?«, wollte Miss Franklin mit hochgezogenen Augenbrauen wissen.
»Meine eigene Zeitung, Madam«, antwortete Katie. »Ich habe sie gerade erst gegründet. Den Druck der ersten Ausgabe habe ich mit meinem Taschengeld finanziert. Aber die Einnahmen aus den Anzeigen werden dazu beitragen, die nächste zu bezahlen. Sie soll eine Stimme für arbeitende Männer und Frauen werden, von ihrem Kampf um gerechte Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und größere politische Mitspracherechte berichten.«
Katies Zeitung enthielt einen Artikel über die Ablehnung des Premierministers, eine Delegation von Frauenrechtlerinnen zu empfangen, einen weiteren über die haarsträubenden Arbeitsbedingungen in einer Marmeladenfabrik von Milford und einen dritten über den immensen Zulauf bei einer Labour-Kundgebung in Limehouse.
»Wer hat diese Artikel geschrieben?«, fragte Miss Franklin mit leicht erhobener Stimme und griff sich an die Brosche an ihrem Kragen.
»Ich, Madam«, antwortete Katie strahlend.
»Sie haben mit Fabrikarbeitern gesprochen, Miss Bristow? Und mit Radikalen? Sie verfolgten Debatten im Unterhaus? Allein?«
»O nein. Ich hatte unseren Butler dabei – Mr Foster. Er begleitet mich immer. Und sehen Sie die hier?«, fragte Katie und deutete auf die Anzeigen für männliche Suspensorien und Badesalze für Frauenbeschwerden. »Die hab ich auch selbst akquiriert. Dafür musste ich eine Menge Geschäfte auf der Whitechapel High Street abklappern. Möchten Sie ein Exemplar, Miss Franklin?«, fragte Katie eifrig. »Es kostet bloß drei Pence. Oder vier Shilling für ein Jahresabonnement. Womit Sie gegenüber dem Straßenverkauf einen Shilling und zwei Pence sparen. Ich habe bereits elf Abonnements an meine Mitschülerinnen verkauft.«
Miss Franklin, unter deren Schülerinnen sich viele privilegierte und behütete Töchter der Aristokratie befanden – Mädchen, die keine Ahnung hatten, dass Männer überhaupt über Körperteile verfügten, die unterstützt werden mussten, oder Frauen an Beschwerden litten, die nur Badesalze lindern konnten –, wurde weiß wie die Wand.
Sie lehnte Katies Angebot ab und schrieb sofort einen Brief an ihre Eltern, um nachzufragen, ob die außerschulischen Aktivitäten ihrer Tochter an einem anderen Institut vielleicht besser gefördert werden könnten.
Joe nahm an, dass er zu Katie hätte strenger sein sollen, nachdem sie zum zweiten Mal rausgeflogen war – Fiona war dies jedenfalls –, hatte es aber nicht übers Herz gebracht. Er kannte nicht viele fünfzehnjährige Mädchen, die eine Arbeiterschaft organisieren konnten – wenn auch im kleinen Rahmen – oder eine eigene Zeitung publizierten. Er fand eine neue Schule für sie, wo kein Anstandsunterricht angeboten wurde und die sich mit ihren fortschrittlichen Lehrmethoden brüstete. Eine Schule, der es nichts ausmachte, wenn sie den Französischunterricht versäumte, um der Befragung des Premierministers beizuwohnen, solange sie ihre Hausaufgaben machte und bei den Prüfungen gut abschnitt.
»Hier, Dad«, sagte Katie jetzt und reichte ihm seine Aktentasche. Joe legte sie auf den Schoß und fuhr mit seinem Rollstuhl los. Katie nahm ihren Block und Füller und folgte ihm.
Joe war durch eine Kugel seit vierzehn Jahren gelähmt und konnte die Beine nicht mehr bewegen. Ein Mann aus dem East End namens Frank Betts hatte Fionas Bruder Sid – damals selbst ein Krimineller – etwas anhängen wollen. Wie Sid gekleidet, tauchte er in Joes Büro auf und gab zwei Schüsse auf ihn ab. Eine der Kugeln blieb in Joes Rückgrat stecken. Er hatte nur um ein Haar überlebt und mehrere Wochen im Koma gelegen. Als er schließlich wieder zu sich kam, machten ihm die Ärzte keine Hoffnung, in Zukunft ein normales Leben führen zu können. Sie sagten, er würde invalid und für immer ans Bett gefesselt bleiben. Gut möglich, dass er sogar beide Beine verlieren würde. Aber Joe hatte sie Lügen gestraft. Sechs Monate nach dem Überfall nahm er sein gewohntes Leben wieder auf. Er musste zwar den kurz zuvor gewonnenen Sitz für Tower Hamlets aufgeben, aber in der Zwischenzeit war der Abgeordnete für Hackney gestorben, und eine Nachwahl wurde anberaumt. Joe zog erneut in den Wahlkampf, diesmal im Rollstuhl. Er gewann den Sitz für die Labour-Partei und hatte ihn seitdem auch nicht mehr verloren.
Im Wartezimmer erklärte Joe den dort anwesenden Bittstellern, was seiner Frau passiert war. Er entschuldigte sich und bat sie, gleich am nächsten Morgen wiederzukommen. Alle waren einverstanden, bis auf eine Gruppe Kirchenvertreterinnen, die sich über die in ganz Hackney verteilten Plakate erregten, auf denen für eine anzügliche neue Musikrevue namens Prinzessin Zema und die Nubier vom Nil geworben wurde.
»Das Mädchen hat ungefähr so viel Kleider am Leib wie am Tag seiner Geburt«, sagte eine aufgebrachte Dame, eine Mrs Hughes.
»Ich muss meinen Enkelkindern die Augen zuhalten, wenn sie unsere Straße entlanggehen«, rief Mrs Archer. »Wir haben den deutschen Kaiser, der Krawall schlägt, und Mrs Pankhurst und ihre Bande wirft Fensterscheiben ein. Unsere jungen Mädchen rauchen und fahren im Automobil, und um allem die Krone aufzusetzen, haben wir jetzt auch noch nackte Ägypterinnen in Hackney! Ich frage Sie, Mr Bristow, wo soll das alles noch hinführen?«
»Ich weiß es nicht, Mrs Archer, aber ich versichere Ihnen, mich persönlich dafür einzusetzen, dass diese Plakate bis Ende der Woche entfernt worden sind«, antwortete Joe.
Nachdem er die Frauen besänftigt und sie sein Büro verlassen hatten, nahmen Joe, Katie, Seamie und Mr Foster den Fahrstuhl nach unten, wo Joes Kutsche wartete. Eine weitere Droschke, mit der Katie und ihre Begleiter hergekommen waren, wartete dahinter.
»Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast, mein Schatz«, sagte er und drückte ihre Hand. »Ich sehe dich dann zu Hause.«
»Aber ich fahre nicht nach Hause, ich komme mit«, erwiderte Katie.
»Katie, Holloway ist ein Gefängnis. Keine Labour-Kundgebung oder Marmeladenfabrik. Es ist ein schrecklicher Ort und für ein fünfzehnjähriges Mädchen nicht geeignet«, sagte Joe entschieden. »Deine Mutter und ich werden bald nach Hause kommen.«
»Nein! Ich gehe nicht nach Hause! Du behandelst mich wie ein Kind, Dad!«, erwiderte Katie aufgebracht. »Die Wahlrechtsbewegung beeinflusst auch meine Zukunft. Es ist Politik. Es geht um Frauenrechte. Hier wird Geschichte geschrieben. Und da soll ich nicht dabei sein dürfen? Ich möchte über die Demonstration, die Verhaftungen und über Holloway selbst in meiner Zeitung berichten, und deinetwegen soll mir das entgehen!«
Joe wollte Katie schon einfach nach Hause beordern, als Mr Foster sich räusperte. »Sir, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben dürfte«, begann er.
»Als wenn ich Sie davon abhalten könnte, Mr Foster«, entgegnete Joe.
»Miss Katharine bringt ein sehr überzeugendes Argument vor. Es geht um eine Qualifikation, die ihr meiner Ansicht nach eines Tages im Parlament sehr wohl von Nutzen sein könnte. Es wäre doch ein bemerkenswerter Pluspunkt für die erste weibliche Abgeordnete, wenn sie von sich behaupten könnte, an vorderster Front für das weibliche Stimmrecht gekämpft zu haben.«
»Ihn hast du schon um den Finger gewickelt, nicht wahr?«, stellte Joe an seine Tochter gewandt fest.
Katie erwiderte nichts, sondern sah ihren Vater nur hoffnungsvoll an.
»Also gut, dann komm mit«, lenkte Joe schließlich ein.
Sie klatschte in die Hände und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
»Wollen mal sehen, ob du in Holloway immer noch so fröhlich bist. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte.«
»Brauchst du Hilfe, Joe?«, fragte Seamie. »Ich komme mir hier ein bisschen nutzlos vor.«
»Durchaus«, antwortete Joe. »Und auch noch etwas Geld, denn es sieht ja ganz danach aus, als müsste ich das halbe Gefängnis befreien. Hast du was bei dir?«
Seamie sah in seine Brieftasche und reichte Joe zwanzig Pfund. Joe bat Mr Foster, die zweite Kutsche nach Hause zu bringen.
»Sicher, Sir«, antwortete Mr Foster. »Und ich sorge dafür, dass das Dienstmädchen eine Kanne Tee bereithält.«
»Gut«, sagte Joe.
Er, Seamie und Katie stiegen in seine Kutsche, ein Fahrzeug, das eigens zum Transport seines Rollstuhls angefertigt worden war, und fuhren dann nach Westen in Richtung Gefängnis los. Kurz darauf erreichten sie London Fields, den Park, wo die Demonstration geendet hatte. Während sie bis dahin in ein Gespräch vertieft gewesen waren, verstummten sie mit einem Mal, als die Droschke an dem Park vorbeirollte.
»Du meine Güte!«, stieß Joe aus, als er aus dem Fenster sah.
Wohin man auch blickte, überall Zerstörung. Die Fenster eines Pubs und mehrerer Häuser waren eingeschlagen. Die Karren von Gemüsehändlern umgeworfen. Überall lagen Äpfel, Kartoffeln und Kohlköpfe herum. Zerfetzte Fahnen hingen schlaff an Laternenpfählen. Zertrampelte Plakate lagen auf dem Boden. Anwohner, Straßenhändler und der Wirt des Pubs taten ihr Bestes, um wieder Ordnung zu schaffen und die Glasscherben und den Müll wegzukehren.
»Dad, ich mache mir Sorgen um Mum«, sagte Katie leise.
»Ich auch«, gestand Joe ein.
»Was ist hier passiert?«, fragte Seamie.
Joe hörte einen Anflug von Angst in seiner Stimme. »Ich bin mir nicht sicher«, erwiderte er, »aber ich glaube, nichts Gutes.«
Als die Kutsche weiterfuhr, sah Joe, dass der Wirt einen Kübel Wasser über die Pflastersteine vor seinem Pub schüttete. Er wusch etwas Rotes damit fort.
»War das …«, begann Seamie.
»Pst«, stieß Joe schnell hervor. Er wollte nicht, dass seine Tochter das hörte, aber es war zu spät.
»Blut«, sagte sie.
»Blut?«, fragte Seamie schockiert. »Wessen Blut?«
»Das der Demonstranten«, antwortete Joe ruhig.
»Warte mal … du willst mir sagen, dass Frauen – Frauen – auf den Straßen von London zusammengeschlagen wurden? Weil sie demonstriert haben? Weil sie um das Wahlrecht gebeten haben?« Seamie schüttelte ungläubig den Kopf und fügte dann hinzu: »Wann hat das angefangen?«
»Du warst eine ganze Weile fort und bist über Eisberge geklettert, Kumpel«, erwiderte Joe ironisch. »Und dann warst du auf deinen Vortragsreisen. Wenn du in London geblieben wärst, dann wüsstest du, dass hier niemand mehr um etwas bittet. Die Benachteiligten – seien es die Armen von Whitechapel, die nationalen Gewerkschaften oder die Frauenrechtlerinnen des Landes –, sie alle fordern jetzt Reformen. Die Dinge haben sich geändert im guten alten England.«
»Das würde ich auch sagen. Warum gibt es keine friedlichen Demonstrationen mehr?«
Joe lächelte bitter. »Die gehören der Vergangenheit an. Der Kampf ums Wahlrecht ist gewalttätig geworden. Jetzt gibt es zwei Fraktionen, die darum kämpfen. Die National Union of Women’s Suffrage Societies unter Leitung von Millicent Fawcett, der auch Fiona angehört und die verfassungskonform vorgeht, um ihre Ziele zu erreichen. Und dann gibt es die Women’s Social und Political Union unter Leitung von Emmeline Pankhurst, die die Verschleppungstaktik von Asquith satthat und militant geworden ist. Christabel, Emmelines Tochter, ist eine Aufwieglerin. Sie hat sich an Tore gekettet. Pflastersteine in Fenster geworfen. Den Premier öffentlich angegriffen. Sachen angezündet. Die Aktivitäten der Pankhursts dagegen finden großes Echo in der Presse. Unglücklicherweise bringen sie jedoch die Pankhursts – aber auch jeden, der sich in ihrer Nähe aufhält – in den Knast.«
Joe blickte Katie an, während er redete, und sah, dass sie kreidebleich geworden war. »Es ist noch nicht zu spät, Schatz. Ich kann dich immer noch zuerst nach Hause bringen.«
»Ich habe keine Angst, Dad. Und ich will nicht nach Hause«, erwiderte Katie ruhig. »Das ist auch mein Kampf. Für wen macht Mum das denn? Für dich? Für Charlie und Peter? Nein. Für mich und Rose, für uns tut sie es. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, sie abzuholen. Und in meiner Zeitung darüber zu berichten, was ich sehe.«
Joe nickte. Tapferes Mädchen, ganz wie ihre Mutter, dachte er. Tapferkeit war ein nobler Zug, schützte aber nicht vor Pferden und Schlagstöcken. Er hatte Angst um seine Frau und machte sich Sorgen, dass sie womöglich verletzt worden war.
»Ich schätze, die alte Dame hatte recht«, sagte Seamie.
»Welche alte Dame?«, fragte Joe.
»Die in deinem Büro. Die sich über die Musikrevue beschwert hat. Als sie meinte, wo das alles noch hinführen soll. Ich hielt sie nur für eine dieser andauernden Nörglerinnen, die sich jetzt eben über nackte Ägypterinnen aufregt. Doch nun frage ich mich, ob sie vielleicht nicht doch recht hatte. England, London … das sind nicht mehr die Orte, die ich 1912 verlassen habe. Ich höre mich jetzt zwar selbst wie eine alte Dame an, aber ehrlich, Joe – Frauen zusammenschlagen? Wie weit ist es denn mit der Welt gekommen?«
Joe sah seinen Schwager an, der immer noch völlig fassungslos wirkte. Er dachte an seine Frau und ihre Freundinnen in den feuchten Zellen von Holloway. Er dachte an die Streiks und Arbeiterdemonstrationen, die in London inzwischen schon fast zum Alltag gehörten. Er dachte an die jüngsten Drohungen aus Deutschland und an Winston Churchills Anruf, der höchstwahrscheinlich Unterstützung für die Finanzierung weiterer Kriegsschiffe zusammentrommeln wollte. Und stellte fest, dass er keine Antwort auf Seamies Frage hatte.
3
Seamie Finnegan dachte, er wüsste Bescheid über Gefängnisse. Vor Jahren hatte er in Nairobi selbst einmal ein paar Tage in einem verbracht. Sein Bruder Sid hatte dort für ein Verbrechen eingesessen, das er nicht begangen hatte. Seamie und Maggie Carr, eine Kaffeeplantagenbesitzerin und Sids Chefin, hatten einen Plan ausgeheckt, um Sid zu befreien, bei dem Seamie und Sid die Rollen tauschen mussten. Es war nicht schwierig gewesen. Es gab nur eine Wache, und das Gebäude selbst war, wie Mrs Carr es ausdrückte, »nicht mehr als ein baufälliger Hühnerstall«.
Jetzt jedoch, als er auf die hoch aufragende Vorderfront blickte, stellte er fest, dass er nichts über Gefängnisse wusste, denn etwas wie Holloway hatte er noch nie gesehen.
Es wirkte wie eine dunkle, mittelalterliche Festung mit Eisentor und Zinnen. Zwei Greifvögel flankierten die Toreinfahrt, und dahinter sah man die Zellenblöcke – lange, rechteckige Bauten mit endlosen Reihen kleiner Fensterschlitze.
Bei dem Anblick stockte ihm der Atem. Sein Entdeckerherz sehnte sich nach den freien, grenzenlosen Gebieten dieser Erde, nach den schneebedeckten Weiten der Antarktis und den hohen Gipfeln des Kilimandscharo. Allein der Gedanke, hinter den hässlichen Steinwällen von Holloway eingesperrt zu sein, war beängstigend.
»Onkel Seamie, hier entlang. Komm mit«, sagte Katie und zog ihn an der Hand.
Joe war bereits mit seinem Rollstuhl durch die Einfahrt und schon halb in Richtung des Zentralgebäudes gefahren, auf dem AUFNAHME stand. Seamie und Katie eilten ihm nach.
Im Innern des Empfangsbereichs herrschte Chaos. Während Joe bei einem uniformierten Schalterbeamten die Kautionssumme für Fiona und ihre Freundin Maud Selwyn-Jones abzählte und Katie eine Frau interviewte, die ein blutiges Taschentuch an den Kopf drückte, griffen andere Frauen – viele in zerrissenen, blutbeschmierten Kleidern, einige mit Schnittwunden und voller blauer Flecken – wutentbrannt Aufseherinnen und Wärter an. Familienmitglieder und Freunde, die sie abholen wollten, baten sie inständig, mit ihnen das Gefängnis zu verlassen, aber vergeblich.
»Wo ist Mrs Fawcett?«, rief eine von ihnen. »Wir gehen nicht, bevor sie nicht freigelassen wird!«
»Wo sind Mrs Bristow und Dr. Hatcher?«, schrie eine andere. »Was macht ihr mit ihnen? Lasst sie frei!«
Die Rufe wurden immer lauter. Dutzende von Stimmen vereinigten sich zu einer. »Lasst sie frei! Lasst sie frei! Lasst sie frei!«
Der Lärm war ohrenbetäubend. Darüber hinweg schrie eine Aufseherin, dass alle gehen müssten, und zwar auf der Stelle, wurde aber sofort niedergebrüllt. Seamie sah einen alten Mann in schwarzem Anzug, der mit besorgtem Gesichtsausdruck von Wache zu Wache ging.
Joe sah ihn auch. »Reverend Wilcott?«, rief er. »Sind Sie das?«
Der Mann drehte sich um. Er trug eine Brille, war glatt rasiert und schien um die fünfzig zu sein. Sein Haar war bereits ergraut, sein Gesichtsausdruck freundlich und leicht verwirrt.
Er sah ihn an, hob die Brille und sagte: »Ah! Mr Bristow. Das wir uns ausgerechnet hier wiedertreffen.«
»Ja, eine schlimme Geschichte, Reverend. Ist Jennie denn auch verhaftet worden?«
»Ja. Ich bin hergekommen, um sie abzuholen, aber sie scheint nicht hier zu sein. Ich mache mir große Sorgen. Der Wärter hat viele Frauen an ihre Angehörigen übergeben, aber nicht Jennie. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Gerade habe ich Mr von Brandt gesehen, der nach Harriet sucht. Ah! Da ist er ja.«
Ein großer, gut gekleideter Mann mit silberblondem Haar gesellte sich zu ihnen. Man stellte sich vor, und Seamie erfuhr, dass Max von Brandt, ein Deutscher aus Berlin, der im Moment in London lebte, Dr. Harriet Hatchers Cousin war, den Harriets Mutter losgeschickt hatte, um sie abzuholen.
»Haben Sie sie gefunden?«, fragte Joe.
»Nein, aber ich habe kurz den Wärter gesprochen, und er sagte mir, dass Harriet und verschiedene Führungsleute der National Union of Suffrage Societes anderswo im Gefängnis festgehalten würden.«
»Aber warum?«, fragte Joe.
»Er behauptete, zu ihrer eigenen Sicherheit. Er sagte, er habe die Führungsleute aus Mrs Fawcetts Gruppe von denen aus Mrs Pankhursts Gruppe trennen müssen. Offensichtlich hat es harsche Auseinandersetzungen zwischen ihnen gegeben, und er befürchtete weitere Feindseligkeiten. Er meinte, sie würden in Kürze freigelassen, aber das war schon vor einer Stunde, und sie sind immer noch nicht aufgetaucht.«
Frustriert rollte Joe zu einer der Aufseherinnen hinüber, um mehr herauszufinden. Max begleitete ihn. Katie führte ihre Interviews fort und machte sich Notizen. Seamie und der Reverend versuchten, höflich Konversation zu machen. Seamie erfuhr, dass der Reverend einer Gemeinde in Wapping vorstand, dass seine Tochter Jennie bei ihm im Pfarrhaus lebte und eine kirchliche Schule für arme Kinder leitete.
»Es ist gleichzeitig auch eine Suppenküche«, erklärte der Reverend. »Wie Jennie immer sagt: ›Hungrige Kinder können nicht lernen, und Kinder, die nicht lernen, werden immer hungrig sein.‹«
Währenddessen wurde am Ende des Empfangsraums eine Tür geöffnet, und eine Gruppe wie betäubt wirkender, erschöpfter Frauen wankte herein. Seamie erkannte seine Schwester sofort, aber seine Erleichterung verwandelte sich bei ihrem Anblick sofort in Bestürzung. Fionas Gesicht war voller blauer Flecken. An ihrer Stirn befand sich eine Schnittwunde, Blut klebte in ihrem Haar, und ihre Jacke war zerrissen.
Als die Frauen in den Empfangsbereich kamen, brach Jubel unter ihren wartenden Mitdemonstrantinnen aus. Es gab Umarmungen, Tränen und Versprechen, wieder zu demonstrieren. Joe und Katie eilten auf Fiona zu. Seamie folgte ihnen durch den Trubel. Die meisten Gesichter der Frauen sagten ihm nichts, aber ein paar erkannte er.
»Gott, ich brauche eine Zigarette«, sagte eine von ihnen laut. Es war Fionas Freundin Harriet Hatcher. »Eine Zigarette und ein großes Glas Gin«, fügte sie hinzu. »Max, bist du das? Gott sei Dank! Gib mir eine Zigarette, ja?«
»Hatch, gib mir bitte auch eine.« Seamie kannte auch diese Stimme. Sie gehörte Maud Selwyn-Jones, der Schwester von India Selwyn-Jones, die mit Fionas Bruder Sid verheiratet war.
»Alles in Ordnung, Fee?«, fragte Seamie seine Schwester, als er schließlich bei ihr war. Joe und Katie standen bereits an ihrer Seite und kümmerten sich um sie.
»Seamie? Was machst du denn hier?«, fragte Fiona.
»Ich war zu Hause, als deine Nachricht eintraf, und habe Katie begleitet.«
»Tut mir leid, mein Lieber.«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich bin froh, dass ich hergekommen bin. Ich hatte ja keine Ahnung, Fiona. Ich … nun, ich bin froh, dass es dir gut geht.«
Er war fassungslos, sie so zugerichtet zu sehen. Fiona hatte ihn großgezogen. Sie hatten ihre Eltern verloren, als Fiona siebzehn und er vier war, und sie war nicht nur seine Schwester, sondern auch wie eine Mutter für ihn gewesen. Sie war einer der liebevollsten, loyalsten und selbstlosesten Menschen, die er kannte, und die Vorstellung, dass jemand ihr wehgetan hatte … Er wünschte sich bloß, dieser Jemand wäre jetzt hier …
»Was ist denn bloß passiert?«, fragte Joe.
»Emmeline und Christabel, das ist passiert«, antwortete Fiona sarkastisch. »Unsere Gruppe hat friedlich demonstriert. Es waren Massen von Leuten und Polizisten versammelt, aber es gab kaum Störaktionen oder Hetztiraden. Dann tauchten die Pankhursts auf. Christabel hat einen Polizisten angespuckt. Dann hat sie einen Stein in ein Pubfenster geschmissen. Von da an lief alles aus dem Ruder. Es gab ein Riesengeschrei. Raufereien brachen aus. Die Frau des Wirts war wütend. Sie verprügelte Christabel und ging auch auf andere Demonstrantinnen los. Die Polizei begann mit Festnahmen. Diejenigen von uns, die friedlich demonstriert hatten, wehrten sich und haben teuer dafür bezahlt, wie du siehst.«
»Der Wärter sagte uns, man habe euch zu eurer eigenen Sicherheit im Keller festgehalten«, berichtete Joe. »Weil es hier im Gefängnis zwischen den beiden Fraktionen zu Reibereien gekommen sei.«
Fiona lachte bitter. »Das hat er dir gesagt?«
»Stimmt das nicht, Mum?«, fragte Katie.
»Nein, Schatz. Der Wärter hat uns im Keller eingesperrt, aber nicht zu unserer Sicherheit. Es gab keine Reibereien zwischen uns. Der Wärter wollte uns damit Angst einjagen, was ihm auch gelungen ist. Aber nicht so sehr, dass wir aufgeben werden. Das wird ihm nie gelingen.«
»Was meinst du mit ›Angst einjagen‹?«, fragte Seamie.
»Er hat uns in eine Zelle gesperrt neben der Zelle einer anderen Frauenrechtlerin, die sich im Hungerstreik befindet und zwangsernährt wird. Das machte er absichtlich. Damit wir sie hören konnten. Es war schrecklich. Wir mussten mitanhören, wie das arme Ding geschrien, sich gewehrt und sich dann heftig erbrochen hat. Daraufhin haben sie die ganze Prozedur wiederholt. Immer wieder. Bis sie das Essen bei sich behielt. Sie haben auch dafür gesorgt, dass wir sie sahen. Danach. Sie wurde direkt an unserer Zelle vorbeigeführt. Sie konnte kaum gehen. Ihr Gesicht war blutverschmiert …«
Fiona hielt inne, von ihren Gefühlen überwältigt. Als sie wieder sprechen konnte, sagte sie: »Wir waren alle ziemlich mit den Nerven fertig und eingeschüchtert, jede von uns. Außer Jennie Wilcott. Sie war einfach klasse! Als die Frau an uns vorbeigeführt wurde, fing sie zu singen an. Abide with Me, und die Frau, die vorher starr zu Boden sah, blickte auf. Und lächelte. Trotz Blut und Tränen lächelte sie. Und dann fingen wir alle zu singen an. Ich glaube, das ganze Gefängnis hat uns gehört und neuen Mut gefasst. Das war allein Jennies Verdienst.«
»Fiona, was genau ist …«, setzte Seamie an, als plötzlich eine junge Frau stolperte und gegen ihn stieß. Sie war klein und blond, etwa fünfundzwanzig, schätzte er, und hatte ein furchtbar zugeschwollenes Auge
»Entschuldigen Sie! Tut mir furchtbar leid«, sagte sie verlegen. »Es ist wegen des Auges. Ich kann nicht richtig sehen.« Sie hielt sich an Reverend Wilcotts Arm fest.
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen«, erwiderte Seamie. »Ganz und gar nicht.«
»Mr Finnegan, das ist meine Tochter Jennie Wilcott«, stellte der Reverend sie vor. »Jennie, das ist Seamus Finnegan, Fionas Bruder und ein sehr berühmter Forscher. Er hat den Südpol entdeckt.«
»Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Miss Wilcott«, sagte Seamie.
»Ganz meinerseits, Mr Finnegan. Wie um alles in der Welt hat es Sie vom Südpol nach Holloway verschlagen? Ihnen muss ja ein großes Unglück widerfahren sein.«
Bevor Seamie antworten konnte, zog ihn Katie am Arm. »Onkel Seamie, wir gehen jetzt. Kommst du?«
Seamie bejahte, dann drehte er sich wieder zu den Wilcotts um. »Bitte, nehmen Sie doch meinen Arm, Miss Wilcott. Wenn Sie auf beiden Seiten jemanden zur Stütze haben, ist es leichter für Sie. Bestimmt. Ich bin einmal schneeblind gewesen. Bei meiner ersten Antarktisreise. Und musste wie ein Lamm herumgeführt werden.«
Jennie nahm Seamies Arm. Gemeinsam verließen sie den Empfangsbereich und durchquerten den langen, düsteren Durchgang, der auf die Straße führte.
»Fiona hat uns gerade von Ihrer Tortur erzählt«, sagte Seamie währenddessen. »Sie müssen die Jennie sein, die Abide with Me gesungen hat?«
»Hast du das, Jennie?«, fragte der Reverend. »Du hast mir zwar von der Zwangsernährung erzählt, aber das nicht. Ich bin froh, dass du gerade das gesungen hast. Es ist ein schönes, altes Kirchenlied. Es muss der armen Frau etwas Trost gespendet haben.«
»Ich habe eigentlich mehr aus Trotz angefangen zu singen als mit der Absicht zu trösten, Dad«, erwiderte Jennie. »Ich habe für die Frau gesungen, ja. Aber auch für ihre Peiniger. Ich wollte sie wissen lassen, dass sie uns nicht brechen können, was immer sie auch tun.«
»Was ist Zwangsernährung?«, fragte Seamie. »Und warum machen die Wärterinnen das mit einer Gefangenen?«
»Lesen Sie keine Londoner Zeitungen, Mr Finnegan?«, fragte Jennie ein wenig entrüstet.
»Doch, Miss Wilcott, aber die sind in New York, Boston oder Chicago schwer zu kriegen. Vom Südpol ganz zu schweigen. Ich bin erst vor einem Monat zurückgekommen.«
»Entschuldigen Sie bitte, Mr Finnegan. Zum zweiten Mal. Es war doch ein sehr anstrengender Tag«, entgegnete Jennie.
»Noch einmal, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Wilcott.« Er sah sie an. Ihr Auge sah schrecklich aus und tat vermutlich sehr weh.
»Es ist eine Mitstreiterin von uns, die zwangsernährt wird«, sagte Jennie langsam. »Sie wurde verhaftet, weil sie die Kutsche von Mr Asquith beschädigt hat. Sie ist jetzt seit einem Monat im Gefängnis und dabei, sich zu Tode zu hungern.«
»Aber warum macht sie das?«
»Um gegen ihre Einkerkerung zu protestieren. Und um die Aufmerksamkeit auf die Sache des Frauenwahlrechts zu lenken. Eine junge Frau, die sich im Gefängnis zu Tode hungert, gibt eine gute Story ab und erregt eine Menge Sympathie in der Öffentlichkeit – was Mr Asquith und seiner Regierung sehr unangenehm sein dürfte.«
»Aber man kann doch niemanden zwingen, etwas zu essen, wenn er nicht will.«
Jennie wandte sich zu ihm um und musterte ihn mit ihrem gesunden Auge. »Doch, das kann man. Es ist eine scheußliche Prozedur, Mr Finnegan. Sind Sie sich sicher, dass Sie das so genau wissen wollen?«
Die Frage ärgerte Seamie. Hielt sie ihn für so einen Schwächling? Er war in Afrika zurechtgekommen. Und in der Antarktis. Er hatte Skorbut, Schneeblindheit und Erfrierungen überstanden. Dann würde er doch allemal auch damit fertig werden. »Ja, Miss Wilcott, ich bin mir sicher«, antwortete er etwas verstimmt.
»Gut, eine weibliche Gefangene im Hungerstreik wird erst bewegungsunfähig gemacht«, begann Jennie. »Sie wird in ein Laken gewickelt, damit sie nicht um sich schlagen kann. Natürlich will sie weder mit den Wärterinnen noch mit dem Gefängnisarzt kooperieren, also presst sie die Lippen zusammen. Deshalb schiebt man ihr ein Metallteil dazwischen, um den Mund zu öffnen und sie auf diese Weise füttern zu können. Oder man schiebt ihr einen Gummischlauch durch die Nase in die Speiseröhre. Ich muss wohl nicht sagen, dass dies sehr schmerzhaft ist. Der Arzt gießt Nahrung durch den Schlauch, gewöhnlich Milch mit Haferschleim. Wenn die Frau ruhig bleibt, kann sie während der Prozedur atmen. Wenn nicht … nun, dann gibt es Schwierigkeiten. Wenn die abgemessene Menge Milch verabreicht ist, wird der Schlauch entfernt, und man lässt von der Frau ab. Wenn sie sich erbricht, beginnt der Arzt von Neuem.«
Seamies Magen drehte sich um. »Sie hatten recht, Miss Wilcott, das ist tatsächlich eine scheußliche Sache.« Sie wusste eine Menge über diese Prozedur. Als er ahnte, warum, erschauerte er. »Sie kennen die Prozedur aus eigener Erfahrung, nicht wahr?«, fragte er. Doch sobald er die Worte ausgesprochen hatte, tat es ihm leid. Derlei fragte man eine Dame nicht, die man gerade kennengelernt hatte.
»Ja, stimmt. Zweimal«, antwortete Jennie ungerührt. Ihre Offenheit überraschte ihn.
»Vielleicht sollten wir uns einem angenehmeren Thema zuwenden, meine Liebe«, warf der Reverend sanft ein. »Seht nur! Da wären wir. Heraus aus der Löwengrube wieder im Licht. Genau wie Daniel.«