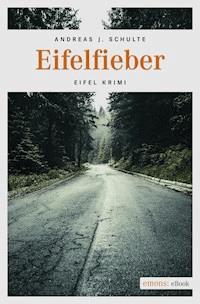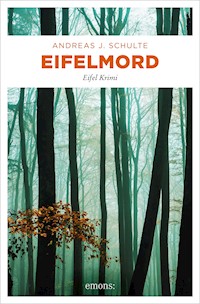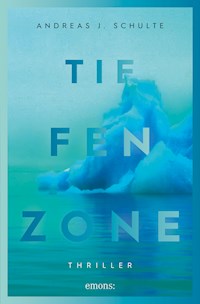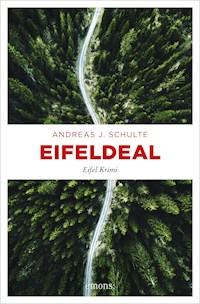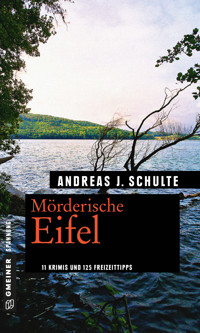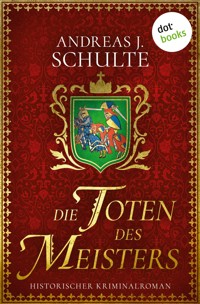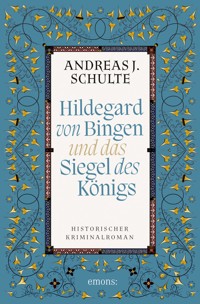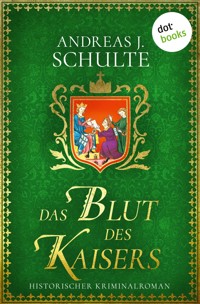
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Konrad von Hohenstade
- Sprache: Deutsch
Wenn die Sicherheit trügt … Winter 1477/78: Habsburg und Frankreich kämpfen um die Vorherrschaft in Europa. Maria von Burgund, die letzte Erbin eines einst glorreichen Herzogtums, gerät zwischen die Fronten dieses heimtückischen Krieges. Hochschwanger und vom Schicksal ihrer Dynastie gezeichnet, muss sich die junge Prinzessin gegen Spionage, Bestechung und Verrat zur Wehr setzen. Im fernen Andernach, unter dem persönlichen Schutz von Ritter Konrad von Hohenstade, wähnt ihr Gatte sie in Sicherheit. Doch der Feind ist Konrad und seinem Schützling längst dicht auf den Fersen und auch vor Mord schreckt er nicht zurück. Wird es Konrad gelingen, das »Blut des Kaisers« zu schützen? »Spannung, Dramatik, Atmosphäre, Historie und tolle Figuren.« Jörg Kijanski, Histo-Couch.de Das fesselnde Finale der perfekt recherchierten und abenteuerlichen Mittelalter-Krimireihe für Fans von Daniel Wolf und Oliver Pötzsch. Alle Bände der Reihe: Band 1: Die Toten des Meisters Band 2: Die Rache des Schnitters Band 3: Das Blut des Kaisers
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
eBook-Neuausgabe Januar 2026
Die Originalausgabe erschien erstmals 2016 bei Ammianus GbR Aachen.
Copyright © der Originalausgabe 2016 Ammianus GbR Aachen
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/dershana; shutterstock/WinWin artlab, PARINYAS; iStock/Matorini und eine Illustration aus dem Codex Maness
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fe)
ISBN 978-3-69076-563-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andreas J. Schulte
Das Blut des Kaisers
Historischer Kriminalroman │ Ein Fall für Konrad von Hohenstade 3
Für Anja, Holger, Kai, Matthias und natürlich meine geliebte Tine. In Erinnerung an einen dänischen Sommer. Ich schreib’ dann mal schön
Prolog
Herbst 1477
»Wenn nur Frieden wäre und ich unseren Herrn und Vater für zwei Wochen bei uns hätte, wäre ich im Paradies. Ihr selber müsstet es mit eigenen Augen sehen. Es ist die Pracht, die mich staunen lässt. Stunden gönnte ich vor den Teppichen verweilen, die den Glanz und Ruhm, aber auch den Untergang Trojas zeigen. Das Schicksal unseres Urahnen, König Priamos, rührt mich. Und doch wandert mein Auge weiter zu den Gemälden, die ein Meister Van Eyck geschaffen hat, hin zu den königlichen Wappenschilden, die mein Herz erfreuen. Vieles ist hier, werter Vater, doch so ganz anders als das Gewohnte. Lasst mich Euch nur eine Begebenheit aufführen: Bei unserem letzten Bankett reichten wir jedem Gast einen goldenen Zahnstocher, besetzt mit Diamanten, verziert mit einer edlen Perle. Wie staunte ich, als ich erfuhr, dass der Herzog solcherlei beinah täglich geschehen ließ.
Aus seinem Besitz stammen an die viertausend Jagdhunde und rund dreitausend abgerichtete Fallen, die für allerlei Jagdvergnügen des Hofes zur Verfügung stehen. Welcher Edelmann mag so viel Besitz benötigen? Nun, meine Frau, Eure Schwiegertochter, ist eine ausgezeichnete Jägerin mit Fallen und Hunden. In ihrem Besitz ist ein weißer Windhund, der sehr schnell ist. Das edle Tier schläft jede Nacht vor unserem Bett.
Ach, werter Vater, es fehlen die Worte, um all das zu beschreiben, was mir hier in den letzten Wochen und Monaten widerfahren ist.
Schon rufen die Kriegsglocken, wollen die neuen Söldner gelehrt und geführt werden. Wie gern würde ich stattdessen nur ins Turnier reiten, mich im Lanzenstechen messen. Aber hier, hier ist es nicht der ritterliche Kampf um Ehre, hier ist es der Tod, der seine Ernte hält. Ich will es Euch ehrlich sagen: Es gibt keinen größeren Schurken auf der ganzen Welt als den Franzosenkönig ...«
»Was bildet sich dieser Knabe ein? Wer ist er, dass er es wagt, Unsere Ansprüche mit Füßen zu treten?« Ludwig, König von Frankreich, ließ den Brief sinken und schaute seinen engen Vertrauten Philippe de Commynes an. Der aber wusste, wann er zu schweigen hatte, und neigte nur stumm den Kopf.
»Redet, wenn Ihr gefragt werdet«, fuhr ihn Ludwig an.
»Es ist, wie Ihr sagt, Majestät. Ein Knabe, der geblendet von der Pracht Burgunds nicht weiß, wo ihm der Kopf steht. Und, wenn ich das hinzufügen darf, eine leichte Beute.«
»Ach, und warum gehört Uns dann nur das Herzogtum von Bourgogne? Warum halten Wir lediglich die Provinzen Picardie und Artois? Leichte Beute? Betrogen wurde ich, ich persönlich, Ludwig, König von Gottes Gnaden über Frankreich«, brüllte der König und sein schmales Gesicht verzerrte sich zu einer wütenden Fratze. Speicheltropfen trafen de Commynes im Gesicht, doch er wagte es nicht, sich auch nur einen Fingerbreit zu rühren, oder gar Widerwillen in seiner Miene zu zeigen.
»Eure Allerchristlichste Majestät wird einen Plan haben, dessen bin ich mir sicher.«
»Speichellecker! Allesamt! Holt mir den Boten dieses Briefes«, schrie Ludwig und seine Stimme überschlug sich vor Wut.
Nur wenige Augenblicke später betraten zwei Palastwachen das Gemach des Königs. Sie eskortierten einen Mann in den Raum, der dem König mit hocherhobenem Kopf gegenübertrat.
»Wie heißt Ihr?« Ludwig von Frankreich musterte das regungslose Gesicht, suchte aber vergeblich nach einem Anzeichen von Furcht.
»Ich bin Georg Graf von Markenburg, Vertrauter Maximilians, dem Sohn des Kaisers und dem neuen Gebieter über Burgund.«
Ludwig zuckte bei dem letzten Satz zusammen und Philippe de Commynes erwartete einen weiteren Wutausbruch seines Herrn, doch der blieb aus.
»So, und Ihr werdet am Hofe Friedrichs erwartet?«
»Selbstverständlich!«
»Nun, dann wisst Ihr auch, was in diesem Schreiben steht?« Ludwig hielt das Pergament hoch.
»Natürlich nicht.«
»›Es gibt keinen größeren Schurken auf der ganzen Welt als den Franzosenkönig‹«, zitierte Ludwig laut, doch wenn er geglaubt hatte, dass Johann von Markenburg eine Regung zeigte, wurde er enttäuscht.
»Wie ich Euch schon sagte, ich kenne nicht den Inhalt des Schreibens, das mein Herr aufgesetzt hat. Meine Aufgabe ist erfüllt, wenn ich es meinem Kaiser übergeben habe.«
Ludwig ging nicht darauf ein und las ungerührt weiter: »›Aber hier, hier ist es nicht der ritterliche Kampf um Ehre, hier ist es der Tod, der seine Ernte hält‹«, er schaute hoch, »amüsanter Gedanke, nicht wahr?«
Ludwig nickte den Wachen zu und wedelte dabei mit der Hand, als wolle er eine lästige Fliege vertreiben. »Schafft ihn hinaus.«
Die Wachen ergriffen Georg von Markenburgs Arme.
»Nein, halt, wartet!« Ludwig trat näher an den Boten Habsburgs heran. Der Ritter war einen guten Kopf größer als der schmächtig gewachsene König. »Wartet, ich mache es lieber selbst.«
Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte Ludwig einen kleinen, aber scharfen Schmuckdolch gezogen. Ein silbernes Funkeln, eine verschwommene Handbewegung und plötzlich schoss Blut aus der durchgeschnittenen Kehle des Ritters. Der Graf von Markenburg knickte röchelnd zusammen. Ein Blutschwall ergoss sich auf Hemd und Wams, färbte alles in wenigen Augenblicken rot.
»Haltet ihn, ich will zusehen, wie das Schwein ausblutet«, befahl Ludwig den Wachen, die den vor Schmerzen zuckenden Körper des Ritters mit eiserner Gewalt aufrecht hielten.
Lächelnd und mit schräg geneigtem Kopf wartete Ludwig das Ende des Todeskampfes ab.
Ungerührt wischte er seinen Dolch am Wams des Toten ab, bevor er ihn in die Scheide zurücksteckte.
»Hier ist es nicht der ritterliche Kampf um Ehre, hier ist es der Tod, der seine Ernte hält. Diesen Satz will ich mir merken. De Commynes – das Spiel hat begonnen.«
Teil I
Kapitel 1: Zwei Tagesritte östlich von Speyer
November 1477
»Dreck, Pest und Ziegenarsch, hab ich Hunger. Ah, ein Königreich für ein warmes Feuer, einen großen Teller Fleisch, einen Becher Wein oder einen großen Krug Würzbier.«
»Du denkst nur an deinen Bauch, Heinrich. Ich wäre schon froh, wenn ich endlich diesen störrischen Gaul loswürde. Meine Fresse, ich spüre jeden einzelnen Knochen im Leib.«
»Josef Schmittges, denkst du, wir könnten dich und unseren lästerlich fluchenden Pastor da vorne nicht ganz genau hören? Ihr sitzt da hoch zu Ross und jammert uns schon seit der letzten Rast die Ohren voll. Nehmt euch ein Beispiel an Thomas, der Junge sitzt wie ihr seit Tagesanbruch auf seinem Pferd, aber hört man ihn jammern oder klagen? Nein, natürlich nicht. Bassenheimer Söldner, Verteidiger von Konstantinopel – dass ich nicht lache. Habt ihr beiden Jammerlappen denn keine Ehre im Leib? Ach, schämt euch.«
Ein Glück, dass ich etwas abseits ritt und weder Hildegard Schmittges noch Jupp oder Heinrich mein breites Grinsen sehen konnten. Pastor Heinrich, oberster Hirte in Andernach und ehemaliger Söldner im Morgenland, konnte mit seinen Flüchen jedem Fuhrmann die Schamröte ins Gesicht treiben. Er wusste, dass Hildegard diese Angewohnheit missbilligte, aber das hinderte ihn nicht daran, seit der Mittagsrast vor sich hinzugrummeln. Und jetzt forderten ein hungriger Magen und eine trockene Kehle ihren Tribut. Mein Freund, der Stadtknecht Jupp Schmittges, schlug sich mehr und mehr auf Heinrichs Seite, zumindest, was das Rumjammern betraf.
Allerdings hatte Jupp ein großes Problem und das saß auf dem Bock des Fuhrwerks: Hildegard, sein Weib. Sie wusste genau, wie sie mit ihrem Gatten umzugehen hatte.
Wahrscheinlich machte sie sich erst Sorgen, wenn Heinrich nicht mehr fluchte und Jupp anfing, sein Pferd zu loben.
Ich schaute mich um, suchte nach Vertrautem in der Umgebung, nach bekannten Wegmarken. Wir ritten auf einem alten Handelsweg ostwärts. Diesen Weg gab es schon seit ewigen Zeiten und doch bestand er aus nicht mehr als zwei ausgefahrenen, von Schlaglöchern übersäten Fahrrinnen. Mein alter Hauslehrer Pater Anselm hatte mir, als ich noch ein Junge war, mit leuchtenden Augen von den früheren römischen Heerstraßen vorgeschwärmt, von den geschotterten Straßen hin zur Stadt am Tiber, auf denen ein Streitwagen mühelos entlangrollen konnte. Beim Anblick der tiefen Furchen auf diesem Handelsweg hätte jeder römische Senator geweint. Unser Glück, dass es nicht regnete oder schneite, sonst hätte sich unser Fuhrwerk noch durch tiefen Schlamm kämpfen müssen. Die letzten Stunden waren wir durch dichten Wald gefahren, doch jetzt lichteten sich die Bäume, gaben den Blick in ein Tal frei. Ich atmete innerlich auf Weit war es nicht mehr, wir hatten bald unser Tagesziel erreicht.
»Seht ihr da vorne das Tal und den Fluss? Hinter der Baumgruppe am Fluss liegt der Mühlenhof, wo wir heute Nacht schlafen werden«, erklärte ich laut und erntete von Hildegard und Johanna ein dankbares Lächeln und von weiter vorne ein zustimmendes Brummen. Die Aussicht auf eine ordentliche Mahlzeit und ein bequemes Nachtlager verlieh uns allen neue Kraft. Die letzten zwei Tage im Sattel waren auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Mein Rücken war steif, die seit Monaten verheilten Verletzungen schmerzten und ich war durchgefroren.
Vor zwei Tagen war unsere kleine Reisegesellschaft in Speyer aufgebrochen, morgen gegen Mittag würden wir, wenn nichts dazwischenkam, die Burg meines Vaters erreichen. Die Domstadt Speyer war natürlich nicht der Beginn unserer Reise gewesen. Die erste Etappe von Andernach nach Speyer hatten wir bequem auf einem Frachtschiff zurückgelegt. Bequem, aber unendlich eintönig, so dass ich insgeheim froh gewesen war, als der Dom von Speyer endlich in Sicht gekommen war und wir die letzte Etappe mit Pferden und Fuhrwerk in Angriff nehmen konnten.
Ich lächelte zum Fuhrwerk herüber. Johanna, die neben Hildegard saß, sah mein Lächeln und zwinkerte mir vergnügt zu. Sie war der Grund, warum wir so weit von Andernach entfernt waren. Johanna Merle würde mein Weib werden. Ich beobachtete sie, wie sie in einen schweren Wollumhang gehüllt geduldig das Rumpeln der Räder ertrug. Eine Zeitlang war sie neben dem Fuhrwerk hergelaufen, doch jetzt leistete sie Hildegard Gesellschaft, die mit eiserner Hand die beiden Zugpferde lenkte. Die Anstrengungen unserer Reise schienen Johanna nichts auszumachen. Sie sah wunderschön aus. Die langen Haare, deren Farbe mich an reifen Weizen erinnerte, waren unter einer weißen Haube verborgen. Weil es in den letzten Stunden kälter geworden war, hatte Johanna nun auch die Kapuze ihres Umhangs darüber gezogen. Immer wenn sich unsere Blicke trafen, glitt ein zärtliches Lächeln über ihr Gesicht, strahlten ihre blauen Augen wie zwei tiefe Seen im Sonnenlicht.
Wir mussten uns beeilen, wenn wir vor Einbruch der Dunkelheit noch zum Mühlenhof kommen wollten.
»Hoh, ich glaube, ich sehe bereits Rauch dort drüben« Heinrich richtete sich im Sattel auf. Mit einem Grinsen wandte er sich an Thomas: »Na, Junge, Lust auf einen kleinen Wettstreit? Wer als Letzter auf dem Hof ist, muss die Pferde der anderen versorgen.«
»Gemacht, Pastor Heinrich!«
Und mit der Begeisterung eines Dreizehnjährigen stieß Thomas seinem Tier die Fersen in die Seite, so dass es einen Satz nach vorne machte und losgaloppierte.
»Hoho, Dreck und Teufelsfratz, ganz schön forsch, das Bürschchen.« Und schon schoss auch unser Pastor davon.
»He, ich reite auch mit«, brüllte Jupp und gab seinem Tier die Zügel frei, »ich werde euch zeigen, wie man richtig reitet.«
Hildegard schaute zu mir herüber: »Mein Gatte, unser Pastor und ein Dreizehnjähriger, hat man schon einmal solche Kindsköpfe gesehen? Männer, egal wie alt, sie sind doch alle gleich. Kannst du alle in einen Sack stecken und mit ’nem Eichenknüppel draufschlagen, triffst du immer den Richtigen. Anwesende ausgenommen, mein lieber Konrad.«
»Gönn ihnen die Freude, Hildegard«, erwiderte ich. »Lass sie voranreiten, ich bleibe hier bei euch. Wir werden ja erfahren, wer am Ende die Pferde versorgt, statt gemütlich im Schankraum zu sitzen.«
Ich muss fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, als ich meinen Vater zum ersten Mal während der Pfingsttage nach Speyer begleiten durfte. Damals war mir die Reise unendlich lang vorgekommen und ich erinnere mich genau daran, wie verwundert ich darüber gewesen war, dass mein Vater von allen, die wir trafen, mit großem Respekt und Ehrerbietung behandelt worden war. Auf unserer Burg war er der Hausherr, das hatte ich nie in Frage gestellt, aber unterwegs und in Speyer? Glanz und Respekt waren damals auch auf mich, den jüngsten Sohn des Herzogs, übertragen worden, eine Rolle, die zu übernehmen ich nicht gewohnt gewesen war. Es gab auf dieser Reise aber noch ein zweites Erlebnis, an das ich mich nun lebhaft erinnerte und das war der Abend im Mühlenhof. Ich durfte im Schankraum bei den Männern sitzen. Lauschte gebannt ihren Geschichten, und als mir vor Müdigkeit die Augen zufielen, erlaubte mir mein Vater, im Stroh des Pferdestalls zu schlafen. Diese eine Nacht und der sonnige Morgen danach, der Geruch des frischen Heus, die Wärme des Stalls, all das habe ich nie vergessen.
Es waren diese Erinnerungen, die mir durch den Kopf gingen, als ich auf dem gepflasterten Vorplatz des Mühlenhofes mein Pferd zügelte und abstieg. Das Haupthaus war frisch gekalkt, die Balken schwarz gestrichen, das Strohdach sah ordentlich und dicht aus. Der Brunnen im Hof, die Mühle mit ihrem Wasserrad, all das kannte ich noch von den vielen Besuchen hier. Der Pferdestall, der sich an die Mühle anschloss, war neu und größer als der alte, in dem ich als Kind geschlafen hatte. Ausdruck von Wohlstand, den sich Meister Jakobus, der Mühlenwirt, und seine Familie hart erarbeitet hatten.
»Ja, ist es die Möglichkeit. Darf ich meinen Augen trauen? Jesus, Maria und Josef, seid Ihr es wirklich? Konrad, Konrad von Hohenstade?«
Die Stimme ließ mich herumfahren. Kein Zweifel, das war Meister Jakobus, ganz wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ein Kugelbauch und zwei mächtige Oberarme, die einen schweren Mehlsack herumwuchten konnten, als hätte er kein Gewicht.
»Guten Abend, Meister Jakobus, sagt, hättet Ihr Herberge für ein paar müde und hungrige Gäste?«
»Hätte ich Herberge? Ja, das will ich meinen und wenn ich selber die Nacht im Freien verbringen müsste, um Euch diesen Wunsch zu erfüllen. Lasst Euch die Hand reichen und ansehen.«
Meister Jakobus lächelte von einem Ohr zum anderen. Als er nähertrat, sah ich, dass die Jahre auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen waren. Er hinkte, die wenigen Haare, die unter seiner einfachen Fellkappe herausschauten, waren schneeweiß und die Falten hatten sich tief in sein Gesicht gegraben. Aber die Herzlichkeit in seinen Augen war immer noch da.
Augenblicke später ergriff Meister Jakobus meine Hand und schüttelte sie. »Verzeiht, Herr, dass ich Euch so überfalle, aber es hat uns allen damals das Herz gebrochen, als wir die Kunde von Eurem Tod erhielten. Dass es nur ein Irrtum war, dafür danke ich dem Allmächtigen.« Meister Jakobus wischte sich über die Augen, die mit einem Mal feucht glänzten. Aber bevor ich noch etwas erwidern konnte, redete er schon weiter.
»So, und nun müsst Ihr mir die beiden Schönheiten vorstellen, die in Eurer Begleitung sind. Edeldamen haben wir selten zu Gast.«
»Schönheiten, Edeldamen? Hast du das gehört, Johanna? Ein Schönredner und Schmeichler, unser Herr Wirt«, Hildegard rückte ihre Haube zurecht, »aber immerhin weiß er, was wir Frauen gern hören.«
Ich grinste. »Also, Meister Jakobus, darf ich Euch vorstellen? Die ehrenwerte Hildegard Schmittges, Gattin von Josef Schmittges, seines Zeichens Stadtknecht in Andernach, und ein treuer Freund und Waffengefährte. Neben Frau Schmittges sitzt Johanna Merle, meine Verlobte.«
»Eure Verlobte? Grundgütiger, warum habt Ihr uns denn nicht vorab eine Botschaft geschickt, dann hätten wir ein Festessen für Euch vorbereitet« Meister Jakobus rang mit ehrlicher Verzweiflung die Hände, dann aber nahm er die Kappe ab und verbeugte sich formvollendet. »Nun, wir werden es Euch so bequem wie möglich machen. Willkommen auf dem Mühlenhof.«
Aus dem Pferdestall hinter dem Mühlenwirt drangen plötzlich laute Stimmen. Meister Jakobus schaute über die Schulter. »Na, das erklärt auch die beiden Herren und den Jungen in meinem Stall. Zwei Kerle groß und breit wie Eichen, die so tun, als würden sie sich gleich an die Gurgel gehen.«
»Und dabei sind sie wie Brüder. Glaubt mir ...« Der Rest meines Satzes ging in lautem Gebrüll unter.
»Sack und Asche, natürlich war ich vor dir auf dem Hof.«
»Ja, am Arsch hängt der Morgenstern, was bildest du dir ein? Ich war natürlich vor dir da. Bitte den heiligen Antonius, Schutzpatron der Pferde, um Beistand, damit dir der Rest deines kläglichen Verstandes erhalten bleibt, wenn du schon jetzt Trugbilder siehst. Nein, vergiss Antonius. Ruf gleich Albinus an, denn du bist ja mit Blindheit geschlagen.«
»Trugbilder? Blindheit? Dass ich nicht lache. Dein Gaul war doch kurz vor dem Zusammenbrechen. Was ja auch kein Wunder ist, bei der Last, die das erbarmungswürdige Tier den ganzen Tag schleppen musste.«
»Soll das etwa heißen, ich sei schwer? Das sind Muskeln, mein Lieber, stark wie Eisenketten. Wenn du es drauf anlegen willst, kannst du sie jederzeit zu schmecken bekommen. Wie sagte schon der große Cicero: Non opus est verbis, sed fustibus!«
»Was immer das heißen mag, es wird dir nichts Gutes einbringen, darauf kannst du wetten.«
Hildegard schaute mich fragend an.
»Hier sind nicht Worte, sondern Prügel am Platz«, übersetzte ich ihr und erntete dafür nur ein empörtes Schnauben, während Johanna anfing zu kichern.
Der Mühlenwirt verdrehte die Augen: »Brüder sagt Ihr, Ritter Konrad? Dass die beiden mir nur nicht in unserem neuen Stall eine Prügelei anfangen. Was soll ich nur machen?«
»Natürlich nichts, Herr Wirt«, mischte sich da Hildegard ein, »das haben wir gleich.«
»Josef Maria Schmittges, willst du uns bis auf die Knochen beschämen? Ihr zwei Trottel kommt jetzt aus dem Stall, aber auf der Stelle. Ja, du auch, Heinrich Balthasar Erzer, Pastor hin oder her.« Die beiden Stimmen im Stall verstummten schlagartig.
Meister Jakobus warf mit mir einen ungläubigen Blick zu und formte lautlos die Frage »Pastor?« Ich nickte.
»Ich werde mal in der Küche Bescheid sagen« Jakobus’ Schultern bebten vor unterdrücktem Lachen, als er zum Haus ging.
Johanna stieg vom Fuhrwerk und hakte sich bei mir ein. »Ein netter Mann, dieser Wirt.«
»Ja, das ist er.«
Johanna drückte meinen Arm. »Würde Ritter Konrad dafür sorgen, dass sich sein künftiges Weib etwas frisch machen kann, bevor sie an einem warmen Kaminfeuer ihren Hunger stillen wird?«
»Es ist mir ein Vergnügen«, erwiderte ich, »und danach kümmere ich mich darum, die beiden Kontrahenten im Pferderennen zu beruhigen.«
Kapitel 2: Im Mühlenhof
»Ich sage dir, Konrad, die beiden sind wirklich Kopf an Kopf auf den Hof geritten. Ich schwöre es, so wahr ich hier sitze.« Thomas hatte in den letzten Monaten eine Menge erlebt und Gefahren überstanden, die einen erwachsenen Mann das Fürchten gelehrt hätten. Es gab keinen Grund, ihm nicht zu glauben.
»Du musst gar nichts schwören, Thomas. Natürlich glaube ich dir. Es war ein langer Tag, Jupp und Heinrich brauchten die Abwechslung. Sie wissen beide selber genau, wie das Rennen ausgegangen ist, sonst hätten sie wohl nicht so bereitwillig gemeinsam die Versorgung der Pferde übernommen.«
»Oder sie haben Angst vor Tante Hildegard.« Thomas grinste breit.
»Na, werde mal nicht frech, mein Junge.« Johanna setzte sich lächelnd zu uns an den Tisch im Schankraum. Sie hatte offenbar die letzten Sätze des Gesprächs mit angehört.
»Hildegard kommt auch jeden Moment. Die Zimmer oben sind großartig. Der Strohsack ist mit frischen Laken bezogen, in jedem Zimmer brennt eine Kohlenpfanne, so dass wir nicht frieren werden und an Stelle von muffigen Binsen liegen auf dem Boden dicke Wollteppiche. Glaubt mir, diese Nacht werden wir es viel bequemer haben als in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, ob ich mich schon auf die Heimreise freuen soll, zumal der Winter immer näher rückt, da werden die Nächte am Flussufer sicher kalt und ungemütlich.«
»Aber dann hast du einen Ehemann an deiner Seite.«
»Konrad, also wirklich.« Johanna bekam tatsächlich kleine rote Flecken am Hals vor lauter Verlegenheit. Wenn ich ehrlich zu mir selber war, konnte ich es auch kaum glauben – es würden nur noch wenige Tage vergehen und diese wunderbare Frau würde mich heiraten.
»Ach, wenn ich euch beide so sehe, entführt mich das in die Jahre, als mein Jupp um mich geworben hat.« Hildegard kam an unseren Tisch, setzte sich auf die Bank und wärmte sich die ausgestreckten Hände am Kaminfeuer.
»Ah, das tut gut«, seufzte sie zufrieden, »diese beiden Gäule sind zwei störrische Biester, da kann man nicht die Hände in den Schoß legen, meine Finger sind ganz steif.«
»Ruh dich aus, Hildegard. Morgen werde ich das Fuhrwerk lenken«, bot Johanna an.
»Das entscheiden wir morgen früh, meine Liebe. Jetzt wollen wir den Abend und die Gastfreundschaft von Meister Jakobus genießen«, erwiderte Hildegard und schaute sich um. »Wo steckt denn Jupp überhaupt? Sind die beiden Streithähne immer noch im Stall zugange?«
In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen und Jupp betrat, dicht gefolgt von Heinrich, den Schankraum. Ein kalter Windstoß begleitete die beiden. Zum Glück beeilten sie sich, die Tür wieder hinter sich zu schließen.
»Hoh, Meister Wirt, was könnt Ihr zwei hungrigen und durstigen Männern von Ehre anbieten?« Heinrichs laute Stimme dröhnte durch den Schankraum. Da standen meine beiden Freunde einträchtig nebeneinander, als könnten sie kein Wässerchen trüben und als ob es nie Streit zwischen ihnen gegeben hätte. Wie sehr sie sich doch ähnelten, die beiden. Nicht nur in ihrer Statur, sondern im Grunde auch in ihrem ganzen Wesen, dachte ich. Wie zwei Brüder, die sich ab und zu in die Haare kriegten, aber dabei nie vergaßen, was sie an dem jeweils anderen hatten. Als junge Burschen hatten Jupp und Heinrich zusammen in Bassenheim als Söldner gedient. Genauso sahen sie jetzt wieder aus, zwei Söldner, die sich, zufrieden mit ihrem Tag, auf eine Mahlzeit und einen Krug Bier freuten. Sie hatten wohl nicht nur die Tiere versorgt, sondern sich auch im Pferdestall schon gewaschen, denn sowohl in Jupps als auch in Heinrichs Haar glänzten noch Wassertropfen.
Meister Jakobus steckte den Kopf aus der Küchentür und rief: »Gebt mir noch einen Augenblick und Ihr werdet es nicht bereuen. Hannes, biete den werten Herren Bier und Wein an. Nun mach schon, Junge, oder muss ich dir etwa Beine machen?« In einer Ecke des Schankraums sprang ein Knabe hoch, kaum älter als Thomas, der eilig hinter der Theke Stellung bezog und mit der heiseren Stimme eines Heranwachsenden fragte: »Nun, was darf es sein, werte Herren?«
»Vinum bonum deorum donum. Ein guter Wein ist ein Geschenk der Götter«, verkündete Heinrich, »also sag: Hast du einen kräftigen Roten im Fass?«
Hannes, der junge Schankknecht, nickte eingeschüchtert.
»Großartig. Worauf wartest du dann noch? Bring uns einen großen Krug und fünf Becher.«
»Sechs Becher«, verbesserte ihn Thomas.
»Junge, was fällt dir ein?«, wies ihn seine Mutter zurecht. Doch ich zwinkerte Thomas nur kurz zu und flüsterte Johanna ins Ohr. »Er ist dreizehn, ein Alter, in dem andere schon auf dem Schlachtfeld stehen, da wird ihn ein kleiner Schluck Rotwein nicht umbringen. Außerdem gibt es Städte, in denen es gesünder ist Wein zu trinken als Wasser. Du hast in Andernach nur Glück.« Ich sah, wie Johanna mit sich kämpfte, aber schließlich nickte sie. »Aber du wirst den Wein mit Wasser verdünnen«, ermahnte sie ihren Sohn.
»Aquam foras, vinum intro!«, erklärte Thomas ernst.
»Sack und Asche – ja hör ich recht? Der Junge spricht Latein«, staunte Jupp und erntete damit direkt von Hildegard einen Ellenbogenstoß in die Rippen.
»Wundert dich das? Bei mir lernt er eben nicht nur Fechten, sondern auch Lesen und Schreiben. Wie sonst soll er Talhoffers Ausführungen über den Schwertkampf verstehen? Gut, ein paar lateinische Sätze habe ich ihm auch beigebracht«, erklärte Heinrich stolz.
»Aber ausgerechnet Petronius’ Ausspruch ›Raus mit dem Wasser, rein mit dem Wein‹? Hattest du da nichts Besseres?«, fragte ich lachend.
»Also, wenn das keine wichtige Lebensweisheit ist, was dann?«, verteidigte sich Heinrich. Johanna hatte dazu sicher ihre eigene Meinung, aber die behielt sie wohlweislich für sich. Sie kannte unseren Pastor lange genug, um ihm so etwas nicht übel zu nehmen. Außerdem hatte Heinrichs Unterricht dafür gesorgt, dass Thomas sich nicht mehr den ganzen Tag bei den Rheinschiffern am Hafen herumtrieb, Botengänge für Gastwirte unternahm und dabei mit Kupplern und Dirnen zusammenkam. Mein Freund Heinrich musste sich schon mehr leisten als nur ein paar unpassende lateinische Zitate, um sich Johannas Dankbarkeit zu verspielen.
»So, wo die Reisegesellschaft jetzt vollständig ist, erlaubt mir, dass ich das Essen auftrage.« Unser Wirt stellte einen großen gusseisernen Topf auf den Tisch und Hannes brachte getöpferte Teller aus der Küche, sogar an Löffel hatte er gedacht, obwohl jeder von uns seinen Löffel und ein Tischmesser bei sich trug.
»Dreck, Teufel und Satansarsch – ich will verdammt sein, wenn ich in diesem himmlischen Duft nicht Hechtklößchen herausrieche.«
»Du wirst verdammt sein, wenn du bei jeder sich bietenden Gelegenheit lästerliche Flüche ausstößt«, murmelte Hildegard. Vielleicht hatte Heinrich sie ja nicht gehört oder er wollte sie nicht hören. Laut fragte er: »Sagt, Herr Wirt, was habt Ihr uns da Herrliches an den Tisch gebracht?«
»Ein Rezept meiner Gattin«, erklärte Meister Jakobus, »eine Gemüsesuppe mit Hechtklößchen. Danach kann ich Euch noch frisches Weizenbrot, geräucherte Wurst, kalten Braten mit Zwiebelsauce und Sauerampfer-Mus und zum Abschluss warmen Haferbrei mit Rosinen und Honig anbieten.«
»Meister Jakobus, das ist ja ein Festmahl«, freute sich Johanna.
»Es ist mir und meiner Familie eine Ehre, werte Frau Merle, Euch und Ritter Konrad bewirten zu dürfen.« Meister Jakobus verbeugte sich und zog sich dann zurück.
Als er uns nicht mehr hören konnte, sagte ich leise: »Mein Großvater hat den Mühlenhof abgegeben und Vater hat von Meister Jakobus nie ein Lehen eingefordert, sondern darauf bestanden, für alle Mühlendienste zu zahlen.«
»Sei es drum, ich glaube, er hat dich einfach in sein Herz geschlossen«, erklärte Johanna bestimmt, und damit war für sie alles erklärt.
Und vielleicht hatte sie damit nicht einmal unrecht.
Als Hildegard die Suppe auf die Teller verteilt hatte, sprach Heinrich ein kurzes Tischgebet und segnete das Essen.
Als mir der Duft der Gemüsesuppe in die Nase stieg, spürte ich erst, wie hungrig ich tatsächlich war.
Die Köchin des Mühlenhofes konnte sich jedenfalls nicht beschweren, dass wir schlechte Esser seien – so viel stand fest, denn wir ließen nicht den kleinsten Bissen übrig.
***
Es fehlten nur noch ein, zwei Stunden bis Mitternacht. Johanna, Thomas und Hildegard hatten sich längst zurückgezogen. Hannes, der Schankknecht, lag weiter hinten im Raum und schlief, zusammengerollt wie ein junger Hund, auf einer Holzbank. Das Kaminfeuer brannte noch und spendete genug Licht, so dass wir die Wachslichter auf dem Tisch gelöscht hatten. Heinrich, Jupp und ich saßen einfach nur da, starrten in die Flammen und freuten uns über die stumme Gesellschaft der anderen.
Aus der Küche kam Meister Jakobus und wischte sich die Hände an seiner Schürze ab. »Wenn ich Euch noch etwas zu trinken bringen soll, dann sagt es nur. Wir sind wohl die Letzten, die noch auf den Beinen sind.«
»Meister Jakobus, das war das beste Essen, das ich seit langem auf dem Teller hatte.« Heinrich lehnte sich zurück, rülpste leise und strich sich zufrieden über den Bauch.
»Ich freue mich, dass es Euch gemundet hat«, erwiderte der Wirt. Zögernd kam er zu uns. »Darf ich Euch etwas fragen, Herr Heinrich?«
»Natürlich! Nur zu, wer ein solches Festmahl auf den Tisch bringen kann, dem erlaube ich jede Frage.«
Der Wirt zog sich einen Hocker heran. »Verratet mir eines, Ihr seid doch nicht wirklich Pastor, oder?«
Heinrich, in einem dunkelblauen Hemd mit gebauschten Ärmeln, Lederwams, Waffengürtel und Stulpenstiefeln, wirkte tatsächlich alles andere als priesterlich, da konnte man die Neugierde des Wirtes durchaus verstehen.
»Beim Schwanz des gehörnten Satans, und ob ich das bin. Der Herr hat mich zwar auf verschlungenen Pfaden zu sich berufen, aber ich bin, so wahr ich hier vor Euch sitze, Vizepfarrer der Liebfrauenkirche zu Andernach, deren erster Pfarrer seine Exzellenz der Erzbischof zu Trier ist.«
Meister Jakobus schüttelte betrübt den Kopf. »Wie schade, Euer Geständnis kostet mich einen Gulden. Denn ich war ungläubig und habe nun meine Wette mit meinem Weib verloren.«
Heinrichs dröhnendes Lachen erfüllte den ganzen Schankraum und nur Augenblicke später stimmten Meister Jakobus, Jupp und ich in dieses ansteckende Lachen mit ein.
Später, als sich auch unser Wirt zurückgezogen hatte, saß ich auf der Bank, lehnte mich gegen ein Schaffell, den Bauch gefüllt und mit mir und der Welt zufrieden. Ich hatte an diesem Abend mehr Wein getrunken, als ich vorgehabt hatte zu trinken, aber auch das kümmerte mich nicht. Es hatte Zeiten gegeben, in denen ich bewusst keinen Wein oder Stärkeres angerührt hatte. Nur, weil ich zuvor versucht hatte, meine Trauer über den Verlust meiner Frau und meiner Tochter zu ertränken. Aber die beiden Männer hier bei mir am Feuer hatten mir neuen Halt gegeben. Ich stand in ihrer Schuld und wusste gleichzeitig, dass sie diese Schuld nie einfordern würden. Und mit diesem Gedanken im Kopf verteilte ich den letzten Wein auf unsere Becher. Die beiden sahen mich erstaunt an, dann aber lasen sie wohl etwas in meiner Miene, was sie verstanden, denn sie lächelten nur stumm und prosteten mir zu.
Kapitel 3: Aufbruch
Am nächsten Morgen lag Raureif auf den Wiesen rund um den Mühlenhof. Ich war froh über die Fellweste und den dicken Wollumhang. Mit klammen Fingern sattelte ich mein Pferd, band die Taschen fest und führte es auf den Hof Thomas hatte bereits die beiden Zugpferde vor das Fuhrwerk gespannt. Sowohl die Reittiere als auch die Zugpferde hatten wir in Speyer gekauft. Wir würden alles bei unserer Heimreise dort auch wieder verkaufen. Obwohl also Thomas die Tiere erst seit zwei Tagen kannte und er in Andernach kaum Gelegenheit bekam, mit Pferden umzugehen, gehorchten sie ihm bereitwillig. Der Junge hatte ein Händchen für Tiere, das würde ich mir merken.
»Meine Fresse, ist das kalt heute früh«, Jupp trat aus dem Haus und schaute prüfend zum Himmel. »Die silbergrauen Wolken da hinten gefallen mir nicht. Sieht nach Schnee aus. Ein Glück, dass wir heute noch die Burg Hohenstade erreichen werden. Bei diesem Wetter eine Nacht im Freien, unter unseren Zeltplanen, wäre weiß Gott alles andere als gemütlich.«
»Mach dir keine Sorgen, Jupp. Auch, wenn wir mit dem Fuhrwerk nicht so schnell vorankommen, werden wir doch spätestens zur Sext die Burg meines Vaters erreicht haben.«
Jupp nickte zufrieden. »Ich werd mal drinnen fragen, ob man uns zwei, drei Felle borgen kann, die wir bei unserer Rückkehr wieder mitbringen. Hildegard und Johanna werden sie gebrauchen können, um sich auf dem Fuhrwerk warmzuhalten.«
»Das ist eine gute Idee«, stimmte ich zu, »ich sattele unterdessen die übrigen Pferde. Komm, Thomas, du kannst mir dabei helfen.«
Auf dem Weg zum Stall streckte ich meinen Rücken und rieb mir verstohlen mit der Hand die rechte Schulter.
»Es ist die Schwertwunde, die dich schmerzt, nicht wahr?«, fragte Thomas, der mich genau beobachtet hatte.
»Ja, Junge, Erasmus von Reiendahl, der elendige Verräter, konnte mich zwar im Zweikampf nicht besiegen, aber ich spüre seinen Stich bei jedem Wetterwechsel und heute früh besonders heftig. Wir sollten uns wirklich beeilen, das Ziel unserer Reise endlich zu erreichen.«
»Herr, auf ein Wort!«
Meister Jakobus kam über den Hof auf uns zu.
»Natürlich, Meister Jakobus, habe ich noch etwas vergessen zu bezahlen?«
»Oh, nein, Ritter Konrad, Ihr wart mehr als großzügig. Es ist nur ... Nun ja, ich weiß nicht, ob ich es vor dem jungen Herrn erzählen soll?«
»Da könnt Ihr unbesorgt sein. Thomas hat schon mehr erlebt, als Ihr ahnt. Also sprecht offen, worum geht es?«
»Nun, gut. Es geht um Euren Reiseweg. Es gibt da Gerüchte, ich will Euch warnen.«
»Warnen? Wovor?«
»Sicher wollt Ihr durchs Braunbachtal.«
»Das hatte ich tatsächlich vor, der Weg ist zwar eng, aber für ein Fuhrwerk passierbar und wir sparen Zeit ein.«
»Ich bitte Euch, nehmt die etwas längere Strecke entlang des Eichenwalds und dann den Höhenweg.«
»Aber warum sollten wir das tun?«
»Es liegt ein Fluch über dem Braunbachtal«, Meister Jakobus bekreuzigte sich, »der Leibhaftige geht dort um. Seit einem guten halben Jahr verschwinden Reisende und Händler spurlos. Kein Reittier, keine Ladung, nicht einmal der Fetzen eines Kleidungsstücks sind je gefunden worden. Und Sebastian, der Sohn des alten Hallbachs, schwört Stein und Bein, dass ihm im Tal, an der engsten Stelle bei den hohen Felsen, der Leibhaftige gegenübergetreten ist. Rotglühend waren seine Augen, nach Tod und Schwefel hat sein Atem gerochen. Genau so hat es Sebastian beschrieben. Seit diesem Tag haben die Menschen hier im Tal dem Ort einen neuen Namen gegebenen: Teufelsschlucht.«
»Aber Meister Jakobus, Ihr glaubt doch nicht an solche Ammenmärchen?«
»Das sind keine Ammenmärchen. Und ob ich daran glaube? Ja, ich glaube daran, denn zu viele Seelen sind in den letzten Wochen spurlos verschwunden. Denkt an meine Worte, Konrad von Hohenstade, ich wollte Euch nur gewarnt haben. Seid wachsam, schon um der Frauen willen, die Euch begleiten. Und wählt den längeren, aber sicheren Weg.«
Er meinte es wirklich ernst mit seiner Warnung. Und weil ich ihn nicht vor den Kopf stoßen wollte, nickte ich zustimmend. Offenbar hatte unser Wirt nichts anderes erwartet, seine zerknirschte Miene glättete sich, er verbeugte sich ein zweites Mal und verschwand in Richtung Mühle. Thomas schaute mich fragend an: »Meinst du, da ist was Wahres dran?« Auch wenn er sich bemühte, war ein leises Zittern in seiner Stimme nicht zu überhören.
Ich legte ihm den Arm um die Schulter. »Der Leibhaftige soll ausgerechnet im einsamen Braunbachtal erscheinen? Das letzte Mal, dass mir jemand erzählt hat, der Teufel sei aufgetaucht, stellte sich anschließend heraus, dass Henne das Frettchen seine Hand im Spiel hatte. Erinnerst du dich? Er hatte den Mönchen im Andernacher Minoriten-Kloster einen bösen Streich gespielt, um sie zu bestehlen. Es gibt sicher Dinge, die ich nicht erklären kann, aber es fällt mir schwer, zu glauben, dass das Böse wie ein gemeiner Strauchdieb Händlern und Reisenden auflauert. Außerdem, Thomas, möchte ich jedem Dämon davon abraten, sich zwischen Pastor Heinrich und sein Mittagsmahl auf der Burg meines Vaters zu stellen. Ein solches Zusammentreffen kann selbst für den Herrn der Unterwelt nur böse ausgehen.«
Kapitel 4: Gerobart
Gerobart hatte als junger Kerl seinen ersten Mann erschlagen. Sein Opfer war ein alter Mann gewesen, betrunken und wehrlos. Der Alte hatte noch versucht, um Hilfe zu brüllen. Den Schrei hatte Gerobart mit einem Schlag seines Knüppels zum Verstummen gebracht. Jung war er damals gewesen, jünger als viele andere, die vor den Toren Nürnbergs vom Betteln und Stehlen lebten, aber schon stark genug, um einen Schädel mit einem Schlag zu spalten.
Dem Alten waren Dutzende andere gefolgt. Gerobart hatte sie nicht gezählt, schon weil ihm das Zählen schwerfiel. Aber wer musste auch schon Zahlen kennen, wenn es darum ging, möglichst schnell möglichst viel Beute zu machen? Niemand!
Er hatte stets geraubt, was er zum Leben brauchte. Dann aber war ihm klar geworden, dass ihm etwas fehlte, was andere offenbar besaßen – ihm fehlte jede Art von Skrupel und Mitleid.
Ihm war es gleich, ob er eine schwangere Frau schlug, wenn sie ihm im Weg war. Er hatte Frauen, Kindern und Alten seine Klinge zu schmecken gegeben. Es bereitete ihm keine schlaflosen Nächte, wenn er mit ansah, wie sich ein Mann schützend vor seine Familie warf, die er, Gerobart, gerade ausraubte. Dreck, nein! Dann schlug er eben diesem Kerl den Schädel ein, verging sich an dessen Weib oder der Tochter und tötete schließlich die ganze Brut.
Für ihn zählte nur die Beute und die wuchs von Jahr zu Jahr. Sein Ruf sorgte für Zulauf, andere Strauchdiebe und Halsabschneider stießen zu ihm und unterwarfen sich seiner harten Hand und Führung. Seit fast einem Jahr lagerten sie nun schon in dieser Gegend. Es lohnte sich, der Handelsweg spülte ihnen reichlich Schätze und leicht verkäufliche Waren in die Hände. Gerobart hatte seine Abnehmer, die nicht nach der Herkunft eines Rings, einer goldenen Fibel oder einer Wagenladung Wein fragten, sondern schweigend bezahlten.
Seit ihm dann der Einfall mit dem Leibhaftigen gekommen war, war sein Glück vollkommen. Keine Seele traute sich mittlerweile auch nur in die Nähe ihres Schlupfwinkels. Und alles hatte er nur dadurch erreicht, dass er ein paar Männer, als Kaufleute verkleidet, in die Gasthäuser der Gegend geschickt hatte. Sie mussten gar nicht viel tun, nur ein paar Geschichten erzählen, ein paar Ammenmärchen. Mit jedem Zeugen, der bei allem, was ihm heilig war, schwor, dass er wahrhaftig einen Dämon gesehen habe, wuchs die Furcht vor der Teufelsschlucht. Niemand wagte sich hierher. Alle nutzten sie den Weg am Eichenwald vorbei, so dass Gerobarts Männer leichtes Spiel hatten, ihre Falle vorzubereiten.
»He, Gerobart!«
»Was schreist du so herum, Merten?«
»Ich habe eine Botschaft von Cunlin erhalten. Reisende sind auf dem Weg. Sie sollen nach fetter Beute aussehen, haben ein Fuhrwerk bei sich und keinen Schutz.«
»Keine Söldner? Bist du sicher?«, fragte Gerobart ungläubig.
Merten nickte grinsend.
»Wie leichtsinnig von ihnen«
»Ja, das ist es. Aber Cunlin lässt ausrichten, dass sie nicht den Weg zum Eichenwald eingeschlagen haben.«
»Sondern?«
»Sie kommen hierher. Sind auf direktem Weg in die Schlucht.«
Gerobart sprang auf und schleuderte seinen Weinbecher zur Seite, aus dem er gerade noch getrunken hatte.
»Verflucht, wer ist bei Cunlin oben am Posten?«
»Nur Sebald. Der Rest wollte essen und saufen.«
Gerobart überschlug die Zeit, die ihm blieb. Noch war es nicht zu spät.
»Also gut, dann sag den anderen, dass sie das Saufen verschieben müssen. Ich will, dass du, Caspar und Jorgen die Flanken übernehmt. Wir lassen an der Klamm die Falle zuschnappen.«
Gerobart grinste Merten an. Der verglich seinen Anführer unwillkürlich mit einem bösartigen Wolf, der bereit war, mitten in einer Schafherde zu wüten, um zu töten. Nicht weil er hungrig war, sondern weil er Lust verspürte, Blut zu schmecken.
»Merten, es ist an der Zeit, dass wir die Schisser hier in der Gegend mal wieder gehörig das Fürchten lehren. Wir werden keine Gefangenen machen, ich will, dass die Kunde vom Teufel, der sich die Händler geholt hat, schon morgen die Runde macht. Dafür brauchen wir ein paar aufgeschlitzte Bäuche. Keine Seele wird es danach noch wagen, einen Fuß in unsere Schlucht zu setzen. Also, hol die übrigen sechs, der Boden der Schlucht soll mit Blut getränkt werden. Wir machen diese Schlucht zum Grab der Pfeffersäcke, die da ahnungslos auf uns zureiten.«
Kapitel 5: In der Teufelsschlucht