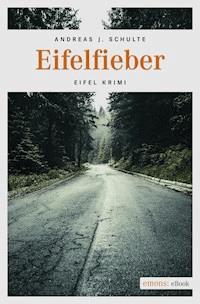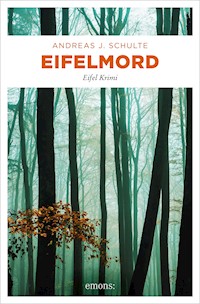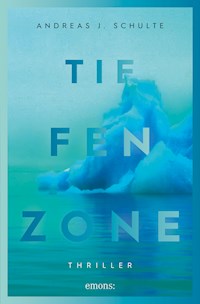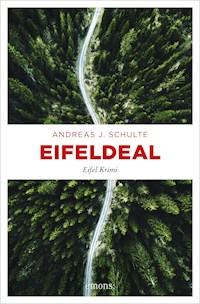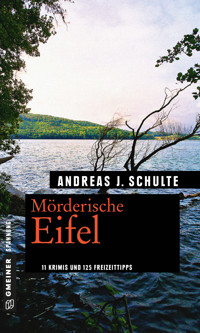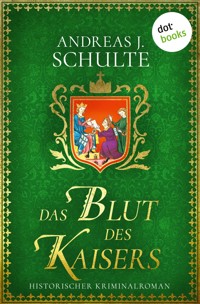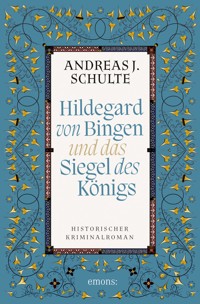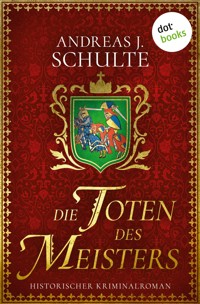
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Konrad von Hohenstade
- Sprache: Deutsch
Der Meister ist in die Stadt gekommen – und sein erster Mord war nur der Anfang … Im Jahre des Herrn 1476 sorgt der brutale Mord an dem Andernacher Ratsherrn Hermann Wilhelm von Grevenrath für Aufregung. Der vermeintliche Täter ist schnell gefasst: Noch in der Nähe des Tatorts läuft der blutbesudelte Gregor Kreuzer der Bürgerwache in die Arme. Stadtrat und Schöffen drängen auf einen schnellen Prozess, denn Andernach erwartet die Delegationen von Habsburg und Burgund. Ein ermordeter Ratsherr, ohne einen verurteilten Mörder, würde kein gutes Licht auf die Stadt werfen … Ein Mann aber hat Zweifel daran, dass Gregor wirklich der Täter ist – der mysteriöse Konrad von Hohenstade. Er ist der Einzige, der die Pläne des Mörders, des Meisters, durchkreuzen könnte. Doch dann gerät er selbst auf dessen Todesliste … »Historischer Lokalkrimi mit Suchtpotenzial« Katha Jansen, SWR3-Buchtip Der packende Auftaktband einer perfekt recherchierten und abenteuerlichen Mittelalter-Krimireihe für Fans von Daniel Wolf und Oliver Pötzsch. In Band zwei macht Konrad sich auf die Suche nach einer kostbaren Reliquie, die in den falschen Händen schreckliche Konsequenzen für die Habsburger haben könnte … Alle Bände der Reihe: Band 1: Die Toten des Meisters Band 2: Die Rache des Schnitters Band 3: Das Blut des Kaisers
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im Jahre des Herrn 1476 sorgt der brutale Mord an dem Andernacher Ratsherrn Hermann Wilhelm von Grevenrath für Aufregung. Der vermeintliche Täter ist schnell gefasst: Noch in der Nähe des Tatorts läuft der blutbesudelte Gregor Kreuzer der Bürgerwache in die Arme. Stadtrat und Schöffen drängen auf einen schnellen Prozess, denn Andernach erwartet die Delegationen von Habsburg und Burgund. Ein ermordeter Ratsherr, ohne einen verurteilten Mörder, würde kein gutes Licht auf die Stadt werfen … Ein Mann aber hat Zweifel daran, dass Gregor wirklich der Täter ist – der mysteriöse Konrad von Hohenstade. Er ist der Einzige, der die Pläne des Mörders, des Meisters, durchkreuzen könnte. Doch dann gerät er selbst auf dessen Todesliste …
eBook-Neuausgabe November 2025
Copyright © der Originalausgabe 2014 Ammianus GbR Aachen
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/dershana; shutterstock/WinWin artlab, PARINYAS; iStock/Matorini und eine Illustration aus dem Codex Maness
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fe)
ISBN 978-3-69076-597-8
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andreas J. Schulte
Die Toten des Meisters
Historischer Kriminalroman
Für meine Frau Christine Schulte
und meine Söhne Florian und Matthias
Kartengrundlage mit freundlicher Unterstützung des Stadtmuseums Andernach
Prolog
»Ich sag dir, Bruder, dieser Mann ist der Teufel persönlich.«
Bruder Georg zupfte an seiner Kutte aus grauem, grobem Wollstoff. Er war nervös, schaute immer wieder hinüber zu dem Mann, den er für einen Mörder hielt. Nein, mehr noch – dieser Mann dort an der Holzreling des kleinen Frachtschiffes, war – davon war Georg überzeugt – ein Schlächter.
Bruder Eckbert, so wie Georg in die graue Kutte der Minores Fratres, der Minderen Brüder, gekleidet, schien sichtlich verlegen. »Bruder Georg, das sind schlimme Vorwürfe, die Ihr erhebt. Denkt nach, seid Ihr sicher? Ihr könnt doch kaum das Gesicht des Mannes erkennen.«
»Das Gesicht – nein, das liegt im Schatten, aber seine Hand, die gezackte Narbe auf dem Handrücken, die ist unverkennbar.«
Bruder Georg schaute starr auf das Wasser des Rheins. Er und sein Mitbruder hatten das kleine Handelsschiff in Bingen bestiegen. So wie alle Mönche, die den Lehren des heiligen Franz von Assisi folgten, hatten auch sie ein Armutsgelübde abgelegt. Georg verzichtete gern auf Besitz, nicht aber auf die Gelegenheit, schneller ans Ziel zu gelangen. Statt eines tagelangen Fußmarsches und der Gefahr, Strauchdieben zum Opfer zu fallen, hatte er kurzerhand die Gelegenheit genutzt, um einen Teil seiner langen Reise per Schiff zurückzulegen. Die Nacht über würden sie an Land festmachen, so wie es bei fast allen Rheinschiffern üblich war, doch dann, im Morgengrauen, würde man weiterfahren. So konnten er und Eckbert zur Terz, sicher aber vor dem Mittagsläuten bei ihren Mitbrüdern im Kloster in Andernach sein. In der Stadt am Rhein waren die Minores Fratres seit vielen Jahren ansässig.
Bruder Georg hatte sich bereits in Worms mit Eckbert zusammengetan, um gemeinsam zu reisen. Doch Georg hatte einen weitaus längeren Weg hinter sich: In Rom, der heiligen Stadt, lag der Anfang seiner Reise. Hierher war er vor vielen Jahren mit einer großen Pilgergruppe gekommen. Seine Mitbrüder verließen die Stadt nach und nach wieder. Doch er blieb am Tiber. Bis er eines Tages einen Brief aus seinem Heimatkloster in Lübeck bekam. Nachdem er die Nachricht gelesen hatte, wusste er, dass die Zeit, zurückzukehren, gekommen war. Damals – vor mehr als einem Jahr – hatte er noch geglaubt, dass es ihm leicht fallen würde. Er liebte lange Fußmärsche, genoss es, in der Natur allein zu sein. Aber nach ein paar Wochen musste er schmerzhaft erkennen, dass er nicht mehr der junge Mann von einst war. Und noch eines stellte er fest: Die Kutte schützte ihn nicht vor Straßenräubern. Beim ersten Mal, noch weit vor den Alpen, stahlen sie ihm seine spärliche Reisekasse. Beim zweiten Mal schlugen ein paar heruntergekommene Wegelagerer mit Knüppeln auf ihn ein, voller Wut und Zorn, dass da jemand noch weniger besaß als sie selbst. Kaufleute, die sich zu ihrem Schutz von ein paar bewaffneten Söldnern begleiten ließen, fanden ihn blutüberströmt am Straßenrand. Sie hatten Erbarmen, luden ihn auf einen ihrer Wagen und brachten ihn zum nächsten Kloster. Hier versorgte ein alter Mitbruder seine Wunden und versuchte ihn davon zu überzeugen, dass er sich besser noch eine Weile erholen sollte. Doch die Zeit drängte. Hoch oben auf den steilen Bergpässen lag der erste Schnee. Georg fürchtete, im Tal bei seinen Mitbrüdern überwintern zu müssen, also setzte er, schneller als ihm selbst lieb war, seine Reise fort. Zunächst schien er Glück zu haben. Die einzelnen Tagesmärsche waren anstrengend, aber er erreichte jeden Abend eine Herberge. Doch dann überraschte ihn – hoch oben in den Bergen – ein Unwetter. Innerhalb weniger Minuten wurde es bitterkalt. Ein Sturm trieb Schnee und Eis vor sich her, und Georg, in seiner dünnen Kutte und den offenen Sandalen, war alldem schutzlos ausgeliefert. Gegen eine Felswand geduckt schloss er mit seinem Leben ab. Er spürte, wie ihn seine Kraft verließ, und gab sich dem Wunsch hin, einfach nur einzuschlafen. Der Allmächtige schien aber andere Pläne zu haben. Georg wurde gerettet: Ein Bergbauer fand den Körper klamm und steif an einen Stein gelehnt. Zwei Wochen lag Georg bewusstlos in der Hütte des Bauern, dann erwachte er. Die Zehen an seinem linken Fuß waren für immer verloren. Dass er überlebt hatte, schien ihm ein Zeichen des Herrn, und so machte er sich, nachdem die Pässe wieder schneefrei waren, erneut auf den Weg.
Georg erinnerte sich schon gar nicht mehr an die ungezählten Tage und Wochen des weiteren Fußmarsches. Aber er hatte gelernt. Seine täglichen Wegstrecken wurden kürzer, und wann immer sich die Möglichkeit bot, schloss er sich anderen Reisenden oder Kaufleuten an. In Worms dann traf er Bruder Eckbert, der ebenfalls nach Andernach wollte.
In Andernach würde Georg erst einmal Station machen, um schließlich die letzte Etappe bis Lübeck anzutreten, seiner Heimatstadt. Georg hoffte darauf, einen Großteil der Reise per Schiff zurücklegen zu können. Doch das musste letztlich der Guardian, der gewählte Vorsteher des Konvents, in Andernach entscheiden, denn Georgs Reisekasse war fast leer. Er wandte sich erneut seinem Mitbruder zu, der wie er schweigend den eigenen Gedanken nachgehangen hatte.
»Seht, Eckbert, vor vielen Jahren in Rom war ich Zeuge eines Streites. Dieser Mann dort hatte einen jungen Edelmann ohne Grund beleidigt und herausgefordert. Der Jüngling besaß zwar einen ordentlichen Schuss Heldenmut, doch er hatte keine Chance gegen seinen Herausforderer.«
»Aber dann war es ein Kampf, kein Mord.« Eckbert schien sichtlich erleichtert.
»Unfug, es war Mord! Der Jüngling hatte sein Schwert noch nicht richtig gezogen, da blieb er wie angewurzelt stehen. Der Bolzen einer kleinen Armbrust hatte ihn tödlich getroffen. Doch nicht genug damit. Sein Mörder ließ die Armbrust unter seinen Mantel gleiten, zog einen Schweizer Dolch, beinah so lang wie ein Schwert, und schnitt dem Jüngling die Kehle durch. Nein, Eckbert, dieser Mann da drüben ist ein Mörder, so wahr mir Gott helfe.«
»Und was passierte dann?« Eckbert blickte nun ebenfalls immer wieder auffällig in die Richtung des geheimnisvollen Fremden.
»Noch ehe die Begleiter des Jünglings wirklich begriffen hatten, was geschehen war, war sein Mörder auch schon verschwunden. Später erfuhr ich, dass der Jüngling ein großes Erbe erwartete, das nun einem Vetter zufiel. Ich sage dir, dieser Streit entstand nicht zufällig, und die Armbrust war auch nicht umsonst gespannt unter dem Umhang getragen worden.«
Georg starrte wieder auf die Wellen, die an dem Bug des Schiffes vorbeiströmten. Mit einem Kopfschütteln versuchte er, die Bilder der Vergangenheit zu verscheuchen. »Kommt, Eckbert, lasst uns dort drüben bei den Getreidesäcken noch etwas ausruhen. Morgen haben wir unser Ziel erreicht.«
***
Er spürte die Blicke der beiden Mönche wie Nadelstiche im Nacken. Irgendetwas stimmte nicht. Er zog seinen Mantel fester um die Schultern, das Gesicht unter der Kapuze verborgen. Der Ältere der beiden Mönche schien zu aufgeregt. Verstohlen betrachtete er die Gesichter der beiden. Er war sehr stolz auf sein Gedächtnis. Alles, was er einmal gesehen hatte, schien sich ihm für immer einzuprägen. Eine Gabe, die seinen Lateinlehrer früher in Erstaunen versetzt hatte.
Dann durchfuhr es ihn wie ein Blitz: Rom, der Auftragsmord an dem jungen Edelmann. Der Mönch hatte in dem Gasthaus gesessen und hätte als einer der wenigen Zeugen auftreten können. Doch so weit war es gar nicht gekommen. Sein Plan war aufgegangen, und er war durch die Hintertür des Gasthauses geschlüpft, noch bevor jemand reagieren konnte. Ein wohliges Schaudern ergriff ihn, als er an den ungläubigen Blick des Opfers dachte, nachdem der Bolzen der Armbrust sein Herz durchbohrt hatte. Der schnelle Schnitt seines Dolches, das leise gurgelnde Geräusch des letzten Atemzuges. Ja, er liebte seine Arbeit. Und während er in der Ferne die Mauern der Stadt Koblenz in der Abenddämmerung auftauchen sah, wusste er, dass die beiden Mönche verschwinden mussten. Die Gefahr war zu groß, er wollte seine Mission nicht gefährden. Zwei Mönche, warum nicht einmal zwei Mönche ... Der Gedanke erregte ihn, und mit einem Lächeln blickte er in die Abendsonne, die die Weinberge in rötliches Licht tauchte. Nur noch etwas Geduld, dann stehen sie vor ihrem Schöpfer. Eigentlich müssten die beiden ihm dankbar sein.
***
Kein Rheinschiffer blieb, wenn es nicht sein musste, in der Nacht auf dem Fluss. Das kleine Frachtschiff legte bei Sonnenuntergang an einer flachen Stelle vor Koblenz an. Die wenige Mann starke Besatzung und der Kapitän des Schiffes gingen an Land, und bald sorgte ein großes Feuer für Licht und Wärme. Von der Besatzung kümmerte sich niemand um die drei Passagiere. Die Reisenden hatten für eine Fahrt bezahlt, keiner erwartete Wein oder gar eine Mahlzeit. Eckbert und Georg hatten sich zurückgezogen. Das wenige, was sie besaßen, trugen sie in Ledersäcken bei sich. Sie aßen Brot und Käse und tranken aus einer gemeinsamen Wasserflasche, die Eckbert noch in Bingen mit Wasser und saurem Wein gefüllt hatte. Mittlerweile war die Sonne untergegangen. Georg blickte sich um. Der Fremde, für ihn der Teufel in Person, war nicht zu sehen. »Wahrscheinlich sitzt er bei der Besatzung und trinkt«, dachte Georg. Eckbert riss ihn mit einem Rülpser aus seinen Gedanken. Georg wandte sich Eckbert zu, als dem Älteren oblag es ihm, das Abendgebet zu sprechen. Eckbert senkte den Kopf und lauschte den lateinischen Versen, die Georg leise aufsagte. An einigen Stellen antwortete er, auch wenn er nicht wusste, was genau er da sagte. Im Gegensatz zu Georg hatte er nie richtig Latein gelernt. Georg hob die Hand zum Segen, und Eckbert bekreuzigte sich. Danach holten beide ihre Reiseumhänge aus den Ledersäcken und wickelten sich in den Wollstoff. Auf dem Fluss wurde es nachts schnell kalt, feucht und kalt.
Dunkel war es geworden, weder Mond noch Sterne drangen durch die dichten Wolken. Umso heller strahlte das Feuer vom Ufer her, so hell, dass alles Übrige in noch tiefere Schatten getaucht war. Laute Stimmen und gegrölte Liederfetzen wehten vom Ufer herüber, in den Trinkflaschen der Schiffer war wohl mehr als nur Wasser.
Morgen, morgen werde ich wieder in einer Klosterzelle schlafen. Mit diesem Gedanken schlief Georg ein, begleitet von dem leisen Schnarchen Eckberts.
***
Er war ein Schatten, ein Nichts, ein Hauch, leise und unbemerkt. Er hatte nachgedacht, einfach und schnell würde er es halten, was er natürlich bedauerte, denn so entsagte er manchem Vergnügen. Der Jüngere von beiden hatte ungefähr seine Gestalt und Größe, seine Wollkutte wollte er noch behalten. Wie sich alles fügte! Sie würde ihm mehr als nur nützlich sein. Der Ältere, der mit dem Hinken, hatte dagegen nichts an sich, das er noch verwenden konnte, auch gut.
Er trat leise zu den beiden Schlafenden. Zuerst der Jüngere. Er griff zu, umfasste den Kopf mit beiden Händen, genoss kurz das Gefühl der Allmacht, das ihn durchströmte, und dann brach er mit einem kräftigen, kurzen Ruck dem Schlafenden das Genick. Es knackte laut, so als würde man auf einen morschen Ast treten. Den Toten würde er gleich zusammen mit dem anderen in den Fluss gleiten lassen. Die Strömung würde die Körper davontragen. Vielleicht kämen sie in ein, zwei Tagen an einem Ufer an, vielleicht – Gedanken darüber machte er sich nicht.
Er beugte sich über den Älteren. Mit einer gleitenden Bewegung zog er seinen Dolch unter dem Mantel hervor. Vorsichtig, beinah zärtlich strich er mit zwei Fingern über die Wangen des Schlafenden. Der schlug die Augen auf. Verwirrung lag in diesen Augen, dann Erkennen. Er liebte diesen Moment, atmete noch einmal tief durch. Und dann, als sich Angst im Blick des anderen spiegelte, stach er zu ...
Abtei am See
September im Jahre
des Herrn 1476
An seine Königliche Hoheit den
Herzog Richard von Hohenstade und Greich
Eure Hoheit,
es ehrt mich, dass Ihr meinen Rat sucht. Mit Freude denke ich an die vielen Jahre in Eurem Dienst. Jetzt, wo mein Lebensweg dem Ziel entgegenstrebt, weiß ich, dass diese Jahre nicht umsonst waren. Heute, hier im Kreise meiner Mitbrüder, ist es ein ruhiges Leben. Ein Leben nach den Regeln des heiligen Benedikt. Doch dank der Jahre bei Euch kann ich nun auch dieses Leben willkommen heißen. Seien wir ehrlich zueinander – nur wer sich nicht immer fragen muss, was hätte sein können, kann das schätzen, was ist.
Verzeiht einem alten Mann seine Gefühle – glaubt nicht, nur weil Klostermauern zwischen uns und der Welt liegen, würden uns die Nachrichten dieser Welt nicht erreichen. In Eurem letzten Brief hattet Ihr gefragt, ob bestimmte Gerüchte der Wahrheit entsprächen. Nun, so will ich die von Euch gestellten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten.
Durch unsere Brüder im Stadthof der Abtei in Andernach und durch unsere Glaubensbrüder, die Minores Fratres, die in Andernach ihre Heimat gefunden haben, erfuhren wir, was sich ereignet hat und was uns erwarten wird. Sicher erinnert sich Euer Gnaden an den glücklosen Versuch des Burgunder Herzogs Karl, die Stadt Neuss einzunehmen. Zwar trägt er nicht umsonst den Beinamen «Der Kühne«, doch schließlich musste er nach vielen Monaten der Belagerung abziehen. Seine Majestät, unser Kaiser Friedrich, dagegen sammelte vor nicht einmal 18 Monaten an die 40.000 Männer im Rheintal, um den Neussern zur Hilfe zu eilen. Dabei war er beinah drei Monate Gast der Ratsherren zu Andernach. Was, wie ich Euch versichere, der Stadtkasse nicht zum Besten gereicht hat. Doch ich schweife schon wieder ab. Wer hätte nun aber gedacht, dass aus den einstigen Feinden in so kurzer Zeit Verbündete werden könnten. Eine Hochzeit zwischen Friedrichs Sohn Maximilian, dem künftigen deutschen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, und Karls Tochter Maria – welch eine Chance für die Habsburger. Und Karl? Er hätte dann einen starken Verbündeten gegen Ludwig XI. an seiner Seite.
Doch Ihr wisst ja, dass schon einmal die Bemühungen um eine Verheiratung fehlschlugen. Was ich Euch nun anvertraue, gebe ich preis aus Respekt vor Euch und in dem Wissen, dass Ihr diese Nachrichten nicht selbstsüchtig ausnutzen werdet.
Die Verhandlung über die Ehe, so sie denn zustande kommen sollte, will Friedrich wiederum in Andernach führen lassen. Wer hätte gedacht, dass ihm diese kleine Stadt am Rhein so ans Herz gewachsen ist. Vielleicht schätzt er aber auch nur die Ferne der großen Städte ...
Schon bald soll eine Delegation der Habsburger mit Vertretern aus Burgund zusammentreffen. Ein Treffen, bei dem die Zukunft der Häuser Burgund und Habsburg, ja des ganzen Reiches in der Waagschale liegt. Gebe Gott der Allmächtige meinen Glaubensbrüdern die Gelassenheit, diesem wichtigen Zusammentreffen unter ihrem Dach einen würdigen Rahmen zu geben.
So – nun wisst Ihr um die Wichtigkeit der kommenden Wochen.
Lasst mich aber nicht schließen, ohne mich nach Eurer Gesundheit und der Eurer Gattin zu erkundigen. Ich hoffe, Ihr seid weiterhin wohlauf. Jetzt sind schon mehr als zwei Jahre vergangen, dass Euer jüngster Sohn, mein früherer Schüler, von uns gegangen ist. Eure damalige Nachricht hat mir das Herz gebrochen. Ich bete dafür, dass der Herr Euch in Eurem Schmerz Trost spendet. Möge der Allmächtige seine schützende Hand über Euch und die Euren halten und Eure Wege allzeit begleiten.
Euer Anselm
Kapitel 1
In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Der Schlusssegen des Priesters wurde durch die hohe Decke der Kirche als vielfaches Echo wiedergegeben. Was hatte ich mir eigentlich dabei gedacht? Warum saß ich hier – in der dunkelsten Ecke, fast als hätte ich etwas zu verbergen?
Ich kannte die Antwort. Ich wollte einen Schlussstrich ziehen. Den Toten ihren Frieden geben – endlich. Doch das war nicht so leicht. In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Die gleichen Worte, ein anderer Priester. Ich sah sie wieder vor mir. Meine Maria, meine geliebte Maria, die unsere kleine Sophie über das Taufbecken hielt, Sophie, wie sie ihr Gesicht verzog, als das kalte Wasser über ihre Stirn floss. Marias braune Augen, die meinen Blick suchten. Ihr Lächeln ...
Ich wischte mir über die Augen, ich hatte gar nicht gemerkt, dass mir Tränen über die Wangen liefen. Wenn ich die beiden so lebhaft vor mir sah, wie sollte ich da einen Schlussstrich ziehen können?
Ich atmete einmal tief durch. Kein Vergessen, aber vielleicht etwas mehr Frieden. Ich stand auf, sah Pastor Heinrich auf mich zukommen. Würdevoll läuft man anders. Heinrich rannte fast in meine Richtung. Mir war klar, warum. Ich war ihm sechs Monate lang aus dem Weg gegangen, sechs Monate, seit wir an dem Grab von Maria und Sophie das letzte Mal miteinander gesprochen hatten.
»Endlich, da seid Ihr ja!« Pastor Heinrichs rundes Gesicht schien ehrlich erfreut. Ein verlorenes Schaf kehrte freiwillig zu seinem Hirten zurück. »Ich hätte spätestens zu Michaelis – bleiben wir bei der Wahrheit – Eure Tür eingetreten und Euch ans Tageslicht gezerrt.« Ich musterte Heinrich. Groß, beinah so groß wie ich selbst, mit der Gestalt einer Eiche und dem Brustkorb eines Fasses. Ja, kein Zweifel, dieser Mann Gottes hätte ohne Weiteres meine Tür eintreten können.
»Ich brauchte Zeit, ich wollte ...« Pastor Heinrich unterbrach mich: »Weiß ich doch, mein Sohn.«
›Mein Sohn?‹ Er hatte tatsächlich ›Mein Sohn‹ zu mir gesagt! Dabei schätzte ich, dass er vielleicht zehn, höchstens fünfzehn Jahre älter war als ich.
»Nun, mein lieber Konrad, ich kenne gar nicht Euren ganzen Namen?« – Heinrich schaute mich an. Seine Augen blickten plötzlich sehr neugierig, neugierig und auch misstrauisch.
»Konrad, einfach nur Konrad, lassen wir es doch dabei, Hochwürden.«
Heinrich stutzte einen Moment, dann aber grinste er. Er schlug mir mit der flachen Hand auf die Schulter. »Meine Fresse, ›Hochwürden‹, noch nie hat mich jemand ›Hochwürden‹ genannt.«
Meine Schulter war gebrochen. Ganz klar, sie musste gebrochen sein. Unauffällig bewegte ich das Schultergelenk. Vielleicht hatte ich ja doch noch einmal Glück gehabt, langsam kehrte das Gefühl wieder zurück. Mein Gott, wenn das ein freundschaftliches Schulterklopfen gewesen sein sollte ...
Heinrich schien nichts bemerkt zu haben. »Lasst bloß den Unfug mit ›Hochwürden‹, ›Heinrich‹ reicht vollkommen, wenn wir beiden unter uns sind.« Er legte mir eine Hand auf den Arm. Ich wappnete mich gegen neue Schmerzen, aber er ließ seine Hand lediglich liegen und drängte mich sanft, aber bestimmt in Richtung Kirchentür.
Erst jetzt fielen mir seine Hände auf: groß wie Schaufeln. Selten hatte ich größere gesehen. Mit diesen Händen hätte er meine Tür gar nicht eintreten müssen, stärkeres Anklopfen hätte schon genügt. Seine Wortwahl klang auch nicht gerade priesterlich, ich vermutete aber, dass er nicht mit allen Gemeindemitgliedern so sprach.
Wir gingen Seite an Seite langsam durch das Kirchenschiff zur Haupttür. Heinrich beachtete kaum die Grüße der übrigen Kirchenbesucher. Er hatte sein verlorenes Schaf wieder, und das wollte er auf keinen Fall erneut verlieren.
Mir fiel eine Geschichte ein, die ich vor ein paar Tagen gehört hatte. Drei Bengel, kaum 20 Jahre alt, aber betrunken für fünf, hatten nachts lautstark vor Heinrichs Haus gegrölt und den Pfaffen um seinen Segen gebeten, wie sie es nannten. Heinrich war dann irgendwann aus dem Haus gekommen. Die Bengel hatten Eichenknüppel dabei, suchten Streit und nahmen wohl an, ein Pastor sei genau das richtige Opfer. Sie kamen nicht aus Andernach – sonst hätten sie es besser gewusst. Heinrich hatte ihnen in wenigen Minuten mit seinen bloßen Händen einen Segen erteilt, den sie so schnell nicht wieder vergessen würden. So eindrücklich, dass zwei von ihnen noch Tage später mit Beulen und blauen Flecken durch die Stadt humpelten. Der Dritte hatte weniger Glück. Wie man sich erzählte, hatte er die schlechte Idee gehabt, ein Messer zu ziehen. Heinrich hatte ihm mit einem Hieb das Handgelenk gebrochen und ihm dann eine so donnernde Ohrfeige verpasst, dass der Angreifer zu Boden ging. Trotz aller Bemühungen der Hospiz-Brüder würde der Bengel wohl immer ein steifes Handgelenk behalten. Das unrühmliche Ende einer Sauftour und der dummen Idee, sich mit einem Pfaffen anzulegen.
Heinrich unterbrach meine Gedanken. »Also nur Konrad, kein Familienname. Warum auch nicht, wir alle haben ein Bündel zu tragen, das man nicht für jeden aufschnürt. Seht Euch dieses Gotteshaus an, Konrad. Es ist doch kein Wunder, wenn alle nur noch Dom dazu sagen. Viel zu groß für diese Gemeinde.« Ich blickte zu den beiden Türmen hoch. Heinrich hatte recht. Diese Kirche konnte beinahe mehr Besucher aufnehmen, als Andernach Bürger hatte.
Heinrich schnaubte: »Aber ich will in der Hölle schmoren, bevor ich mich beschwere. Ein einfacher Pfaffe mit einem eigenen Dom. Ich verrate Euch, was ich denke. Andernach ist seit den Zeiten Kaiser Friedrich Barbarossas eine kurkölnische Stadt. Doch als Kirchengemeinde gehören wir zu Trier. Wusstet Ihr, dass ich nur Vizepfarrer dieser Gemeinde bin? Ja, eigentlich ist der jeweilige Erzbischof zu Trier der erste Pfarrer dieses Gotteshauses, gebaut von einem seiner Vorgänger vor fast 300 Jahren. Der damalige Erzbischof zu Trier wollte mit dem Bau dieser Kirche dem kurkölnischen Andernach mal zeigen, wer die dickeren Eier hat. Also, sofern ein Erzbischof überhaupt welche, ich meine ... ach, ich und mein loses Maul.« Heinrich seufzte und schwieg.
Ich hatte schon einige Priester kennengelernt, aber dieser hier schien mir von ganz besonderer Art.
»Ich nehme an, Ihr wart nicht immer ein Mann Gottes?«
Die kummervollen Falten in Heinrichs Gesicht verschwanden. »Beim Schwanz des Teufels und seinem Pferdefuß! Ihr habt richtig geraten. Bevor ich meine eigentliche Bestimmung fand, diente ich verschiedenen Herren als Söldner und lehrte dabei so manchen Fußsoldaten den richtigen Umgang mit Schwert, Stock und Spieß. Und Ihr, Herr ...?« Heinrich sah mich fragend an. Er versuchte es doch tatsächlich noch einmal. Ich wusste genau, was er dachte. Damals vor einem halben Jahr hatte ich auf die Grabplatte nur ihre Vornamen gravieren lassen: Maria und Sophie. Mein Familienname gehörte zu einer Vergangenheit, die ich vergessen wollte. Am liebsten hätte ich ihn damals mit in die Gruft gelegt.
»Konrad – bleiben wir doch wirklich einfach bei Konrad.« Ich hielt Heinrich die Hand hin. Für einen Moment zögerte er, dann griff er beherzt zu. Wäre ich nicht durch den Schlag auf die Schulter gewarnt gewesen, wahrscheinlich hätte er mir die Hand gebrochen. Aber nun, da ich meine Schulter wieder einigermaßen bewegen konnte, war ich vorbereitet. Ich drehte ganz leicht meine Hand nach innen und erwiderte den Druck. Heinrichs Lächeln wurde zu einem breiten Grinsen. »Also nur ›Konrad‹, soll mir recht sein. Also, lieber Konrad, habt Ihr gekämpft?«
Wieder kehrte der misstrauische Blick in seine Augen zurück, wenn auch nur für einen kurzen Moment. So wie eine Wolke, die kurz vor die Sonne zieht. »Ach, Heinrich, was soll ich sagen, es ergab sich keine Gelegenheit, wisst Ihr? Ich denke, nicht jeder Mann muss kämpfen. Es gab so viele andere Dinge auf dem Hof meines Vaters.«
»So seid Ihr auf dem Land aufgewachsen? Aber Ihr habt dennoch eine Schule besucht, ich höre es an Eurer Wortwahl.«
»Ich hatte einen strengen Lehrer, der seine Lektionen durchaus handfest vermitteln konnte, wenn man nicht eifrig genug war.«
»Per aspera ad astra.«
»Durch die Hölle zu den Sternen«, murmelte ich, ohne lange darüber nachzudenken.
»So habt Ihr auch Latein gelernt!« Heinrich schien aufrichtig überrascht. »Ja, Konrad, welche Freude. Sagt, spielt Ihr womöglich auch Schach? Seit Johannes Krieger, unser früherer Schullehrer, im letzten Winter verstorben ist, habe ich keinen Spielpartner mehr finden können.«
»Es ist zwar ein paar Jahre her, doch ja, auch Schach hab ich einmal gespielt.«
»Großartig, wir müssen in den nächsten Tagen einmal eine Partie spielen. Ich meine natürlich, wenn Ihr ebenfalls dazu Lust habt?« Warum nicht, Heinrich schien mir der richtige Spielpartner zu sein. Außerdem hatte ich das Gefühl, ich müsste etwas gutmachen. »Gern, kommt vorbei, wann immer Ihr könnt! Ich gehe abends selten aus.«
Ich ging abends nie aus. Jedenfalls nie zum Spaß. Und ich hatte ganz sicher etwas gutzumachen. Schließlich hatte ich gerade meinen Pastor in weniger als fünf Minuten mehr als einmal belogen. Kein guter Anfang für eine Freundschaft, gar kein guter Anfang.
Kapitel 2
Wie leicht war es doch, einen Menschen zu töten. Jeder konnte töten – keine Frage, man brauchte nicht einmal besonders viel Mut. Manchen passierte es einfach so, fast nebenbei.
Nein, er tötete nicht nur, er war ein Künstler, ein Meister seines Faches. Er war geschaffen, um zu töten. Lautlos, wirkungsvoll, ohne Fehler. Dieses warme, schaudernde Gefühl, dieses Prickeln auf seiner Haut, diesen einen Moment bis zur Neige auszukosten wie einen Becher teuren Rotweins. Keine Frau konnte ihm dieses Gefühl geben. Er hatte es gewusst, schon nach dem ersten Mal. Jung war er damals gewesen, jung und unerfahren – doch er hatte gelernt, hatte sich selbst immer schwierigere Aufgaben gestellt. Die Lust, die war geblieben. Er liebte es, ihnen in die Augen zu sehen – so wie gestern Nacht bei dem hinkenden Mönchlein. Er sah ihren Blick schwinden, sich von dieser Welt verabschieden. Oft überrascht, meistens entsetzt. Ja, so kurz konnte die Zeit auf Erden sein, so kurz leuchtete oft nur das Lebenslicht, bevor eine Hand es auslöschte. Seine Hand.
Er gestattete sich ein zufriedenes Lächeln, als er die Stadtmauern von Andernach auftauchen sah. Das Schiff würde im Hafen anlegen, nicht weit von der Verladestation der Mühlsteine. Fässer und Säcke würden entladen werden, neue Ware an Bord gebracht. Keiner der Besatzung hatte beim Ablegen vor Koblenz auf die Reisenden geachtet.
Mit einem lauten Knirschen legte das Boot an der Hafenmauer an. Der Kapitän – schlaftrunken und gezeichnet vom nächtlichen Branntweingelage – schaute sich um, als würde er jemanden suchen. »Mein Herr, ehe ich es vergesse: Die beiden Mönche haben heute früh schon das Schiff verlassen.«
Der Kapitän schaute die dunkelgekleidete Gestalt an, die vor ihm stand, das Gesicht im Schatten der weiten Kapuze verborgen. Noch bevor er etwas erwidern konnte, drückte der Mann ihm ein italienisches Goldstück in die Hand. Dass es Gold war, fiel ihm selbst in seinem benebelten Zustand auf, das spürte er am Gewicht der Münze. »Ich habe den beiden versprochen, ich käme für ihre Fahrt auf. Dies sollte reichen, nehme ich an. Die beiden wollten wohl doch lieber als wandernde Brüder in die Stadt kommen.«
Der Kapitän brummte – alles war ihm recht, und dass einer der Mönche bereits bezahlt hatte, verschwieg er. Warum sich nicht zweimal bezahlen lassen? Sollten doch die Mönche tun, was ihnen gefiel. Noch bevor er richtig antworten konnte, wandte sich der Mann vor ihm um, nahm zwei Bündel Gepäck und lief mit einer unvermuteten Gewandtheit das schmale, schlüpfrig nasse Brett zur Hafenmauer hinüber.
Er ging mit schnellen Schritten auf das große Stadttor zu. Das hektische Treiben des Hafens interessierte ihn nicht. Geschickt wich er Karren und Hafenarbeitern mit Säcken und Fässern aus. Sein Auftraggeber hatte ihm über seinen Mittelsmann die verlangte Geldsumme in Gold geschickt. Nie direkten Kontakt zu seinen Auftraggebern und immer nur Gold, das war sein Credo. Mit dem Gold kamen die Anweisungen. Diesmal reizten sie ihn besonders, denn ihm war nur ein Ziel gesetzt worden, das er zu erfüllen hatte. Wie – das stand ihm frei. Ein Ziel und ein einziger Name, den er möglichst rasch von der Liste tilgen wollte, um sich dann in Ruhe der übrigen Arbeit zu widmen. Man hatte ihm freie Hand gelassen. Während er durch das Stadttor schritt, spürte er die vertraute Anspannung: Vor ihm lag eine große Aufgabe – aber er war schließlich auch nicht irgendwer. Er war der Meister.
Kapitel 3
»Ich rede und rede, warum aber seid Ihr heute in meine Kirche gekommen, Konrad?« Heinrich schaute mich fragend an, langsam waren wir um die große Kirche herumgegangen. Auf diese Frage hatte ich gewartet. Ich hatte sie mir selbst in den letzten Tagen immer wieder gestellt. Mittlerweile wusste ich die Antwort.
»Heinrich, Ihr habt damals viel für mich getan. Ihr habt Euch um alles gekümmert, als ich dazu nicht in der Lage war. Ich möchte dafür etwas tun, nennt es einfach eine offene Schuld begleichen.«
Heinrich fuhr dazwischen: »Redet doch keinen solchen Unfug! Ich will verdammt sein, wenn ich mich nicht kümmere. Da liegen eine bildschöne Frau und ihre kleine Tochter im Sterben, der Mann selber schwer krank, redet nur noch im Fieberwahn. Was hab ich denn groß getan, was nicht jeder andere Christenmensch getan hätte?«
Heinrichs Worte klangen mir in den Ohren, meine Gedanken wanderten. Maria war bildschön gewesen, Sophie viel zu jung.
Heinrich spürte meinen Schmerz. Wieder legte er mir seinen massigen Arm um die Schultern. Gott sei Dank verzichtete er dieses Mal auf seine aufmunternden Schläge. »Dreck, Teufel und Verdammnis, was red ich da. Ist immer noch da, der Schmerz und die Trauer, nicht wahr? Aber schaut Euch an – gut seht Ihr aus, und das Leben geht schließlich weiter.«
Ich verzichtete auf eine Antwort, was sollte ich auch schon sagen. Dass ich wieder gut aussah, war eine dreiste Lüge. Während des Fiebers hatte ich Gewicht verloren. Mit meinen mehr als sechs Fuß Größe war ich mittlerweile dünn wie ein Kräuterweiblein. Mein Gesicht war schmaler, die Falten tiefer geworden. Nicht nur, dass mir Hosen und Hemden am Körper schlotterten, auch meine Kräfte kehrten nur langsam zurück. Manche Bewegung fiel mir noch schwer, doch vor ein paar Wochen hatte ich damit begonnen, jeden Tag zu üben. Von »gut aussehen« konnte aber wirklich keine Rede sein.
»Ich möchte etwas tun, Heinrich, ich möchte etwas zurückgeben.«
»Na ja, wie ich gehört habe ...« Heinrich verstummte, bekam aber gleichzeitig einen verschmitzten, ja geradezu listigen Gesichtsausdruck: »Abwarten, Konrad, abwarten. Bestimmt fällt mir etwas ein.«
Wenn ich mir diesen massigen, fluchenden Priester an meiner Seite anschaute, glaubte ich ihm jedes Wort.
Kapitel 4
Er schritt durch das große Stadttor. Kein Büttel, kein Torwächter hielt ihn auf. Warum auch? Die Stadt lebte vom Handel, von den fremden Kaufleuten, die hier am Hafen ihre Geschäfte machten und abends die Gulden in einem der zahlreichen Gasthäuser ausgaben. Nein, er hatte nicht damit gerechnet, dass er tagsüber angehalten werden würde. Nach dem Abendläuten, wenn die Tore geschlossen wurden, sah das sicher anders aus. Aber genau deshalb war er ja jetzt da. Er würde sich umsehen, die Stadt, ihre Gassen und Höfe studieren. Andernach war eine Leinwand für ihn, weiß und frisch. Hier würde er sein Kunstwerk erschaffen. Eine Bühne ohne Zuschauer, auf der er seine neue Tragödie aufführen wollte.
Ein wundervoller Gedanke.
Gleichzeitig nahm er alle Einzelheiten um sich herum wahr, sog sie in sich auf. Vielleicht würden sie später einmal nützlich sein.
Das Stadttor war ein mächtiges Doppeltor mit zwei Erkern im Obergeschoss. Zwischen dem Außentor und dem Tor zur Stadtseite lagen mehr als 20 Schritte. Sollte das Außentor bei einem Angriff fallen, konnten die Verteidiger von den obenliegenden Wehrgängen die Angreifer in Schach halten. Das wuchtige Mauerwerk war jedenfalls nicht nur zur Zierde gewählt.
Ein paar Jungen spielten hinter dem Tor. Mit Klingen aus Holz fochten sie, hieben unter lautem Gejohle aufeinander ein. »Seht her, ich bin Lanzelot, erster Ritter am Hofe König Artus!« Einer der Jungen stellte sich auf der Steinstufe eines Hauseingangs in Positur. Doch bevor sich Jung-Lanzelot wieder in den Kampf stürzen konnte, spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Erschrocken drehte er sich um. Vor ihm stand ein Mann in einem schweren, schwarzen Reiseumhang. Die Kapuze mit der lang auslaufenden Spitze, einer Gugel gleich, ließ das Gesicht zunächst im Schatten. Doch dann schlug der Mann die Kapuze zurück. Der Junge musterte den Fremden. Kein Bart, ein schmales Gesicht, unscheinbar wie viele andere, das braune Haar kappenartig kurz geschnitten. Manch reicher Kaufmann trug so seine Haare. Der Fremde lächelte ihn an. »Wenn ich Euch, edler Ritter, kurz unterbrechen darf, so verratet einem Reisenden doch, wo er den ersten Gasthof am Platz finden kann?«
Der Junge grinste, die meisten Erwachsenen beachteten sie kaum, oder sie störten sich an ihren Spielen. Von der Kleidung des Fremden konnte man außer dem schwarzen Reiseumhang nicht viel erkennen. Hatte der Fremde Geld genug? »Kommt darauf an, was Ihr ausgeben wollt.« Mittlerweile hatten die übrigen Jungen mit dem Kampf aufgehört und standen jetzt schweigend und etwas abseits, um zu beobachten. »Das Gasthaus, in dem unsere hohen Ratsherren einkehren, ist der Gasthof ›Zum Hirsch‹.«
»Und wo finde ich diesen Gasthof?« Zusammen mit der Frage drückte der Fremde dem Jungen ein paar Weißpfennige in die Hand. Der Junge öffnete die Hand, schaute prüfend hinein und zeigte dann mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht die Gasse hinauf. »Dort hoch, einfach der Nase nach. Das hier ist die Korngasse, fast am Ende ist der Hirsch. Ist nicht zu übersehen.«
Der Fremde nickte kurz, schlug dann die Kapuze wieder nach vorne. Für einen Wimpernschlag blickte der Junge direkt in die Augen des Fremden. Dabei vergaß er alles: die Geldstücke in seiner Faust, den Kampf und seine Freunde. Das Gesicht hatte wie jedes andere ausgesehen, aber die Augen waren anders. Dunkel, tief, geradezu unheimlich. Das Lächeln schien diesen Blick gar nicht zu erreichen, es war, als gehörten die Augen zu einem anderen. Doch dann war der Moment vorbei. Der Fremde deutete eine Verbeugung an.
»Habt Dank, Lanzelot, und vergesst bei Eurem Kampf nicht, dass Ihr noch den Gral finden müsst.« Der Fremde drehte sich um und ging mit weiten Schritten die steile Korngasse hoch. Der Junge blickte ihm kurz nach, dann wurde er von seinen Freunden umringt, die alle neugierig wissen wollten, wie viel die Auskunft wert gewesen war. Auf den Fremden achtete keiner mehr. Der lief weiter, aufmerksam nahm er jede Kleinigkeit in sich auf: die Steinstufen aus Basalt, die zu den Hauseingängen gehörten, die hohen Giebel der Häuser mit ihrem vorgebauten zweiten Stockwerk, die schmalen Durchgänge, die von der Gasse wegführten. Manche Häuser standen so eng beieinander, dass es aussah, als lehnten sie aneinander, wie Saufkumpane, die sich gegenseitig stützen mussten, um noch torkelnd nach Hause zu kommen. Im Zwielicht einer dieser schmalen Gassen hörte er das Grunzen von Schweinen. Ein paar Schritte weiter konnte er gerade noch zur Seite springen, als aus einer Tür mit Schwung ein Nachttopf in die Unratrinne geleert wurde. Die Häuser strahlten Wohlstand aus: Alle waren sie im Erdgeschoss aus Stein, einem schwarzen Lavastein, der wie ein dunkler Schwamm aussah. Darüber erhoben sich solides Fachwerk und geschnitzte Eichenbalken. Die Fenster der oberen Stockwerke waren mit dünnem Pergament aus getrockneten Schweineblasen verschlossen. In einigen Fenstern gab es sogar bleigefasste Glasscheiben. Die Korngasse war jedenfalls nicht das Armenviertel der Stadt – soviel stand für ihn fest.
Aus einem Hof, fast am Ende der Gasse, war lautes Hämmern zu hören. Ein Schmied arbeitete an einem Hufeisen, zwei Knechte hielten das Pferd fest. Andere pökelten Fleisch in großen Salzfässern. Zwei Frauen waren an einem Brunnen damit beschäftigt, Waschwasser in Tröge zu füllen. Alles nahm er mit einem einzigen Blick in sich auf. Über dem Tor, das diesen Einblick in den Hof gewährte, hing ein großer, eiserner Hirsch, den Kopf zum Röhren weit nach hinten gebogen. Der Fremde hatte sein Ziel erreicht.
Kapitel 5
Ich fühlte mich auf eine seltsame Art erleichtert, so als wäre eine Aufgabe erledigt. Nachdem ich mich von Pastor Heinrich verabschiedet hatte, wurde mir erst richtig klar, wie lange ich auf dieses kurze Gespräch gewartet hatte. Ganz automatisch wandte ich mich dem kleinen Friedhof zu, der direkt neben der Kirche angelegt worden war. Hier gab es zwei Massengräber: In den Tagen, als der namenlose Schrecken der Krankheit durch die Straßen Andernachs ging, die Gesunden sich kaum noch aus ihrem Haus trauten, hatten die Stadtväter keine andere Lösung gesehen. Als die Leichen zahlreicher wurden, waren viele froh, wenn ihre Angehörigen möglichst schnell unter die Erde kamen. Schnell aus dem Haus, damit die tückische Krankheit nicht noch weiter um sich griff. Und manch ein Nachbar weigerte sich, auch nur einen Gulden für ein richtiges Begräbnis zu bezahlen, wenn nebenan der Tod wieder zuschlug. Auch Maria und Sophie wären sicher in eine der großen Gruften geworfen worden.
Als ich an ihrem Grab stand, wuchs erneut meine Dankbarkeit gegenüber Heinrich. Er hatte uns kaum gekannt, Maria hatte sich wohl ein paar Mal mit ihm unterhalten. Heinrich war es, der dafür sorgte, dass ein Arzt regelmäßig nach uns schaute. Maria und Sophie todkrank in ihren Betten, ich selbst im Kampf mit dem tödlichen Fieber. Ich gewann wie durch ein Wunder. Maria und Sophie verloren. Heinrich weigerte sich bis zuletzt, die beiden in die Massengruft werfen zu lassen. So lange, bis sicher war, dass ich das Schlimmste überwunden hatte. An einem klaren, kalten Morgen stand ich, ein Schatten meiner selbst, dann zusammen mit ihm vor ihrem offenen Grab. Er hatte beide in einen Steinsarg legen lassen, der von irgendeinem wohlhabenden Gemeindemitglied einmal für den Pfarrer selbst gestiftet worden war.
An diesem Wintertag hatte ich zwar das Schlimmste der Krankheit überwunden, doch ich war nicht darauf vorbereitet, an diesem Loch zu stehen, Erde hineinzuwerfen. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ihr Lachen, ihre Blicke, weggewischt! Ich war nicht einmal bei ihnen, als sie starben.
Jetzt, an ihrem Grab, wurde mir eines bewusst: Zum ersten Mal seit vielen Monaten fühlte ich nicht mehr den Knoten im Bauch – konnte mit einem Mal wieder an ein Morgen denken. Für heute war es Zeit, die Toten ruhen zu lassen. Stumm verabschiedete ich mich von den beiden und schlenderte langsam zum Ausgang hinüber. Ich schloss sorgfältig das Friedhofstor hinter mir. Vor mir lag noch ein langer Vormittag.
Vom Friedhof aus war es nicht sehr weit, nur die Kirchgasse hinauf zur Hochstraße.
Die Sonne versuchte immer noch, den milchig trüben Nebel zu durchbrechen. Der Tag konnte sich nicht entscheiden, ob er herbstlich grau oder sonnig werden wollte. Mein Magen knurrte. Wenn ich ein zweites Frühstück wollte, musste ich noch Brot und etwas Käse kaufen. Ich entschloss mich, erst einmal zum Alten Markt hinüber zu gehen.
Plötzlich zog mir der Duft von frischgebackenem Brot in die Nase. Der Bäcker in der nächsten Gasse verteilte gerade ofenfrische Laibe in die Körbe seiner beiden Bäckerjungen, die sie zu den Gasthäusern bringen sollten. Das liebte ich so an Andernach. Man konnte hier an fast jeder Ecke frisches Brot kaufen. Ich entschied mich für ein kräftiges Roggenbrot, das noch warm war, als der Bäcker es mir in einen Leinenbeutel packte. Mit dem Leinenbeutel über der Schulter lief ich weiter zum Marktplatz. Zweimal in jeder Woche, einmal in ihrer Mitte und einmal an ihrem Ende, gab es einen Wochenmarkt. Aber auch außerhalb dieser Markttage versuchten immer ein paar Bauern, zumindest etwas Gemüse, Obst, Butter und Käse zu verkaufen. Dafür waren sie bereits im Morgengrauen aufgebrochen, um mit dem Öffnen der Stadttore in die Stadt zu kommen, aufmerksam beobachtet von der Marktwache, die zum Beispiel dafür Sorge tragen musste, dass jeder die in Andernach gültigen Maße und Gewichte nutzte und einhielt. Schließlich gab es einen beträchtlichen Unterschied zwischen einem Malter Hafer in Andernach und einem Malter Hafer in Koblenz. Jeder wusste darum, aber wenn es um Gewinne ging, wurde mancher eben doch schwach.
»Na, junger Mann, wie wäre es mit uns beiden?« Ich drehte mich zur Seite. Der alten Frau, die sich schwer auf den Rand ihres Handkarrens stützte, sah man jedes Jahr ihres biblischen Alters an. Sonne, Wind und viele Jahrzehnte hatten ihre Spuren hinterlassen. Das Gesicht glich einem knorrigen Baumstamm, einem Baumstamm mit nur noch zwei einsamen Zähnen. Doch trotz ihres Alters – die Augen war klar, und ich hätte schwören können, dass ein Teil der Runzeln Lachfalten waren.
»Leider bin ich schon versprochen, edle Maid – so bleibt mir nur der Trost, etwas gesalzene Butter und Hartkäse mit Kümmel kaufen zu können. Doch ich verspreche hoch und heilig, dass ich bei jedem Bissen an Euch denken werde.«
»Na, endlich mal ein Bursche, der nicht so schüchtern ist.« Die Alte gluckste vor Lachen. »Aber ganz ehrlich, junger Herr, mit einer alten Schachtel wie mir hättest du auch nur noch wenig Freude. Als ich jung war, da hätte ich dir ein paar Dinge zeigen können, die ...« Was sie mir hätte zeigen wollen, erfuhr ich nicht mehr, denn in diesem Moment fiel ein schrankbreiter Schatten auf ihren Handkarren, und zum zweiten Mal an diesem Morgen schlug mir eine schwere Hand auf die Schulter. Herrgott noch mal – hatten denn heute alle den Wunsch, mir die Knochen zu brechen? Doch noch bevor ich mich umdrehen konnte, dröhnte mir eine sehr bekannte Bassstimme lauthals ins Ohr. »Das hätte ich mir ja denken können, noch vor dem Mittagsläuten auf dem Marktplatz rumlungern und mit der schönsten Frau am Platze anbändeln. Na, wenn ich das Hildegard erzähle.«
Die Pranke auf meiner Schulter drehte mich kurzerhand herum. Wahrscheinlich hätte ich dagegenhalten können. Wahrscheinlich – sicher war ich mir nicht. Stimme und Pranke gehörten zu einem der wenigen Freunde, die ich in den letzten Monaten in Andernach gefunden hatte: Josef Schmittges. Von allen nur Jupp Schmittges genannt. Jupp gehörte zu den Stadtknechten. Offiziell gab es unter ihnen keine Rangfolge, doch Jupp hatte die meiste Erfahrung. Er war es, der den übrigen Schwert- und Stockkampf beibrachte. Mit seiner Erfahrung als Soldat hatte Jupp die Andernacher Stadtknechte zu einer disziplinierten Truppe geformt. In Friedenszeiten sorgten die Stadtknechte für die Einhaltung der Marktordnung, und bei kleineren Streitereien oder größeren Prügeleien griffen sie ein. Andernachs Bürger selbst sorgten für die Wachen auf den Türmen der Stadtmauer. Maria und ich hatten sie kurz nach unserem Umzug bei einem Spaziergang gezählt: vier Haupttore, sechs kleinere Pforten und sechzehn Türme – die Bürger hatten eine ganze Menge zu bewachen. Und wieder war es Jupp gewesen, der aus der bunt zusammengewürfelten Gruppe eine schlagkräftige Bürgerwehr geformt hatte, die auch im Ernstfall für die Verteidigung der Stadt sorgen konnte. Ich hatte allerdings das Gefühl, Jupp war ganz froh darüber, dass die Bürgerwehr noch nie ernsthaft hatte kämpfen müssen. Nicht, als ob er seinen Dienst nicht ernst genommen hätte. Man musste aber auch schon schwer verstört oder lebensmüde sein, um sich mit diesem Bär von Mann anzulegen. Meist reichte selbst bei dem betrunkensten Raufbold das bloße Auftauchen von Jupp, um wieder für Ruhe zu sorgen. Jupp und Pastor Heinrich zusammen, das wäre ein unschlagbares Duo. Die beiden hatte vieles gemeinsam. Bei dem Gedanken musste ich grinsen.
»So, so – statt einer Rechtfertigung grinsen wir auch noch blöde. Das grenzt doch glatt an Beleidigung eines Stadtknechts.« Jupps dröhnende Stimme war nur schwer zu überhören. Mittlerweile drehten sich schon die ersten Leute zu uns um.
»Mensch, Jupp, gib Ruhe! Du verschreckst ja die Marktkäufer. Von der freundlichen Dame mir gegenüber ganz zu schweigen.«
Tatsächlich schien es, als wäre Jupp das Ganze plötzlich peinlich. Er lächelte verlegen wie ein Schuljunge.