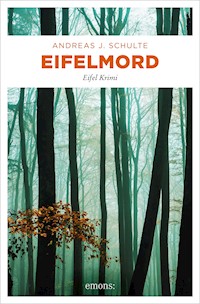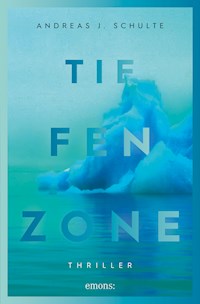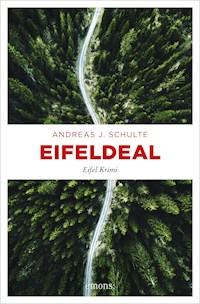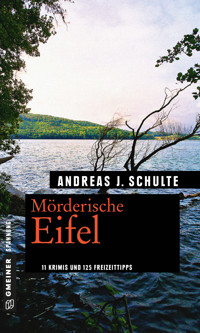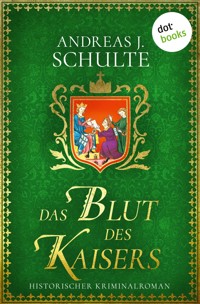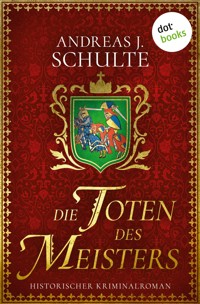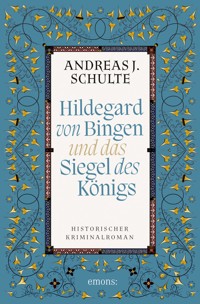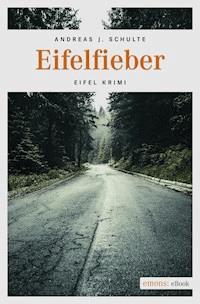
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Paul David
- Sprache: Deutsch
Der Enthüllungsjournalist Roger Winkler hat sich angeblich das Leben genommen, doch seine Schwester glaubt nicht an einen Selbstmord und bittet den ehemaligen Militärpolizisten Paul David um Hilfe. Was als Routine beginnt, wird schnell zum Kampf um Leben und Tod, denn die beiden kommen einem Verbrechersyndikat auf die Spur, das über Leichen geht. Musste Winkler sterben, weil er zu viel wusste?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas J.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: iStockphoto.com/da-kuk Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Lothar Strüh eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-143-7 Eifel Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Anna, Birgit, Jürgen, Sylvia und Brigitte– für euch, die ihr an Paul David geglaubt habt.
Und für meine geliebte Tine, die mir geholfen hat, aus dieser Idee ein Buch zu machen.
Das Leben zwingt uns oft auf den Boden,aber du kannst entscheiden,ob du liegen bleibst oder wieder aufstehst.
Jackie Chan
Prolog
Agenturmeldung vom 23.Juli 2011
In Masar-e Scharif haben afghanische Sicherheitskräfte offiziell das Kommando von der internationalen SchutztruppeISAFübernommen. »Die Verantwortung für die Sicherheit und die militärischen Lasten können nicht für immer von unseren ausländischen Freunden geschultert werden«, sagte der Gouverneur der Provinz Balkh im Norden des Landes, Atta Mohammad Noor. Es gebe noch viel zu tun, der Friede sei noch nicht sicher, so Atta, der damit auf den jüngsten Zwischenfall in Masar-e Scharif anspielte.
An der feierlichen Übergabezeremonie im Hauptquartier der afghanischen Armee in der Nordregion nahmen auch zahlreiche Regierungsvertreter teil.
Eine Straße nördlich von Masar-e Scharif– vier Tage vorher
Seine Brüder würden seinen Namen preisen. Aamun ad-Din trug einen großen Namen. Sein Vorfahre Nur ad-Din hatte die Ungläubigen des Zweiten Kreuzzuges, die vor mehr als achthundertsechzig Jahren die Mauern und Tore von Damaskus belagerten, verjagt und in die Flucht geschlagen. Allein die Ankündigung, dass er mit seinem Heer anrückte, hatte die feigen Ritter des Abendlandes in Angst und Schrecken versetzt. Heute würde Aamun seinem großen Ahnen Ehre erweisen. Ein weiterer ad-Din, über den in den Lagern, Dörfern und Städten mit Ehrfurcht gesprochen würde. Ein Held würde er werden, heute würde es vollendet. Wieder tastete Aamuns Hand nach den beiden kleinen Schaltern, der eine rot, der andere schwarz.
Vorsichtig strich er darüber, genoss das Gefühl der Macht, die ihm diese kleinen Stücke Plastik verliehen. Aamun ließ die Hand sinken und suchte nach einer bequemeren Stellung auf dem alten Autositz des Transporters, doch dessen Sitze waren schon lange durchgesessen, voller Löcher und Risse. Bald, bald würde seine Stunde kommen. Er spürte den Schweiß auf der Stirn, die Tropfen, die salzig in seinen Augen brannten. Er starrte durch die staubige Windschutzscheibe. Die Straße vor ihm war so gut wie leer. Kaum einer nutzte diesen Weg in die Stadt. Auf der einen Seite der Straße standen ein paar rotbraune Lehmhütten, die Bewohner waren bereits vor Stunden fortgegangen, voller Sorge.
Wie viele seiner Brüder mussten mit ihren Familien in diesen armseligen Verhältnissen ihr Leben fristen, fragte sich Aamun. Doch er wusste auch, dass es die andere Seite gab. Gestern hatte er in der Stadt die Moschee besucht, ihre Pracht bewundert, am Grab des großen Kalifen Ali gebetet. Ihm waren die vielen reichen Pilger aufgefallen, die auf ihrer Reise nach Mekka in der Stadt Station machten. Wieder zuckte seine Hand zu den unscheinbaren Schaltern. Tief in seinem Innersten musste sich Aamun eingestehen, dass es nicht die verhassten Besatzer waren, die seinen Landsleuten ein Leben im Wohlstand verwehrten. Doch was spielte das jetzt noch für eine Rolle? Er hatte seine Wahl getroffen…
Es gab zwei Regeln, die allen schon bei ihrer Ankunft eingetrichtert wurden. Regel Nummer eins: Niemand trifft vor Ort selbstständige Entscheidungen. Es wird alles mit der Einsatzzentrale besprochen. Regel Nummer zwei: Man mischt sich niemals in die internen Angelegenheiten der Afghanen ein.
Leichter gesagt als getan. In den letzten Tagen wurde ich das Gefühl nicht los, dass wir in die Mühlen der afghanischen Politik geraten waren. Aber was ging mich das an? Ich war nur ein unbedeutender Militärpolizist mit einem Personenschutzauftrag.
Ich schaute nach draußen. Die Zufahrtsstraße nach Masar-e Scharif glich den zahllosen anderen Straßen des Landes– mehr Schotterpiste als Straße. Eine Piste quer durch eine Steinwüste: Außer den Bergen am Horizont und dem Himmel über uns hatte alles die gleiche sandbraune Farbe. Selbst die dürren Sträucher sahen sandbraun aus. Ein ganzes Land voller Staub und Steine. Doch diese Wüste hatte ihre eigene Schönheit und Würde. Es war das Licht, das die Felsen schimmern ließ, die Weite, der wolkenlose Himmel, der in der Nacht von Sternen übersät war, dass es mir den Atem raubte. Nur war ich nicht in diesem Land, um mich von den Naturschönheiten überwältigen zu lassen. Mein Befehl war unmissverständlich. »Begleiten Sie Schekeb Fani, den Stellvertreter des Gouverneurs, zum Verhandlungszentrum. Begleiten Sie die Vorbereitungen für die Übergabezeremonie, und dann sorgen Sie dafür, wieder rechtzeitig im Camp zu sein.« Weitere Regeln: Das Camp wird immer in kleinen Teams verlassen, wir führen nur Tageseinsätze durch, und vor Einbruch der Dunkelheit sind wir zurück im Camp.
»Hauptmann David, wir haben die Stadt gleich erreicht. Soll ich Meldung machen?«
»Oberfeld Schneider, was wollen Sie denn melden? Dass wir in einem ungepanzerten, überhitzten Geländewagen auf einer Schotterpiste Staub schlucken?«
»Aber ich dachte, die Einsatzzentrale sollte darüber informiert sein, wo wir uns gerade befinden.«
Ich schaute zu Oberfeldwebel Achim Schneider hinüber. Er war jetzt seit zwei Wochen im Land, und ich konnte gut verstehen, dass er alles richtig machen wollte. Deshalb schluckte ich auch die bissige Bemerkung, die mir auf der Zunge lag, wieder herunter.
»Sie haben recht, nur wüsste ich nicht, was wir der Einsatzzentrale als Position angeben sollten. Schauen Sie raus. Sehen Sie da draußen irgendeinen Hinweis, den wir als Wegmarke weitergeben könnten? Setzen Sie Ihre Meldung ab, wenn Sie sicher sein können, dass man uns nach der Meldung auch finden würde.«
»Jawohl, Herr Hauptmann.«
Ich warf über die Schulter einen Blick auf unsere beiden Begleiter. Der eine, Roger Lüttmann, war freier Journalist. Er sollte über die Übergabezeremonie am kommenden Samstag berichten. Heute früh hatte man ihn uns ins Auto gesetzt, und mehr als ein paar Sätze hatten wir nicht gewechselt. Mit geschlossenen Augen döste Lüttmann auf der Rückbank vor sich hin. Neben ihm saß Schekeb Fani, der seit mehr als einer Stunde in seinem Terminkalender blätterte und sich Notizen machte. Kein Anzeichen dafür, dass er unser Gespräch verfolgt hatte. Das aber konnte auch täuschen, ich wusste, dass Schekeb Fani Deutsch, Französisch und Englisch sprach. Die teilnahmslose Miene war womöglich nur Fassade.
»Da vorne ist eine Brücke, wir sind wahrscheinlich gleich auf der Zufahrtsstraße.«
Ich seufzte innerlich. Oberfeldwebel Schneider und seine ständigen Positionsvermutungen in einer Gegend, in der im Vorbeifahren ein Stein wie der andere aussah, zerrten an den Nerven.
Aamun ad-Din sah den Wagen schon von Weitem. Das musste er sein, es gab keinen Zweifel. Sein Informant hatte sogar die Uhrzeit richtig geschätzt. Kein Begleitschutz, da hätten sie sich die Sprengladung an der Brücke ja sparen können. Soweit er das erkennen konnte, waren die Ungläubigen und der Verräter in einem ungepanzerten Auto unterwegs. Das hatten sie bei der Planung nicht einmal zu hoffen gewagt. Ein alter grauer Geländewagen, aber immer noch viel zu auffällig. Welcher Afghane konnte sich schon eine Mercedes G-Klasse leisten?
Bei Allah, wozu der ganze Sprengstoff auf seiner Ladefläche? Sollte er sie auf der Brücke sprengen? Nein, er wollte ihren Tod selbst in der Hand haben, sie von der Straße fegen wie die rächende Faust Gottes. Aamun legte den schwarzen Schalter um. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
»Hören Sie, Oberfeld, niemand weiß, dass wir kommen, niemand kennt unsere Route. Ich glaube, Sie können ganz beruhigt sein. Hier wird… Halten Sie an!«, rief ich.
Oberfeldwebel Schneider reagierte zu unserem Glück rechtzeitig auf meine Warnung und bremste sofort.
»Was ist denn, Herr Hauptmann?«, fragte er verwirrt. »Sind wir schon am Ziel?« Lüttmann hatte die Augen aufgeschlagen.
Ich schüttelte den Kopf. Im ersten Moment hätte ich gar nicht sagen können, warum Schneider bremsen sollte. In meinem Kopf schrillte eine Alarmglocke. Während der ganzen Fahrt hatte ich aufmerksam die Umgebung beobachtet. Was stimmte hier nicht? Was hatte Schneider gerade noch gesagt? Er hat von der Brücke vor uns gesprochen, fiel mir ein.
Plötzlich wusste ich es: Seit zwei Stunden hatten wir vor jedem Haus Menschen gesehen, Ziegen weideten am Weg, Kinder spielten an der Straße. Hier aber war alles wie ausgestorben.
»Hier ist keine Menschenseele«, sagte ich laut.
»Ja und? Vielleicht sind alle in den Häusern«, warf Lüttmann ein.
»Oder sie wurden gewarnt und sind in Deckung gegangen.«
»Aber warum gerade hier?«
»Weil das die erste Brücke seit zwei Stunden ist«, sagte ich und dachte laut weiter, »normalerweise würden wir im Konvoi fahren. Wenn ich das Begleitfahrzeug ausschalten wollte, dann auf einer Brücke.«
Lüttmann sah nicht gerade überzeugt aus. »Na, wenn Sie meinen…«
Die Explosion beendete seine Zweifel. Steine flogen umher, unsere Windschutzscheibe splitterte zu einem feinen Spinnennetz von Rissen.
Im nächsten Moment röhrte laut der Dieselmotor eines Transporters auf, verstummte, startete erneut. Der Fahrer gab Vollgas, und der Transporter raste die Straße herunter– genau auf uns zu.
Aamun legte den nächsten Gang ein und verfluchte die Schaltung und Kupplung der Schrottkarre. Beim ersten Starten hatte er gleich vor lauter Aufregung den Motor abgewürgt. Seit Tagen hatte er sich gefragt, was er in den letzten Augenblicken seines Lebens tun würde. Eine Sure aus dem Koran aufsagen, Allah oder den Propheten anrufen. Jetzt, wo es so weit war, wurde das alles unwichtig. Aamun brüllte seinen Triumph heraus und trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch, den Finger am roten Schalter, der seinen Feinden Tod und Verderben bringen würde.
Ich warf mich im Sitz herum.
»Raus, raus, raus!«, brüllte ich. Ich riss das Sturmgewehr neben mir vom Sitz und stieß die Tür auf. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass bei Oberfeldwebel Schneider der langjährige Drill, gepaart mit dem nackten Überlebenswillen, Wirkung zeigte. Er warf sich nach draußen, zerrte Lüttmann von der Rückbank und suchte Deckung. Meine Sorge galt Fani. Ich riss die hintere Beifahrertür auf und zog ihn halb aus dem Auto, um ihn neben dem Hinterreifen auf den Boden zu drücken.
»P13 an Einsatzzentrale, kommen. Werden wahrscheinlich angegriffen, noch kein Feindkontakt.« Schneiders atemlose Funkmeldung eroberte gerade in meinen Charts der schwachsinnigsten Funksprüche einen Platz ganz weit oben. Der Transporter wurde langsamer, hielt dann an. Dreihundert Meter von uns entfernt gab der Fahrer mehrmals im Stand Gas, ließ den Motor aufheulen. Das würde kein Freundschaftsbesuch werden. Wollte er uns rammen? Möglich, aber wären wir gepanzert wie sonst immer, würde das wenig bringen. Mein Gott, schoss es mir durch den Kopf, jede Wette, dass er Sprengstoff an Bord hat!
»Schneider«, brüllte ich, »machen Sie, dass Sie hier mit den Zivilisten wegkommen.«
»Aber Hauptmann…«
»Verdammt, hauen Sie ab, rüber zu den Häusern da drüben, bleiben Sie hinter einer Mauer, und dann melden Sie Feindkontakt.«
Schekeb Fani zitterte, und seine Hände krallten sich in meine Uniformjacke.
»Sie müssen mich schützen.«
»Oberfeld, Sie übernehmen Fani und Lüttmann. Los, los.«
Ich sah, wie Fani gebückt um den Wagen rannte, und hörte die drei loslaufen. Reichte die Zeit? Ich rollte mich auf den Bauch. Ich hatte das Sturmgewehr und meine P8-Pistole mit fünfzehn Schuss.
Der Transporter machte einen Satz nach vorne, als der Fahrer wieder anfuhr. War es ein Selbstmordattentäter, würde er vermutlich erst im letzten Moment die Sprengung auslösen. Hoffentlich waren Schneider, Lüttmann und Fani schon in Deckung gegangen. Ich konzentrierte mich darauf, ruhig zu atmen, dann nahm ich den Fahrer ins Visier.
Niemand trifft vor Ort selbstständige Entscheidungen. Es wird alles mit der Einsatzzentrale besprochen.
Dafür war es jetzt zu spät.
Er wollte den Moment auskosten, die Angst seiner Feinde genießen. Aamun schloss verzückt die Augen. Auf diesen Tag hatte er so lange gewartet, jetzt würde er es vollenden. Er gab Gas. Diese verdammte Straße, Aamun brauchte beide Hände am Lenkrad, um den Wagen auf Spur zu halten.
»Tod den Ungläubigen, Tod dem Verräter!«
Aamun ad-Din schrie sich die Seele aus dem Leib.
Ich drückte ab.
Sein Schrei verstummte. Aamun ad-Din hatte keinen Schuss gehört, kein Aufblitzen eines Mündungsfeuers gesehen, keinen Schmerz gespürt. Eine einzige Kugel traf ihn in die Stirn und beendete seinen Traum, als Märtyrer ins Paradies zu gelangen.
Die Gestalt des Fahrers sackte zur Seite. Als Nächstes schoss ich auf die Reifen. Der Transporter schlingerte hin und her, dann kippte er um. Weit weg von Schneider, Lüttmann und Fani.
Ich schloss die Augen und atmete erleichtert auf.
Erster Teil
Drei Jahre später
Campingplatz Pönterbach
Es war eigentlich ein ganz netter Tag gewesen. Nett und durchschnittlich, wie viele andere Tage davor auch. Bis gerade, da hatte er aufgehört, nett zu sein.
»Mein Mann, der Oberst, wollte selber zu denen rübergehen und für Ordnung sorgen. Aber ich habe ihm gesagt, das wäre nicht seine Aufgabe. Ich dachte, die Platzbesitzerin sollte sich darum kümmern.«
Den Redefluss der kleinen Dame mit den stahlgrauen Locken hätte ich allenfalls mit einem Knebel stoppen können. Frau Oberst schritt energisch voran.
»Ach, was rede ich da, die Platzbesitzerin ist ja unterwegs. Aber wenn Sie so nett wären«, ihr Blick wanderte kurz zu meinem Armstumpf, »also nur, wenn es Ihnen keine allzu große Mühe macht. Die Jungs sind wirklich laut, und ob die schon so viel trinken dürfen? Ich weiß ja nicht!«
Ich brummte Zustimmung. Die Jungs waren noch jung, und kein Mensch hatte was gegen ein paar Bierchen vor dem Zelt, aber das Gegröle, das ich jetzt hören konnte, klang nach mehr als nur ein paar Bierchen.
»Ich schlage vor, Sie gehen jetzt zurück zu Ihrem Wohnmobil und beruhigen Ihren Gatten. Die Platzbesitzerin ist meine Tante, und ich werde mich mal mit den Jungs auf der Zeltwiese unterhalten«, sagte ich mit einer sanften Stimme, von der ich wusste, dass sie in der Regel Vertrauen erweckte. Der Erfolg blieb auch diesmal nicht aus. Die kleine Dame mit den Stahllocken entspannte sich und lächelte mir zu. »So, Ihre Tante, ach, das ist aber nett. Ja, dann will ich mal wieder.«
Sprach’s und bog Richtung Wohnmobil samt Oberst ab.
Ich ging weiter zur Zeltwiese.
Ein Kleinbus, vier Zelte, Klapptische, Stühle, Holzkohlengrill und zwei Schnapsleichen.
Die Bierkästen neben den Zelten wollten noch geleert werden, die vier Flaschen Billig-Wodka, die daneben in der Abendsonne glänzten, waren es schon. Der TSG Elz 1903 beziehungsweise die Karate-Tiger des TSG Elz hatten sich in den Kopf gesetzt, mir den Tag zu versauen. Gar nicht nett von ihnen.
Auf einem Klapptisch funkelte ein vierzig Zentimeter großer Pokal. Im Kleinbus klebte ein Schild »Im Kampf die Besten. Karate-Regionalmeisterschaft Süd 2014«.
Von den beiden Schnapsleichen einmal abgesehen, verfolgten die anderen weiterhin den Plan, den Pokal und ihren Sieg mehr als ausgiebig zu feiern.
Alkohol durften sie alle schon trinken, auch wenn es nach meinem Geschmack noch ein bisschen zu früh für den Totalabsturz war, aber das Rumgrölen störte wirklich.
»Ey, guck mal, Alter. Wir kriegen Besuch.«
Ein großer Blonder mit der Statur eines Bodybuilders hatte mich entdeckt. Sein schwarzhaariger Nachbar, etwas schmaler, aber genauso durchtrainiert, setzte ein breites Grinsen auf.
»Jau, den kenn ich, das ist der Typ vorne vom Kiosk, der hat die Anmeldungen gemacht. Hab ich euch doch erzählt, der Krüppel.«
Ich beschloss, den »Krüppel« zu überhören, und startete stattdessen meine Charmeoffensive: »Seht mal, Jungs, ich kann ja verstehen, dass ihr euch über den Sieg freut.« Mit dem Kopf wies ich kurz auf den Pokal. »Ich gratuliere, aber ich schlage vor, dass ihr es mal ein bisschen langsamer angehen lasst. Hört mit der Sauferei auf, und vor allem lasst das Gegröle. Wir haben hier noch andere Gäste.«
»Die können uns mal. Meinst du etwa den alten Knacker drüben in dem Edelmobil? Scheiß drauf, echt«, aus einem der Klappstühle erhob sich ein weiterer Jüngling und stellte sich mit Bierflasche in der Hand neben seine beiden Freunde, »wir werden heute feiern, dafür haben wir bezahlt.« Die Übrigen blieben sitzen und beobachteten feixend ihre drei Anführer. Die drei, ich schätzte sie auf knapp zwanzig, hatten genug getrunken, um leichtsinnig zu sein, und zu wenig, um zu schwanken. Schade. Mir wäre eine einfache Lösung lieber gewesen.
»Also gut, dann mal ganz offiziell: Ihr gebt jetzt Ruhe, oder ihr packt eure Zelte ein und verschwindet. Natürlich bekommt ihr euer Geld wieder, meldet euch einfach vorne am Kiosk neben der Rezeption. Diese beiden Möglichkeiten gibt es, ihr habt die Wahl.«
Die drei schauten sich grinsend an, und in diesem Moment wusste ich, dass sie die dritte Möglichkeit wählen würden. Angetrunkene Karate-Tiger lassen sich wenig sagen, und sie packen nicht einfach die Zelte ein. Schon gar nicht diejenigen, die »Im Kampf die Besten« sind.
Genau das hatte ich befürchtet. Der Blonde machte zwei Schritte zurück zu seinem Stuhl und griff in eine offene Sporttasche. Was er da hervorholte, war ein Nunchaku: zwei dreißig Zentimeter lange Holzstäbe, die mit einer kurzen Kette verbunden waren. Mein Problem lag auf der Hand. Ein paar Sachen wollte ich bei den Jungs lieber vermeiden: eine Eskalation des Ganzen, Knochenbrüche, große Verletzungen und dauerhafte körperliche Schäden.
Mit einer lässigen Handbewegung wirbelte der Blonde die Hölzer durch die Luft. Beschwichtigend hob ich die rechte Hand. Vor langer Zeit hatte ich mal einen Kurs zur Deeskalation von Konflikten absolvieren müssen.
»So, Alter, jetzt haust du ab! Ist das klar? Wir wollen dich hier nicht noch einmal sehen.«
Ich strich die Deeskalation von meiner Liste. Der Blonde wirbelte das Nunchaku in meine Richtung, die Spitze des gut drei Zentimeter starken Holzstabes zischte an meinem Gesicht vorbei. Ich strich auch die Knochenbrüche!
»Los, Kai, zeig’s ihm! Ey, der hat ja jetzt schon die Hosen voll, der…«
Der Schwarzhaarige vergaß, was ich noch so alles hatte. Ich ließ Kai nicht noch einmal in meine Richtung schlagen. Das Holz wirbelte durch die Luft. Ich drehte den Körper zur Seite, wich dem Holzstab aus und stieß mit der abgewinkelten flachen Hand kräftig zu. Der Stoß traf Kai direkt auf dem Brustbein, er machte ein Gesicht, als wäre er gegen eine Wand gelaufen, stolperte zurück und knallte auf den Hintern.
Sein schwarzhaariger Freund übernahm. Mit einem Schrei stieß er seine Faust nach vorne. Vor gut drei Jahren hätte ich noch mit dem rechten Arm den Schlag geblockt und mit der linken Faust locker zugeschlagen. Jetzt musste ich improvisieren: Den Schlag blockte ich mit der rechten Hand ab, lenkte Arm und Faust meines Gegners nach innen. Freie Bahn in Richtung Kinn. Ich winkelte den Arm ab, holte Schwung aus der Hüfte und traf mit der Spitze meines Ellenbogens den Schwarzhaarigen genau am Kinn. Nicht zu fest, aber es reichte aus, dass sein Kopf in den Nacken flog. Mit zwei Schritten war ich hinter ihm und trat ihm in die Kniekehle seines rechten Beins. Er stieß einen Schmerzensschrei aus und knickte ein. Ein zusätzlicher Stoß in den Rücken, und er landete mit dem Gesicht in der Wiese.
Blieb nur noch der Jüngling mit der Bierflasche übrig. Sein Tritt traf mich in die Seite, damit hätte er mir auch ein paar Rippen brechen können. Blitzschnell fasste ich zu und schnappte mir sein Bein. Tritte haben immer den Nachteil, dass der Kämpfer nur noch instabil steht. Wer schnell genug ist, den wird das nicht stören. Mister Bierflasche war aber nicht schnell genug. Mit seinem Bein unter dem Arm machte ich zwei Schritte zur Seite. Ihm blieb nichts anderes übrig, als auf einem Bein mitzuhüpfen. Hüpfen lassen, Bein zur Seite stoßen, herumwirbeln. Freund Bierflasche brachte die Hüpferei so richtig aus dem Gleichgewicht. Mit der flachen Hand schlug ich zu. Ich hätte auch die Faust nehmen können, aber dann wäre es mit seiner künftigen Familienplanung für immer vorbei gewesen.
Der Schlag in den Schritt reichte aus, dass seine Gesichtsfarbe ins Käsige wechselte, sein Kampfschrei endete in einem hohen Wimmern. Er kippte wie ein nasser Sack zur Seite. Kai war mittlerweile wieder auf den Beinen. Sein Nunchaku ließ er im Gras liegen, war auch besser so, die Dinger waren schließlich nicht umsonst verboten. Mit einem Schrei holte Kai Schwung, drehte sich und kickte in meine Richtung. Dass die Jungs immer schreien mussten. Er hätte besser auf seinen Stand achten sollen. Ich duckte mich, stützte mich mit dem rechten Arm auf und trat zu. Mein Fuß traf ihn seitwärts am Knie. Er schrie noch einmal, diesmal vor Schmerzen. Ich hatte nicht allzu fest zugetreten, aber es genügte für eine Trainingspause von mindestens drei Monaten. Keine großen Verletzungen, keine dauerhaften körperlichen Schäden.
Die drei Angreifer lagen stöhnend im Gras. Kai umklammerte sein Knie, der Schwarzhaarige rieb sich die Kniekehle, und Mr.Bierflasche hielt sich die Hoden fest, fiepte wie ein verängstigter Hamster und kotzte dann den Inhalt mehrerer Flaschen Bier in die Wiese.
Ich schaute die übrigen Karate-Tiger an, die mich mit halb geöffnetem Mund ungläubig anstarrten. Ist schon ernüchternd, wenn die aktuellen Regionalmeister wimmernd vor einem Krüppel im Gras liegen.
»So, Jungs, jetzt ist Schluss. Wer von euch ist noch nüchtern und hat einen Führerschein?«
Zögernd hob einer die Hand. »Ich vertrag kein Bier und keinen Wodka.«
»Gut, wie heißt du?«
»Tim.«
»Also, Tim, du sorgst dafür, dass die Zelte hier abgebaut werden, die Schnapsleichen und deine Freunde in den Bus wandern und ihr in spätestens einer Stunde von diesem Platz verschwunden seid. Du meldest dich vor dem Rausfahren bei mir, und ich zahle dir das Geld für die Platzmiete zurück. Solltet ihr in einer Stunde immer noch hier sein, rufe ich die Polizei.« Ich bückte mich und klaubte das Nunchaku aus dem Gras. »Das hier wird die Polizei sicher ganz spannend finden, was meinst du? Haben wir uns verstanden?«
Tim nickte heftig, und die anderen, zumindest die, die noch einigermaßen klar im Kopf waren, nickten mit.
Ich drehte mich um und ging ohne ein weiteres Wort zur Rezeption zurück.
Vom Wohnmobil kam mir der Oberst entgegen.
»Dass ich so etwas noch einmal sehen durfte.« Er lächelte anerkennend und nahm dann Haltung an. »Oberst Klaus Hartmann.«
»David, Paul David«, antwortete ich. Er runzelte bei der englischen Aussprache meines Namens irritiert die Stirn. Das kannte ich schon, also ergänzte ich: »Doppelte Staatsbürgerschaft. Vater war bei den US-Marines, Mutter aus der Eifel.«
»Aha, aber das da gerade war nicht aus der Eifel, auch nicht von den US-Marines, jedenfalls nicht alles. Ist schon eine Zeit lang her, dass ich eine Krav-Maga-Abwehrtechnik gesehen habe.«
Krav Maga, der hebräische Name für Kontaktkampf, wird vor allem in der israelischen Armee gelehrt. Aber eben nicht nur dort.
»Na ja, ein paar Techniken beherrsche ich ganz gut.«
Der Oberst schnaubte.
»Die und noch ein paar weitere«, gab ich zu.
»Polizei oder Bundespolizei?«
»Keins von beiden«, antwortete ich, »nur ein einfacher Feldjäger, Herr Oberst. Hauptmann Paul David im Ruhestand.«
Jeder andere hätte mir geglaubt. Oberst Hartmann kannte aber offenbar zu viele Feldjäger, und er hatte mich kämpfen gesehen. Er schnaubte noch mal ungläubig, aber er fragte nicht weiter. Das verdiente eine Belohnung.
»Wenn Sie mögen, kommen Sie doch mit Ihrer Gattin heute Abend auf ein Glas Wein vorbei.«
»Hat denn die Platzbesitzerin nichts dagegen?«
»Ich verrate Ihnen was: Die Hälfte des Platzes gehört mir, und meine Tante Helga würde sich sicher freuen. Sagen wir, als kleiner Ausgleich für das Gegröle der Karate-Tiger.«
Der Oberst schlug mir auf die Schulter. »Ihre kleine Einlage da gerade, Hauptmann David, war eigentlich schon Ausgleich genug, die Einladung zum Wein nehmen wir aber trotzdem gerne an.«
Hatte ich mein Glück herausgefordert? Musste ich mir selber beweisen, dass ich es noch konnte, dass ich auch drei Zwanzigjährige schaffte? Vielleicht hätte ich vor drei Jahren anders reagiert…
Vielleicht wäre ich vor drei Jahren auch gar nicht erst angegriffen worden. Damals, als ich noch beide Arme besaß und meine Tage nie nett und durchschnittlich waren.
Monschau, Eifel, sechs Uhr früh
John Clark ArmbrusterIII., seit zwei Jahren US-Botschafter in Berlin, trat aus dem Hotel und atmete einmal tief durch. Die Luft roch hier nicht nur anders als in Berlin, sie schmeckte sogar frischer. Ja, bei Gott, es war die richtige Entscheidung gewesen, für einen Tag dem diplomatischen Trott den Rücken zu kehren, dachte er zufrieden. Einfach in einem kleinen Ort Station zu machen, wo ihn keiner auf der Straße kannte.
Am liebsten wäre es der Security der Botschaft gewesen, wenn er direkt nach seinem Besuch der Air Base in Spandahlem wieder zurück nach Berlin geflogen wäre. Aber er wollte einfach mal ein paar Stunden Ruhe. Monschau gefiel ihm. Die alten Fachwerkhäuser strahlten Geschichte aus, jeder Stein hier war so viel älter als alles, was sie drüben hatten. Gut, das Hotel war nicht das Ritz– na und, wen störte das schon? Er hatte den Abend in einem jahrhundertealten Gewölbekeller genossen, sich das Essen und den Wein schmecken lassen und danach so tief und fest wie schon lange nicht mehr geschlafen.
In der nächsten Woche würde er eine Wirtschaftsdelegation nach Asien begleiten, schon morgen standen Meetings, ein Vortrag vor Studenten und ein Empfang der Botschaft von Kenia in seinem Terminkalender. Aber heute wollte er daran nicht denken. Der Botschafter rückte den Brustgurt seiner Pulsuhr unter dem Laufshirt zurecht. Ein dünnes Piepsen und ein blinkendes Herzsymbol im Display der Uhr zeigten ihm, dass der Gurt jetzt richtig saß.
Er schaute sich kurz zu seinen beiden Begleitern um. Die prüften mit geübtem Blick die Straße rechts und links. Die Männer glichen einander wie ein Ei dem anderen. Gut einen Meter neunzig groß, breite Schultern, kurze blonde Haare, glatt rasiert, wachsamer Blick. Ein Foto von den beiden hätte in jedem Lexikon neben dem Stichwort »Bodyguard« stehen können.
Das war auch ganz gut so, fand Armbruster, die beiden Männer ersparten ihm manchen Ärger. Jeder, der auch nur halbwegs bei Verstand war, würde in ihrer Gegenwart auf eine Provokation oder Schlimmeres verzichten. Die Männer gelangten offenbar zu dem Schluss, dass ihm in Monschau, um sechs Uhr früh, wohl keine Gefahr drohte und er mit seiner Laufrunde beginnen konnte. Auf ein stummes Kommando hin nickten sie ihm gleichzeitig mit unbeweglicher Miene zu. Armbruster seufzte einmal leise, drehte sich um und trabte los. Er hatte sie noch nie lächeln gesehen, von Lachen ganz zu schweigen. Das kam in ihrem Kosmos nicht vor.
Er war da anders: Er liebte es, Spaß zu haben, das pralle Leben mit beiden Händen zu packen und es festzuhalten. Armbruster war Witwer, Kathy, seine Frau, war vor acht Jahren gestorben.
Knapp über fünfzig, durchtrainiert und sonnengebräunt, ähnelte der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika mehr einem Filmstar als einem Politiker. Er war ein begehrter Gast auf jedem gesellschaftlichen Großereignis der Hauptstadt.
Tap-Tap-Tap.
In Berlin hatte er seine feste Strecke. Durch den Tiergarten in Richtung Spreebogenpark, vorbei an der Schweizer Botschaft und weiter zum Fluss. Die Leibwächter hassten es, wenn er häufig dieselbe Strecke lief: zu gefährlich und für einen möglichen Attentäter zu leicht nachzuvollziehen. Aber der Botschafter ließ sich von seinem Ritual nicht abbringen, zu sehr liebte er die morgendliche Stille.
Hier in dem kleinen Eifelstädtchen brauchte er keine besondere Strecke, um Ruhe zu tanken. Er lief weiter, aus dem Ort hinaus, vorbei an einem großen Parkplatz und dann zum Fluss. Den Weg hatte er sich gestern Abend von dem Hotelbesitzer genau beschreiben lassen. Seine Schritte wurden gleichmäßig, waren das einzige Geräusch. Der Morgen gehörte ihm allein. In wenigen Stunden würden sich wieder Heerscharen von Touristen zwischen den alten Häusern hindurchdrängen. Armbruster fand in seinen Laufrhythmus.
Piep. Piep.
Die Laufuhr signalisierte ihm, dass der Pulsschlag noch unterhalb der gewählten Trainingsfrequenz lag.
Tap-Tap-Tap.
Armbruster musste sich nicht extra umschauen, um zu wissen, dass seine beiden Leibwächter in einem Abstand von wenigen Schritten hinter ihm herliefen. Sie hätten ihn auch jederzeit überholen können, aber das war nicht ihre Aufgabe.
Außerdem sind sie ein gutes Vierteljahrhundert jünger als ich, dachte Armbruster. Klar können die mich überholen, so viel Fitness darf ich ja wohl erwarten.
Tap-Tap-Tap.
Der Botschafter atmete die kühle Luft tief ein.
Er lief gut, seinen letzten Halbmarathon hatte er in einer Stunde fünfundfünfzig Minuten geschafft. Nicht schlecht für mein Alter, dachte er zufrieden. Beim nächsten Mal wollte er noch mindestens drei Minuten schneller werden.
Tap-Tap-Tap.
Der Weg vor ihm wurde zu einem schmalen Pfad neben dem Fluss. Hier musste er darauf achten, nicht über eine Baumwurzel zu stolpern.
Piep. Piep. Piep. Piep.
John Clark Armbruster schaute verwundert auf seine Laufuhr. Irgendwas musste mit dem Ding nicht in Ordnung sein. Sein Puls lag sonst immer bei hundertvierzig bis hundertfünfzig Schlägen pro Minute, jetzt stand eine fette Zweihundertzwanzig auf dem Display und blinkte hektisch.
Es kam plötzlich: kein Ziehen in der Brust, kein Gefühl der Enge, keine Taubheit im Arm.
Mitten im Lauf, bei Kilometer sechs an diesem frühen Morgen, explodierte ohne jede Vorwarnung das Herz von John Clark ArmbrusterIII. Der Botschafter stolperte, griff sich kurz mit der rechten Hand an die Brust und starb mit einem erstaunten Gesichtsausdruck.
Piep. Piep. Pie…
Campingplatz Pönterbach
Berlin. Mitglieder der Bundesregierung haben bestürzt auf den plötzlichen Tod desUS-amerikanischen Botschafters John Clark ArmbrusterIII. reagiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte persönlich mitUS-Präsident Obama und sprach der Familie Armbrusters im Namen der deutschen Regierung ihre Anteilnahme aus. Außenminister Frank-Walter Steinmeier nannte Armbruster einen verlässlichen Gesprächspartner und einen engen Freund Deutschlands.
Der 52-jährigeUS-Botschafter war gestern früh in Monschau/Eifel bei einer morgendlichen Laufrunde tot zusammengebrochen. Die Ärzte gehen von einem Herzversagen aus. Armbruster hatte einen Tag zuvor dieUSAir Base Spandahlem besucht und sich dort mit Vertretern derUS-Streitkräfte getroffen. John Clark Armbruster war Witwer und hinterlässt zwei erwachsene Töchter im Alter von26 und28Jahren. Der Diplomat lebte seit zwei Jahren in Berlin. Vor seiner politischen Laufbahn und der Aufgabe als Botschafter derUS-Regierung war Armbruster Vorstandsmitglied desUS-KonzernsJMT. Armbruster wird mit einer Militärmaschine in die Vereinigten Staaten gebracht, die Beisetzung soll am Wochenende in seiner Heimatstadt Boston erfolgen.
Ich schob die Zeitung zur Seite, trank noch einen Schluck Milchkaffee. Es gab schlimmere Arten zu sterben als bei einer morgendlichen Laufrunde. Doch zweiundfünfzig Jahre war kein Alter, von dem Schmerz der Familie ganz zu schweigen.
»Und? Gibt es was Neues in der großen weiten Welt?«
Helga stand in der Tür des Kiosks und strahlte mich an.
»Nichts, was dir hier im Pöntertal Kopfzerbrechen bereiten sollte«, antwortete ich lächelnd.
Helga kam näher. Dass ich sie nicht mehr Tante Helga nennen musste, hatten wir an meinem sechzehnten Geburtstag vereinbart. »Da komm ich mir immer so alt vor«, hatte sie mir damals erklärt. Für mich war sie damals schon alt gewesen, aber das behielt ich für mich. Heute wusste ich es besser. Die sechs Jahrzehnte waren ihr nicht anzusehen. Trotz der grauen Haare, die sie in einer modischen Kurzhaarfrisur trug. »Für Dauerwelle und Haarefärben bin ich noch nicht alt genug«, war ihr Standardsatz zu diesem Thema.
Mit dem Zeigefinger wies sie auf den Artikel über den Tod des US-Botschafters. »Schlimme Sache. Erinnert mich an den Tod deines Onkels.«
Helga schluckte trocken und wischte sich kurz über die Augen.
Mit Hans, meinem Onkel, war Helga fünfunddreißig Jahre verheiratet gewesen. Als Neunzehnjährige hatte sie ihm das Jawort gegeben. Die Ehe der beiden blieb kinderlos. Vielleicht war das der Grund, warum Hans mich, seinen einzigen Neffen, in seinem Testament berücksichtigt hatte. Hans war ein Urbild von einem Mann gewesen. Die Arbeit draußen, die Pflege des großen Campingplatzgeländes, hatte ihm Spaß gemacht, mehr Spaß als seine Arbeit als Physiklehrer. Heute würde man so etwas einen Aussteiger nennen. Jedenfalls warf er irgendwann die Brocken hin, beendete seine Laufbahn als Studienrat und kümmerte sich nur noch um den Campingplatz. Bis zu diesem einen Morgen, als ihn Gäste tot neben seinem Rasentraktor fanden.
»Dass er von Kindesbeinen an ein schwaches Herz gehabt hatte, konnte ja keiner ahnen«, sagte Helga, als hätte sie meine Gedanken gelesen. »Wahrscheinlich war das bei diesem Amerikaner genauso.«
Ich nickte stumm. Was sollte ich auch groß dazu sagen?
Nebenan im Büro klingelte das Telefon. Helga gab sich einen Ruck. »Ich geh schon dran, mein Lieber. Aber vergiss nicht, wenn du nach Nickenich fährst, musst du Mettwürste kaufen, sonst kannst du die Kartoffelsuppe heute Mittag vergessen.«
»Mach ich, Helga. Dein Zettel an der Tür war heute früh schon nicht zu übersehen.«
»Werd mir nicht frech, Junge. Du weißt ja, alte Tanten können ganz fies werden, wenn sie keine Mettwurst in der Suppe haben.«
Gemünd
Für die einen war er der Shootingstar der Sozialdemokraten, für die anderen ein ehrgeiziger Emporkömmling ohne politischen Stallgeruch. Fakt war: Er hatte eine kurze, aber steile Karriere hinter sich. Erfolgreicher Unternehmensgründer, Schattenminister für IT und neue Medien während des vorletzten Wahlkampfes, überraschendes Direktmandat in seinem Wahlkreis, Mitglied im Parteivorstand, neuer Fraktionschef.
Dirk Steffen Wollmers hatte auf der ganzen Linie Erfolg und, mal ehrlich, das Ende war doch noch gar nicht abzusehen. Für DS, wie ihn seine Freunde nannten, war klar, wohin die Reise gehen sollte: Bundeskanzleramt, Berlin.
Davon war Gemünd, ein Teil des Eifelstädtchens Schleiden, noch eine ganze Ecke entfernt. Aber hier hatte alles angefangen, dieser Teil der Eifel war sein Wahlkreis, den er im Handstreich dem erzkonservativen Wahlgegner abgenommen hatte.
Ein verdienter Erfolg. Seine Anteile an der IT-Firma in Köln waren verkauft. Mit dem Geld im Rücken hatte er Wahlkampf gemacht, und zwar nach dem Motto: Ich weiß, wie Wirtschaft funktioniert. Seht her, ich hab es bewiesen. Zeit, dass mal in Berlin jemand das Sagen hat, der mehr als nur das Wort Start-up buchstabieren kann.
DS Wollmers’ Masterplan hatte keine Schwachpunkte.
Gut, seine Wähler und Parteigenossen wären alles andere als begeistert gewesen, wenn sie von dem Schwarzgeldkonto in Liechtenstein gewusst hätten. Das offizielle Bild mit Gattin, Sohn, Tochter und obligatorischem Hund pflegte er vor allem im Wahlkreis und bei Terminen. In Berlin wartete Steffi darauf, dass er sich für sie entschied. Als ob das überhaupt in Frage käme! Aber solange sie mitspielte, sollte es ihm recht sein. »Blond bumst gut«, hatten seine Stubenkameraden beim Bund immer gefeixt. Steffi war ziemlich blond.
Wollmers zog sich die Handschuhe über und rutschte auf dem Sitz der Fitnessmaschine in Position, um seine Armmuskeln zu trainieren. Seit er in der Politik war, achtete er noch mehr darauf, körperlich fit zu bleiben. Das sah gut aus, kam vor allem bei den weiblichen Wählern gut an, und schließlich musste er ohne Probleme die Nächte mit Steffi in den Berliner Edelclubs überleben.
Kraftvoll zog Wollmers den Griff herunter. Alles lief bei ihm bestens, er war auf der Überholspur. Nur eine Sache wurmte ihn: Er hatte nicht mitbekommen, dass Armbruster ganz in der Nähe gewesen war. Das hätte doch gute Wahlkampffotos abgegeben. Er und der US-Botschafter irgendwo in der Eifel, das war transatlantische Freundschaft pur. Da hätte er in Sachen Außenpolitik punkten können. Aber es hatte nicht geklappt, schlimmer noch, diese Tragödie in Monschau hatte ihm zusätzliche Arbeit beschert, weil er eine Presseerklärung aufsetzen musste.
Armbruster war wohl doch nicht so fit gewesen, wie er gedacht hatte. Ihm würde so was nicht passieren, er liebte sein Training. Und wenn er sich die Pressefotos anschaute, was er oft und gerne tat, dann gefiel ihm, was er sah. In zehn Tagen bei dem Kurztrip nach Ghana mit dem Internationalen Roten Kreuz würde er in T-Shirt und Cargohose wieder eine gute Figur machen.
Wollmers arbeitete verbissen an der Kraftmaschine, zweihundertneunzig Pfund Gewicht hoben sich hinter ihm. Er schaute auf die Uhr. Fünfundvierzig Minuten Training hier im Fitnessraum seines Einfamilienhauses, dann duschen und anschließend zur Sitzung in die Stadt. Heike, seine Frau, war mit den Kindern einkaufen, das Handy und das Festnetztelefon waren auf die Mailbox umgeleitet. Fünfundvierzig Minuten Ruhe.
Wollmers wechselte die Maschine. Begann mit beiden Beinen eine Fußplatte nach vorne zu stemmen. Der plötzliche scharfe Schmerz in der Brust presste ihn zurück ins Polster des Sitzes.
Als Dirk Steffen Wollmers, Fraktionsvorsitzender und künftiger Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, starb, knallte das Gewicht der Maschine mit einem lauten Schlag zurück, der durch das ganze Haus hallte. Doch da war niemand, der das hören konnte.
Redaktionsbüro desSPIEGEL, Frankfurta.M.
»Nun, Frau Winkler, ich will ganz ehrlich sein…«
Susanne Winkler stöhnte innerlich auf. Ganz ehrlich sein– ja, was denn sonst? Ich möchte Ihnen gleich mal so richtig die Hucke volllügen? Doch ganz sicher nicht. Aber es waren nicht nur diese wohlmeinenden Worthülsen, die sie aufregten, es war auch das, was da gleich wieder einmal kommen würde. Sie ahnte, wie der Satz ihres Gegenübers enden würde: »Wir haben leider genug Autoren in diesem Fachbereich«, »Ich kann es mir nicht leisten, eine Newcomerin mit so einem heiklen Thema zu veröffentlichen« oder –und dieser Satz ärgerte sie am meisten– »Der Artikel hat noch nicht die inhaltliche Tiefe, die man bei dem Namen Winkler erwarten würde«.
»Nun, Frau Winkler, ich will ganz ehrlich sein, ich hatte anfangs ja noch meine Zweifel, aber Ihre Reportage hier gefällt mir.«
Susanne Winkler riss erstaunt die Augen auf und schluckte ihre bissige Bemerkung gerade noch herunter. Hoppla, das war ja mal was ganz Neues.
Sie musterte Johannes Dieblich, Chef des SPIEGEL im Frankfurter Büro, aufmerksam, suchte in seinem fleischigen Gesicht nach einem Zeichen dafür, dass er es doch nicht ernst meinte. Dieblich aber saß nur da, die Hände vor dem massigen Körper gefaltet, und blickte sie wohlwollend an. Modell: herzensguter Erbonkel.
»Sie sagen ja gar nichts? Sie wollen doch, dass die Story veröffentlicht wird?«
»Doch, doch, natürlich«, beeilte sich Susanne zu antworten, »ich hatte nur… also, ich dachte, ich müsste Sie erst von dem Thema überzeugen.« Schließlich war der Müllskandal, die illegale Entsorgung hochgiftiger Abfälle mitten in einem Naturschutzgebiet Mecklenburg-Vorpommerns, keine leichte Kost. Da standen Arbeitsplätze auf dem Spiel, Jobs in einer Gegend, wo neue Jobs eine Seltenheit waren. Sechs, sieben, acht persönliche Redaktionsgespräche hatte sie bereits hinter sich. Alle waren sie auf eine Absage hinausgelaufen. Von den ungezählten Telefonaten ganz zu schweigen.
»Ich werde das Ganze noch der Hamburger Hauptredaktion vorstellen«, erklärte Dieblich, »außerdem wird unser Justiziar sicher auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Sie wissen ja: Alle im SPIEGEL verarbeiteten und verzeichneten Nachrichten, Informationen, Tatsachen müssen unbedingt zutreffen…«
»…jede Nachricht und jede Tatsache ist peinlichst genau nachzuprüfen«, ergänzte Susanne.
Dieblich nickte wohlwollend. »Sie sagen es, Frau Winkler. Aber ich denke, in spätestens drei, vier Wochen könnten wir die Geschichte hier bringen. Gibt es noch irgendeinen Fallstrick, den wir kennen müssen?«
Susanne schüttelte energisch den Kopf. »Nein, ich habe jeden einzelnen Punkt mit eidesstattlichen Zeugenaussagen, Fotos und Kopien von Dokumenten und E-Mails belegt. Sie finden alles in dem Hintergrunddossier.«
Dieblich schob sich nach vorne auf seine Stuhlkante. Auch wenn er nicht vorhatte, aufzustehen, war dies das sichtbare Zeichen dafür, dass das Gespräch aus seiner Sicht beendet war.
»Na dann. Willkommen an Bord, Frau Winkler. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ach ja, eines noch. Sie wissen sicher, dass wir nicht mehr die fürstlichen Zeilenhonorare von früher zahlen, schließlich stehen wir auch im Wettbewerb. Und Sie als Anfängerin, ich denke, Sie verstehen, was ich meine.«
Susanne vermied es, nachzufragen, wie hoch das Honorar sein würde. Ein Fehler, sicher, aber im Moment war sie einfach nur glücklich darüber, dass ihre Geschichte endlich abgedruckt wurde. Das Telefon auf dem penibel aufgeräumten Schreibtisch intonierte leise eine Variation des Boléros von Ravel. Dieblich streckte ihr die Hand entgegen. »Wenn Sie erlauben, da muss ich wohl drangehen. Wir sind ja fertig– oder?«
Als Susanne aufstand, sah sie kurz Dieblich zusammenzucken. Diese Reaktion kannte sie schon. Mit ihrer Größe von einem Meter zweiundachtzig überragte sie, auch mit flachen Absätzen, viele Männer. Das erschreckte die Herren offenbar. Sie schüttelte Dieblich die Hand. »Meine Kontaktdaten stehen auf dem Manuskript, rufen Sie mich doch bitte einfach an, wenn Sie noch Fragen haben.«
Dieblich nickte stumm, griff bereits zum Telefonhörer und ließ sich in seinen Schreibtischstuhl zurücksinken.
»Ja, Dieblich hier… ah, Sie sind es…«
Susanne ging aus dem Zimmer, den Gang runter waren die Toiletten. Am Waschbecken drehte sie das kalte Wasser auf und wusch sich einmal durchs Gesicht. Tief durchatmen, ermahnte sie sich, du hast es geschafft. Ein Jahr lang hatte sie die drei Punkte ihrer inneren Liste abgearbeitet.
Erstens: Es ist mir egal, wie groß ich bin, ich trage trotzdem High Heels, wenn’s mir passt.
Zweitens: Ich werde fünfzehn Kilo abnehmen. Schokolade ist kein Trost.
Und drittens: Ich kriege eine Story beim SPIEGEL unter.
Sie hatte diese Liste mit den letzten Nougatpralinen und einem Glas Prosecco besiegelt, jetzt endlich konnte sie auch den letzten Punkt streichen.
Leicht war es nicht gewesen, vor allem die Sache mit der Schokolade, aber es hatte sich gelohnt, und die alten Jeans passten wieder.
»Gut gemacht, Kleine!«, lobte sie ihr Spiegelbild. Das muss gefeiert werden, mindestens mit einem großen Salat und einem Glas Weißwein bei Bellini.
Als sie auf dem Weg zum Ausgang an der halb geöffneten Tür Dieblichs vorbeikam, telefonierte der Bürochef immer noch.
»Ja, natürlich hab ich Ihrer Schwester nichts gesagt…«
Susanne blieb wie angewurzelt stehen.
»Hören Sie, wir haben einen Deal, ich bringe die Story Ihrer Schwester, die hätte ich sogar so genommen, wenn ich sie denn auf den Tisch gekriegt hätte. Was? Nein, wirklich… sauber recherchiert, flotte Schreibe, mich wundert, dass die nicht andere längst gebracht haben. Ja… trotzdem, Sie haben es mir versprochen. Ihre Schwester wird veröffentlicht, und wir kriegen die Story über die Rüstungsgeschäfte zum Sonderpreis von Ihnen. Ja…«
Susanne spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. Sie riss die Tür auf, funkelte Johannes Dieblich wütend an.
»Bestellen Sie meinem Bruder, dass ich auf seine Hilfe pfeife. ›Flotte Schreibe, gut recherchiert?‹ Was haben Sie denn erwartet– einen Artikel für die Schülerzeitung?« Susanne Winklers Stimme bebte vor unterdrückter Wut, und Dieblich sank in seinem Sessel zusammen.
»Ja, machen Sie ruhig den Deal mit meinem Bruder, aber ich verlange den vollen Honorarsatz pro Zeile, Ihre Märchen über den Wettbewerb erzählen Sie einfach der nächsten dummen Gans, die keinen Bruder mit zwei Pulitzern hat.« Susanne ließ Dieblich keine Gelegenheit für eine Erwiderung, sondern drehte sich um und ließ einen völlig verdatterten Bürochef zurück.
Dieblich schnaubte empört. Irgendjemanden würde er jetzt gern anbrüllen, Roger Winkler am anderen Ende der Telefonleitung kam dafür leider nicht in Frage. »Haben Sie das gehört, Winkler? Haben Sie…« Dieblich brach mitten im Satz ab. Roger Winkler lachte, kein leises, dezent amüsiertes Lachen, sondern laut und dröhnend.
Als Susanne Winkler wieder in ihrem alten Golf saß, schloss sie die Augen und ließ den Kopf stöhnend auf das Lenkrad sinken. Mit der Faust schlug sie wütend auf das Armaturenbrett. Dann richtete sie sich auf. Wo war das verdammte Handy? Sie hatte es doch hier im Auto gelassen. Schließlich kramte sie zwischen Jacke, leerer Plastiktüte, Taschenschirm und einer halb vollen Wasserflasche auf dem Beifahrersitz ihr Telefon hervor. Sie wusste, dass ihr Bruder den Anruf jetzt ganz sicher nicht annehmen würde, aber das war ihr egal. »Hallo, hier ist die Mailbox von Roger Winkler, hinterlassen Sie Name und Rufnummer. Ich melde mich, ziemlich sicher.«
»Roger! Hör mir genau zu: Ich. Bin. Sauer. Stinksauer! Das kostet dich eine Kleinigkeit, du Arsch!«