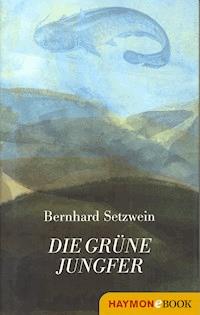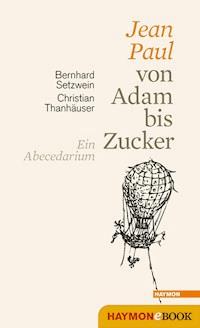Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem Oktobertag des Jahres 1995 taucht in München ein seltsamer Fremder auf, der sich als "Erster Sekretär Sämtlicher Jahweischer Dienste" ausgibt. Mister Fulizer, wie er sich unter anderem nennt, soll die Stadt vor dem von allerhöchster Stelle angeordneten Strafgericht bewahren. Voraussetzung dafür: es lassen sich "sieben Gerechte" finden, die in dieser Stadt gelebt oder sich aufgehalten haben. Um diese schicksalhafte Frage zu klären, versichert sich Fulizer der Mitarbeit des verkrachten Schriftstellers Hermann Kreutner. Dieser kennt die Geschichte und die Geschichten der Stadt wie kaum ein anderer (jedenfalls behauptet er das). War zum Beispiel Franz Kafka einer dieser "sieben Gerechten"? Er war im November 1916 auf Lesereise in München, traf dort durch Zufall Adolf Hitler im Cafè Heck am Hofgarten und hätte ihn beinahe auf ein anderes Gleis gebracht. Oder gehörte der jüdische Kommerzienrat Jakob Lehmann dazu? Er wurde im März 1933 von einem jungen Nazi auf offener Straße verhaftet und in dessen Wohnung verschleppt, wo sich dann Seltsames abspielte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Setzwein
DAS BUCH DER SIEBEN GRECHTEN
Roman
Haymon
Ungekürzte E-Book Ausgabe 2014
© 1999
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7712-5
Cover: Benno Peter
Satz: Haymon-Verlag
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Inhalt
VORSPIEL IN PRAG
ERSTES KAPITEL
Die Katakomben unterm Königsplatz / Wohnt hier Niegehört Versager? / Dieser Schriftsteller-Nachmittag glückt, oh ja, doch!
ZWEITES KAPITEL
Zusammenstoß am Hofgarten / Kreutner wird bei seinem Namen genannt / Die sieben Gerechten
DRITTES KAPITEL
Kafka meets Hitler / Der Hungerkünstler / Kreutner flieht in den Untergrund
VIERTES KAPITEL
Die Somnambule und das Biest / Lederjacken machen und bekommen Ärger / Fulizers Nachtreise
FÜNFTES KAPITEL
Auf einer Streuobsderwiese spät nachts / Er muß ja nicht, ihm bleibt ja die Parabellum / Am »Elysium« zur Hölle geschickt
SECHSTES KAPITEL
Full of Bourbon / Vorsehung, was is’n das? / Krakau meldet sich
SIEBTES KAPITEL
Montagmorgen alles neu / Vom Geblüt her: Strudelrasse! / Gear als Schachterlteufel
ZWISCHENSPIEL IN KRAKAU
ACHTES KAPITEL
Kreutner findet ein offenes Ohr / Nächtlich im Archiv / Wer gehorcht wem?
NEUNTES KAPITEL
Kreutner am Hart / Plötzlich antwortet die Chat-box / Und Radelspeck, was (er-) findet der?
ZEHNTES KAPITEL
Hängt ’ne Traumsau am Morgenwehr / Gear muß den Bluthund machen / Ein unschuldig gefallenes Mädchen / Gowno!
ELFTES KAPITEL
Siehst du, Toni, der Herr Kommerzienrat mag ein Schweinernes! / Ehrliches Lügen / Bei seinem Licht im Dunklen geh’n
ZWÖLFTES KAPITEL
In der »news bar« / Cash auf die Hand / Die »Anti Screen Foundation«
DREIZEHNTES KAPITEL
Der Ort ist in dir / Brand in der Herzog-Rudolf-Straße / Wie schneidet man den Bart? / Ein Zug fährt ab
ENDSPIEL IN WIEN
EPILOG
»… jeder Schwur hängt am siebten.«
Josef ben Abraham Josef Gikatilla, Kabbalist des 13. Jh.s
VORSPIEL IN PRAG
»Ein Gott, der auf die Erde käme, dürfte gar nichts andres tun, als Unrecht.«
FRIEDRICH NIETZSCHE
1.
Das Notwendige mit dem Angenehmen zu verbinden, diesen unausgesprochenen Hintergedanken hegten die meisten Mitglieder der Jahweischen Kongregation, als sie sich darauf einigten, die nächste der vierteljährlich einzuberufenden Sitzungen in Prag abzuhalten. Auch wollte man dem alten Herrn eine Freude machen, denn in Prag würde er sich ganz jenen nostalgischen Stimmungen und leicht weinerlichen Reminiszenzen hingeben können, zu denen er in letzter Zeit des öfteren, von den Tagesaktualitäten und anstehenden Entscheidungen mehr und mehr überfordert, Zuflucht nahm. Kloster Strahov, die Sankt-Veits-Kathedrale, Peter und Paul, all die Zeugen jener guten alten Zeit, als seine Aktien noch besser standen, wie würden sie ihm gefallen! Allein schon die Namen der zu seinen Ehren erbauten Hallen in dieser Stadt, die zu inspizieren er jedoch noch nie die Gelegenheit gefunden hatte, würden ihn in eine aufgeräumtere Stimmung versetzen: »Kirche der siegreichen Muttergottes«… klang das nicht wie ein Schlachtruf aus glücklicheren Kreuzfahrerzeiten!
In einem Rückgebäude des Waldsteinpalais am Valdštejnské náměstí, einen Stock über den bescheidenen Büroräumen des tschechischen PEN-Clubs, würde man ohne größere Probleme, soviel hatte der Planungsstab schon eruiert, einen Tagungsraum zur Verfügung gestellt bekommen. Der Alte war von der Idee geradezu entzückt:
»In Prag, da waren wir ja noch nie«, hatte er in Ulan-Ude, dem vorherigen Tagungsort, ausgerufen, als man, wie immer, unter dem Tagesordnungspunkt »Allfälliges« am Ende der Konferenz festlegte, wo die nächste Zusammenkunft stattfinden solle. »Bloß kein Ulan-Ude mehr«, war sein zorniger Einwurf, »wer ist nur auf dieses gottverlassene Ulan-Ude gekommen. Imbecils! Das ist ja noch schlimmer als letztes Jahr im Kongo! Allein dieser Gestank hier. Man sollte es ausradieren, dieses Ulan-Ude. Kann man hier nicht etwas in die Luft gehen lassen, Fulizer, irgendeine Fabrik, ein Kraftwerk?«
Der Koordinator sämtlicher Jahweischen Dienste zuckte zusammen, schließlich war es seine Idee gewesen, den schwerfälligen Konferenztroß an den Baikalsee zu scheuchen. Er wußte, er würde diese Scharte wieder auswetzen müssen. Da fiel ihm als rettende Idee Prag ein.
Es hob die von einigen Konferenzteilnehmern an dieser heiklen Stelle regelmäßig angezettelte Diskussion darüber an, ob ein solcher Tagungstourismus nicht höchst entbehrlich, ja angesichts der dramatischen Weltlage gar verwerflich sei, doch der Chef fegte Argumente gegen die turnusmäßigen Konsultationen, die man möglichst gleichmäßig über alle Kontinente verteilte, mit der Bemerkung hinweg:
»Eine Jahweische Kongregation, meine Herren, hat überall zu sein und nirgends. Heute Kapstadt, morgen Wladiwostok. Früher hieß es einmal, Sie scheinen das vergessen zu haben: Der Geist des Herrn weht überall. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, meine Herren! Uns nimmt ja sowieso schon niemand mehr ernst. Und jetzt wollen Sie sich völlig von der Bildfläche verabschieden, oder wie? Wir müssen in die Offensive gehen. Das Gebot der Stunde heißt: Omnipräsenz demonstrieren.«
Als der alte Herr dann Anfang Oktober mit seinem Mitarbeiterstab in Prag eintraf, hatten die für das Besuchsprotokoll Verantwortlichen den alten Nepper- und Schleppertrick vorbereitet, mit dem man jeden Neuling einfängt, um ihm Staunen und Begeisterung restlos abzuknöpfen. Man muß ihn zur Talstation der Kabinenbahn bringen, die hinauf zur Volkssternwarte und Sankt-Laurenz-Kirche führt.
Während der Auffahrt sollte man darauf achten, daß der Pragneuling jetzt, da es noch zu früh wäre, nicht der Versuchung erliegt, sich umzuwenden und den Blick auf die am rechten Moldauufer gelegene Altstadt zu richten, man schaue nur immer den bewaldeten Hügel hinauf, auf den die Kabinenbahn von einem am Boden über Kurbeln laufenden Stahlseil hinaufgezogen wird. An der oberen Station angekommen, wird man den Fußweg durch Streuobstwiesen wählen und durch mit Äpfeln und Birnen behängte Zweige hindurch den Hradschin auftauchen sehen. Am Kloster Strahov sind es nur noch wenige Schritte bis zu einer Art Terrasse. Tritt man auf die hinaus, liegt mit einem Mal ganz Prag vor einem ausgebreitet da: die Karlsbrücke mit ihren spitz zulaufenden Pfeilern im Vordergrund, dahinter, blattgoldbeschlagen vom Abendlicht, Teynkirche und Pulverturm.
Auch bei dem alten Herrn verfehlte diese Ent- und Verführungstaktik ihre Wirkung nicht. Minutenlang stand er wort- und regungslos vor diesem Panorama, das nur für ihn aufgebaut schien, und zum ersten Mal beschlichen ihn so etwas wie leise Wehmut, düstere Ahnung. Ihm wurde plötzlich klar, was da eigentlich geopfert würde, falls der von der Jahweischen Kongregation auf den letzten Krisensitzungen beschlossene Aktionsplan mit dem Arbeitstitel »Die Heimsuchung Mitteleuropas« tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt würde.
Die Mitarbeiter und Berater des Chefs bemerkten, wie sich dessen Gesicht verdüsterte, ohne daß sie ahnten, warum. Um ihn bei Laune zu halten und ihn für die anstehende Sitzung, auf der gravierende Entscheidungen würden fallen müssen, positiv zu stimmen, absolvierte man mit ihm in den Vormittagsstunden ein gerafftes Sightseeing-Programm. Am Altstädter Ring wollte er angesichts des monumentalen Jan-Hus-Denkmals wissen, wer diese ausgemergelte Gestalt sei – man hatte es ihm schon vor 400 Jahren erklärt, aber sein Kurzzeitgedächtnis ließ in letzter Zeit merklich nach. Außerdem mochte er Nörgler und Besserwisser wie diesen Jan Hus nicht sonderlich, die ständig an dem herumzumäkeln hatten, was schließlich gemäß seinen Direktiven von wenn auch manchmal unfähigen Statthaltern ausgeführt wurde.
Besser gefiel ihm da schon die Geschichte, die ihm seine Berater auf der Karlsbrücke erzählten.
»Braver Mann, dieser Wenzel«, bemerkte er sichtlich bewegt. Übrigens war wie immer Abschirmung und Geheimhaltung dieser Mission des alten Herrn vom Jahweischen Sicherheitsstab aufs beste vorbereitet worden, selbst auf der Karlsbrücke im dichtesten Gedränge, wo sich der Chef besonders für die drolligen Franz-Kafka- und Rabbi-Löw-Marionetten der fliegenden Händler interessierte, schöpfte niemand den geringsten Verdacht, wer sich da unter die Menschenmassen gemischt hatte. Ja einer der spendier-launisch gestimmten Touristen warf ihm sogar einen 200-Kronen-Schein in den Hut, den der Alte, der ungewohnt warmen Oktobersonne wegen, abgenommen hatte und, zu Mißverständnissen einladend, vor der Brust hielt. Die runden, schwarzen Gläser seiner Sonnenbrille taten ein übriges dazu, den falschen Eindruck überhaupt erst aufkommen zu lassen.
Nach Hradschin und Sankt-Nikolaus-Kirche führte man den alten Herrn zum Mittagessen. Am Maltézské náměstí saß man im Freien, der Chef zeigte sogar, seit langem einmal wieder, einen gesegneten Appetit. Von hier aus war es auch nicht mehr weit bis zum Ort der Konferenz am Valdštejnské náměstí. Den Nachgeschmack der unvergleichlichen Palatschinken mit den süßen Sahnehäubchen noch auf der Zunge, eröffnete er die Sitzung und kam, ohne viel Umschweife, zu der Frage, die den Krisenstab diesmal zu beschäftigen hatte.
»Wer ist als nächstes dran? Etwa die in Grosny?«
»Schon erledigt, Chef. Dort sieht es aus wie in Dresden fünfundvierzig.«
Der Alte brummte mürrisch. In letzter Zeit kam es immer öfter vor, daß er sich solche Blößen gab. Was sollten die untergeordneten Abteilungsleiter der Jahweischen Dienste von ihm denken? Daß er schon nicht mehr wußte, was man vor einem Vierteljahr auf der letzten Konferenz besprochen und ausgemacht hatte? Unwirsch fuhr er fort:
»Na gut! Und Sarajewo? Was ist mit Sarajewo? Sind die schon dran gewesen«, er massierte mit Daumen und Zeigefinger seine Geheimratsecken, »hatten wir nicht beschlossen: Als nächstes knöpfen wir uns Sarajewo vor?«
»Wir sind dran, Chef! Nicht mehr lange und wir haben es soweit wie seinerzeit Coventry.«
»Vukovar ist schon erledigt. Nicht mehr wiederzuerkennen«, mischte sich der diensteifrige Ducee ein. Damit hatte er wohl recht, nur vergaß er, daß innerhalb der Jahweischen Kongregation längst kein Mensch mehr von Vukovar redete. Daß Ducee der Neuling in der Runde war, erkannte man neben einem solchen Lapsus schon daran, daß er seine Unsicherheit hinter einer Wehrmauer aus Aktenordnern zu verschanzen versuchte.
»Und? Zeigt das irgendeine Wirkung? Ich meine, sind wenigstens die halb zerstörten Kirchen wieder voll? Sie waren es doch«, zum Glück für Ducee lenkte der Alte seine Attacke nun auf Fulizer um, der sein kariertes Sakko ausgezogen und demonstrativ die Ärmel seines weißen Nylonhemdes nach oben gekrempelt hatte, »der diesen famosen Plan ausgeheckt hat. Ein paar mittlere Katastrophen, und die Leute laufen uns scharenweise in die Arme zurück. Das war doch Ihre Prognose?!«
»Sicher, Chef, wir müssen nur noch etwas Geduld haben. Die Leute werden nervös. In fünf Jahren kommt sowieso der große Amoklauf. Es wird sein wie bei der ersten Jahrtausendwende. Sie werden ihre Vermögen verschenken und wieder barfuß nach Santiago de Compostela pilgern. Wir müssen die Panik noch etwas anschüren. Tausende Erdbebenopfer in Japan, das war schon nicht schlecht!«
Ein kurzes Lächeln huschte über Ducees neunmalkluges Erstsemestergesicht: Das Erdbeben war seine Idee gewesen, die er mit einem musterschülerhaften »Chef!-Chef!-Ich-weiß-was«-Gehabe auf der letzten Sitzung eingebracht hatte. Fulizer rapportierte weiter:
»Die in Südamerika haben wir schon weichgeklopft, sitzen vor ihren Hausaltären und bibbern den Rosenkranz rauf und runter. Unser ganzes Augenmerk sollte nun der Europa-Mission gelten: Selbst dort, wo sie sich immer in Sicherheit wähnten, in ihrer properen, satten, schönen, alten Welt, kommt langsam Endzeitstimmung auf. Wir dürfen jetzt nicht lockerlassen. Im Gegenteil. Wir müssen noch eins drauflegen.«
»Also gut!« lenkte der Chef ein, »wer ist als nächstes dran? Wie wär’s mit Lissabon? Oder Budapest? Wir müssen etwas Symbolträchtiges finden, diesmal. Eine alte Kulturhauptstadt. Eine Insel der Seligen, eine Oase, wo sie glauben, von allem verschont zu bleiben. Sie sollen spüren, diese Würmer, daß wir sie überall erwischen können.«
»Wie wär’s mit Venedig«, wagte sich Ducee schon wieder keß hinter seiner Verschanzung hervor. »Venedig sehen und sterben, davon träumen sie doch alle, diese Lemminge, warum sollen wir ihnen den Spaß nicht gönnen.«
Fulizer mußte immer mehr über den Jungen staunen: Sogar schon den für diese Runde unerläßlichen Zynismus hatte er sich zugelegt, ein wirklich lernfähiger Bursche. Mit einem Grinsen im Gesicht schlug Ducee vor:
»Wir könnten ein kleines Hochwässerchen schicken, mitten in der Hochsaison. Oder eine nette Epidemie ausbrechen lassen, sollte kein Problem sein, bei der Kloake, die da herumschwimmt.«
»Unsere Abteilung«, meldete sich nun auch Schrett, Leiter der Sektion Süd- und Mittelamerika, erstmals zu Wort, »hat die Option Mexiko City einmal in der Computersimulation durchgespielt. Ich kann Ihnen sagen, Chef: maximale Schockwirkung bei vergleichsweise minimalem Einsatz. Jeder Schlag ein Treffer. Da ist praktisch gar kein Platz mehr zum Danebentreffen, so wie die da hausen.«
»Aber das ist doch genau das, womit die halbe Welt rechnet. Da können wir gleich Kalkutta nehmen. Nein, es muß ganz unerwartet einmal die treffen, die nicht im geringsten damit rechnen!«
»Wie wär’s mit Frankreich«, platzte Ducee dazwischen.
Auf die Gelegenheit hatte Fulizer nur gewartet. Mal schauen, wie unser vorlauter Einserschüler mit kleinen, gezielten Nackenschlägen fertig werden würde.
»Sie sollten die Berichte lesen, die ich Ihnen hingelegt habe, Ducee: In Frankreich leistet unsere Destabilisierungseinheit bereits seit Monaten ganze Arbeit. In Paris traut sich bald kein Mensch mehr in die Metro, wegen der algerischen Terrorbomben, was wollen Sie da noch mehr!«
Ducee suchte hektisch in seinen Akten nach Berichten, die er übersehen haben könnte. Mappe um Mappe wuchs die Ringmauer noch höher, hinter der sich Ducee auf einmal wie belagert vorkam.
»Wir brauchen eine nette, freundliche, saubere Stadt. Eine, wo jeder gerne leben würde. Keine Slums, keine Kriminalität, keine radikalen Gruppen, die sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Berge womöglich in der Nähe, ein paar Badeseen, die perfekte Freizeit-City, wo die Leute mit dem Gefühl leben: Ist doch eine einzige Party, das Leben!«
»Lausanne!« Der Vorschlag kam von einem der Sachbearbeiter, die in der zweiten Reihe saßen; in der ersten, direkt am zum ovalen Konferenztisch mutierten Lagerfeuer, durften nur die Häuptlinge Platz nehmen. Für gewöhnlich kamen die Zuträger der rhetorischen Brillanz in der ersten Reihe nur dann zu Wort, wenn ihren Chefs nach den prinzipiellen markigen Worten die Lust zu detailgenauen, faktenunterfütterten Kurzreferaten fehlte. Fulizer nahm den eingeworfenen Vorschlag dennoch auf:
»Lausanne, ja, erfüllt zwar die meisten der eben genannten Kriterien, hat aber ein entscheidendes Manko: Wen würde es wirklich jucken, wenn Lausanne plötzlich nicht mehr auf der Landkarte stünde? Nein, unser Zielobjekt muß das gewisse Etwas haben, Kunst und Kultur, Lebensstil, so etwas wie italienisches Flair, das bestimmte savoir vivre, Sie verstehen mich. Nachdem wir zugeschlagen haben, muß alle Welt jammern: Warum mußte es ausgerechnet diese Stadt treffen, die doch eine der liebenswertesten war, eine der wohnlichsten. Nur so bekommen wir jenes bis auf die Knochen gehende Erschrecken, das wir doch mit der ganzen Aktion erreichen wollen.«
Schrett meldete sich zu Wort: »Auch wenn es nicht in meinen direkten Zuständigkeitsbereich gehört: Ich habe da über unsere Leute beim argentinischen Geheimdienst etwas erfahren, was Sie interessieren dürfte. Die bosnischen Serben planen Racheakte für den Fall, daß die NATO sich weiterhin in den Krieg einmischt und noch in Montenegro und in den Kosovo einmarschiert. Wir wissen, die Serben haben da etwas vor, was sich bestens mit unseren Plänen verbinden ließe.«
Alles horchte auf, selbst der Chef, in der letzten Viertelstunde immer tiefer in seinen Sessel gesunken, stemmte sich an den Armlehnen zu neuer Aufmerksamkeit empor.
»Dank ihrer Connections haben die Serben in einigen der ehemals sowjetischen Splitterstaaten eine ansehnliche Menge von mittel bis stark radioaktivem Müll zusammengesammelt. Das alles wollen sie in einen Sprengkopf packen und mit einer Mittelstreckenrakete über einer Großstadt zum Explodieren bringen, die in einem der führenden NATO-Staaten liegt. Das Zeug würde, schön fein verteilt, auf eine Millionenbevölkerung herunterrieseln. Wir müßten nur, durch von uns eingeschleuste Mitarbeiter, dafür sorgen, daß das Ding auch wirklich dorthin gelenkt wird, wo wir es hinhaben wollen.«
»Fulizer, können Sie das in die Hand nehmen?«
Der Chef war auf einmal wieder hellwach. Der Koordinator sämtlicher Jahweischer Dienste nickte mit zusammengepreßten Lippen.
»Okay, dann lassen Sie uns das Zielobjekt festlegen. Ducee, eine Europakarte! Subito!«
Die Mitglieder der Kongregation beugten sich über die von Ducee auf dem Konferenztisch ausgerollte Landkarte.
»Von Bosien aus gut erreichbar …«
»Vor allem zielgenau erreichbar. Nicht daß uns die strahlendenen Sterntaler in irgendeinen frisch geodelten Acker fallen!«
Alle sahen dasselbe, daß es nämlich das Nächstliegende wäre, Rom ins Visier zu nehmen, die Rakete der Serben bräuchte nur über die Adria geschickt zu werden, vielleicht läppische 500 Kilometer Distanz. Andererseits: Rom war die letzte Zuflucht des alten Herrn, wenn sein Weltverdruß wieder das Sintflutstadium erreicht hatte und er nur mehr herumbrüllte: »Ich lass’ sie ersaufen, alle!« Nach Rom gebracht, beruhigte der Chef sich meist wieder.
Fulizer versuchte abzulenken. »Es muß einen der größeren Staaten in der NATO treffen, wegen der Glaubwürdigkeit. Auf Italien würden die Serben nie schießen, höchstens nach Frankreich …«
»… oder nach Deutschland!« war Ducee vorlaut.
Der alte Herr beugte sich nun näher über die Karte. Sein Finger wanderte Richtung Norden, fuhr in kleinen Kreisen um den mit »Wien« gekennzeichneten Punkt herum, wischte immer wieder über diese Stelle, als ob dadurch der Schleier verschwände, der es dem alten Herrn unmöglich machte, den Namen zu lesen. Fulizer sprang bei:
»Wien … das ist Wien, Chef. Liegt aber in Österreich, was sich weitgehend neutral verhält. Uninteressant für die Serben, vollkommen uninteressant.« Der Chef sah von der Karte auf, musterte Fulizer. Der stach mit dem Zeigefinger, ohne lange suchen zu müssen, auf einen Punkt etwas weiter westlich:
»All unsere Kriterien erfüllen und nicht allzu weit vom Schuß der Serben entfernt liegen würde eigentlich nur ein Zielobjekt: München!«
Der Alte schaute gar nicht mehr auf die Karte. Diese von blauen Flußkrampfvenen und roten Landesgrenzenarterien durchzogene schrumpelige Vettel Alteuropa verschwamm ihm sowieso vor den Augen. Er blickte durch die Runde, jeden seiner Hauptabteilungsleiter fest entschlossen fixierend:
»Also, meine Herren, Sie haben’s gehört: München!«
2.
»Vielleicht sind fünfzig Fromme in der Stadt; willst du sie wirklich vertilgen?
Willst du dem Ort nicht lieber verzeihen um der fünfzig Frommen willen, die in der Stadt sind.«
GENESIS, Kapitel 18, Vers 24
Am Abend ließ der alte Herr ein Gewitter, das sich in den Herbst verirrt hatte, niedergehen über Prag – ihm stand zu vorgerückter Stunde der Sinn noch nach etwas Theaterdonner. Vom Kloster Strahov aus, wo die Jahweische Kongregation Quartier bezogen hatte, konnte er über die ganze Stadt schauen und dabei zusehen, wie die Blitze über den Dächern und Türmen Prags züngelten. Schließlich verkroch sich das Unwetter hinter die östlich gelegenen Hügel, nur mehr fern grollten die Donner, als es auch im Leib des alten Herrn leise rumorte. Die Nachmittagssitzung hatte sich bis in den späten Abend hingezogen, und seit den unvergleichlichen Palatschinken am Maltezske náměstí hatte der Chef nichts mehr zu essen bekommen: Ihm knurrte der Magen. Erst ein leises, anschwellendes Grollen von unten herauf, dann ein Donnern in der Nähe des Solarplexus. Wenn man genauer hinhorchte, bemerkte man den Gleichklang: draußen das Wettergrollen, im Inneren das Magendonnern. Der alte Herr freute sich: Einmal mehr fiel ihm auf, wie sinnreich und wohlgeordnet er alles eingerichtet hatte. Omnia ubique! Das wäre doch eigentlich eine Erkenntnis vom Kaliber »später Goethe«, dachte sich der Alte, aber dem konnte man einen solchen Sinnspruch ja nun nicht mehr in die Feder diktieren. Manchmal kam er sich richtig einsam und verlassen vor: All seine Lieblinge schon von den Würmern aufgefressen, und die Lebenden waren’s nicht mehr wert, daß man sich zu ihnen hinabneigte. Ja, vielleicht diesem Reichsdeutschen, den er vor etlichen Wochen hatte hundert werden lassen, dem könnte man so eine feine Beobachtung allen Weltzusammenhanges in den Füllfederhalter fließen lassen. Wie hieß er doch gleich wieder …?
Fulizer trat ins Zimmer. Wie jeden Abend kam er, um dem alten Herrn bei seinem Kampf mit Hosenträgern und Sockenhaltern, mit Bruchband und Rheumawäsche zu sekundieren. Keinen anderen als Fulizer, die treue Seele, duldete der Chef bei dieser allabendlichen Zeremonie in seiner Nähe. Die beiden nutzten diese letzte gemeinsame Stunde des Tages, während alles Überflüssige abgelegt wurde und die nackten Tatsachen zum Vorschein kamen, zu einem bilanzierenden Gespräch, zu einer Bewertung dessen, was der Tag gebracht hatte. Im Zwielicht der Dämmerung, während der »blauen Stunde«, verloren die Probleme ihre scharfen Ecken und Kanten, Skrupel und Gewissensbisse zogen das Nachthemd an und legten sich zur Ruhe.
Fulizer kam gerade aus dem Badezimmer zurück mit einem Glas Wasser, in das er die Tablette für die Reinigung der Zahnprothese geworfen hatte, als der Chef, auf der Bettkante sitzend, fragte: »Dieses München, Fulizer, war ich schon jemals dort? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern!«
»Wir hatten schon alles vorbereitet, damals, Chef. Sie wollten sich unters Volk mischen, bei der Einweihung der Michaelskirche.«
»Wann war das?«
»Im selben Jahr, in dem Sixtus V. gestorben ist. Ich weiß es noch, weil dann wieder nichts wurde aus der München-Visite. Wir mußten in Rom bleiben. Schade. Ist immerhin nach St. Peter die Kirche mit dem zweitgrößten Tonnengewölbe der Welt.«
»Was?«
»St. Michael.«
»Und ich war noch nie dort?«
»Leider nicht. Lediglich Schrett, damals noch Mitteleuropa-Leiter, und ich hatten da in den Zwanzigern ein paar Missionen zu erledigen. Wir mußten diesen Wehrmachtsgefreiten aus Braunau aufs richtige Gleis bugsieren, die ›ersten 7 wackeren Kämpen‹ im Sterneckerbräu und was noch alles folgte. Achtunddreißig dann, Arcisstraße, Führerbau, das haben wir gut hingekriegt, damit ging alles los.«
»Warum bin ich nie nach München gekommen? Sogar schon Ulan-Ude, aber nie München!« Der Alte stellte das Glas wieder zurück. »Und jetzt wird es bald zu spät sein!« Er blickte Fulizer direkt ins Gesicht. »Meinen Sie wirklich, wir sollen München …?«
»Sorry, Chef, aber die Kwitl …« Dieses babylonische Kauderwelsch, das der Alte, wo er ging und stand, ausspuckte, klebte einem, wenn man nicht aufpaßte, an wie ein alter Kaugummi. »Sie haben es selbst aufschreiben lassen, und was geschrieben steht …«
»Ich weiß, ich weiß! Aber wir hatten doch noch so einen … Trick, einen Ausweg, eine Ultima ratio, wie sich selbst das auf die Kwitl Geschriebene noch einmal revidieren läßt. Erinnern Sie sich, Fulizer?«
»›Solange die Gerechten in der Stadt vorhanden sind, wird an den Frevlern nicht strenges Gericht vollzogen; sind von ihr die Gerechten fortgenommen, wird an den Frevlern strenges Gericht vollzogene.‹«
»Die Lamedwownik, richtig …«, murmelte der Chef.
»Lamed-waw … sechsunddreißig. Ja, das ist eine der Varianten, daß es sechsunddreißig sein müssen. Dann wieder hieß es fünfzig …«
»Wer räumt da endlich einmal auf, in diesem Durcheinander«, brauste der Chef auf. Jedesmal, wenn die Rede auf die diversen Überlieferungsfehler und Fassungsvarianten seiner Worte kam, packte ihn der nicht ganz unberechtigte Zorn über die ewige Schlamperei bei den für die Editionsfragen Zuständigen. Fulizer konnte darauf jetzt keine Rücksicht nehmen.
»Die mit der Aktion ›Sodom‹ Beauftragten ließen sich damals sogar auf zehn herunterhandeln! – Ich meine, wir hätten uns schließlich auf sieben geeinigt. War es nicht so?«
»Ja, ja«, unterbrach der Chef erneut Fulizer. »O.k., das war mal so eine Phase, so ein Spleen von mir, alles in dieser Siebenzahl zu verstecken. Aber das hört ja nicht mehr auf. – Wie war das gerade mit den Sieben im Sterneckerbräu? Selbst die müssen uns alles nachmachen!«
»Aber es war nun mal Beschlußsache, daß wenn sieben Gerechte in einer Stadt gelebt oder sich aufgehalten haben, wir die Finger davon lassen.«
»Und wie sieht’s aus?«
»Mit München?«
»Durak«, murmelte der Chef, »von was reden wir denn?!«
Warum war er nur so gereizt? Fast schien es, als ob er den Beschluß von heute nachmittag schon bereute. Manchmal konnte man den Eindruck haben, der Chef war nicht mehr der alte …, irgendwie unsicher, zu viele Skrupel, womöglich gar Mitleid mit diesen Erdenwürmern. War aber auch verdammt viel schiefgegangen die letzten Jahrhunderte.
»Müßte man eruieren. Kann ich so aus dem Stand nicht sagen.«
»Na, dann machen Sie mal, Fulizer. Nächste Woche will ich einen ersten Bericht sehen!«
ERSTES KAPITEL
Die Katakomben unterm Königsplatz / Wohnt hier Niegehört Versager? / Dieser Schriftsteller-Nachmittag glückt, oh ja, doch!
„Nun schaut aber dort nach rechts und versucht, auf einem Dachboden einen Mann zu entdecken, der beim Schein einer schwachen Lampe im Nachthemd auf und ab geht. […] Der Mensch, der da oben haust, ist ein Dichter.«
ALAIN RENÉ LESAGE
»… mit nichts, was einen drückt – außer dem Bewußtsein, ein Versager zu sein.«
T. S. ELIOT
BERTHOLD, DAS SCHWEIN! Das hatte er ihm eingebrockt. Unter Garantie! Koschik starrte in das gleißende Scheinwerferlicht einer Taschenlampe, war geblendet. Was sich langsam abzuzeichnen begann im Dunkel hinter der geradezu schmerzenden Lichtquelle, war das fluoreszierende Weiß zweier Schirmmützen, wie sie die Bullen tragen. Koschik war geradewegs einer Polizeistreife in die Arme gelaufen, als er versucht hatte, durch den verborgenen Eingang am zugewucherten Sockel des ehemaligen Ehrentempels in die Nazikatakomben unter dem Königsplatz einzusteigen. Koschik konnte sich nicht vorstellen, daß das illegal war; obdachlose Stadtstreicher konnten doch auch mehr oder minder unbehelligt dort unten ihr Quartier aufschlagen. Was ihm allerdings Schwierigkeiten einbringen würde, das war Koschik klar, noch während er in das Scheinwerferlicht der Bullen blinzelte, waren die Trophäen, die er in seinem Rucksack dabei hatte. Trophäen, die er Berthold hatte zeigen wollen. So wie es abgemacht gewesen war. An ihrem Schwurtag, dem siebzehnten August. Im »Führerbunker«, wie sie ihn nannten. Wer jedoch nicht da war zur vereinbarten Zeit, das war Berthold!
Die Trophäen, indiziertes Propagandamaterial aus Kanada und den USA, ein original Koppelschloß mit Reichsadler, ein stockfleckiges Exemplar von »Mein Kampf« sowie eine noch unentschärfte Handgranate aus Bundeswehrbeständen, brachten Koschik als Strafe wegen unerlaubtem Waffenbesitz und Verbreitung von NS-Material zehn mal fünf Stunden ein, die er in einer sozialen Einrichtung ableisten mußte. Das wäre noch auszuhalten gewesen, wenn er nicht ausgerechnet in ein Freizeitheim im Westend geschickt worden wäre, das vorwiegend von Türken besucht wurde. Das alles hatte er Berthold zu verdanken, seinem besten Freund, wie er früher gedacht hatte, daß er jetzt hier, mitten unter den beschnittenen Knoblauchfressern, Küchendienst schieben mußte. Ja, einmal verlangte der Heimleiter, der sicher wußte, warum Koschik zu diesem Sozialdienst verdonnert worden war, sogar, er solle die Toiletten saubermachen, was er aber rundheraus verweigerte.
Warum war Berthold nicht gekommen? Warum hatte er ihn allein in diese Scheiße tappen lassen? Und vor allem, warum hatte er sich nicht gemeldet, die Tage, die Wochen danach? Es konnte keinen Zweifel geben: Berthold war desertiert. Klammheimlich desertiert aus jener Eliteeinheit, die nur aus ihnen beiden bestanden hatte und die den Kampf ganz alleine hätte aufnehmen müssen gegen jenes Gesindel, unter das Koschik nun geraten war als ein Galeerensklave, als ein Stück Dreck. Für dieses feige Entfernen von der verschworenen Truppe, die sie doch einmal gewesen waren, gebührte Berthold ein Denkzettel. Koschik setzte verschiedene Entwürfe dazu auf. Mal waren diese Denkzettel spitz, kurz und scharf wie die Klingenspitze eines Stiletts, dann wieder ellenlang wie ein verkrampfter, umständlicher Brief, der alles erklären will und die Erinnerungen wachruft.
Koschik sah es als seine Lebensaufgabe an, ein rigoroser Einzelner zu werden, nichts zog ihn so sehr an wie die magischen Orte der Absonderung. Das Seltsame und Widersprüchliche allerdings war, daß er, einzelgängerisch wie er lebte, seinen Hausaltar ausgerechnet für jene Bewegung errichtete, die nichts mehr bekämpft hatte als den Einzelnen, die immer nur als ein gesichtsloses, roboterhaftes Ganzes aufgetreten war. Genau das aber faszinierte Koschik. Mit der Zeit kannte er alle die heimlichen und verbotenen Kultplätze der Stadt, wo diese Bewegung aufmarschiert war, wo sich Entscheidendes zusammengebraut hatte. Es gab, stellte er fest, regelrecht eine zweite, eine vergessene Stadt, versiegelt unter Gehwegplatten und Straßenasphalt, verborgen hinter neuem Mauerverputz und Wandfarbe. Manches war abgerissen worden, manches von Efeu und Vergessen überrankt (die Fundamente der Ehrentempel am Königsplatz zum Beispiel). Koschik hatte diese versunkene Stadt nach und nach rekonstruiert, nur für sich selbst, aus Büchern und alten Zeitschriften, die er auf der Auer Dult, auf Trödelmärkten und in obskuren Läden voller Varia und Kuriosa zusammengesammelt hatte.
Mit der Zeit kannte er sich aus wie nur wenige. Koschik wußte, in welcher Straße der »Wurzenhof« seinerzeit war, das Stammlokal der SA. Er hätte jedem sagen können, wo genau am Gärtnerplatz im »Amberger Hof« sich die Sturmtruppen versammelt hatten. In seinem Zimmer hing ein auf Sperrholz aufgezogener Stadtplan, in den er die Route des Marsches vom 9. November 1923 eingezeichnet hatte. Vom Bürgerbräukeller in der Rosenheimer Straße waren sie losgezogen, über die Ludwigsbrücke und durchs Tal, am Marienplatz in die Weinstraße eingebogen, vor bis zur Theatiner. Von hier aus sahen sie bereits am Odeonsplatz postiert: die Landespolizei. Dann eben durch die Perusa zum Max-Josephs-Platz! Als der Zug dort links in die Residenzstraße umschwenkte, säumte eine unüberschaubare Menge von Sympathisanten und Schaulustigen die Gehsteige. Es muß gewesen sein wie beim Einzug der Wies'nfestwirte! Statt Blasmusik die »Wacht am Rhein«. Bei diesem Marsch im November 1923 hätte Koschik um alles in der Welt dabeisein wollen, in erster Reihe, gleichviel ob dort der Tod wartete (so wie auf den Neubauer, dem es, direkt neben Ludendorff marschierend, den Schädel zerriß) oder nicht. Es mußte doch noch etwas Wichtigeres geben als immer nur dieses scheiß kriecherische Am-Leben-bleiben-Wollen. So dachte Koschik mit seinen knapp 18 Jahren.
Schon in der Schule wußte er, was die Geschichte dieser heimlichen, verschütteten Stadt betraf, in der ja schließlich alles begonnen hatte, mehr als jeder seiner Lehrer. Wenn er ihnen genüßlich unter die Nase rieb, daß Hitler, der als Kunstmaler und Schriftsteller nach München gekommen war, immerhin Opern komponiert und Theaterstücke verfaßt hatte, machten sie ein Gesicht, als würde er behaupten, ein solcher Mensch könne doch niemals auf die Idee der Judenvernichtung kommen – was er damit natürlich keineswegs gesagt hatte, sie waren nur immer gleich so furchtbar empfindlich. Mit nichts konnte man diese sonst so kumpelhaften, ihre Antiautoritätsmonstranz vor sich hertragenden Brüder der 68er-Kongregation leichter aus der Fassung bringen, stellte Koschik amüsiert fest, als mit kleinen, naiv vorgebrachten Zwischenfragen wie: Ob es richtig sei, daß in den angeblichen Gaskammern von Auschwitz nirgendwo Heizungsanlagen gefunden worden seien und, falls man dies zugeben müsse, wie denn dann eigentlich das kristalline Zyklon B in einen gasförmigen Zustand gebracht worden sei, wo doch jedermann wisse, daß es dazu einer Raumtemperatur von über 25 Grad bedarf?
Daß Koschik das Gymnasium nach der Mittleren Reife verlassen mußte, war also keineswegs eine Folge mangelnder Intelligenz gewesen. Man wollte nur immer das Verkehrte von ihm wissen, nie das, was ihn wirklich interessierte und worin er sich auskannte. Daß er mit siebzehn schon Nietzsche gelesen hatte, »Wille zur Macht«, wem hätte er das erzählen sollen, mit wem sich darüber unterhalten können? Verlangten nicht Sätze wie »Ihr habt alle nicht den Mut, einen Menschen zu töten« nach jemandem, der dagegenhielt? Doch da war keiner. Selbst die Klassenkameraden hielten ihn für meschugge, abgeben wollte sich mit ihm keiner.
Einen, ja doch, einen hatte es gegeben, den Berthold, dem imponierte das, wie einzeln und unabhängig, ohne Rücksicht auf irgend jemand, dieser Koschik war. Vom Dagegenhalten, vom Verteidigen einer eigenen Meinung konnte zwar auch bei Berthold keine Rede sein, aber immerhin war er ein leicht zu begeisterndes Publikum. Dankbar hing er Koschik an den Lippen, wenn der – in Charlie-Chaplin-Manier- seine Hitlerparodien aufführte und mit schnarrender Stimme Sätze losließ wie: »Der Abgesonderte war immer und ständig von Gewalten des Blödsinns umgeben!« Ja, Gewalten des Blödsinns, für nichts anderes hielt Berthold letztlich Koschiks Kasperltheater vorm Spiegel, sein Einüben des »Koschikgrußes«, ein ruckartiges Hochschnellen des Unterarms bei gleichzeitig ausgestreckter Hand, während der Oberarm starr an den Oberkörper gepreßt blieb. Diese Blödsinnsgewalten schüttelten ihn … vor Lachen. Koschik allerdings nahm dies alles ernster, als es für Berthold ganz offensichtlich war.
Den Monologen über Nietzsche und den Führer hörte er schon eher gelangweilt zu. Wenn Koschik allerdings vom Königsplatz anfing zu erzählen, was er da alles in Erfahrung gebracht habe von dem unterirdischen Labyrinth, das die Nazis dort gebaut hätten, dann war auch Berthold wieder ganz Ohr. Von der eher technischen Seite her betrachtete er Koschiks Computerspielereien: Versteckte und unerlaubte Mailboxes von irgendwelchen Neonazis im Internet aufzuspüren, war eine geile Beschäftigung für langweilige Samstagnachmittage. Dort wurde man regelrecht aufgefordert, die Tastatur seines PCs zu einem Schnellfeuergewehr zu machen und sich an den e-Mail-Schlachten diverser »Newsgroups« zu beteiligen, von denen es hieß, »they are unmoderated and have a very high noise level«. Anfänglich zappten sich Koschik und Berthold durch die diversen »web sites«, nahmen gute Ratschläge mit wie »Your skin is your uniform«, erfuhren das Neueste vom Burenkampf in Südafrika (»The Boers Strike Back!«) und wunderten sich, daß man selbst in Kanada wußte, wer oder was Yggdrasil ist. Sie fühlten sich hinter ihrem PC-Monitor nicht mehr alleine. Anscheinend war man schon in jedem Winkel der Welt bereit und saß in den Startlöchern: »The fireworks begin!«
Schließlich steuerten sie auch eigene Diskussionsbeiträge ins Internet bei und setzten darunter, quasi als Absender, »Bajuwarische Helden, gez. Graf Arco«. Auf den Namen war Koschik gekommen. Was es mit Graf Arco auf sich hatte, darüber mußte er Berthold erst aufklären, der wußte auch rein gar nichts! Ein mutiger Einzelner sei der gewesen, der einfach hingegangen sei und diesen Berliner Juden Kurt Eisner über den Haufen geblasen habe. Ein echter bajuwarischer Held!
»Bomben legen, is doch geil. Tschuschen oder noch besser Türken in die Luft jagen, wie die in Oberwart, das is der Schocker, oder?!«
Sie feixten und kicherten wie Dreizehnjährige, die von ihrer ersten nächtlichen Sprayer-Tour heimkamen: Da prangte doch tatsächlich eine herausgestreckte Rolling-Stones-Zunge und der Schriftzug »Ätsch« in der U-Bahn-Unterführung an der Wand!
Ihre erste Nachricht ins Internet war noch ganz kurz gewesen, hatten sie doch Schiß, daß ihnen vielleicht doch jemand auf die Schliche käme, würden sie die Onlineverbindung allzu lange Zeit aufrechterhalten. Ein nichtssagender Jux im Grunde, den sie da losschickten: »Wir haben dich, Kurt Eisner! Gez. Graf Arco.« Eines absolut lausigen Freitagabends surften sie auf einer Welle Langeweile in eine irgendwo in Kanada installierte Webside, und dort wurde relativ unverblümt ausgeplaudert, wie man eine Briefbombe zusammenbastelt. »It will be a really nice event, if your FRIEND opens the letter!« Berthold und Koschik feixten und malten sich aus, wem sie einen solchen Brief gerne schicken würden. Dann marodierten sie weiter durch die immer kruder und brutaler werdenden Websides diverser anonymer Internet-Anbieter.
Doch mit der Zeit saß Koschik, ohne daß er es anfänglich bemerkte, immer öfter alleine vorm PC. Berthold ließ sich kaum mehr sehen. Schob das begonnene Studium der Betriebswirtschaft als Ausrede vor, aber Koschik wußte genau, Berthold hatte die Lust verloren, für ihn waren das alles nur Kindereien gewesen. Der schien gar nicht zu bemerken, wie bitterernst es dagegen Koschik war, wenn er sagte, daß ihn das ganze Ausländergesindel in und um den Hauptbahnhof herum ankotze. Berthold wohnte ja auch nicht in der Blumenau und war noch nie plötzlich in der Nacht von drei Halbstarken gestellt worden, hatte noch nie auf die im Laternenlicht aufblitzende Klinge eines Stiletts gestarrt.
Berthold, der das Gymnasium fertig gemacht hatte, war im Grunde ein Klugscheißer geworden. In Diskussionen hielt er Koschik jetzt sogar schon entgegen:
»Was willst du eigentlich: Normal müßte man an alle Hauswände sprühen: Ausländer rein! Wir haben jetzt erst in ’ner Vorlesung gehört, daß die Türken mittlerweile dieselbe Rücklagen- und Sparquote haben wie die Deutschen. Die wenn alle ihre Notgroschen plötzlich abheben und wieder nach Anatolien abhauen, gibt’s hier ’nen Bankencrash, der sich gewaschen hat!«
Als Koschik wieder einmal anfing, auf billige Art und Weise gegen Ausländer zu hetzen, hielt ihm Berthold entgegen: »Mensch, schau dir doch mal deinen eigenen Namen an! Hast du da schon mal nachgeforscht? Tippe auf Wasserpolacke in der dritten Degeneration!«
Zu Zeiten der Thule-Gesellschaft wäre Berthold für so eine Äußerung vor ein Feme-Gericht gezerrt und wahrscheinlich eines grauen Morgens an einem der Isarwehre bei der Praterinsel gefunden worden.
Berthold hatte, und wahrscheinlich wußte er das ganz genau, bei Koschik an einen wunden Punkt gerührt. Wenn der ehrlich gewesen wäre, hätte er zugeben müssen, daß er wirklich so gut wie nichts wußte über sein Herkommen. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt, die Mutter nach ihm zu fragen, wäre sinnlos gewesen. Die erzählte nicht einmal etwas über ihre eigene Vergangenheit, geschweige denn über die eines Mannes, der nicht einmal einen Namen zu haben schien. Koschik hatte längst aufgehört, seine Mutter irgend etwas zu fragen. Es war ihm ganz recht, daß man sich die meiste Zeit sowieso nicht sah: Nachts, wenn er am Computer saß oder sich durchs nächtliche Schlachthaus der diversen Privatsender zappte, bediente sie im Wienerwald in Pasing, tagsüber, wenn sie zu Hause war, arbeitete er im Lager vom Grosso-Markt als regalauffüllende Aushilfe.
Die Wohnung war leer, wenn er am frühen Abend nach Hause kam, Koschik stand dann oft am Fenster seines Zimmers. Vom achten Stock aus sah er auf die Landsberger Autobahn hinunter, sah die fauligen Autoäpfel dort unten vorbeirollen und wünschte sich ein Gewehr, um all die Würmer und Maden herausschießen zu können, die sich darin breitmachten. Wie sähen all diese Protzköpfe aus, dachte er oft, wenn sie jäher Schmerz oder plötzliche Austilgung träfe? – Wie ein Apfelbutzen, den man an eine Wand wirft, würde ihr Hirn am Autobahnbrückenpfeiler kleben.
Nicht einmal mehr an ihrem Schwurtag ließ sich Berthold blicken. Nicht der zwanzigste April, das wäre öde und einfallslos gewesen, sondern den siebzehnten August hatten sie gewählt. Die letzten zwei-, dreimal hatten sie sich am Königsplatz getroffen, Koschik hatte Berthold den Einstieg in die unterirdischen Bunker und Verbindungsgänge zwischen ehemaligem Führerbau und Verwaltungsbau der NSDAP gezeigt – für einen Doppler »Bauern-trunk« hatte ein Penner Koschik den Tip gegeben. Wie Ratten waren sie durch das Gängelabyrinth gerannt, und bei jedem in altdeutscher Frakturschrift geschriebenen Hinweisschild auf irgendwelchen Stahltüren – »Rotweinkeller« lasen sie einmal, waren wohl in die ehemaligen Versorgungsbunker geraten – hatte Koschik spitze Piepslaute ausgestoßen… der Modergestank jener für ihn so aufregenden Zeit wehte ihn an, und er konnte und wollte gar nicht unterscheiden, was davon den Hinterlassenschaften der Penner zuzurechnen war, die hier ihren Unterschlupf fanden. Absoluter Höhepunkt war, wie sie vergangenes Jahr in jenen Raum vordrangen, in dem sich ein Gewirr von Kabeln und Meßinstrumenten befand, an einer Art Schaltplan an der Wand entdeckten sie die Aufschrift »Mithörleitung«. Sie waren in der Kommandozentrale dieser unterirdischen Hadeswelt angelangt, im Abhörraum! ER selbst mußte hier gewesen sein, denn das hat er sich bestimmt vorführen lassen, wie man aus diesem geheimen Unterstand heraus alles mit anhören konnte, was im Braunen Haus in der Brienner oder in der Stellvertreterkanzlei in der Arcisstraße gesprochen wurde.
Hatte Berthold das schon alles vergessen? Wie sie mit den Fingerkuppen über den Putz der Mauern gefahren waren, in den die Amis ihre Siegerparolen, aber auch Bildchen mit Schweinereien geritzt hatten? Hatte es ihm nicht genauso einen leisen Schauer über den Rücken gejagt? Selbst die Vorstellung von Niederlage und Untergang, die hier in diesen Gängen stattgefunden hatten, erregte Koschik noch. Verlierer sein war keine Schande, wenn man nur etwas hinterließ, was nicht mehr auszutilgen war. Damals, dort unten in den Katakomben des Königsplatzes, hatten sie sich geschworen, wenigstens einmal gemeinsam ein großes Ding zu drehen, etwas hochgehen lassen, irgendein Fanal setzen. Scheißegal, ob es aufkäme! Hauptsache, einmal angeschaut und wahrgenommen werden, und wenn’s nur vom Auge einer Fernsehkamera war.
Berthold hatte eingeschlagen in die hingestreckte Hand, aber an der Art, wie er so komisch lachte, hatte Koschik gleich gemerkt, daß er es wieder nicht wirklich ernst meinte, daß er wieder alles nur für einen Jux hielt. Und dieser Jux wurde immer fader für Berthold, verlor jeglichen Nervenkitzel. Für ihn war das alles nur eine Art intellektuelles Bungee-Springen gewesen. Längst war Berthold auf der Suche nach neuen Kicks.
Koschik hatte das anfänglich nicht bemerkt. Wie ein Hund seinem Herrn dackelte er Berthold hinterher. Dem war diese Anhänglichkeit längst lästig geworden. Immer seltener ließ er von sich hören. Ließ abgemachte Treffen einfach platzen, kam nicht, bemühte sich nicht einmal um eine Ausrede. Als Koschik wieder einmal von ihm sitzengelassen worden war, rief er bei Berthold an.
»Weißt du, was für vorgestern abgemacht war?«
»Du …, letzte Woche, die Woche davor, die letzten drei Monate, du, ich hab Prüfungen, bei mir ist nur noch Pauken angesagt.«
»Aber an unsere Abmachung hättest du denken können!«
»Ach so, klar…, unser Treffen. Aber wir holen’s nach! Vielleicht könnten wir eine richtige Party draus machen, was meinst du? Ich könnte ein paar Typen mitbringen.«
»Is’ o.k., is’ o.k.!«
»Ej, warum so aggressiv?«
»Liest du eigentlich noch die Mailboxes? Ich mein’, was sich so tut?«
»Ich hab’s dir doch gesagt: Keine Zeit!«
»Und was ist mit unserer Aktion ›Graf Arco‹? – ›Kurt Eisner, wir wissen wo du steckst!‹«
Wieder dieses Lachen, dieses alles ins Lächerliche und Unbedeutende ziehende Grienen. (Koschik sah ihn genau vor sich.) Bei Berthold im Hintergrund hörte er eine Frauenstimme, eine von der lästigen Art, die immer fragen, was denn jetzt los sei und ob man nicht bald komme. Berthold wimmelte ab:
»Du bist immer noch der alte, wie? – Also, sei mir nicht bös, aber ich muß jetzt … Laß wieder was hören!«
Worauf du dich verlassen kannst, hatte Koschik beim Auflegen gedacht.
Es sollte nur eine kleine Erinnerung sein, an einen guten, alten Freund. Eine Art Knallfrosch, den man dem Spezi unter den Stuhl legt. Eine aufgeblasene Papiertüte, die man mit einem Schlag zwischen den Händen zerplatzen läßt, und alle zucken zusammen. Koschik erinnerte sich jener Internet-Adresse, die so interessante Tips angeboten hatte. »It will be a really nice event, if your FRIEND opens the letter!« Koschik lud die Anleitung auf seine Festplatte.
Er hoffte, die Schlampe, die er neulich am Telefon im Hintergrund gehört hatte, stünde daneben, wenn Berthold den Brief öffnete. Noch besser wäre ja, sie machte ihn selber auf, aber wie er das anstellen sollte, wußte er nicht. Er war schon froh, wenn überhaupt alles klappte.
Draußen bei Allach zwischen den Feldern machte er ein, zwei Probesprengungen. Er legte das präparierte Briefkuvert mit dem Strohhalmröhrchen, das die Explosion auslösen sollte, zwischen zwei Steine und warf aus drei, vier Metern Entfernung einen Ziegel auf die Vorrichtung: Wie ein Karateschlag knickte der Ziegel das Kuvert, und Koschik flogen beim ersten Mal ordentlich Erdklumpen um die Ohren. Er halbierte die Menge des Sprengstoffes. Den dritten, bereits scharf gemachten Umschlag legte er in seinem Schreibtisch in eine Schublade und genoß den Nervenkitzel, neben einer explosionsbereiten Bombe zu leben … Was war das Anzapfen verfolgungs- und strafwürdiger Internet-Nachrichten, die etwas von Auschwitzlüge faselten, für ein Kinderkram dagegen. Koschik zögerte noch, den Brief wirklich aufzugeben, im Grunde genügte ihm schon dieses Vorspiel. Das Kuvert lag tagelang dort im Schreibtisch.
Auch Koschiks Mutter war es schon aufgefallen, daß der einzige Freund ihres Sohnes, jener ihr eigentlich ganz sympathische Berthold, sich lange nicht mehr hatte sehen lassen. Um so erstaunter war sie, als sie beim Aufräumen im Schreibtisch des Sohnes ein Kuvert fand, das die Anschrift Bertholds trug. Es war ein auffällig dicker DIN-A-5-Umschlag, das Sonderbarste aber war, daß es als Absender den Namen »Graf Arco« und als Adresse die seltsamerweise im Münchner Osten gelegene Kurt-Eisner-Straße trug. Sie nahm den Brief in die Hand, überlegte, was es damit auf sich haben könnte. Warum nur schrieb ihr Sohn seinem besten … oder mußte es schon heißen: ehemals besten Freund einen Brief unter falscher Absenderangabe? Sie drehte und wendete das Kuvert, schlenkerte den Brief in der rechten Hand und klopfte damit auf den Handballen ihrer linken …
Als Koschik am Abend die Tür zu seinem Zimmer öffnete, sah er als erstes die Blutspritzer auf der Fensterscheibe. Warum nur nahm er nicht die Mutter wahr, die vor seinem Schreibtisch auf dem Boden lag, in einer dunklen Lache, sondern nur den Feierabendverkehr draußen auf der Landsberger Autobahn, der sich stadtauswärts Richtung der im Westen gelegenen Schlafstädte wälzte?
Mit der Geschichte würde er sie alle aus dem Rennen hauen, die war »Poetry-slam-Sieg«-verdächtig! Kreutner sah zu, wie sein Laserdrucker Seite für Seite erbrach, zehn waren’s, er zählte mit, respektable Leistung für einen Schreibtag, dessen Nachmittag gerade erst angebrochen war.
Und das nach den letzten Wochen, die absolut nicht gut gelaufen waren für Kreutner. Nicht nur das, sie waren hundsmiserabel gelaufen, sie waren so gelaufen, daß Kreutner nahe daran gewesen war, endgültig aufzugeben und das Schild an seiner Wohnungstür abzuschrauben, »Niegehört Versager« müßte da stehen, wenn er ehrlich war, und nicht »Hermann Kreutner«. Ja, es war schon eine Niederlage in Form einer 0:12-Packung, die er da hatte einstecken müssen, beinahe täglich trudelten die Manuskriptsendungen wieder bei ihm ein, die Kreutner vor Wochen – siegessicher und daher gleich im Dutzend! – an diverse Verlage gestreufeuert hatte. Mit niederschmetternder Regelmäßigkeit fand er nun Vormittag für Vormittag in seinem Briefkasten eines der gut fünf Zentimeter dicken Päckchen wieder, sie steckten nur halb im Briefschlitz, Kreutner sah es schon, wenn er die Stiege im Treppenhaus herunterkam, wie ihm der Briefkasten wieder seine Kartonzunge herausstreckte.
Die Päckchen enthielten Kreutners Romanmanuskript. Genaugenommen ein stark gekürztes Expose desselben, 400 Seiten von geplanten 1000, die es einmal werden sollten. Expose konnte man also eigentlich nicht sagen, es war mehr so ein Treatment, doch auch das traf es nicht richtig … Kreutner hatte das dumpfe Gefühl, die Tatsache, nicht genau ausdrücken zu können, um was es sich bei diesen 400 Seiten überhaupt handelte, hing ursächlich mit der erstaunlichen Anhänglichkeit dieser Päckchen zusammen: Sie kamen alle wieder zu ihm zurück. Die beigelegten Lektoratsschreiben hatten alle irgendwie den gleichen Wortlaut, ein Geseire von wegen »… senden wir Ihnen daher Ihr interessantes Romanfragment zurück … sehen Sie in unserer Ablehnung bitte kein Werturteil« … »was denn sonst, ihr Wichser!« war Kreutners einziger Kommentar dazu, während er sie zusammenknüllte und in die Zimmerecke warf.
Auch seinem Freund Rohrbacher konnte Kreutner nicht recht schlüssig klarmachen, um was es sich bei seinem Opus magnum handelte, an dem er nun schon vier Jahre herumbosselte. »Es ist der Roman des Jahrhunderts!«
»Wie bitte!?«
»Ich meine, unser Jahrhundert, polyphon dargestellt, am Beispiel dieser Stadt, und sag selber, ist sie nicht beispielhaft: Räterepublik, Hitlerputsch, Hauptstadt der Bewegung?«
Diese Frage galt dem Mitarbeiter des Stadtarchivs, Rohrbacher hatte in dieser Funktion Kreutner schon manchen Dienst erwiesen. Er kannte sich aus wie nur wenige in der Stadtgeschichte.
»Und, wie soll das Ding mal heißen?«
»›Schwimmende Felsen‹ … verstehst du, die Polyphonie, der ständige Perspektivenwechsel, das Erzählerkollektiv, Stadtund Weltgeschichte, gespiegelt im Prisma der Erzählinstanzen…«
»Sag mal: Felsen können doch gar nicht schwimmen?«
Rohrbacher, Kreutner hatte es schon immer gewußt, war ein Aktenwurm, dafür war er zu gebrauchen, irgend etwas aus den Tiefen seines Archivs herauszurecherchieren, in Fragen der literarischen Technik aber war er ignorant bis zum Geht-nicht-mehr. Es war sinnlos.
»Ach, vergiß es.«
»Du, ich will dir da nicht zu nahe treten, ich meine, du bist der Literat, das soll keine Wertung sein, nur ›schwimmende Felsen‹, das klingt irgendwie so wie ›emigrierende Käseschachteln‹ oder ›abtauchende Wolpertinger‹ …«