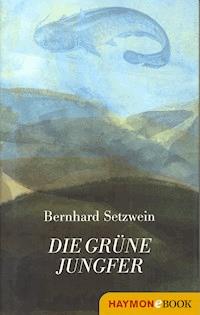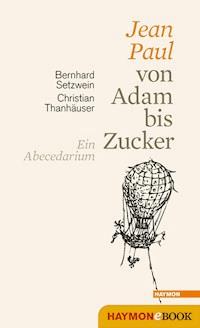Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1896 kehrt Heinrich Graf Coudenhove-Kalergi mit seiner japanischen Ehefrau Mitsuko und den beiden Söhnen Richard und Johannes aus dem diplomatischen Dienst in Japan zurück. Jahre später findet sich Johannes in einem tschechischen Internierungslager wieder, durch die "Beneš-Dekrete" hat die Familie alles verloren - nur nicht ihre große Geschichte. Und so beginnt "Graf Hansi" zu erzählen … Im Schicksal der Familie Coudenhove-Kalergi begegnen einander kosmopolitisches Denken und provinzieller Nationalismus, fernöstliche und mitteleuropäische Kultur, und die glamouröse Ära der Jahrhundertwende-Aristokratie trifft auf die neuen Zeiten von Technik und Fortschritt. Mit leichter Hand erzählt Bernhard Setzwein die Geschichte dieser ungewöhnlichen Familie an der Schwelle vom alten zum neuen Europa - geistreich, lebendig und höchst unterhaltsam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Setzwein
Der böhmische Samurai
Roman
„… ein Zwitter aus Wahrheit und Unwahrheit“
Richard Coudenhove-Kalergi, „Adel“
„Alle Kineser san Japaner.
Aufhängen sollt ma de Bagasch bei ihnare Zöpf.“
Karl Kraus, „Die letzten Tage der Menschheit“
„Die japanische Kultur ist nicht dualistisch.
Gut und Böse sind nicht so prinzipiell entgegengesetzt,
wie wir das in Europa gewohnt sind.“
Joanna Bator
1
Ronsperg, Mai 1896 „Kommt da die neue gräfliche Herrschaft oder ist das nur die Vorhut von einem Wanderzirkus?“
Der Schullehrer Fischer flüsterte dem Fleischhauer Spinler, der neben ihm im Spalier stand, seine spöttische Bemerkung ins Ohr. Mußte ja nicht jeder hören, was er von der feierlichen Einfahrt jener drei Kutschen hielt, mit denen die langerwartete neue Herrschaft soeben in Schloß Ronsperg eintraf. Tatsächlich war es, gelinde gesagt, irritierend, was die Männer zu sehen bekamen: Graf und Gräfin waren nicht auszumachen, statt dessen saßen an der Spitze des kleinen Wagen-Trecks im offenen Landauer zwei zierliche Japanerinnen im Kimono. Jede hielt einen kleinen Buben auf dem Schoß, auch sie in Miniaturausgaben des traditionellen japanischen Wickelgewandes gekleidet, an dem vor allem die breiten Seidenschärpen um den Bauch herum auffielen. Die beiden Kinder mußten die Söhne des Grafen sein, Hansi und Richard, und wären sie nicht von ihren beiden Erzieherinnen hochgehalten worden, man hätte sie hinter dem Verschlag des Landauers gar nicht gesehen. Vorne auf dem Kutschbock saß neben dem Wagenlenker ein bärtiger Hüne, dessen exotische Kleidung nicht minder kurios war. Der Kerl kam daher wie ein kaukasischer Berghirte, offenes weißes Leinenhemd, Kniebundhose, Ledersandalen, deren Riemen bis hoch zu den Waden gebunden waren, dazu ein Patronengürtel um den Leib, in dem ein orientalischer Krummdolch steckte. Schullehrer Fischer hatte schon recht, wenn ihm bei einem solchen Anblick als erstes ein Haufen wilder Zirkusleute einfiel.
In der zweiten Kutsche saß lediglich der junge Gutsverwalter Bernklau mit seinem Gehilfen, die beiden hatten die japanische Reisegesellschaft am Tauser Bahnhof in Empfang genommen. Dahinter ein Leiterwagen, wie ihn die Bauern benutzen, mit dem Gepäck, riesige Koffer, manche davon schrankgroß. Vom Grafenpaar selbst aber keine Spur.
„Ja, so was!“ grunzte der Fleischermeister, als das letzte der Fuhrwerke an ihm vorbeigerollt war, und die schweren Bauernrösser, die den Leiterwagen zogen, hatten direkt vor ihm ihre g’stinkerten Roßballen fallen lassen, damit es auch ja sinnbildlich wurde: Da habt’s euren Mist. Bis zur Schloßeinfahrt hin reichte das Ehrenspalier der Ronsperger Bürger, und es zog sich über den Ringplatz an der Kirche vorbei die Hauptstraße entlang bis an den Rand des kleinen Städtchens. Ja, sogar noch weiter, wenn auch mit größeren Lücken zwischen den grüppchenweise zusammenstehenden Bauersleuten beiderseits der Landstraße, die in Richtung Taus führte. Dort in der Bezirksstadt nämlich, wo es seit 1861 einen Bahnhof an der Strecke Prag–Pilsen–München gab, hatte die Reisegesellschaft noch ein letztes Mal umsteigen müssen, auf die bereitstehenden Kutschen. Ja, es war halt schon elend weit weg und abgelegen, dieses Japan, zumindest von Ronsperg aus gesehen, dem kleinen Städtchen ganz am Rande des böhmischen Kronlandes, im Tal der Pivoňka, umgeben von dichten Wäldern.
„Sind die unterwegs irgendwo verloren gegangen?“ fragte, nicht ganz ernst gemeint, der Schullehrer. „Oder ist die gnä’ Frau Gräfin gar seekrank geworden? Die Japaner haben ja jahrhundertelang nie ihre Insel verlassen, sind nie auf ein Schiff gestiegen. Die Mitsuko, dem Grafen seine Frau, soll überhaupt die erste Japanerin in Europa sein. Die Arme! Und erst die Reise bis hierher. Haben Sie sich Ihnen das einmal angeschaut, Spinler, über wie viele Weltmeere man da fährt?“
Fischer hatte es getan, in seinem „Großen Schulatlas“. Phänomenaler Mann, dieser Carl Diercke, der erst vor wenigen Jahren sein faszinierendes Weltkartenmaterial herausgegeben hatte. Immer wieder zeigte Fischer seinen Schülern den Atlas und pries ihn als ein wahres Wunderwerk. Und wie begeistert die mit ihren vom Kuhstall nie sauber werdenden Fingern den Reiseweg nachgefahren waren. Ost- und Südchinesisches Meer, Indischer Ozean, Rotes Meer, Suezkanal, Mittelmeer, Bosporus, Schwarzes Meer, Donau.
„Aber ankommen sind’s nicht.“
Da hatte er zweifelsfrei recht, der Fleischermeister Spinler. Der hatte noch nicht einmal die Zeit gefunden, seine von einer Schlachtung blutverschmierte Gummischürze abzulegen. Vielleicht hatte er sie aber auch ganz bewußt anbehalten, Spinler trug nämlich seine antimonarchistische Grundüberzeugung nur zu gerne für jedermann sichtbar zur Schau. Gleichzeitig war er seit langem der stets zuverlässige Fleischlieferant der Schloßküche gewesen und hatte sich mit dem alten Grafen eigentlich immer bestens verstanden. Bis der verstorben war, vor drei Jahren. Seither fehlte nicht nur ein gestandener Hausherr, jemand, der Anweisungen hätte geben können, wie es weitergehen solle mit den Besitzungen, zu denen ja auch noch das verwaiste Kloster Stockau mit Brauerei und Teichwirtschaft sowie das Jagdschloß Dianahof gehörten. Nein, es fehlte vor allem das Gesellschaftsleben, mit all den Banketten und Festen, es fehlten die Bestellungen ganzer Schweinehälften und mehrerer Kilo schwerer Lungenbraten vom Rind, die Spinler immer selbst zum Schloß gebracht hatte, da schickte er keinen Lehrbuben … schließlich war man in diesem Fall eine Art Ronsperger Hoflieferant, und der hatte selbstverständlich persönlich Aufwartung zu machen.
Als solche verstand Spinler auch sein Spalierstehen am heutigen Tag … aber daß man sie gar so enttäuschte, das warf kein gutes Licht auf die neue Herrschaft. Irgendwie paßte es nicht mehr zwischen Ronsperg und der Grafenfamilie, hatte Spinler den Eindruck, und wahrlich nicht nur er. Schon der alte Graf Franz Karl hatte sich mehr und mehr aus dem Böhmerwaldstädtchen zurückgezogen … solche Leut’, und da kam wieder die revoluzzerische Seite an Spinler zum Vorschein, haben ja die freie Auswahl, wo sie ihr feines, nichtstuerisches Leben verbringen, Schlösser und Ländereien an jeder Hand fünfe, schimpfte er, über ganz Europa verteilt, ob das etwa eine Gerechtigkeit sei? Er übertrieb natürlich. Zwei weitere Besitzungen gehörten der Grafenfamilie, eine in Zamuto in den ungarischen Karpaten und eine in Ottensheim an der Donau. Dort war er dann ja auch verstorben, der alte Graf Franz Karl.
Schon das war eine Kränkung der Ronsperger gewesen. Gibt der einfach in Ottensheim den Löffel ab und bringt seine Böhmerwaldler um eine Leichenaufbahrung de luxe. Da half auch die spätere Überführung und Beerdigung in Ronsperg nichts mehr, der Fauxpas war schon passiert, nämlich am falschen Ort gestorben zu sein. Irgend etwas hatte den alten Grafen offenbar von Ronsperg vertrieben. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, er habe die Einsamkeit nicht mehr ertragen. In der Tat konnte es hier, inmitten der böhmischen Wälder, auf eine Art einschichtig sein, die dem Gemüt gar nicht zuträglich war. Vielleicht hatte auch der frühe Tod seiner Ehefrau Marie, mit gerade siebenunddreißig Jahren, den Ausschlag gegeben, daß für den Grafen an diesem Ort kein Bleiben mehr war. Jedenfalls: Er zog sich mit dem Großteil der Dienerschaft im Sommer nach Zamuto und ansonsten auf Schloß Ottensheim zurück. Zu sagen, daß seit dieser Zeit das Schloß Ronsperg verkommen sei, ginge vielleicht zu weit, aber der Glanz früherer Jahre war unverkennbar dahin. Die Marodigkeit lugte aus allen Ritzen.
Es wurde also Zeit, daß die neue Herrschaft endlich eintraf. Sohn Heinrich, das älteste der sechs Kinder von Franz Karl und Marie, hatte sich drei Jahre lang gesträubt, aus Japan zurückzukommen. Gefiel’s dem dort am Ende vielleicht sogar besser als daheim? Die jüngeren Brüder hatte er immer vorgeschoben, soll es doch der Friedrich machen oder der Johann. Warum man ausgerechnet ihn aus seiner neuen Heimat herausreißen müsse, wo er doch gerade erst begonnen habe, eine Familie zu gründen? Als Vize-Botschafter des österreichischen Kaisers war er, nach Jahren unter anderem in Buenos Aires, Athen und Konstantinopel, an die Gesandtschaft in Tokio versetzt worden. Dort hatte er seine Frau kennengelernt, dort waren die beiden Söhne Hansi und Richard zur Welt gekommen. Als es dann plötzlich hieß, man müsse nach Europa ziehen, um dort ein Schloß im von Wölfen umheulten Böhmerwald zu bewohnen, war der Schrecken für Mitsuko und ihre Eltern erst einmal groß. Würde man die Tochter und die Enkelkinder jemals wiedersehen? fragten sich Heinrichs Schwiegereltern Aoyama.
„Ißt jetzt der Japaner auch einmal das Bürgermeisterstückl von einem herrlichen Lungenbraten … oder nur Seegurken?“
Spinler konnte es einfach nicht lassen, vor sich hinzugranteln. Ihm paßte partout nicht, daß er hier herumstehen mußte, statt in seinem Schlachthaus zu sein. Von Rechts wegen hätte er außerdem viel weiter vorne stehen müssen im Spalier, eigentlich schon direkt im Schloßhof drinnen, wo das Empfangskomitee Aufstellung genommen hatte. Schließlich war er doch viele Jahre der erste Lieferant für alle Fleisch- und Wurstwaren gewesen, und das sollte tunlichst auch so bleiben. Nicht, daß noch der Grünhut mit seiner koscheren Fleischhauerei bei der neuen Herrschaft das Rennen machen würde … ein Rennen auf krummen Hammelbeinen, denn von einer richtigen Sau mit vier wunderbaren Stelzen hatte dieser jüdische Schächter ja noch nie etwas verstanden.
„Seegurken?“ meldete sich jetzt Fischer zu Wort. Anscheinend hatte er dem selbstgesprächlerischen Murren Spinlers doch aufmerksam zugehört. ‚Typisch Schullehrer!‘ dachte sich der Schlachter und klärte seinen Nebenmann auf: „Kein Gemüse, heißt nur so. Der Japaner ißt fast nichts anders. Noch nie davon gelesen, Herr Schullehrer? Das Zeug lebt im Meer. Aalförmig in gewisser Hinsicht. Kann bis zu zwei Meter lang werden. Und die Innereien zum Beispiel von diesen … Seeschlangen, könnt’ man auch sagen, die haut der Asiate in eine Salzlake, das ist dann eine Delikatess’ für die Schlitzaugen. Quasi dem sein saures Beuscherl. Da werd’ ich sauber sitzenbleiben auf meinen schönen Kalbsschnitzerln, meinen S’ nicht, Herr Lehrer?“
„Daß Sie aber auch immer nur ans Geschäft denken können, Spinler! Wo doch jetzt die große, weite Welt bei uns Einzug hält. Was machen Sie eigentlich bei der nächsten großen Einladung im Schloß, wenn sich der Graf und die Gräfin die Ehre geben und nur mehr Eßstäbchen neben den Tellern liegen?“
Das sagte Fischer nur, um Spinler zu ärgern. Er hielt ihn eh für einen Menschen, der nicht einmal ordentlich mit Messer und Gabel essen konnte. Spinler glotzte ihn verständnislos an. Immer nur ans Geschäft denken! An was denn sonst?
Gott sei Dank löste sich das Spalier jetzt auf. Spinler winkte verächtlich ab, ließ den Lehrer mit seinem Gerede einfach stehen und schloß sich dem Strom derjenigen an, die Richtung Schloßhof drängten, wo mittlerweile die Kutschen angehalten hatten.
Auf der Freitreppe wartete ein Empfangskomitee auf die Ankömmlinge. Neben Bürgermeister, Pfarrer und Rabbiner hatte auch eine Schulklasse Aufstellung genommen. Der Schuldirektor hatte deren Führung und Aufsicht selber übernommen, das konnte man an einem solchen Tag unmöglich Leuten wie dem Fischer überlassen, in den Augen des Direktors ein Ausbund an nicht zu verantwortender Gutmütigkeit. Jetzt aber würde es darauf ankommen, daß die Klasse den vom Direktor höchstpersönlich in Reimform gebrachten Willkommensgruß als Sprechchorus mit größtmöglicher Akkuratesse darbrächte … das erforderte selbstverständlich sein Dirigat. Allein der Sauhaufen dieser Bauernlümmel konnte natürlich nicht an sich halten, als sie sahen, wer da in den Schloßhof eingefahren kam. Gar nicht mehr beruhigen konnten sie sich beim Anblick des Berghirten, der sich vom Kutschbock geschwungen hatte, um den Damen hinten in der Kutsche das Ausstiegstreppchen auszuklappen. Und dann erst die Japanerinnen, wie sie ihre in Zehensandalen steckenden Füßchen auf den Boden des Schloßhofes setzten, nachdem sie die beiden Buben dem herbeigeeilten Gutsverwalter entgegengestreckt hatten, damit der sie aus der Kutsche hob. So standen nun die Ankömmlinge dem Ronsperger Empfangskomitee gegenüber, Aug in Aug sozusagen. Und was man da sehen konnte, machten die besonders vorwitzigen unter den Schülern sogleich ihrem kichernden und feixenden Nebenmann deutlich, in dem sie sich gegenseitig Grimassen schnitten. Mit den Zeigefingern an den Augenwinkeln zogen sie sich die Sehschlitze lang, was von Hansi und Richard indes genau registriert wurde. Denn anders als ihre Erzieherinnen und der Berghirte nahmen sie von den Willkommensgrüßen seitens des Bürgermeisters und der anderen Honoratioren nicht das geringste wahr, sondern starrten mit völlig unbewegter Miene auf die feindliche Wand aus glotzenden Fischaugen, die alle auf sie gerichtet waren.
Schutz hinter irgendeinem Rücken zu finden war leider nicht möglich. Vater und Mutter waren ja nicht da. Und die beiden japanischen Kinderfräulein waren ausschließlich damit beschäftigt, sich kichernd gegenseitig zu versichern, daß sie kein Sterbenswörtchen von dem verstanden, was da auf sie eingeredet wurde. Ja, aber warum stand man denn hier überhaupt herum ohne Graf und Gräfin, zu deren Ehre schließlich dieses ganze Theater veranstaltet wurde? Eben hatte der Schuldirektor die Arme gehoben, um seinen Schülern den Einsatz zu geben, und die hatten auch schon angefangen, die ersten beiden Zeilen des Empfangsgedichtes herunterzuleiern … herunterzuleiern mit Schmiß allerdings. Doch der Bürgermeister würgte das alles ab, indem er mit einer großen Armbewegung den ganzen Radau in der Luft einfing und mit einem zusätzlichen „Schschtt!“ zum Schweigen brachte.
„Wo sind denn eigentlich die Herrschaften? Ich mein … wir sind doch hier zusammengekommen, um den Graf und die Gräfin … die sind doch nicht etwa in Japan geblieben?“
Es war nun Sache des Gutsverwalters, endlich Aufklärung zu bringen. Er hatte selber erst am Tauser Bahnhof von jenen Wiener Herrschaften Genaueres erfahren, die die Reisegruppe ab Budapest quasi übernommen hatten und nun weitergaben an die Ronsperger Kutschenabordnung. Diese komplizierten Übergabeprozeduren waren deshalb notwendig, weil Graf und Gräfin sich bereits in Ägypten von der übrigen Reisegruppe abgesondert hätten, „fahrt ihr ruhig schon einmal voraus“, denn die beiden wollten die einmalige Gelegenheit beim Schopfe packen und sich die Pyramiden und überhaupt manches ansehen.
„Ah so … ja, ja …“
Der Bürgermeister war genauso verdutzt wie alle anderen. Und auch der Schuldirektor wußte nicht recht, ob er seinen Schülern nun noch einmal den Einsatz geben sollte oder nicht. Wer würde überhaupt seine Reimkunst zu würdigen wissen? Dieser Kerl in Hirtenverkleidung sicherlich nicht. Und die beiden jungen, noch sehr jungen Grafensöhne? Der Bürgermeister hatte sich schon zu ihnen hinuntergebeugt und betont onkelhaft angesprochen, „ja dann begrüßen wir halt unsere junge Herrschaft … willkommen in Ronsperg!“, und ihnen die Hand hingehalten. Was Richard und Hansi erschrocken Schutz hinter den Beinen ihrer Kinderfräulein suchen ließ. Woher hätte der Bürgermeister aber auch wissen sollen, daß es in Japan als ausgesprochen unhöflich gilt, jemandem die Hand entgegenzustrecken?
2
Chrastavice, August 1945 „Jetzt halt endlich die Goschn, sonst komm’ ich runter!“
Es ist Lahanka auf der Pritsche über ihnen, der mal wieder auf seine bekannt freundliche Art daran erinnert, was eh allen klar ist: Besser, man schläft jetzt, klüger, man sammelt wenigstens ein paar neue Kräfte, die könnten wichtig sein für den morgigen Tag, um auch den irgendwie lebend zu überstehen. Nur: Es ist halt verdammt eng jetzt, zu dritt auf der unteren Pritsche. Weil Stangel ja auch unbedingt Platz machen mußte, vorhin, als der Neuankömmling bei ihnen in der Baracke landete. Frank hat das gleich für übertrieben gehalten. Mit diesem ewigen Mitleid kommt man hier in Chrastavice zu gar nichts, zu Schlaf am allerwenigsten. Und dann auch noch das Gequatsche von dem Neuen, das allerdings, das muß selbst Frank zugegeben, doch auch ganz unterhaltend gewesen ist. Die Geschichte, wie er im Böhmerwald angekommen ist, vor fast fünfzig Jahren, als Dreijähriger. Wenn der in dem Tempo weitermacht, wird das eine tausendnächtige Scheherazade. Frank muß sich eingestehen: Trotz allem hört er doch auch gerne zu. Er weiß zwar nicht, wie er heute nacht liegen soll, ohne daß er ständig einen Ellbogen im Gesicht oder ein Knie am Steiß hat, aber daß es mit dem neuen Kumpel in dieser beschissenen Lage vielleicht doch den einen oder anderen Ausflug in andere Gedankenwelten geben könnte, das dämmert sogar ihm. Und wer weiß, vielleicht kann es sogar helfen, das alles hier zu überstehen.
Hat Stangel also recht, daß er den Neuling unter ihrer beide Fittiche nimmt? Allerdings ohne Frank ausdrücklich gefragt zu haben, ob er damit einverstanden ist. Er wird halt wieder arg mitgenommen gewesen sein von der Art und Weise, wie man den Mann hierhergebracht hat. Frank findet: Das war nichts Besonderes. Das kann jedem passieren. So wie die Tür zur Baracke vorhin aufgerissen worden ist. Gleißend hell die Fläche im Türstock. Die Silhouetten zweier Männer tauchen auf. Sie halten etwas zwischen sich, etwas Eingesunkenes, Zusammengesacktes. Schleifen es über die Schwelle, schunkeln es zwei-, dreimal hin und her, so als ob sie Schwung nähmen für einen besonders weiten Wurf. Dann aber fällt ihnen der reglose Körper doch bloß aus den Händen, direkt vor Stangels und Franks Füße.
So wie der Neue ist hier schon mancher gelandet, nämlich auf der Schnauze. Mühsam versucht er, ein Bein anzuwinkeln, den Hintern zu heben, irgendwie auf die Knie zu kommen. Es gelingt ihm nicht. Die Wachleute spucken noch ein paar Tschechischbrocken auf ihn aus, drehen sich um und schlagen die Tür hinter sich zu. Keiner von den Männern in der Baracke rührt sich. Alle bleiben sie still hocken auf ihren Pritschen. Vielleicht daß die Kraft nicht mehr ausreicht, aufzustehen und dem Neuling zu helfen. Oder wollen sie ihm gleich einmal klarmachen, daß er sich hier besser auf niemanden verläßt? Daß er lieber schauen sollte, alleine durchzukommen? Wenn’s sein muß, auch auf Kosten eines anderen. Sich die wenigen verbleibenden Kräfte so einteilen, daß es zumindest fürs eigene Überleben reicht: Es gibt nur wenige in Chrastavice, die noch immer glauben, sich an diesen Grundsatz nicht halten zu müssen.
Stangel ist so einer. Ihm geht der Spitzname im Kopf herum, den gerade jemand benutzt hat. Einer, dem das Gesicht des Mannes am Boden anscheinend bekannt ist.
„Sieh an, Graf Schlitzauge, hier bei uns in dieser bescheidenen Hütte. Was verschafft uns die Ehre?“
Dieser Spott und diese Häme kommen Stangel vertraut vor. Dieser gewisse Beiklang von ‚jetzt hilft dir dein blaues Blut auch nichts mehr‘. Denn das scheint das einzig Tröstliche an ihrer aller Lage zu sein: daß jetzt keine Unterschiede mehr gemacht werden und alle in derselben Scheiße stecken.
Sogar die gräfliche Herrschaft. Darüber ist in den letzten Wochen öfters geredet worden, daß es die feinen Herrschaften nun genauso erwischt wie alle anderen. Die Trauttmansdorffs aus dem Bischofteinitzer Schloß zum Beispiel. Oder auch die Ronsperger, obwohl die eine Japanerin im Stammbaum haben, die Frau des alten Grafen. Ihr Ältester ist der jetzige Schloßbesitzer. Der wird es wohl sein, der jetzt vor Stangels Füßen liegt. Ausgesprochen mißliche Lage, in die zu kommen sich der Ronsperger Graf wahrscheinlich auch nie vorgestellt hat. Was hat er, der Halbjapaner, an diesem Ort zu suchen, in dieser Hölle, die die Tschechen allen Deutschböhmen bereiten, von denen sie annehmen, sie hätten mit den Nazis paktiert?
Er versucht es erneut, sich aufzurichten. Immerhin schafft er es bis auf Hände und Knie. In dieser Stellung hält er inne, keucht und läßt den Kopf zwischen den Schultern herunterhängen. Wie ein geprügelter Hund kniet er zitternd vor Stangel. Und stinkt. Der ganze Graf stinkt noch abscheulicher als jeder Straßenköter mit Räude. Kommt offensichtlich gerade vom Latrinendienst. Man riecht es nicht nur, man sieht es auch an den Spuren auf seinem Anzug. Stangel steht von seiner Pritsche auf und hilft dem Grafen, der sich mühsam aufzurappeln versucht.
„Danke! Vielen Dank.“
Der Graf spuckt und hustet es mehr hervor, als daß er es sagt. Ein Faden Blut rinnt aus seinem Mund, und er scheint es nicht einmal zu merken. Ziemlich übel haben sie ihn zugerichtet.
„Kleines Mißgeschick meinerseits.“
Der Schlitzäugige bemüht sich, ein Lächeln zustande zu bringen. Stangel kann sich ungefähr denken, was passiert ist. Schließlich ist er selbst auch schon dran gewesen, zum Räumdienst in der Latrine. Donnerbalken und Grube, alles haben sie extra zu kurz und zu klein gemacht, so daß der Abtritt alle zwei, drei Wochen vor Exkrementen überläuft. Dann muß einer ran und den Kot in ein Holzfaß umfüllen, das anschließend weggebracht wird. Als Schöpfgefäß für die Scheiße drückt das Wachpersonal dem jeweiligen Latrinenräumer gerne einmal eine Kaffeetasse in die Hand.
„Sie hatte einen Goldrand“, sagt Schlitzauge. Gedanken erraten ist nicht schwer im Lager. Es gibt nicht viele. Womit soll man seine Phantasie schon beschäftigen? Natürlich mit Vorstellungen von Essen. Leibspeisen in ungeheuren Portionen. Ob solche vorgegaukelten Genüsse allerdings wirklich helfen, besser mit dem zurechtzukommen, was es tatsächlich gibt? Alle Tage ein bitterer Rübenkaffee und eine dünne Wassersuppe. „Einäugige“ sagen sie in der Baracke dazu. Manchmal, das ist dann schon ein Festtag, gibt es hartes, verschimmeltes Kastenbrot. Hat man sich daran halbwegs satt gegessen, kreisen die noch übrigbleibenden Gedanken um das zweite große Thema: Was werden sie uns heute wieder antun? Im Falle des Grafen ist es eine Teetasse gewesen, die man ihm am Rand der Fäkaliengrube in die Hand gedrückt hat. Anscheinend ist der Latrinenräumdienst das erste gewesen, womit sie ihn im Lager empfangen haben. Ob eine andere Begrüßungszeremonie allerdings besser gewesen wäre … man darf seine Zweifel haben. Frank und Stangel jedenfalls, die schon länger im Lager sind, hat man gezwungen, erst einmal einen Tag lang in der Julihitze im Hof des Lagers mit dem Gesicht zu einer Wand Aufstellung zu nehmen. Es gab keinen einzigen Tropfen Wasser, zu essen sowieso nichts, keiner durfte sich rühren, und bei der kleinsten Verfehlung standen zwei Kerle neben einem und schlugen mit ihren russischen Lederpeitschen zu.
Es sind dieselben jungen Kerle gewesen, die vor Wochen in den Ortschaften entlang der Grenze aufgetaucht sind, in Hostau und Paschnitz, Schüttwa und Neu Gramatin. Halbe Buben noch, jeweils drei, vier von ihnen angeführt von einem Älteren. Alles, was sie ausweist als eine Art Ordnungstruppe, sind rote Binden, die sie über den Ärmeln ihrer sackgroben Straßenanzüge tragen. Und die Karabiner natürlich, die sind ein weiteres Argument dafür, lieber nicht nach irgendwelchen Legitimationen zu fragen, sondern ihnen ohne Widerworte zu folgen. Schon wie sie zielgerichtet von Haus zu Haus gestürmt sind, ließ erkennen, daß sie einem genauen Plan folgen, wenn nicht gar einer Art Liste, roten Liste selbstverständlich.
Rot ist sowieso ihre Farbe. Auch die Lkws, in denen sie Staub aufwirbelnd in die kleinen Ortschaften hereingebraust sind, sind mit roten Tüchern und Banderolen gekennzeichnet. Auf Bürgermeister und sogenannte höhergestellte Persönlichkeiten haben sie es besonders abgesehen. Meist haben sie nur den Familienvorstand mitgenommen, in anderen Fällen aber auch die ganze Sippe. Bei den Trauttmansdorffs sind sogar die Kinder mit aufgeladen worden auf die Pritsche des Lasters. Auch sie hält man nun in Chrastavice fest, und selbst den jüngsten, einen zwölfjährigen Buben, zieht man für Strafarbeiten heran, zum Beispiel für das Zurechtsägen von Brennholz. Die wenigen Frauen, die es im Lager gibt, sind für die Lagerküche eingeteilt und müssen aus verfaulten Kartoffeln und schimmeligen Runkelrüben jene Suppe kochen, die Tag für Tag an die Gefangenen ausgegeben wird. Auch das Reinigen der Waschräume sowie das Aufwischen der Blutlachen im Vernehmungsraum des Lagerkommandanten Rojt gehört zu ihren Aufgaben. Einzig den Latrinendienst erspart man ihnen. Der bleibt für Auserwählte reserviert.
Auserwählte wie „Graf Schlitzauge“. Er erzählt es ihnen, stockend, ein-, zweimal verzerrt es ihm das Gesicht vor Schmerzen, aber er versucht, überlegen zu klingen. Daß ihm einer vom Wachpersonal die Teetasse in die Hand gedrückt habe. „Für die feine Herrschaft natürlich mit Goldrand“, das habe er höhnisch auf Tschechisch hinzugefügt und wohl angenommen, er, der Graf, verstehe es nicht. Anschließend habe er wortlos auf die Grube mit den Exkrementen gezeigt. „Na, und dann bin ich eben hineingestiegen und hab angefangen. Ich war schon fast unten am Boden der Grube, da stieß ich mit der Tasse gegen einen Stein. Man hat ihn nicht sehen können, unter dem Kot, beziehungsweise ich hab nicht so genau hingeschaut. Und schon war er ab, der Henkel.“
„So ein Pech aber auch“, sagt Frank trocken. Eigentlich möchte Stangel jetzt zu dem geschundenen Mann vor ihm sagen, ‚der meint es nicht so‘. Immerhin beobachtet er Frank nun schon eine ganze Weile und hat längst bemerkt, daß dessen Sarkasmus nur dazu dient, sich selbst abzustumpfen. Aber Stangel ärgert sich, daß Frank nicht wenigstens einmal still sein kann. Er gibt ihm einen Rempler, „mach Platz!“, und bietet dem Grafen an, er solle sich zu ihnen auf die Pritsche setzen. Frank ahnt, was das bedeutet. Natürlich wird es nicht dabei bleiben, daß das Schlitzauge seinen Hintern nur ganz zaghaft auf die Bettkante setzt. Der wird, wenn es erst einmal dunkel ist, näher zu ihnen herrutschen und, wenn sie alle drei in einen bleiernen Schlaf gefallen sein werden, genauso um ein Stück vom Strohsack streiten, wie das auch er und Stangel traumverloren mit Ellbogenremplern und Fußtritten Nacht für Nacht tun.
Ganz vorne bei der Barackentür zu liegen, hält Frank die ganze Zeit schon für keine sehr gute Idee. Natürlich stammt sie von Stangel, der, als man sie in der Gruppe hier hereintrieb, Frank beiseite zog und bestimmte: „Wir bleiben hier vorne!“ Das Essen wird schließlich auch bei der Türöffnung hereingebracht, und den ewigen Kampf um die wenigen Bissen gleich von der ersten Reihe aus zu starten, ist natürlich von Vorteil. Ein Aufgeben oder gar Räumen des Platzes kommt also nicht in Frage. Frank ist klar, mit Stangel darf er es sich auf keinen Fall verderben, sonst hat er überhaupt keine Chance, auch nur halbwegs heil aus dieser Sache herauszukommen. Schwer zu sagen, was genau ihm dieses Gefühl gibt. Vielleicht die Tatsache, daß es denen hier im Lager, sowohl den Kerlen mit ihren Lederpeitschen als auch dem Kommandanten Rojt, bislang nicht gelungen ist, aus Stangel das zu machen, was sie aus jedem hier machen: ein gebrochenes, willenloses Wesen, das nur mehr ihnen und den Regeln des Lagers gehorcht. Alles andere vergißt man besser. Vor allem jene Verhaltensweisen, mit denen man bislang ganz gut durchs Leben gekommen ist, die nun aber auf einen Schlag alle Gültigkeit verloren haben.
Nur Stangel ist einer, der beharrt weiterhin auf ihnen. Das zeigt die Art, wie er Schlitzauge einen Platz auf ihrer Pritsche angeboten hat. Und jetzt auch noch das Bekanntmachen untereinander. „Das ist Postsekretär Hermann Frank aus Hostau. Und mein Name ist Alfred Stangel. Ich war einmal Schulrat in Schüttwa.“
„Angenehm. Johann Graf von … ach, wißt ihr was, ich glaube, wir sollten diesen alten Kram vergessen. Der hilft uns eh nicht mehr weiter. Ich bin der Hansi!“
Schlitzauge streckt die Hand aus. Frank braucht schon wieder einen Rempler von Stangel, um zu begreifen, daß er sie jetzt schütteln soll. Was er aber nicht tut. Er dreht sich weg. Keine Lust zu reden. Stangel und Hansi hingegen brauchen nicht lange, und schon sind sie mitten in der angeregtesten Unterhaltung. Frank kann sich nur wundern. Auch über das, was er nach und nach zu hören bekommt. Denn selbstverständlich kriecht er zwar ein Stück weiter nach hinten auf der Pritsche, sichert sich auch schon einmal ein Stück vom Strohsack als Kopfkissen, dreht dann den beiden anderen den Rücken zu, lauscht aber trotzdem ganz genau, was sie reden. Stangel sagt: „Eines verstehe ich nicht, Graf …“
„Du sollst nicht Graf sagen!“
„’Tschuldigung. Eines verstehe ich nicht, Hansi.“
„Was denn?“
„Wenn ich es recht sehe, dann sind wir hier im Lager doch alles Deutschböhmen?“
„Sieht so aus.“
„Weil sie uns raus haben wollen. Sie werden uns alle aus dem Land schmeißen.“
„Ich befürchte: ja.“
„Aber warum bist du dann hier?“
„Warum sollte ich nicht hier sein? Und vor allem, wenn nicht hier, wo dann?“
„Na, zum Beispiel dort, wo alle so aussehen wie du. Weit weg von hier. Wo man das alles nicht kennt, was wir hier in Europa die letzten sechs Jahre erlebt haben …“
„Du meinst im Land der Schlitzaugen?“
„Schlitzauge hast du jetzt gesagt. Außerdem finde ich: Besonders schlitzig sind sie gar nicht.“
„Mehr so halbschlitzig, ist es das, was du meinst?“
„Man fragt sich halt …“
„Klar. In Bischofteinitz im Gefängnis, wohin sie uns zuerst gebracht haben, haben sie mich auch gefragt. Zum Beispiel, ob ich ein Spion sei. Wahrscheinlich hat ihnen jemand erzählt, daß ich im April, als einer der ersten aus Ronsperg, mit den Amerikanern geredet habe. Sie kamen über den Hirschstein herüber. Wir sind mit einem weißen Bettuch vor die Stadt hinaus, und ich hab mit ihnen geredet. Was kann ich dafür, daß ich Englisch spreche. Russisch übrigens auch. Ich habe die Verhandlungen gedolmetscht. Weil kurze Zeit später waren die Russen auch da. Die kamen aus Richtung Bischofteinitz. Getroffen haben sie sich in der Mitte auf halber Strecke … bei mir im Schloß.“
„Hast du das denen in Bischofteinitz nicht erzählt?“
„Lange Erklärungen haben dort keinen interessiert. Da hieß es immer nur ‚ja oder nein‘. Spion – ja oder nein. Nazi – ja oder nein. Ich meine, so einfach geht es doch nicht …“
‚O doch‘, will Stangel sagen, ‚ich fürchte, so einfach wird es gehen.‘ Er ist bereits dem Kommandanten von Chrastavice vorgeführt worden und hat eine erste Unterhaltung mit ihm und seinen Männern fürs Grobe hinter sich. Aber er findet, Hansi hat heute schon genug mitgemacht. Er will ihn nicht noch mehr erschrecken.
„Das mit dir und deiner Familie ist wohl eine längere Geschichte, wie?“ sagt er statt dessen.
„Und ob!“ strahlt Hansi. Daß sich dafür noch einmal jemand interessieren würde, hat er nicht geglaubt. Aber so wie ihn Stangel jetzt aufmunternd ansieht, muß er fast den Eindruck bekommen, nun habe er den Richtigen gefunden.
3
Ronsperg, Sommer 1896 Als wenige Wochen später Graf und Gräfin endlich auch noch in Ronsperg eintrafen, da stand keiner mehr Spalier, und niemand erinnerte sich an irgendein auswendig gelerntes Willkommensgedicht. Man lasse sich doch von der launischen Herrschaft nicht noch einmal pflanzen, so ungefähr war die allgemeine Stimmung im Städtchen.
Nur im Schloß selber herrschte Aufgeregtheit und Vorfreude. Selbstverständlich hatte die Schloßküche ein mehrgängiges Mahl vorbereitet, und aus der zur Herrschaft des Grafen gehörenden Stockauer Brauerei war eigens ein Faß Festbier angeliefert worden. Für die Tafel hatte man im Salon gedeckt, alles, wie es sich gehörte. Teller, Gläser, Besteck … Besteck? Nachdem man Mitsuko ihren Platz an der langen Tafel gezeigt hatte, an einer der Stirnseiten gegenüber ihrem Gatten, hatte sie irritiert Messer und Gabel in die Hand genommen, und noch während ihr Braten, Soße und Serviettenknödel serviert worden waren, hatte sie indigniert gefragt, woher diese Dinge kämen und vor allem: wofür sie vorgesehen seien. Heinrich machte es ihr vor.
„Siehst du, so geht es: Das eine schneidet, das andere spießt.“
Er hielt die beiden Werkzeuge in die Höhe – „Messer, Gabel“ – und schob ein von Bratensoße tropfendes Knödelstück, aus dem die Zinken der Gabel hervorschauten, in den Mund. „Und das Besteck kommt aus der Schublade dort in der Anrichte. Es ist noch alles so wie früher, als ich hier Kind gewesen bin. Ist es nicht herrlich, wenn sich manche Dinge gar nicht ändern und einfach so bleiben, wie sie immer waren?“
„Soll das heißen, das hat schon einmal jemand im Mund gehabt?“
„Aber Mitsulein, meine kleine Lotusblüte, das Silberbesteck ist Familienbesitz und mindestens hundert Jahre alt.“ Er lachte, gekünstelt und gönnerhaft. ‚Schon einmal jemand im Mund gehabt …‘, na, du bist g’spaßig. Und wer das schon alles im Mund gehabt hat. Generationen!“
Mitsuko ließ ihr Besteck klirrend auf den Teller fallen. Daheim in Japan, Heinrich wußte es genau, hatte es zu jedem Essen ein paar neue Stäbchen gegeben. Sie starrte auf die von der Soße schon ganz braun gefärbten, matschigen Knödelscheiben. Was würde man ihr noch alles zumuten? Sie hatte augenblicklich nicht mehr den geringsten Appetit, und nicht einmal die Powidltascherln, die man ihr als Dessert anbot, konnten sie umstimmen.
Das war die Ankunft Mitsukos in Ronsperg.
4
Chrastavice, August 1945 „Paß auf, Schlitzauge: Kann sein, daß heute nacht hier ein paar von den jungen Kerlen aus der Wachmannschaft auftauchen, abgefüllt bis obenhin. Man weiß nicht, woher sie den vielen Schnaps haben, jedenfalls: Es wird dunkel und sie sind besoffen. Das ist wie ein Naturgesetz: dunkel, besoffen. Dann gehen sie auf Patrouille, wie sie das nennen. Geistern durchs Lager, mit Vorliebe drüben in der Frauenbaracke, aber auch hier bei uns, und fuchteln jedem mit der Pistole vor der Nase herum. Faseln was von Erschießungen, vom Fleck weg. Denk dir nix und vor allem: Bleib ruhig.“
Jetzt flüstern sie doch wieder, möglichst leise, um Lahanka nicht zu wecken. Man hört, wie der laut rasselnd schnarcht und ab und zu grunzt, allein da oben auf seiner Pritsche, einen gesegneten Schlaf hat der offenbar. Nur bei Frank, Stangel und Schlitzauge klappt es nicht. Sie haben eine Zeitlang stillgehalten, wegen des Rabauken aus Neu Gramatin über ihnen, jetzt aber müssen sie Schlitzauge noch ein paar wichtige Tips geben. Selbst Frank findet Gefallen an der Unterweisung des Neulings. So kann man beweisen, daß man ein alter Hase ist und sich auskennt in den Regeln des Lagerlebens.
„Man muß sie machen lassen, die jungen Kerle“, flüstert er weiter. „Laß sie ihr Mütchen kühlen. Da gibt’s nur eins: wegducken und Maul halten. Wer sich ihnen entgegenstellt, den haben sie von da an im Visier, glaub mir. Und für den lassen sie sich ständig was Neues einfallen. Vorletzte Nacht haben sie ein paar drüben aus der anderen Baracke geholt. Man sagt, die seien alle bei der SA gewesen. Haben ihnen mit Draht die Hände auf den Rücken gefesselt, sie mit dem Rücken auf den Boden gelegt und sind auf ihnen herumgesprungen. Und dabei mußten sie singen … die am Boden natürlich: ‚’s geht alles vorüber, ’s geht alles vorbei …‘“
„Dem Rojt sind solche Eskapaden gar nicht recht.“ Es klingt fast so, als ob Stangel den Kommandanten des Lagers in Schutz nehmen wolle. „Aber nicht mal der stellt sich denen in den Weg, wenn sie besoffen sind.“
„Die würden den auch glatt übersehen und über den Haufen rennen. Hast du den Rojt schon gesehen?“ fragt Frank den Grafen.
„Nein. Wieso?“
„Wenn ich dir einen Rat geben soll: Verkneif dir das Grinsen, wenn du ihm das erste Mal gegenüberstehst.“
„Wieso?“
„Das mag er nicht.“
Frank findet, das muß als Erklärung genügen. Nur Stangel wird deutlicher.
„Rojt, das ist der ‚Kleine‘. So heißt er bei allen hier im Lager.“
„Ein laufender Meter …“, pflichtet Frank bei.
„Naja, so um die einsvierzig wird er schon haben. Nur laß ihn das nicht merken …“
„… also nicht merken, daß du merkst, was für ein Zwerg er ist.“
„Verstehe.“
„Sonst kann er ekelhaft werden.“
„Nicht daß er sich selber die Finger schmutzig macht, nicht der Kleine. Aber dafür hat er seine Leute.“
„Drüben im Verhörzimmer der Kommandantur. Mindestens zu dritt sind sie da jedesmal.“
„Und du alleine.“
„Um was geht es dabei … ich meine, bei dieser Art von Unterredung?“ fragt Hansi, und die anderen beiden sind sich nicht sicher, ist er tatsächlich so blöd oder stellt er sich nur so.
„Um ein Geständnis natürlich“, antwortet Stangel. „Du sollst sagen, daß du bei den Nazis mitgemacht hast.“
„Würd’ ich aber nicht, wenn ich du wäre“, rät Frank. „Du wirst einiges aushalten müssen, das ist klar. Aber gib nie irgend etwas zu. Nicht einmal, daß dich deine Mutter zur Welt gebracht hat. Sag: Man kann sich nie sicher sein. Weil ansonsten bleibst du hier. Oder noch schlimmer: Sie schicken dich nach Sibirien. Die Abschiebung über die Grenze nach Bayern jedenfalls, die kannst du dann vergessen.“
„Danke“, sagt Hansi. Er weiß auch nicht warum. Aber es ist genau das, was die anderen beiden hören wollen. Sie werden nun noch generöser.
„Weißt du was, Hansi, du kommst morgen früh mit uns mit. In unsere Brigade. Da können wir wenigstens auf dich aufpassen.“
Stangels und Franks Mannschaftszug kommt alle paar Tage an einen anderen Ort. Immer sind es irgendwelche Aufräumarbeiten, die sie zu erledigen haben, Schutt wegschaufeln, Straßen reparieren, Bahngleise neu verlegen. Oder wie seit einigen Tagen bei einem riesigen Haufen von Ziegeln Mörtelreste abschlagen und fein säuberlich neu aufschlichten. Das wird er doch hoffentlich hinbekommen, der Graf. Weil wenn nicht, hat es die ganze Brigade auszubaden. Dann hagelt es nicht nur noch mehr Prügel als sowieso schon, dann kann es passieren, daß ihnen das Essen gestrichen wird, der herrliche Rübenkaffee und die „Einäugige“. Das findet Frank gar nicht lustig.
„Bist du verrückt?“ herrscht er Stangel an. „Der versaut uns doch alles. Der hat doch sein ganzes Leben noch kein einziges Mal zupacken müssen? Stimmt’s, Schlitzauge?“
„Nun ja …“
„Hast du schon jemals einen Fäustel in der Hand gehabt?“ fragt ihn Frank. „Wenn einer zu dir sagt, ‚hol mal die Herzschaufel her‘, was bringst du ihm dann? Und weißt du überhaupt, wo bei einer Herzschaufel oben und unten ist?“
„Jetzt haltet endlich mal das Maul!“
Frank ist zu laut geworden bei seinem ganz speziellen Verhör Hansis. Diesmal ist es nicht Lahanka, der dazwischenfährt, sondern einer von weiter hinten. Besser sie sind jetzt ruhig, bevor sie noch die ganze Mannschaft gegen sich aufbringen. Und schließlich gilt es ja auch zu bedenken: Wo soll man morgen früh die Kräfte hernehmen, um den Tag zu überleben? Unausgeschlafen wird man schnell zum „Gespenst“. So heißen im Lager diejenigen, die bereits durch Wände gehen können oder spurlos in den Lehmboden einsickern: Plötzlich sind sie weg und verschwunden. Nichts bleibt übrig. Ihre wenigen Sachen sind im Nu unter den anderen aufgeteilt, und keiner spricht mehr von ihnen. Das wollen sie nicht, die drei von der gemeinsamen Pritsche. Deshalb gibt Stangel, der schließlich Schullehrer war, den Befehl aus: „Wir schlafen jetzt.“ Frank stupst noch einmal Hansi an, der sich für seinen Geschmack zu breit macht auf dem Strohsack, und droht ihm: „Träum was Schönes.“
5
Ronsperg, Dezember 1899 Es gab so manche Frage, die sich die Leute im Städtchen im Zusammenhang mit der neuen Herrschaft stellten, auch nachdem sie schon eine Weile hier lebten, und eine der vordringlichsten davon war: Welchem Glauben hängen die überhaupt an? Vom Grafen war es klar: Heinrich war als Abkömmling der Ronspergheimer selbstverständlich lebenslang ein guter Christ und Katholik. Alles andere wäre auch höchst befremdlich gewesen, schließlich hatte die Herrschaft auf Schloß Ronsperg das Patronat über die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sowie über sechs weitere Dorfpfarreien ringsum inne. In der Kirche gab es, auf der Nordseite des Chorraumes, eigens einen Patronatsstuhl, eine Art Loge mit verglasten Fenstern, von wo aus die Herrschaft, erhöht über der restlichen Gemeinde, die unten in den Kirchenbänken hockte, an der heiligen Messe teilnehmen konnte. Und dort, in diesem Grafenstuhl, saß nun alle Sonn- und Feiertage der neue Graf mit seiner Familie. Allerdings war es für manchen Ronsperger schon eine Frage der Gewöhnung, hinter den spiegelnden Glasscheiben das Gesicht einer Japanerin zu erkennen.
Natürlich hatte sich herumgesprochen, daß die Frau des Grafen sich noch vor der Hochzeit hatte taufen lassen – andernfalls hätte es gar nicht zur Vermählung kommen können. Aber dennoch: Wußte man, was im Inneren dieser sich – wie es vielen vorkam – puppenhaft bewegenden Person mit dem maskenhaft starren Gesichtsausdruck vor sich ging? Und vor allem was sie, unterstützt von ihren japanischen Kinderfräulein, in Sachen rechtem und wahrem Glauben dem Nachwuchs einimpfte, der ähnlich undurchsichtig schlitzäugig in die Welt schaute wie seine Mutter?
Und konnte der Graf tatsächlich das entscheidende Gegengewicht in der religiösen Erziehung sein, wo er sich doch andauernd, wie sich bald herausstellte, mit den Einflüsterern anderer Glaubensrichtungen umgab? Über die Beschäftigten des Schlosses, die ja viel mehr als er selber mit der Ronsperger Bevölkerung in Kontakt kamen, ließ sich jedenfalls leicht in Erfahrung bringen, daß der neue Schloßherr freundschaftlichen Umgang mit bedeutenden geistigen Führern sämtlicher Weltreligionen pflegte. Das hätte man für eine Form aristokratischer Großsprecherei halten können, bis eines Tages ein Gast vor dem Schloß auftauchte, der offensichtlich von weit her angereist war. Er trug einen Turban und lange, wallende Gewänder. Sein Name war Abdullah Sohraworthy, und es hieß, er stamme aus Indien, sei ein Kalifensohn. Gleich für mehrere Monate lud der Graf ihn als Gast auf Schloß Ronsperg ein. Bald war er wie zur Familie gehörig, an der Essenstafel aufmerksam beobachtet von den Kindern: Nie griffen seine ungeheuer feinen Finger nach einem Glas Alkohol, und immer, wenn es böhmischen Schweinebraten oder einen Hasenrücken gab, wurde ihm etwas anderes vorgesetzt.
Abdullah tauchte nun öfter in Ronsperg auf. Es hieß dann stets, er sei wieder einmal unterwegs in den großen Städten Europas, um Anhänger zu gewinnen für seine Idee einer „panislamistischen Bewegung“, was immer das auch sein mochte. Mit Heinrich jedenfalls verbrachte er ganze Nachmittage in dessen Bibliothek. Sie schlossen sich dort regelrecht ein, damit niemand sie bei ihrem Dialog über Religionsfragen störte.
Solche Gespräche führte der Graf nicht nur mit Sohraworthy. Vertreter des Buddhismus waren in Ronsperg ebenso zu Gast wie Sufisten aus Kairo oder Patriarchen aus Serbien und Rußland. Selbstverständlich lud Heinrich auch Vertreter der christlichen Religionen zu seinen Ronsperger Gesprächen. Dann bat er auch Stadtpfarrer Mauritz hinzu, der stets interessiert war zu erfahren, was Brüder seiner Kirche in anderen Weltgegenden erlebten. Wie zum Beispiel der Bischof von Hakodate, den es als französischen Missionar in die Heimat Mitsukos verschlagen hatte. Er war ein, wenn auch nicht oft, so doch besonders gern gesehener Gast, konnte er doch stets Nachrichten aus jenem Land mitbringen, nach dem sich die Gräfin – man spürte es trotz ihrer asiatisch mienenspiellosen Zurückhaltung – vor Heimweh geradezu verzehrte. Noch dazu, wo sie mit dem Bischof Japanisch sprechen konnte. Das hatte der nämlich in Hakodate erstaunlich gut gelernt. Daneben beherrschte er nur seine Muttersprache Französisch. Pfarrer Mauritz wiederum sprach nur Deutsch und Tschechisch. Und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als bei ihrem Dreiergespräch in der Schloßbibliothek auf jene Sprache zurückzugreifen, die sich bei solcherlei Religionsgesprächen noch immer als letzter Strohhalm einer ansonsten stockenden Verständigung erwiesen hatte: Kirchenlateinisch nämlich. Allerdings fehlte Pfarrer Mauritz schon gleich zu Beginn der rechte Begriff, als er den Bischof fragen wollte, wie denn die Reise mit der Eisenbahn von Pilsen hierher nach Ronsperg gewesen sei. Der Graf wußte schließlich beizuspringen, mit der im Lateinischen so noch nicht gekannten Formulierung von der „via ferrata“.
Heinrich fand für jeden und in jeder Situation das rechte Wort in der rechten Sprache. Er war einfach ein Genie der Verständigung zwischen den Kulturen. Und so konnte es nicht wunder nehmen, daß er schon bald auch mit dem Ronsperger Rabbi, Bernhard Glaser, einen intensiven Gedankenaustausch pflegte. In diesem Fall hatte sein Kontaktsuchen zum Vorsteher der jüdischen Gemeinde jedoch noch einen speziellen Grund: Heinrich, immerhin mittlerweile vierfacher Vater und dem Studentenalter wahrlich entwachsen, hatte sich an der Prager Universität für ein Studium der Semitischen Philosophie eingeschrieben. Und offensichtlich gab es eine Reihe von Fragen, die er außerhalb der Vorlesungen und Seminare mit einem schriftkundigen Vertreter dieser alten monotheistischen Glaubenslehre, die denselben Wurzeln wie das Christentum entstammte, zu besprechen hatte. Die gut drei Dutzend jüdischen Familien mitsamt ihrem Rabbiner fristeten in Ronsperg ein weitgehend unbehelligtes Leben, kein sehr wohlhabendes, aber ein gediegenes. Groß mit ihnen abgeben tat sich von den übrigen Ronspergern niemand. Erst mit dem Einzug des neuen Grafen in das Schloß änderte sich das. Anfänglich sah man ihn und den Rabbiner des öfteren am Ringplatz beieinander stehen und ausführliche Gespräche führen. Es dauerte nicht lange, und es kam zu gegenseitigen Einladungen. Das Verhältnis wurde für jeden, der Augen im Kopf hatte, immer vertraulicher. Man mußte zwangsläufig zu dem Eindruck kommen, die beiden verstünden sich von Mal zu Mal besser. Blieb eigentlich nur mehr die Frage: Was reden die die ganze Zeit? Beziehungsweise: Die hecken doch irgend etwas aus. Nur was?
6
Ronsperg, 13. April 1900 Am ersten Karfreitag des neuen Jahrhunderts – er fiel ausgerechnet auf einen Dreizehnten – sollten die Ronsperger erfahren, was Rabbi und Graf im Schilde führten. Das heißt, eigentlich war es gar kein gemeinsamer Plan, sondern einzig und allein Heinrichs Entschluß, dem Ablauf der Karfreitagsmesse eine unerhörte Wendung zu geben. Glaser war nur zufällig nahe am Ort des Geschehens. Und auch bei Heinrich stellte sich der Impuls zu jener Handlung ganz spontan ein, sie war nicht lang überlegt oder geplant, sondern eben mehr eine plötzliche Eingebung, wie sie in Kirchen ja manchmal vorkommen sollen. Auch Mitsuko verstand im ersten Moment nicht, was denn eigentlich los sei, als sich ihr Ehemann plötzlich aufrichtete, Gerolf bei der Hand nahm und seiner Frau, die die erst zweijährige Elisabeth auf dem Schoß sitzen hatte, ein Zeichen gab, ihm zu folgen. Ganz offensichtlich war die Messe noch nicht zu Ende, so viel begriff selbst Mitsuko, die ansonsten kaum etwas verstand von dem, was Pfarrer und Gemeinde in ihrem eigenartigen, mal gesungenen, mal gesprochenen Frage-und-Antwort-Spiel austauschten. Weil aber eine gute Japanerin niemals etwas anderes tun würde, als völlig wort- und widerstandslos ihrem Gatten zu folgen, stand Mitsuko auf und stupste ihre beiden Ältesten, Hansi und Richard, an, damit auch sie mitkämen. Die beiden starrten nämlich fasziniert hinunter in den Altarraum, und fast schien es, als ob sie begierig auf das warteten, was Heinrich offensichtlich nicht mehr hören wollte, ja, mehr als das: wovon er sich, durch sein demonstratives Aufstehen und Weggehen, unbedingt distanzieren mußte, und zwar für das ganze, unten im Kirchenschiff hockende Ronsperg sicht- und hörbar. Die Karfreitagsliturgie näherte sich gerade der Stelle, an der die Fürbitten verlesen werden würden. Und das „Lasset uns beten für die treulosen Juden …“ war noch gar nicht durch den Kirchenraum gehallt, da hörte man, wie die knarzende Tür zur Patronatsloge extra laut, so konnte es einem vorkommen, zugeschlagen wurde. Selbst die letzten, die bis jetzt noch nicht auf das seltsame Geschehen im Grafenstuhl aufmerksam geworden waren, richteten nun ihren Blick hinauf in den Chor und sahen: Da verließ doch tatsächlich die Grafenfamilie mitten während der Karfreitagsmesse die Kirche.
Was den Skandal aber erst perfekt machte, war das, was draußen auf dem Ringplatz folgte. Man weiß nicht genau, wer es beobachtet hat, denn zu dieser Stunde sollten natürlich alle guten Ronsperger Christenmenschen in der Kirche gewesen sein. Aber einer muß es gesehen haben, denn kurze Zeit später wußte es der ganze Ort: Der Graf kam mit seiner Familie aus der Kirche heraus, und wer wartete draußen auf dem Ringplatz, so als ob man sich dort verabredet hätte? Rabbi Bernhard Glaser. Daß sich der dort überhaupt herumtreiben durfte! Früher wäre so etwas undenkbar gewesen. Da wurde an Sonn- und Feiertagen die Judengasse noch mit einer schweren Eisenkette zwischen Altem Rathaus und dem Kohlengeschäft Füßl abgesperrt, und von den Mosaischen durfte sich keiner auf dem Kirch- oder Ringplatz blicken lassen. Aber mittlerweile galten diese bewährten Grundsätze ja nichts mehr. Wie zum Hohn stellten sich, während man drinnen in der Kirche für die treulosen Juden betete, damit ihnen der Herr endlich den Schleier von ihren Herzen wegziehe, der Patronatsherr von Mariä Himmelfahrt und der Rabbiner zusammen und begannen eine Unterhaltung. Und weil abzusehen war, daß die länger dauern würde (und die Kleine auf dem Arm der Gräfin schon zu quengeln anfing), lud Heinrich den Rabbiner ein, mit ihm ins Schloß zu kommen.
Dort zogen sie sich schnell in Bibliothek und Arbeitszimmer des Grafen zurück. Naturgemäß dauerte es nicht lange, bis ihr Gespräch bei dem Thema landete, das seit Monaten jede Unterhaltung dominierte, bei der es um das Zusammenleben von Juden und Gojim ging. Beinahe auf den Tag genau ein Jahr war es nun her, daß man in einem Waldstück nahe Malá Věžnice, an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren und also weit hinten im Osten, die Leiche eines 18jährigen Mädchens gefunden hatte, mit durchgeschnittener Kehle. Ihr Körper war eigenartig blutleer gewesen, das hatten die Forensiker bei der Autopsie festgestellt. Und so war schnell das Gerücht aufgekommen, es könne sich bei dieser grausamen Tat nur um einen jüdischen Ritualmord handeln.
„Glauben Sie allen Ernstes, daß Matzen besser schmecken, wenn man Blut hineinrührt?“ fragte der Rabbiner den Grafen, denn das war es, was man seit Jahrhunderten den Juden vorwarf, sie würden hinter dem Blut unschuldiger christlicher Kinder herjagen, um es an Pessach dem Teig ihres ungesäuerten Brotes beizumischen. Dummerweise war der Mord an Anežka Hrůzová, so hatte das Mädchen geheißen, ausgerechnet am Vorabend von Pessach passiert, dummerweise vor allem für Poldi Hilsner, denn den hatte man schnell ausgemacht als jemanden, dem man diese Tat leicht in die Schuhe schieben konnte. Der junge arbeitslose Mann war schlecht beleumundet, nicht besonders hell im Kopf und daher zu einer juristischen Verteidigung der eigenen Person kaum in der Lage. Und vor allem: Er war Jude.
„Alles Unsinn! Wer kommt denn überhaupt auf eine solche Idee, Blut und Brot auf diese ekelhafte Weise in Verbindung zu bringen?“
„Ihr Christen vielleicht, Herr Graf?“
Glaser entschuldigte sich sogleich für diese Bemerkung, sie war ihm herausgerutscht. Dem Grafen mußte man so etwas freilich nicht sagen. Der Rabbi hatte bald bemerkt, welch außerordentlicher Gewinn es für das kleine Städtchen war, daß dieser Mann von Welt, der alle Erdteile bereist hatte, die Nachfolge des alten Grafen Franz Karl angetreten hatte. Und insbesondere für ihn selber hatte sich Entscheidendes geändert: Endlich hatte der Rabbiner einen Partner, mit dem er das tun konnte, was er am liebsten tat, Fragen der Religion und des Glaubens besprechen. Und er mußte ehrlicherweise sagen, vom Grafen konnte man noch allerhand lernen. Kein Wunder, der Mann hatte ein exorbitantes Wissen. Immer wieder staunte Glaser, wenn der Graf ihn in seine Bibliothek führte und ihm die Abteilung mit religionsgeschichtlichen Büchern zeigte. Nichts schien da zu fehlen, und zwar nicht nur, was dessen eigene Glaubensrichtung betraf, sondern über sämtliche Weltreligionen konnte man sich hier kundig machen. Insbesondere seine Sammlung von Judaica war, Glaser mußte es neidlos anerkennen, höchst imposant und den armseligen Beständen in seiner eigenen Synagoge weit überlegen. Daher lud der Graf ihn auch jedesmal ein, sich ein paar Bücher auszusuchen und mit nach Hause zu nehmen: „Ich denke, die sind bei Ihnen besser aufgehoben.“ Er machte sie ihm zwar nicht offen ausgesprochen zum Geschenk, Nachfragen nach dem Mitgenommenen gab es aber in der Folgezeit nie. Auf diese Weise erfolgte über die Jahre Stück um Stück ein Umzug eines Teils der Bibliothek aus dem Schloß hinüber in die Synagoge in der Judengasse, und es schien ganz so, als ob dies auch genau die verschwiegene Absicht des Grafen sei.
„Jetzt hat das neue Jahrhundert angefangen, und die Leute glauben immer noch an diese mittelalterlichen Schauermärchen.“
Heinrich war jedesmal empört, wenn die Sprache auf den Fall der ermordeten Anežka Hrůzová kam. Die Rolle ihres zwielichtigen Bruders habe man, fand er, nie ausreichend untersucht. Soll der nicht mittlerweile längst nach Amerika verschwunden sein?
Rabbi Glaser hatte davon noch nichts gehört. Es interessierte ihn auch nicht sonderlich. Selbst wenn sich herausstellen sollte, daß es noch andere Verdächtige gab, was änderte das. „Immer schiebt man es uns in die Schuhe.“
„Ich weiß auch nicht“, sagte der Graf, „das sind alte … uralte Atavismen. Das wurde uns jahrhundertelang eingebleut. Sogar Masaryk schreibt, er müsse zugeben, daß er den Antisemitismus – und das war schwer genug – intellektuell überwunden habe, emotional könne er ihn aber wohl sein Leben lang nie ganz loswerden.“
„Na bravo!“ rief Glaser sarkastisch. „Er fühlt sich also in der Gegenwart eines Juden immer unwohl, und das wird so bleiben für Ihren famosen Herrn … Herrn …“
„Tomáš Masaryk. Philosophieprofessor in Prag. Wissen Sie denn gar nicht, daß er zum Fall von Leopold Hilsner eine flammende Protestschrift verfaßt hat?“
Der Graf stand von der Sitzgruppe auf, um an eines seiner Bücherregale zu gehen. „In Prag haben ihn dafür die tschechischen Studenten niedergeschrieen und am Abhalten seiner Vorlesung gehindert. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Er ist nicht etwa aus dem Hörsaal davongelaufen, sondern er hat sich umgedreht und seine Ausführungen stumm mit der Kreide an die Tafel geschrieben. – Ach, hier habe ich sie ja … die Broschüre. Ist bei Erscheinen sofort verboten worden. Ich hab mir trotzdem ein Exemplar gesichert.“
Der Graf brachte es Glaser, der sitzen geblieben war. Er las den Titel, „Die Nothwendigkeit der Revision des Polnaer Processes“, und blätterte lustlos darin herum. Er mochte sich mit diesem Fall gar nicht mehr länger auseinandersetzen. Dem Rabbiner war von Anfang an klar gewesen, wie alles enden würde: mit der Verurteilung von Leopold Hilsner, auch wenn der immer wieder beteuert hatte, mit dem Fall nichts zu tun zu haben. Wie auch anders, nachdem wochenlang gegen den, wie es in den Zeitungen hieß, „perversen Judenbengel“ gehetzt worden war. Und genauso war es dann auch gekommen. Das Gericht in Polná hatte geurteilt: schuldig des Mordes an Anežka Hrůzová, die Strafe lautete auf Tod durch den Strang.
„Es muß eine Revision geben“, sagte der Graf. „Das ist es, was Masaryk fordert. Und sie wird auch kommen.“
„Glauben Sie allen Ernstes, da wird ein anderes Urteil gesprochen? Der Prozeß gegen uns Juden ist schon vor 2000 Jahren in letzter Instanz entschieden worden. Da ändert sich nichts mehr, glauben Sie mir.“
„O doch!“
„Sie wollen etwas gegen den Antisemitismus unternehmen?“
„Ja, den festen Vorsatz habe ich.“
„Aber Sie wissen doch, der ist unausrottbar. Vor allem unter denjenigen, denen Juden so gut wie nie begegnen.“
„Wie meinen Sie das?“
„Das ist doch eine alte Tatsache. Antisemitismus funktioniert überall dort am besten, wo es keine Juden gibt.“
Der Graf schmunzelte. „Das muß ich mir merken.“
„Wozu?“
„Um es einen von denen bei nächster Gelegenheit entgegenzuhalten.“
„Und Sie glauben, das hilft?“
„Ja. Wenn ich zu etwas nicht bereit bin, dann ist es, den Glauben daran aufzugeben.“
Das war es, was der Rabbiner am Grafen bewunderte. Der gab einfach nicht auf. Und zwar bei dem, was Glaser mittlerweile ihre ‚gemeinsame Sache‘ zu nennen geneigt war. Denn immer wieder kamen sie auf dieses Thema zurück und debattierten oft Nachmittage lang, welche Strategien sinnvoll wären. Der Enthusiasmus des Grafen riß ihn mit. Dabei hatte sich Glaser längst mit der Einsicht arrangiert: So lange es Juden geben würde, würden sie mit Antisemiten leben müssen. Nur der Graf schien gegen dieses Naturgesetz zu rebellieren. Eine solche Unverdrossenheit wie die, mit der der Graf für die Rehabilitierung der Juden kämpfte, hatte Glaser noch nicht erlebt, bei niemandem. Er schreibe an einer Arbeit, sagte der Graf, in der werde er nachweisen, welche Quellen der Antisemitismus habe und daß sie allesamt irrational und folglich eines jeden aufgeklärten, intelligenten Menschen unwürdig seien. Das Ganze werde er als Dissertation an der Universität in Prag einreichen.
„Das wird die Antisemiten ungeheuer beeindrucken“, erwiderte Glaser, allerdings um gleich darauf Spott und Sarkasmus beiseite zu lassen und den Grafen zu ermuntern: „Aber trotzdem, versuchen Sie’s. Wenn überhaupt, dann muß das jemand wie Sie machen. – Und Sie haben auch bestimmt keinen Juden in Ihrem Stammbaum?“
„Aber nein, wo denken Sie hin!“
„Dann wird es auch nicht so einfach werden, Ihre Schrift zu diskreditieren.“
„Ganz recht. Und wissen Sie, was wir jetzt jedes Jahr machen werden, Glaser?“
„Was denn?“
„Unsere Karfreitagsgespräche. Solange nämlich dieses infame ‚oremus et pro perfidis Judæis‘ nicht aus den Fürbitten verschwindet, so lange werde ich aufstehen und gehen. Und Sie werden draußen am Stadtbrunnen warten, und dann zeigen wir denen einmal, wie es auch gehen kann.“
7
Chrastavice, August 1945 „Mein Gott, iß! Das wird nicht frischer.“
Hansi hält eines der Kastenbrote in der Hand. Die anderen mühen sich bereits, das harte Frühstück klein zu kauen. Nur er reibt noch immer mit dem Finger über die blau-grünen Schimmelflecken und scheint sich nicht entschließen zu können. Dabei hielte er ohne Stangel noch nicht einmal das in Händen. Eben sind, wie jeden Morgen, drei Männer vom Wachpersonal in die Baracke gekommen. Zwei tragen einen Korb zwischen sich, der dritte eine alte, verbeulte Kanne mit dem Rübenkaffee. In dem Korb sind Brote. Doch die Wachleute stellen ihn nicht einfach ab. Vielmehr kippen sie den Inhalt auf den Lehmboden. Warten ab und sehen zu, was passiert. Das ist ihr erstes Gaudium an diesen Tag, der gerade erst heraufzudämmern beginnt. Im Nu springen alle von ihren Pritschen auf und stürzen sich auf den Brothaufen. Auch Frank und Stangel werfen sich blitzschnell ins Gewühl, nur Hansi bleibt stehen und betrachtet das Schauspiel, dessen Regeln er noch nicht begreift. Frank taucht als erster wieder auf, mit einem Laib, dem ein Stück abgerissen ist. Gleich verzieht er sich auf die Pritsche und macht deutlich, daß er unter keinen Umständen etwas davon abgeben wird. Dann steht Stangel vor Hansi. Er hat zwei Brote ergattert, eines gibt er Hansi. „Jetzt iß doch.“
Hansi fängt an, das Brot in kleinere Stücke zu brechen, steckt diese aber statt in den Mund in seine Jackentaschen.
„Es schmeckt großartig“, redet Stangel ihm gut zu. „Alles schmeckt großartig, wenn man nur genügend Hunger hat.“
„Bist du jetzt dem seine Amme oder was? Willst du ihn vielleicht demnächst mit einem Löffelchen füttern?“
Lahanka scheint der Ausgeschlafenste von allen an diesem Morgen zu sein. Er sitzt auf der oberen Pritsche des Stockbettes und läßt die Beine herunterbaumeln.
„So einer ist eben anderes gewohnt, stimmt’s, Schlitzauge? Was haben sie dir denn in der Ronsperger Schloßküche so alles aufgekocht?“
Das ist das Stichwort für den Grafen. Er fängt an, seine Lieblingsspeisen aufzuzählen. Hält sich dabei an die Chronologie der Jahreszeiten. Fängt an mit den Fischessen während der Fastenzeit, mit den fetten Karpfen aus den Stockauer Teichen, weiter geht es mit den Spanferkeln, die an so manchem Sommerabend im Schloßpark an einem Spieß über offenem Feuer brieten. Im Herbst war es selbstverständlich Wild, das auf dem Speiseplan stand, Rehragout mit Serviettenknödel oder Wildschweinbraten mit Rotkraut.
Und es funktioniert: Den anderen schmeckt das harte, schimmelige Brot gleich viel besser, wenn es mit den Schilderungen Hansis gewürzt wird. Schließlich landet er bei Weihnachten. Da hat es selbstverständlich jedes Jahr eine Weihnachtsgans gegeben. Seine Erinnerungen an Weihnachten werden auf ewig von einem Duft nach Gänsefett durchzogen bleiben. Bis dann auf einmal Schluß damit war. Ende der dreißiger Jahre.
„Warum das denn?“
„Weil uns der Lieferant dieser herrlichen Gänse abhanden gekommen ist.“
„Wer war es denn?“
„Rabbi Glaser von der Ronsperger Judengemeinde.“
„Bei dem habt ihr eure Weihnachtsgänse gekauft?“
„Doch nicht gekauft. Wir haben sie von ihm geschenkt bekommen. Jedes Jahr wieder schickte er seinen Schames, einen alten, etwas vertrottelten Kerl, der mit einer unvorstellbar speckigen Kappe auf dem Kopf herumlief und dem man ansah, wie unwohl er sich dabei fühlte, in ein Haus mit lauter Gojim gehen zu müssen. Doch diesen Verdruß hat der Rabbi seinem Synagogendiener jedes Jahr abverlangt, das mußte sein. Außer er kam gleich selber vorbei und brachte die schlachtfrische, schon ausgenommene und gerupfte Gans.“
„Unglaublich. Der Jud’ hat euch eine Weihnachtsgans geschenkt? Und wieso hat er das getan?“
„Das hat uns der Vater nie so genau erklärt. Und wenn, dann sicherlich nur meinem Bruder Richard, dem Dicky. Er hat bloß immer gesagt: Der Rabbi und ich, wir haben eine Abmachung.“
„Ah ja, das hat er gesagt?“
„Genau so.“
8
Ronsperg, März 1901 „Wieso eigentlich wirft man ausgerechnet den Juden vor, sie hätten unseren Heiland umgebracht, können Sie mir das sagen, Rabbi?“
Seit der Graf dem Studium der Semitischen Philosophie in Prag nachging, viel zu sporadisch und unregelmäßig, wie er selbst einräumen mußte, seitdem kam er mit eigenartigen Fragen zu Glaser. Heinrich hatte es sich angewöhnt, einfach in der Judengasse vorbeizuschauen und nicht erst den Umweg über eine förmliche Einladung ins Schloß, überbracht durch die Schafferin oder seinen Verwalter, den Bernklau, zu wählen. Glaser war es immer etwas unangenehm, wenn der Graf plötzlich in der Tür stand. Einen wie ihn, fand er, müsse man in einer anderen Umgebung empfangen, als sie die beengte Rabbinerwohnung im Erdgeschoß der Synagoge bot. Ein ziemlich scheußliches, feuchtes Loch war das, stets unaufgeräumt wegen der Horde von Kindern, die hier herumtobte. Unter die acht eigenen des Rabbiners und seiner Frau mischten sich noch etliche der Nachbarschaft – bei den Mandlers und Grünhuts war man offensichtlich der Meinung, daß so ein gelehrter Mann wie der Rabbi, der den lieben langen Tag nichts anderes tat, als seinen Kopf in Bücher zu stecken, einen guten Einfluß auf die Entwicklung ihres Nachwuchses haben müsse. Und außerdem habe der Zeit, auf einen solchen Sack Flöhe aufzupassen, im Gegensatz zum übrigen Teil der Judengassen-Bevölkerung, der tagein, tagaus nichts anderes kannte als ewiges Werkeln und Hinterherjagen hinter Massematten.
Doch dem Grafen schien das alles nichts auszumachen. Er konnte im größten Saustall, sofern man ihm nur irgendwo eine kleine Sitzfläche freiräumte, mit einem verschleierten Blick Richtung Zimmerplafond über die religionsgeschichtlich heikelsten Fragen sprechen. Und ob ihm dabei aufmerksam zugehört wurde, war gar nicht so wichtig, Glaser hatte eher den Eindruck, das Ganze war mehr eine Klärung der Sachlage im Rahmen eines ausufernden Monologs.
„Denn eigentlich waren es doch die Römer, die Jesus den Prozeß gemacht haben“, war zum Beispiel so eine typische, beim selbstgesprächlerischen Reden verfertigte Conclusio des Grafen. Daß Glaser auf die Ausgangsfrage des Grafen, was denn die Juden getan hätten, daß man sie seit Jahrhunderten als die Mörder Jesu hinstelle, mit: „Da fragen Sie mich etwas, ich habe nicht die leiseste Ahnung“ antwortete, hatte er gar nicht gehört. Der Rabbi schickte erst einmal sämtliche Kinder aus dem Zimmer, um sich dann Zeit für eine etwas weiter ausholende Entgegnung zu nehmen.