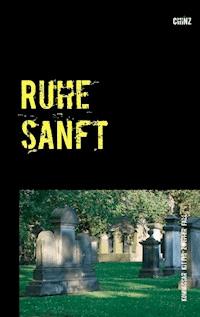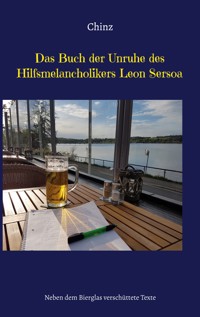
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine von Fernando Pessoas 'Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares' inspirierte, leidlich sortierte Sammlung von kurzen Texten, die ich während des hochkonzentrierten Trinkens und Starrens in diversen Kneipen aus Versehen neben meinem Bierglas verschüttet habe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Eine von Fernando Pessoas „Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares“ inspirierte, leidlich sortierte Sammlung von kurzen Texten, die ich während des hochkonzentrierten Trinkens und Starrens in diversen Kneipen aus Versehen neben meinem Bierglas verschüttet habe.
Autor
Chinz, 1968 in Köln geboren, wohnt heute in Varel.
Er arbeitet als Krankenpfleger, lebt als Musiker und Schriftsteller und bezeichnet sich selbst als gut gelaunten Melancholiker.
Bisher erschienen:
„Alzagra“, Roman
„Die Brücke“ (Kommissar Kittys erster Fall), Krimi
„Fast zu spät“ (Das Schweigen der Glascontainer), Roman
„Ruhe sanft“ (Kommissar Kittys zweiter Fall), Krimi
„Die Besucher“, Theaterstück
„Jupp“, Novelle
„Der perfekte Kaffee“, Ein Kännchen Leben
für Fernando Pessoa, Kurt Tucholsky, J.K. Rowlin und Elke Heidenreich
„Ich bin eine Gestalt in einem noch zu schreibenden Roman, die luftig vorüberweht und sich auflöst, ohne gewesen zu sein, unter den Träumen desjenigen, der mich nicht zu formulieren verstand.“
(Fernando Pessoa „Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares“)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Epilog
Prolog:
Vor vierzig Jahren lebte ich für einige Wochen in Varel, um meine sterbende Mutter zu versorgen.
Wenn sie abends endlich schlief und mein Bruder den Bereitschaftsdienst übernahm, saß ich oft im Tante Emma und trank Bier. Zu viel, dachte ich am nächsten Morgen. Zu wenig, so kam es mir gegen Mitternacht vor, wenn die Kneipe schloss und ich nach Hause wankte.
Es war meist sehr voll, viele fröhliche, laute und redselige Menschengruppen oder Pärchen und ein paar Vereinzelte, schweigsam ins Leere starrende und irgendetwas ertränkende wie mich.
Ein junger Mann, ungefähr mein Alter, saß oft direkt neben der Zapfanlage am Tresen. Manchmal saß er als einziger dort, meist umgeben von vielen Menschen, aber auch dann: Er saß als Einzelner dort, deutlich alleine, ohne Kontakt zu den anderen, trank ähnlich schnell wie ich, starrte auch viel ins Leere, aber zwischendurch schrieb er immer wieder kurze Texte auf einen Stapel Blätter vor sich.
Ich hatte ihn schon oft gesehen, aber heute Abend trafen sich unsere Blicke zum ersten Mal. Seine Augen weiteten sich kurz, ich erwartete ein Lächeln oder wenigstens ein Nicken, aber er errötete nur leicht, sah schnell auf sein Blatt, nahm den Stift und schrieb etwas.
Hatte er wirklich mich gesehen? Oder eher etwas in der Leere zwischen uns, die zwar voller Menschen war, aber halt eine Leere, wie alles um mich in der Zeit.
Ich versank wieder in trüben Gedanken und beachtete ihn nicht mehr, bis ich zufällig sah, dass er an der Theke stand und bezahlte. Wir waren inzwischen die letzten Gäste und auch ich ging bezahlen. Ich warf einen Blick zu der Stelle, an der er geschrieben hatte und sah dort ein Blatt liegen.
„Stimmt so“, sagte ich, griff mir das Blatt und lief raus. Er war zum Glück noch nicht weit gekommen und ich hatte ihn schnell eingeholt.
„Sie haben etwas liegen lassen.“
Er drehte sich um, sah mich mit müden, glasigen, aber vor allem überraschten Augen an und sagte, leicht mit dem Kopf schüttelnd und jetzt lächelnd:
„Ich hatte nicht mehr damit gerechnet.“
„Was meinen Sie?“
„Ich schreibe schon so lange und so viel und jetzt ist es das erste Mal, dass ich mitbekomme, dass jemand seinen Text findet.“
Ich begriff immer noch nicht.
„Das ist Ihr Blatt.“
„Das haben Sie für mich geschrieben?“
„Es scheint so. Zumindest hat der Text sie gefunden. Ich selbst weiß meist nicht, für wen ich gerade schreibe.“
Ich war mir nicht sicher, ob das einen Sinn ergab, was er sagte. Er war ziemlich betrunken. Ich mindestens genauso. Verstand ich es deswegen nicht? Oder ging es gar nicht um Verstehen?
„Mir sind schon einige Blätter verloren gegangen. Wer weiß, vielleicht haben auch andere ihre Texte gefunden; es mir bloß nicht gesagt. Pessoa weiß ja auch nichts von mir.“
Er sah auf einmal sehr glücklich aus. Die Augen waren einen Moment lang wach und leuchtend, bevor die Müdigkeit wieder ihren Tribut forderte.
„In welche Richtung gehen Sie?“, fragte ich ihn.
„Ich wohne in der Nähe der Hafenschule.“
„Die kenne ich nicht. Wissen Sie, ich bin nicht ...“
Er fasste sich an die Stirn und unterbrach mich:
„Klar! Das hätte ich mir denken können. Dieses Verlorene in Ihrem Blick. Sie sind auch nicht von hier, oder?“
„Ja. Tatsächlich. Ich wohne sonst in Bielefeld, aber meine Mutter ...“
„Nein, ich meine, Sie gehören eigentlich auch nicht auf diese Welt. Jetzt verstehe ich es endlich! Es ist so einfach!“
Ich hingegen verstand kein Wort.
„Verlorene Seelen schreiben für andere Heimatlose. Fremde für Fremde.“
„Ich kann Ihnen nicht ganz folgen.“
Er drehte sich plötzlich zu mir um, umarmte mich kurz und strahlte mich an:
„Es tut gut, nicht ganz allein verloren in dieser überfüllten Welt zu sein. Ich heiße Leon.“
Auch ich stellte mich vor, aber er hörte gar nicht zu.
„Ich nehme an, das geht dir genauso. Ich habe keine Ahnung, wo ich herkomme und auch nicht, wo ich falsch abgebogen bin, dass ich auf diesem Planeten, als Mensch unter Menschen gelandet bin. Ich hielt das bisher für einen großen Fehler, einen schmerzlichen Irrtum. Aber vielleicht ist es einfach nur eine kleine Zwischenepisode, die Sinn ergibt. Eine kurzzeitige Anstellung als Aushilfsschriftsteller, Melancholiker auf Zeit. Ich empfange Stimmungen und Melodien aus mir unbekannten Räumen und forme sie zu Texten um, damit sie danach den finden, für den sie eigentlich bestimmt waren.“
„Du formst Melodien zu Texten um?“
„Es kommt immer auf die Melodie an. Es hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Der Text ist nicht wichtig. Pessoa schreibt in einer anderen Zeit, ein ganz anderes Leben vom Inhalt her, aber mit exakt meiner Melodie. Das ist es, was mir wirklich geholfen hat, nicht Romane von anderen, die über meine Zeit schreiben, die ähnliche Probleme und Komplexe haben wie ich, aber nicht die gleiche Melodie. Texte berühren das Gehirn, die Melodie das Herz. Ich glaube, da wo wir herkommen, gibt es nur Melodie.“
Er sah eine Weile verträumt zum Mond, der gerade hinter einer Wolke hervorgekommen war, dann drehte er sich zu mir um und streckte seine Hand nach dem Blatt aus. Ich gab es ihm und er überflog es mit staunendem Blick.
„Das? Ausgerechnet das?“ Er errötete leicht. „Tja, auch mir fällt es manchmal noch schwer zu glauben, dass der Inhalt nicht das Wichtigste ist. Ich hätte wirklich gedacht ... egal. Schön. Ich freue mich wirklich sehr!“
Er gab mir das Blatt zurück und fuhr fort:
„Ich hatte nicht mehr daran geglaubt, dass meine Gabe gebraucht wird. Es gibt ja kaum noch Menschen, die nach ihrer Bestimmung suchen.“
Ich verstand immer noch nichts wirklich, aber irgendwas fühlte sich richtig an.
„Und meine Bestimmung ist, dein Blatt zu finden und es dir zu sagen, damit du weißt, dass du doch nicht umsonst hier bist?“
Er lachte.
„Natürlich ist das nicht die Bestimmung deines Lebens, aber vielleicht eine von vielen kleinen Möglichkeiten, die man zusätzlich hat, um das eigene Leben und das anderer zu bereichern.“
Er sah mir eine Weile tief in die Augen. Ich schien ihn an jemanden zu erinnern.
„Du bist für etwas Großes bestimmt, Cidira.“
„Ich heiße nicht Cidira.“
Er hörte mich offensichtlich nicht, lächelte mich noch eine Weile strahlend und liebevoll an, dann fielen ihm die Augen zu. Er schien im Stehen eingeschlafen zu sein. Ich stupste ihn an.
Er zuckte leicht zusammen, öffnete überrascht die Augen, murmelte „Entschuldigung.“, als hätte er mich gerade aus Versehen angerempelt und ging, ohne sich noch einmal umzusehen, seinen Weg.
Zwei Tage später sah ich ihn wieder im Tante Emma. Er sah unsicher und überlegend zu mir hin, wie beim ersten Treffen. Ich lächelte ihm zu und er sah, leicht errötend, auf sein Blatt und fing an zu schreiben.
Ich ging zu ihm hin und wir wechselten ein paar Worte. Schnell war mir klar, dass er sich nicht an unser Gespräch erinnern konnte, nicht mehr wusste, wer ich bin, nur noch eine unbestimmte und verschwommene Ahnung hatte.
Er fragte nicht nach und ich sagte auch nichts. Eigentlich ja auch nicht wissend, was genau an dem Abend passiert war, was er in mir berührt hatte.
Ich ging diesmal früher als er, nickte ihm, während ich an der Theke bezahlte, kurz zu. Er schaute mich überrascht an, nickte auch und schrieb mit fröhlichen Augen weiter.
Als ich zuhause ankam, fand ich ein Blatt von ihm in der Jackentasche. Das war unmöglich! Ich hatte die Jacke an diesem Abend nicht ausgezogen. Er war nie in meiner Nähe gewesen. Wie ...?
Und ... weswegen? Er hatte mich nicht erkannt. Das war deutlich gewesen.
Hatte sein Blatt mich erkannt?
Ich sah ihn nur noch zweimal. Ein weiteres Gespräch haben wir nicht mehr geführt. Aber beide Male fand ich, wenn ich gehen wollte, ein Blatt von ihm, ohne dass ich mir erklären konnte, wie es auf meinen Platz gekommen war.
Noch weniger konnte ich mir erklären, dass ich auch später, nach dem Tod meiner Mutter, immer wieder Blätter in seiner Schrift fand, in Kneipen in Bielefeld, aber auch an völlig anderen Plätzen: in der Straßenbahn in Berlin, auf einer Kirchenbank in Norwegen, im Kino in Heidelberg, am Strand in Südfrankreich.
Zum Glück kann ich rückblickend sagen, dass dies nicht die eine, große Bestimmung in meinem Leben war - seine Texte zu finden. Ich habe, kurz nachdem ich ihn kennengelernt hatte, meine Bestimmung gefunden und sie, in aller Bescheidenheit geprahlt, recht gut erfüllt, wie ich meine.
Ich denke auch nicht, dass es seine einzige Bestimmung war, Blätter zu schreiben, die dann zu mir fanden. Das Schreiben vielleicht schon. Blätter und Melodien für viele Menschen? Ich habe keine Ahnung. Was ich weiß: Mein Leben hat er bereichert, womöglich sogar ein- zweimal gerettet.
Mehrere hundert Mal fand ich Blätter von ihm für mich, an den unterschiedlichsten Orten, immer überraschend und vor allem immer genau dann, wenn ich sie brauchte. Wenn die Leere mal wieder anschwoll, der schwarze Hund wieder da war, ich jemanden verloren hatte oder wie so oft, einfach nicht mehr wusste, warum und wofür ich da war. Er war da, fasste meine Selbstzweifel und Sprachlosigkeit in Worte, summte meine Melodie, wenn ich keine Kraft mehr dazu hatte und auf einmal war die schwere Leere deutlich leichter zu ertragen.
Irgendwo da draußen war, wie real er auch immer sein mochte, ein Seelenverwandter und schien auf mich aufzupassen. Das Sicherheitsnetz im nicht gerade sturzfreien Balanceakt meines Lebens.
Ich habe die Blätter in einer großen Kiste auf dem Dachboden gesammelt. Sie sind ohne Datum und deswegen inzwischen völlig durcheinander. Nur das erste Blatt liegt immer oben auf.
Ich habe ihn nur viermal im Leben kurz gesehen, aber wenn ich heute zurückblicke, das deutliche Gefühl:
Er war immer da.
-1-
Ich schreibe nicht für mich. Noch nie stand das so deutlich und hübsch vor mir.
Vieles, was ich geschrieben habe, kann ich am nächsten Tag nicht mehr lesen. Ich sollte wirklich mal an meiner Schrift arbeiten! Aber wozu? Wenn ich es lesen kann, dann ist es im besseren Fall nett, aber belanglos, oft sagt es mir einfach nichts. Als würde ich Gesprächsfetzen von einem Nebentisch aufschreiben, die halt nicht für mich bestimmt waren und die ich nicht verstehe, weil mir der Zusammenhang des bisherigen Gesprächs fehlt. Mag sein, dass meine Sätze einen Sinn ergaben, als ich sie schrieb. Vielleicht waren sie aber auch einfach für jemand anderen bestimmt.
Wenn dem denn so sein sollte, steht jetzt leider ebenfalls sehr deutlich und hübsch vor mir: Auch diese jemand anderen interessiert es nicht, was ich schreibe.
Eine mir unbekannte hübsche Frau, etwa vier Meter entfernt, hat diesen kleinen Text verursacht, als sie neugierig zu mir hinsah. Da ich, als nicht schreibender Mann, nicht viel hermache, blieb nur die Möglichkeit, doch noch mal den Stift aufzuwecken, obwohl schon seit Seiten klar ist, dass ich heute nichts Vernünftiges mehr schreiben werde.
Die Frau schaut längst nicht mehr zu mir hin, in ein paar Tagen erinnre ich mich nicht mehr an sie (in ein paar Minuten sie sich nicht mehr an mich) und auch diese Seite wird in einer Kiste irgendwo auf dem Dachboden, völlig unbeachtet ein sinnloses Leben verbringen, bis sie von einer Maus zerfressen oder einfach so, ungelesen zu Staub zerfällt. Wie wir alle halt.
Die meisten Menschen fallen ungelesen in ihr Grab. Der ein oder andere Freund, womöglich ein Partner, haben ein paar Seiten oder wenigstens den Klappentext deines Lebens gelesen. Aber dein ganzes Buch, alle Seiten, dieses langweilige, austauschbare Phrasengedresche, dieses Drama ohne Höhepunkt, diese nicht originellen Textbausteine, dieses zwar einzigartige, aber halt in keiner Weise außergewöhnliche oder gar faszinierende Buch?
Genaugenommen bist du ja froh, dass keiner dieses teilweise völlig hilflose Gestammel wirklich aufmerksam liest. Wem sollte es gefallen?
Ich erwische mich ja schon selbst, wie ich Absätze, manchmal Seiten bei mir überspringe, weil sie mich nicht interessieren. Unkonzentriertes Blättern durch meine Geschichte, während mich Seitenblicke auf andere Bücher ablenken - deren Umschläge sehen vielversprechender aus; wenn ich zufällig einen Satz aus einem anderen Buch höre: faszinierend. Ich will wissen, wie es weitergeht. Will ich das bei mir?
-2-
Ich bin mir fremd geworden.
Was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass ich mir nie besonders nahestand, geschweige denn jemals auch nur ansatzweise das Gefühl gehabt hätte, mich zu kennen, zu verstehen, von mögen ganz zu schweigen.
Ich bin für mich doch eher immer ein Unbekannter gewesen, den ich halt deutlich häufiger als alle anderen zufällig traf, mit dem ich aber über freundliches Grüßen nicht weit hinausgekommen bin. Gelegentlich kurze oberflächliche Gespräche, deren Inhalt ich meist schon am nächsten Tag vergessen habe. Häufiger ein verächtlicher oder gar wütender Blick, fast immer ohne dass ich die Ursache wusste.
Der Mitbewohner, den ich nie richtig kennengelernt habe und der sich jetzt doch deutlich verändert hat. Nichts Fassbares, außer vielleicht, dass er mir noch weniger als vorher in die Augen schaut, zum Beispiel, wenn ich ihn morgens im Spiegel sehe.
Ob ich etwas Falsches gesagt oder getan habe? Ich spüre eine deutliche Distanz zwischen uns, da wo vorher keine Nähe war.
Obwohl ich bisher behauptet hätte, dass keine tiefen Gefühle für mich in mir sind - jetzt ist da eine Leere, wo vorher etwas war. Etwas, was ich nie erkannt oder begriffen, nicht einmal wahrgenommen habe, bis es mir jetzt abhandengekommen ist.
Wie der Kranke auf einmal merkt, dass er vorher gesund war, was ihm selbstverständlich erschien und jetzt fehlt. Da war etwas in mir, was mich mit mir verband und jetzt ist es nicht mehr da.
-3-
Ich stolpere vorwärts, stoße immer wieder gegen Gegenstände oder Passanten, muss mich dauernd entschuldigen und ich weiß ja, woran es liegt, aber ich kann nicht anders. Immer wieder Cidira.
„Schau nach vorn. Da geht dein Leben weiter. Eure Geschichte ist abgeschlossen. Sie hat jetzt einen anderen. Lass die Vergangenheit ruhen!“
Ich kann es nicht. Ich schau zurück. Da, wo wir uns trafen, da, wo ich für immer bleiben wollte, dieser eine Moment, in dem sich mein ganzes Leben erfüllte, ich darf diesen Augenblick nicht verlieren! Genau dann ginge mein Leben nicht mehr weiter.
Klar, es ginge vorwärts, Ich sähe Neues, ich könnte Hindernissen besser ausweichen, würde nicht mehr anecken, alles ginge glatt und problemlos ... und sinnlos. Was wäre das für ein Leben? Nicht meins.
-4-
Eine außergewöhnlich hübsche Frau kam vor zehn Minuten in die Kneipe. Schon auf dem Weg zur Theke wurde sie von zwei Männern angesprochen, die aber nur ein Kopfschütteln ernteten.
An der Theke, bevor sie selbst bestellen konnte, bekam sie von dem Mann rechts neben ihr ein Getränk ausgegeben. Sie bedankte sich kurz und beachtete ihn nicht weiter.
Kurz danach quatschte sie jemand von links an:
„Läuft alles gut bei dir?“
Sie schaute nur irritiert in seine Richtung und sagte nichts. Gerade geht einer an ihr vorbei: „Alles gut?“ - Keine Antwort.
Sie ist das Objekt der Begierde aller Männer hier und ich bin inzwischen der Einzige, der noch nicht abgeblitzt ist.
So kann ich mich, dank meiner Schüchternheit, heute mal als so etwas Ähnliches wie einen Sieger fühlen.
-5-
Wir laufen über die Erde, fühlen uns dem Maulwurf und der Blumenzwiebel weit überlegen und leben doch selbst, von einer höheren Ebene betrachtet, unter der Erde.
Die meisten von uns Blumenzwiebeln sind tag- und lebendfüllend damit beschäftigt, Würmer und Mäuse abzuwehren, eine sichere Umgebung für die Zwiebel zu bauen und neben den anderen Zwiebeln gut auszusehen. Wir prahlen mit unseren Behausungen, den festen Dächern, die jeden Eindringling von oben abwehren, ohne zu merken, dass wir damit auch das Leben bringende Wasser von uns fernhalten und nicht nach oben wachsen können.
Makellose Blumenzwiebeln werden bewundert und die, die aufgeplatzt sind, anfangen Wurzeln ins Erdreich zu schlagen und gar nach oben wachsen, als seltsame Sonderlinge gemieden.
„Spiel nicht mit den Blumenkindern!“
Aber diejenigen von uns, die wenigen, die ihre Bestimmung begriffen haben, sind längst aus dem Erdreich raus. Okay, mit Zwiebel und Wurzeln immer noch drinnen, deutlich fester drinnen, als die, die nur hier sind, aber jedenfalls schaut ein Teil von uns schon aus der Erde raus, wächst der Sonne entgegen, dieser fruchtbaren Wärme und Helligkeit, die wir unter der Erde schon ahnten.
Unsere Seele, unsere Träume sind längst im richtigen Leben und der im Körper gefangene Geist unter der Erde sehnt sich nach dem Himmel. Warum muss ich noch hier sein?
Vielleicht, um anderen Blumenzwiebeln den Weg zu zeigen?
Denn zugegebenermaßen hätte ich meine Bestimmung nicht von allein gefunden. Ich habe nach nichts anderem gesucht, war zufrieden, zwar keine besondere Blumenzwiebel, aber immerhin keine verachtete zu sein.
Bis diese eine besondere Frühlingssonne es auf mir noch heute unerklärliche Weise schaffte, zu mir ins tiefe Erdreich durchzudringen.
Während der wenigen Wochen mit Cidira habe ich noch nichts davon begriffen, nur gefühlt, eher geahnt, dass etwas Ungeheuerliches, etwas für immer Veränderndes, etwas meine sehr enge Vorstellung von Glück Sprengendes passierte.
Während unserer Tage wollte ich auch gar nichts verstehen. Ich wollte nur diese unerklärliche und mir bis dahin völlig unbekannte Wärme, die sie mir war, spüren. Sehnsucht nach Höherem, Weiterem, Wachsendem, Fruchtbarem, das ich damals noch nicht kannte, das mir eine völlig andere Welt war.
Raus aus dem verhassten Erdreich, rein in die frische Luft, in die Weite, in die Freiheit, zur Frühlingssonne.
Ins Leben.
-6-
Von der interessanten Nachbarin, die mich auf angenehme Weise an Cidira erinnert, angequatscht worden.
„Was schreibst du?“
„Einen Roman.“
„Interessant.“
Mir war durchaus klar, dass nach diesem Anfang ein Hauptteil kommen musste, aber ich wusste nichts mehr zu sagen.
Eine Weile saß sie noch neben mir und wartete, anfangs noch mit Interesse, ob da mehr von mir käme. Aber da kam nichts und sie zog weiter.
Jetzt sitzen zwei Männer neben mir. Auch sie scheinen fasziniert von dem, was ich hier mit Stift und Papier mache - Was mache ich hier? - während sie halt nur einfach da sitzen, jeder mit einem Glas vor sich, gelegentlich trinkend.
Ich sehe wohl aus, als täte ich etwas Sinnvolles, Aufregendes, womöglich sogar etwas später Weltberühmtes. Ach ... träumt ruhig weiter.
Ich ja auch.
---
„Ich wäre gerne Ecstasy oder Viagra, aber ich bin nur Paracetamol. Ich bin nützlich, man braucht mich, wenn es nicht gut geht, aber für das fröhliche, volle, lustvolle Leben, dafür sind die anderen da.“
(Aus der großen Sammlung: „Sätze, die einem mittelmäßigen Autoren spontan einfallen, wenn er etwas schreiben muss, weil der Nachbar gerade auf sein Blatt schaut.“)
---
Viele fragen mich, was ich schreibe, oder gar, was ich hier mache, als wäre es nicht offensichtlich und fast nie jemand, wo ich spontan denke: Dich hätte ich gerne als Leser!
Ich antworte ausweichend, manchmal gar nicht. Es gibt Leser, die möchte ich meinen Büchern nicht zumuten. Ich möchte mich nicht verkaufen. Ich möchte gewürdigt werden.
PS:
Es scheint auch niemand von den Besuchern hier spontan zu denken: Dich hätte ich gerne als Autor!
Mein Nachbar eben zu mir, als er auf die Toilette kam, wo ich gerade am Pissoir stand:
„Kannst du das doch?“
„Ja.“
„Dann ist ja gut. Ich hatte Angst, du hättest keinen Pimmel.“
Schriftstellerei scheint nicht wirklich männlich zu wirken.
Ach Hemingway, ach Frisch, ach insbesondere Charles Bukowski ... ihr Weiber!
Aber ich sollte nicht lästern, sondern dankbar sein, dass ich den Kuss der Muse kenne, der nur wahre Männer trifft (unhaltbare, aber angenehme These) und dass, völlig unverständlicherweise, die schönste und begabteste Muse aller Zeiten sich entschieden hat, mich zu küssen.
-7-
Ich mag Menschen, die schüchtern und unsicher in Kneipen kommen.
Sowas würde ich mir für Kirchen wünschen: Dass da verlorene, gescheiterte Menschen zögernd reinkommen, nicht genau wissend, was sie erwartet; unsicher, weil da so viele Profis sind, die sich auskennen und sie wissen nicht, wo hinsetzen und was bestellen.
Kirche müsste ein Ort der unbestimmten Hoffnung sein; kein Ort, wo die Bedienung vorne unumstößliche Wahrheiten verkündet, sondern einer, wo sie zuhört, für jeden Gast die passende Antwort, das richtige Getränk oder halt nur ein verständnisvolles, schweigendes Nicken hat.
Der Pastor schüttet noch mal nach und murmelt: „Ja, das Leben ist echt scheiße!“ Und das wäre schon die erste kleine Erlösung ..., vielleicht der Beginn eines wunderbaren Glaubens.
So hatte sich Gott das vorgestellt. Als er jedoch sah, was aus seiner Kneipe geworden war, mit diesen selbstgerechten, konkursverwaltenden Bedienungen der Kirche, die nicht mal Wasser in Wein verwandeln konnten, wandte er sich voller Grauen ab.
Schade um einige liebevoll eingerichtete Kneipkirchen. Ich denke, ER hat inzwischen ein gemütliches Café am anderen Ende des Universums eröffnet.
-8-
Mag ja durchaus unter anderem an meinem Gefühl, auf der falschen Welt gelandet zu sein, in diesem Leben unter diesen Mitmenschen ein Fremder zu sein, jemand der die Sprache der meisten Menschen weder richtig spricht noch versteht, liegen, dass ich so viel Mitgefühl für Flüchtlinge und Asylsuchende habe.
Ich wurde freundlich aufgenommen, meinem Antrag auf Duldung auf dieser Erde wurde stattgegeben.
Wirklich integriert habe ich mich nie. Das ist nicht mein Planet, nicht meine Kultur, nicht mein Leben hier. Aber ich kann nicht zurück, ich habe vergessen, wo ich zuhause war oder es ist zerstört, es wird es nie wieder geben ... Hat es es je gegeben?
---
Ich bin ein Mensch und Schriftsteller mit Migrationshintergrund.
Ich weiß nicht, woher ich komme und wohin ich gehöre, aber hier bin ich definitiv fremd.
Die meisten Menschen sprechen eine andere Sprache als ich. Auch die meisten Deutschen.
Sie reden in beeindruckendem Tempo und Umfang, während mir für das, was mir wichtig ist, fast immer die Worte fehlen.
Ich verstehe selten, was sie sagen wollen und noch seltener, warum es sich lohnen sollte, über die Dinge zu sprechen, über die sie sprechen.
Wie Politiker sprechen, wie Juristen sprechen, wie Bedienungsanleitungen sprechen, wie PEGIDA spricht - Ich verstehe sie nicht!
Und ich weigere mich, ihre Sprache zu erlernen!
Ich werde mich nicht integrieren!