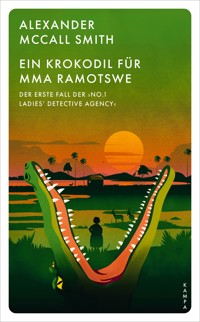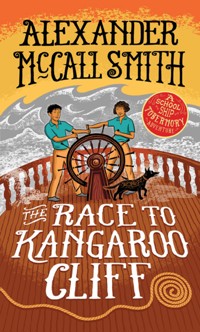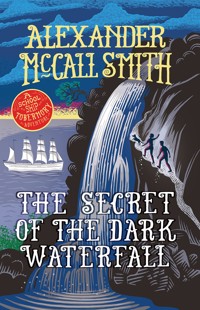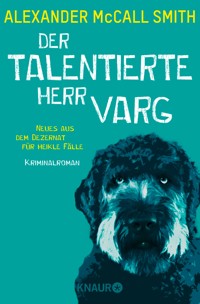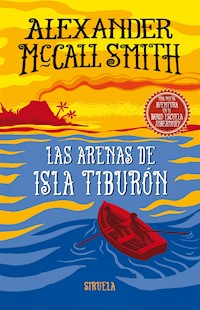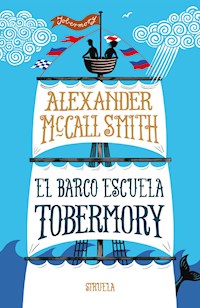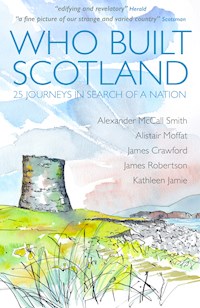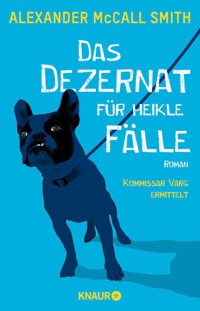
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ulf "Wolf" Varg
- Sprache: Deutsch
Sie lösen jeden Fall – auch den absurdesten! Willkommen in Malmö, zum Start der neuen humorvollen Krimi-Reihe von Bestseller-Autor Alexander McCall Smith: In Schwedens »Dezernat für heikle Fälle« in Malmö landet all das, was die Kollegen von der Kripo nicht recht einzuordnen wissen: Inspektor Ulf Varg, seine hübsche Kollegin Anna Bengsdotter und der fliegenfischende Erik Nykvist sind Merkwürdigkeiten gewohnt. In aller Ruhe und mit der gebotenen Sorgfalt machen sie sich an die Ermittlungen im Fall eines hinterhältigen Messerangriffs – auf ein Knie! Auch die Tatsache, dass der angeblich verschwundene Freund eines jungen Mädchens in Wahrheit gar nicht existiert, kann Ulf nicht aus der Ruhe bringen. Anders sieht es da schon mit der akuten Depression seines treuen Hundes Marten aus, der plötzlich nicht mal mehr Eichhörnchen jagen mag … Als dann auch noch ein FKK-Strand in Süd-Schweden von einem Werwolf heimgesucht zu werden scheint, ist Ulfs ganze Kombinationsgabe gefragt. Humorvoller Cosy Crime vom internationalen Bestseller-Autor: Liebevoll-verschroben und voller britischem Humor zeichnet Alexander McCall Smith das Personal in seiner neuen Krimi-Reihe, die rund um Malmö in Süd-Schweden spielt. Sterben muss hier garantiert niemand, dafür darf herzlich gelacht werden. »Mit viel Herz und Verstand führt Alexander McCall Smith eine originelle neue Cosy-Crime-Serie ein. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Band.« Alan Bradley, Bestseller-Autor der »Flavia de Luce«-Serie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alexander McCall Smith
Das Dezernat für heikle Fälle
Kommissar Varg ermittelt
Roman
Aus dem Englischen von Alice Jakubeit
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hier wird jedes Verbrechen aufgeklärt – auch das absurdeste.
Im Dezernat für heikle Fälle in Malmö landet all das, was die Kollegen von der Kripo nicht recht einzuordnen wissen: Inspektor Ulf Varg, seine hübsche Kollegin Anna und der fliegenfischende Erik sind Merkwürdigkeiten gewohnt, und so machen sie sich in aller Ruhe an die Ermittlungen im Fall eines hinterhältigen Messerangriffs – auf ein Knie! Deutlich komplizierter erscheint Ulf die akute Depression seines treuen Hundes Marten, der plötzlich nicht mal mehr Eichhörnchen jagen mag … Als dann auch noch ein FKK-Strand von einem Werwolf heimgesucht zu werden scheint, ist Ulfs ganze Kombinationsgabe gefragt.
Humorvoller Cosy Crime vom internationalen Bestseller-Autor: Liebevoll-verschroben zeichnet Alexander McCall Smith das Personal in seiner neuen Krimi-Reihe, die rund um Malmö in Süd-Schweden spielt. Sterben muss hier garantiert niemand, dafür darf herzlich gelacht werden.
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel eins | Freies Assoziieren, berechnet zum normalen Stundensatz
Kapitel zwei | Ausgesprochen niedrige Beweggründe
Kapitel drei | Der singende Baum
Kapitel vier | Bim
Kapitel fünf | Er ist zum Nordpol gefahren
Kapitel sechs | Der Geruch des Neids
Kapitel sieben | Ein toter Hund schwimmt
Kapitel acht | Er hat des Königs Fahrrad repariert
Kapitel neun | Kekse, Katzen, Korb, Schweden
Kapitel zehn | Der plötzliche Drang zu weinen
Kapitel elf | Da sind Hormone im Spiel
Kapitel zwölf | Schwede zu sein, ist nicht immer leicht
Kapitel dreizehn | Perikarditis
Kapitel vierzehn | Lykanthropie
Kapitel fünfzehn | Nihil humanum mihi alienum est
Dieses Buch ist Bob McCreadie gewidmet
Kapitel eins
Freies Assoziieren, berechnet zum normalen Stundensatz
Søren«, sagte Dr. Svensson in ernstem Ton, doch seine Augen hinter der Hornbrille lächelten. Dann wartete er auf die Reaktion. Es würde eine Antwort auf diese Einwortfrage geben, aber man würde abwarten müssen, wie sie ausfiel.
Ulf Varg, geboren in Malmö, Schweden, Sohn von Ture und Liv Varg, nur allzu kurz verheiratet, jetzt wieder Single; achtunddreißig Jahre alt, womit er rasant auf den Wendepunkt, wie er es im Stillen nannte, zuging – »Wenn man erst vierzig ist, Ulf«, hatte sein Freund Lars gesagt, »was kommt dann noch?« –, eben dieser Ulf Varg hob den Blick zur Decke, als sein Therapeut »Søren« sagte. Und dann gab er unwillkürlich zurück: »Søren?«
Sein Therapeut, der liebenswürdige Dr. Svensson, wie so viele seiner Patienten ihn nannten, schüttelte den Kopf. Er wusste, dass ein Therapeut nicht den Kopf schütteln sollte, und er hatte versucht, es nicht allzu oft zu tun, aber es geschah ganz automatisch, wie so vieles, was wir tun, ohne eigentlich darüber nachzudenken – zucken, die Nase rümpfen, die Augenbrauen heben, die Beine übereinanderschlagen. Zwar haben viele dieser Handlungen nichts zu bedeuten, sind bloße Begleiterscheinungen des Lebendigseins, aber den Kopf zu schütteln bedeutet Missbilligung. Und der liebenswürdige Dr. Svensson missbilligte nicht. Er hatte Verständnis, was etwas völlig anderes ist.
Nun jedoch missbilligte er und schüttelte den Kopf, ehe er sich daran erinnerte, dass er nicht missbilligen und nicht den Kopf schütteln wollte. »Ist das eine Frage oder eine Aussage? Sie sollen nämlich keine Fragen stellen. Beim freien Assoziieren geht es nur darum, Herr Varg, das, was unter der Oberfläche ist, ans Licht – zum Ausdruck – zu bringen.«
Das, was unter der Oberfläche ist, ans Licht zu bringen … Das gefiel Ulf. Genau das ist es, dachte er, was ich jedes Mal, wenn ich ins Büro gehe, mache. Ich stehe morgens auf, um das, was unter der Oberfläche ist, ans Licht zu bringen. Wenn ich einen Leitsatz hätte, dann würde er wohl mehr oder weniger so lauten. Er wäre viel besser als der, der seinem Dezernat vom Polizeipräsidium aufgezwungen worden war. Im Dienste der Öffentlichkeit. So vage, so wenig aussagekräftig – wie alle Verlautbarungen aus dem Polizeipräsidium. Jene grauen Männer und Frauen, die über Zielvorgaben und Fingerspitzengefühl und alles Mögliche redeten außer der einen Sache, um die es wirklich ging: die zu finden, die gegen das Gesetz verstoßen hatten.
»Herr Varg?«
Ulf ließ den Blick von der Decke sinken. Jetzt betrachtete er den Teppich und Dr. Svenssons braune Wildlederschuhe. Es waren Budapester mit diesem eigenartigen Lochmuster, das, wie ihm einmal jemand erklärt hatte, dazu diente, den Fuß atmen zu lassen, und nicht etwa bloß Ausdruck der englischen Ästhetik war. Sicher waren sie teuer gewesen. Schon als er sie zum ersten Mal gesehen hatte, war er zu dem Schluss gekommen, es seien englische Schuhe, weil sie danach aussahen, und das war genau die Art von Detail, die einem guten Ermittler auffiel. Italienische Schuhe waren schmaler und eleganter, vermutlich weil die Italiener schmalere, elegantere Füße als die Engländer hatten. Die Niederländer hatten natürlich noch größere Füße als die Engländer; Niederländer, sinnierte Ulf, waren hochgewachsene Menschen von kräftiger Statur – was in gewisser Weise komisch war, denn die Niederlande waren ein so kleines Land … und so anfällig für Überschwemmungen, wie diese Geschichte, die man ihm als Kind vorgelesen hatte – über den kleinen niederländischen Jungen mit dem Finger im Deich –, so deutlich gemacht hatte …
»Herr Varg?« In Dr. Svenssons Tonfall schwang eine Spur Ungeduld mit. Es war ja schön und gut, wenn Patienten sich in irgendeinem Tagtraum verloren, aber der Sinn dieser Sitzungen war, etwas preiszugeben, nicht etwas zu verheimlichen, und die Patienten sollten sich darüber äußern, was sie dachten, anstatt es einfach nur zu denken.
»Tut mir leid, Dr. Svensson. Ich habe nachgedacht.«
»Ah!«, sagte der Therapeut. »Genau das sollen Sie auch, wissen Sie? Das Denken geht der Verbalisierung voraus und die Verbalisierung der Lösung. Und so sehr ich das auch begrüße, wollen wir hier doch herausfinden, was Sie denken, ohne zu denken. Anders gesagt, wir wollen herausfinden, was in Ihrem Kopf vorgeht. Denn das …«
Ulf nickte. »Ja, ich weiß. Das ist mir klar. Ich habe bloß deshalb Søren gesagt, weil ich nicht sicher war, was Sie meinten. Ich wollte mich vergewissern.«
»Ich meinte Søren. Den Namen. Søren.«
Ulf dachte nach. Søren löste nichts in ihm aus. Hätte Dr. Svensson Harald oder Per gesagt, hätte er Rowdy oder Zähne antworten können, denn daran dachte er dabei. Ulf war mit zwei Jungen, die auf diese Namen hörten, in dieselbe Klasse gegangen. Hätte Dr. Svensson also Harald gesagt, hätte er Rowdy geantwortet, denn das war Harald gewesen. Und hätte Dr. Svensson Per gesagt, hätte Ulf Zähne geantwortet, weil Per zwischen den Schneidezähnen eine Lücke gehabt hatte, die seine Eltern aus Geldmangel nicht kieferorthopädisch hatten korrigieren lassen können.
Dann kam ihm recht unvermittelt etwas in den Sinn, und er erwiderte: »Kierkegaard.«
Das schien Dr. Svensson zu freuen. »Kierkegaard?«, fragte er nach.
»Ja, Søren Kierkegaard.«
Dr. Svensson lächelte. Es war beinahe Zeit, die Sitzung zu beenden, und er schloss gerne mit etwas Nachdenklichem. »Dürfte ich fragen, warum Kierkegaard? Haben Sie ihn gelesen?«
Ulf bejahte.
»Ich bin beeindruckt«, sagte Dr. Svensson. »Man rechnet nicht damit, dass ein …« Er unterbrach sich.
Erwartungsvoll sah Ulf ihn an.
Dr. Svensson versuchte, seine Verlegenheit zu überspielen, aber es gelang ihm nicht. »Das sollte nicht, nun ja, das sollte nicht so klingen.«
»Ihr Unbewusstes?«, fragte Ulf milde. »Ihr Unbewusstes hat gesprochen.«
Der Therapeut lächelte. »Was ich sagen wollte – bevor ich mich gerade noch rechtzeitig unterbrach: Ich hätte nicht gedacht, dass ein Polizist Kierkegaard gelesen hat. Natürlich spricht überhaupt nichts dagegen, dass Polizisten Kierkegaard lesen, aber es ist ungewöhnlich, meinen Sie nicht auch?«
»Genau genommen bin ich Kommissar.«
Wieder war Dr. Svensson verlegen. »Selbstverständlich.«
»Wobei Kriminalbeamten ja auch Polizisten sind.«
Dr. Svensson nickte. »Wie wohl auch Richter und Amtsärzte und Politiker. Jeder, der uns sagt, wie wir uns zu verhalten haben, ist in gewisser Weise ein Polizist.«
»Aber Therapeuten nicht?«
Dr. Svensson lachte. »Ein Therapeut sollte Ihnen nicht sagen, wie Sie sich zu verhalten haben. Ein Therapeut sollte Ihnen helfen, zu erkennen, warum Sie tun, was Sie tun, und er sollte Ihnen helfen, damit aufzuhören – wenn Sie das denn wollen. Von daher, nein, ein Therapeut ist sicher kein Polizist.« Er hielt inne. »Aber warum Kierkegaard? Was spricht Sie bei Kierkegaard an?«
»Dass er mich anspricht, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe ihn gelesen. Das ist nicht dasselbe.«
Dr. Svensson sah auf die Uhr. »Vielleicht sollten wir es dabei belassen«, sagte er. »Wir sind heute recht gut vorangekommen.«
Ulf stand auf.
»Und jetzt?«, fragte Dr. Svensson.
»Wie, und jetzt?«
»Ich habe mich gefragt, was Sie jetzt tun. Sehen Sie, meine Patienten kommen in diesen Raum, sie reden – oder besser gesagt, wir reden miteinander –, und dann gehen sie hinaus in die Welt und fahren mit ihrem Leben fort. Und ich bleibe hier und denke – nicht immer, aber manchmal –, ich denke: Was werden sie da draußen jetzt tun? Gehen sie nach Hause und setzen sich auf einen Stuhl? Gehen sie in irgendein Büro und schieben Papiere über den Schreibtisch? Oder starren auf einen Monitor, bis es Zeit ist, in ein Haus heimzukehren, in dem alle Kinder auf Monitore starren? Ist es das, was sie tun? Machen sie sich deshalb die Mühe?«
Ulf zögerte. »Das sind sehr tiefgründige Fragen. Sehr tiefgründig. Aber da Sie schon fragen: Ich kehre in mein Büro zurück. Dort werde ich mich an meinen Schreibtisch setzen und einen Bericht über den Fall schreiben, den wir gerade abgeschlossen haben.«
»Sie schließen Fälle ab«, murmelte Dr. Svensson. »Meine bleiben unabgeschlossen. Sie bleiben größtenteils ungelöst.«
»Ja, wir schließen Fälle ab. Wir stehen diesbezüglich sehr unter Druck.«
Dr. Svensson seufzte. »Sie Glücklicher.« Er trat ans Fenster. Ich sehe aus dem Fenster, dachte er. Die Patienten gehen ihrer Wege und erledigen Bedeutsames, wie Fälle abzuschließen, und ich sehe aus dem Fenster. Dann sagte er: »Sie dürfen mir vermutlich nicht verraten, worum es in diesem Fall ging.«
»Ich darf keine Namen oder andere Details nennen«, erwiderte Ulf. »Aber ich kann Ihnen sagen, dass jemandem eine sehr ungewöhnliche Verletzung zugefügt wurde.«
Dr. Svensson drehte sich zu seinem Patienten um.
»In der Kniekehle«, erläuterte Ulf.
»Wie eigenartig. In der Kniekehle?«
»Ja«, sagte Ulf. »Aber mehr darf ich wirklich nicht verraten.«
»Seltsam.«
Ulf runzelte die Stirn. »Dass ich nichts weiter erklären darf? Das ist seltsam?«
»Nein, dass jemand einen anderen Menschen in der Kniekehle verletzt. Natürlich ist die Wahl eines Ziels wohl kaum Zufall. Wir verletzen, was wir lieben, was wir begehren, ebenso sehr wie das, was wir hassen. Aber es ist schon seltsam, oder? In der Kniekehle …«
Ulf ging zur Tür. »Sie würden sich wundern, wie seltsam die Leute sein können, Dr. Svensson. Ja, sogar jemand wie Sie – der in seinem Beruf Tag für Tag alle möglichen dunklen Geheimnisse zu hören bekommt. Sogar Sie. Sie würden sich wundern.«
»Ach ja?«
»Ja. Wenn Sie ein paar Tage an meiner Stelle wären, würde Ihnen vor Staunen die Kinnlade bis auf den Tisch runterklappen. Regelmäßig.«
Dr. Svensson lächelte. »Sieh mal einer an.« Sein Lächeln erstarb. Die Kinnlade. Freud, erinnerte er sich, starb an einer Krankheit, die seinen Kiefer befallen hatte. In London, fern von zu Hause und umzingelt von Feinden, flackerte dieser erleuchtende, in seiner Scharfsinnigkeit befreiende Geist, erlosch und überließ es uns, mit der Dunkelheit und den Geschöpfen, die sie bevölkern, fertigzuwerden.
Kapitel zwei
Ausgesprochen niedrige Beweggründe
Ulfs Büro lag in einem Gebäude mit hohem Giebel in der Altstadt von Malmö, der Gamla Staden. Die scharenweise hierher strömenden Touristen ahnten nicht, dass sich hinter der nicht gekennzeichneten Tür in der Mitte der verschlungenen Gasse, die zum Malmö Konstmuseum führte, der Sitz des Dezernats für heikle Fälle der Malmöer Kriminalpolizei verbarg. Wer eine gewisse Zeit in dem Café direkt gegenüber verbrachte, würde, so er ein aufmerksamer Beobachter war, bemerken, dass dies ein außergewöhnlich betriebsames Bürohaus war, den vielen Leuten nach zu urteilen, die durch diese ansonsten gewöhnliche Tür ein und aus gingen. Nach einer Weile würde besagtem Touristen außerdem auffallen, dass viele dieser Leute ins Café kamen, wo sie sich, entweder an der Theke oder an einem der Tische, leise unterhielten, wie man es tut, wenn man in einem Café Angelegenheiten erörtert, über die man nicht öffentlich sprechen darf.
Ulfs Schreibtisch stand in Raum fünf dieses Bürohauses. Er teilte sich das Zimmer mit drei anderen: zwei Kollegen, Anna Bengtsdotter und Carl Holgersson, und einem Sachbearbeiter, Erik Nykvist. Anna und Carl waren etwa im gleichen Alter wie Ulf, wobei Carl ein paar Jahre älter war. Erik jedoch war Ende fünfzig und sprach schon vom Ruhestand. Seine Karriere war nicht gerade kometenhaft gewesen: Nach achtunddreißig Jahren im Dezernat war er aus der Poststelle zum Sachbearbeiter befördert worden – ein Aufstieg von drei Stufen auf einer Leiter mit siebzehn genau umrissenen Sprossen. Es kümmerte ihn nicht sonderlich: Seine Leidenschaft war das Angeln, und die Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, war lediglich eine unbedeutende Ablenkung von dem Kampf zwischen Mann und Fisch, der seine wachen Gedanken beherrschte. Der Ruhestand würde herrlich sein, glaubte er, da seine Frau ein bescheidenes Holzhaus auf einer Insel im Stockholmer Schärengarten geerbt hatte, nur einen Steinwurf vom Meer entfernt. Seine Rente würde recht großzügig ausfallen, und an einem Ort wie diesem hatte man nur geringe Ausgaben. Zum Holzhaus gehörte auch ein kleines Stück Land – groß genug, um ihren Bedarf an Gemüse zu decken –, und sie würden fünf Mal die Woche Fisch essen, genau wie bisher auch. »Was will man mehr?«, hatte er Ulf einmal gefragt. Und Ulf hatte erwidert, er könne sich nur schwer ein idealeres Leben vorstellen als das, welches Erik sehr wahrscheinlich führen werde, wenn er erst im Ruhestand sei.
Anna Bengtsdotter, deren Schreibtisch dem von Ulf gegenüberstand, stammte aus Stockholm, wo ihr Vater der Inhaber eines kleinen Wanderzirkus war. Dieser Zirkus befand sich seit drei Generationen im Familienbesitz, und auf Anna war Druck ausgeübt worden, sie solle zusammen mit mehreren Cousinen in einer höchst beliebten, musikalisch unterlegten Reitnummer auftreten. Sie hatte sich geweigert und darauf bestanden, stattdessen Personalmanagement zu studieren. Daraus hatte sich eine Stelle in der Personalabteilung der Polizei ergeben, und von dort aus hatte sie sich hartnäckig und entschlossen um eine Versetzung zur Kriminalpolizei beworben. Anna war mit Jo Dahlman, einem Anästhesisten, verheiratet, einem stillen Menschen, dessen große Leidenschaft die Philatelie war. Sie hatte Zwillingstöchter, die begeisterte Schwimmerinnen waren und sich in Malmöer Schwimmerkreisen bereits einen Namen gemacht hatten.
Zwar erledigten Anna und Ulf beide sehr gewissenhaft ihre Arbeit, doch sie gaben offen zu, dass Carl derjenige im Team war, der am meisten arbeitete. Er war morgens immer der Erste und abends der Letzte, obwohl er eine junge Familie hatte. Es war Carl, der bereitwillig – und bemerkenswert gut gelaunt – Sonderschichten übernahm, wenn das Arbeitsaufkommen in ihrem unter Personalmangel leidenden Dezernat erforderte, dass jemand für einen kranken Kollegen einsprang. Carl war es auch, der sich freiwillig für Aufgaben meldete, die entweder extrem langweilig oder außergewöhnlich belastend waren. »Wenn ich es nicht mache«, sagte er, »dann muss es jemand anderes tun. Ihm oder ihr würde es auch nicht besser gefallen als mir, und dann kann ich es auch machen, meint ihr nicht?«
Ulf hatte den Eindruck, dass die Logik dieser Arbeitsaufteilung irgendwie fehlerhaft war, es sei denn, man hätte eine Weltauffassung, deren zentraler Wert Altruismus war. Und bei den meisten Menschen, dachte Ulf, war das nicht der Fall. »Man muss auch an sich selbst denken, Carl«, lautete seine Antwort.
Worauf Carl erwiderte: »Nicht, wenn man Immanuel Kant ist, Ulf.« Und hastig hinzufügte – denn Carl war immer ein wenig bescheiden: »Was ich natürlich nicht bin.«
Erik, der diesen Wortwechsel an seinem Schreibtisch am anderen Ende des Zimmers mit angehört hatte, warf ein: »In welcher Abteilung ist der?«
Carl hätte lachen können, tat es jedoch nicht, ebenso wenig wie Ulf. »Er hat sich vor langer Zeit zur Ruhe gesetzt«, erwiderte Carl. Es hatte keinen Sinn, dachte er, jemandem wie Erik, dessen Welt aus Fischen, Fährzeiten und Inselwetter bestand, Kant zu erklären.
Ulf hatte sich gefragt, woher Carl sein Pflichtbewusstsein hatte, und war zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich seinem Vater zuzuschreiben war, einem lutherischen Theologen, der regelmäßig in einer Fernsehsendung namens Was du denken solltest auftrat. Darin ging es um aktuelle Moralfragen wie Vegetariertum, die Aufnahme von Flüchtlingen, Umweltschutz – all die Kalamitäten und Probleme, die das Leben zu einem moralischen Minenfeld machen konnten. Professor Holgersson hatte genau die gemessene, feierliche Sprechweise, die fesselndes Fernsehen ergab. Bei seinen Debattenbeiträgen konnten die Leute den Blick nicht von ihm abwenden, und von seiner sonoren Stimme und dem gemessenen Tonfall konnten sie gar nicht genug bekommen. Mittlerweile war er gut bekannt – sogar bei Menschen, die ansonsten nicht an solchen Themen interessiert waren –, und es gab jetzt eine Radiowerbung, in der ein Schauspieler mit dieser mimetischen Gabe, die manchen Darstellern anscheinend gegeben war, des Professors Stimme nachahmte und so die Zuhörer zum Kauf einer bestimmten Marke von Möbeln zur Selbstmontage aufrief.
Insofern wunderte es Ulf nicht, dass Carl so fleißig, methodisch und absolut zuverlässig war. Oder dass er ein Bücherwurm war – bei Professorenkindern konnte man wohl damit rechnen, dass sie Bücherwürmer wurden. Dies hatte zur Folge, dass Carl Ulf und Anna hin und wieder, vielleicht in einer Kaffeepause im Café auf der anderen Straßenseite oder im Auto unterwegs zu irgendeinem Tatort, unverhofft mit Fakten zu einem Thema beglückte, auf das sein Vater ihn zufällig gerade aufmerksam gemacht hatte. Gelegentlich ging es dabei um philosophische oder gar theologische Fragen, aber anscheinend war die Lektüre des Professors deutlich breiter gefächert und umfasste Bücher und Zeitschriften zu so unterschiedlichen Themen wie Primatenforschung, Bauingenieurswesen und Medizin. Ein Autodidakt auf einem solchen Gebiet mag nicht der ideale Arbeitskollege sein, aber Carl war niemals langweilig, und es war schon häufig vorgekommen, dass Ulf nach einer von dessen beiläufigen Bemerkungen in die Bibliothek gegangen war, um etwas über dieses oder jenes abstruse Thema nachzulesen.
»Carl ist sehr schlau«, bemerkte Erik eines Tages. »Warum ist er nicht irgendwo Professor – wie sein Vater – anstatt Kriminalbeamter?«
»Er ist bei uns, weil er an Gerechtigkeit glaubt«, sagte Ulf. »Und weil er glaubt, dass es richtig ist, anderen zu helfen.«
Erik wirkte nachdenklich. »Was macht er in seiner Freizeit?«
Ulf erwiderte, seiner Meinung nach habe Carl bei den Anforderungen, die seine junge Familie stelle, und den Überstunden, die er im Dezernat mache, sehr wenig freie Zeit. Dennoch fand er ganz offensichtlich Zeit zum Lesen, also war es wohl das, was er tat.
»Bloß lesen?«, fragte Erik. »Bloß Bücher lesen und so?«
»Ja. Ich glaube schon.«
Verwundert schüttelte Erik den Kopf. »Ich sollte ihn fragen, ob er mal mit zum Angeln kommen möchte.«
»Das könntest du tun«, sagte Ulf. »Aber ich bezweifle, dass er dafür Zeit hat.«
Erik zuckte die Achseln. »Wenn man keine Zeit zum Angeln hat, dann …, na ja, was soll das alles dann?«
Ulf hatte nicht das Gefühl, dass eine Fortsetzung dieser Unterhaltung fruchtbar wäre. Daher sagte er bloß: »Stimmt, Erik«, und beließ es dabei.
Der Fall, den Ulf am Ende der letzten Therapiesitzung bei Dr. Svensson erwähnt hatte, hatte wie viele Fälle seines Dezernats mit einem einfachen Bericht der lokalen Polizei begonnen. Deren Mittel waren knapp, und wenn irgendetwas geschah, das aussah, als könnte es komplizierte Ermittlungen nach sich ziehen, verwies man es ans Dezernat für heikle Fälle. Man könnte es auch an die normale Kriminalpolizei übergeben, aber zu dieser Behörde pflegte die lokale Polizei gute Beziehungen und vermied es daher, den Kollegen dort zu viel aufzubürden. Da die Weitergabe dieser Fälle häufig ziemlich hastig erfolgte, waren manche, die in Ulfs Dezernat landeten, gar nicht sonderlich heikel, aber alles in allem funktionierte das System. Nur gelegentlich mussten sie darauf hinweisen, dass das routinemäßige Verschwinden eines Teenagers oder der Diebstahl eines Laptops eigentlich nicht die Art von Fällen war, für die das Dezernat geschaffen worden war.
In dem Bericht, der eines Morgens hereinkam, stand bloß: »Marktmesserstecherei. Keine schwere Verletzung, aber ungewöhnlicher Lokus. Keine Zeugen, auch das Opfer selbst hat nichts gesehen. Bitte ermitteln.«
Ulf las es Anna vor. »Ungewöhnlicher Lokus? Was soll das denn heißen?«
»Komische Stelle, denke ich.«
»Aber dieser Lokus könnte der Tatort oder der Lokus der Verletzung sein.«
Anna lachte. »Letzteres wohl kaum. Nein, ich vermute eher, diese Messerstecherei fand hinter einem Marionettentheater oder unter einem Tisch mit Broschüren der Friedensbewegung statt – die Kriegsgegner haben da an den meisten Tagen einen Stand. Irgend so was.«
Ulf seufzte. »Dann machen wir uns wohl besser auf den Weg und fragen herum. Die lokale Polizei sagt, es sei jemand vor Ort, der uns über das, was man weiß, informiert. Viel kann das ja nicht sein – keine Zeugen, sagen sie.«
Anna klappte ihren Laptop zu und griff nach ihrer Handtasche. »Ich wollte sowieso einkaufen«, sagte sie. »Also komme ich mit. Ich brauche Brokkoli. Und Freilandeier.«
Sie fuhren mit Ulfs altem hellgrauem Saab zum Markt. Einst war er silberfarben gewesen, der ganze Stolz von Ulfs Göteborger Onkel, doch mit der Zeit war die Farbe matt geworden. »Das ist die Kattegat-Luft«, hatte der Onkel erklärt. »Das Salz schadet manchen Lacken, und ich glaube, Silber ist dafür besonders anfällig. Aber innen, Ulf, ist das Auto perfekt. Echtes Leder. Alles funktioniert. Alles.«
Besagter Onkel hatte das Autofahren widerstrebend aufgegeben, da sein Sehvermögen nachgelassen hatte. »Es wird mir ein großer Trost sein, zu wissen, dass du dich darum kümmerst, Ulf. Und ich hoffe, du hast genauso viel Freude daran, wie ich sie hatte.«
Die hatte Ulf. Er liebte dieses Auto, und manchmal, wenn er aus irgendeinem Grund niedergeschlagen war, machte er eine Ausfahrt damit – ohne bestimmtes Ziel, einfach nur, um unterwegs zu sein, getröstet vom Geruch der alten Lederpolster und umgeben von den Geräuschen einer perfekt funktionierenden mechanischen Schöpfung: dem Ticken der Uhr im Armaturenbrett, dem reibungslosen Brummen des Motors, dem satten Geräusch der gut geschmierten Schaltung. Von diesen Ausflügen kehrte er stets mit gehobener Laune zurück, und so fragte er sich, ob er das Geld, das er für seine Sitzungen bei Dr. Svensson ausgab, nicht lieber in Benzin für weitere ziellose, aber eindeutig therapeutisch wirkende Ausflüge mit dem Saab investieren sollte.
Auch Anna fuhr gern in Ulfs Auto, und auf der kurzen Strecke zum Markt lehnte sie sich zurück, schloss die Augen und liebkoste das rissige Leder des Autositzes. »Das Beste an Ermittlungen mit dir, Ulf«, sagte sie träumerisch, »sind die Fahrten mit deinem Auto.«
Ulf lächelte. »Tut mir leid, dass meine Gesellschaft dir so wenig gilt, Anna.«
Sie schlug die Augen auf. »Oh, so habe ich das nicht gemeint, Ulf.« Sie hielt inne. »Weißt du, was ich meine? In deinem Auto zu fahren ist, als wäre man im alten Schweden.«
»Du meinst, es ist eine sozialdemokratische Erfahrung?«
Anna grinste. »So ähnlich. Eine Rückkehr in die Zeit der Unschuld. Alle wollen das, oder nicht?«
Ulf sagte, er glaube, manche wollten das. Allerdings könnten sie missverstanden werden: Nostalgie und eine reaktionäre Haltung konnten gefährlich dicht beieinanderliegen.
Die Unterhaltung driftete ab. Anna erzählte Ulf von einer Auseinandersetzung an der Schule ihrer Töchter. Eine streitbare Mutter hatte einem der Lehrer vorgeworfen, er bewerte die Leistung ihres Kindes zu schlecht. »Aber in Wirklichkeit ist das fragliche Kind einfach ein ziemlicher Blindgänger. Ich will ja nicht gemein sein, aber es ist schwer, dieses Kind unterzubewerten.«
»Wir müssen so tun, als ob«, sagte Ulf. »Neuerdings müssen wir in so vielem tun, als ob. Wir müssen so tun, als ob uns etwas gefiele, das uns gar nicht gefällt. Wir müssen uns solche Mühe geben, nicht zu werten.«
»Vermutlich«, sagte Anna. »Vermutlich müssen Lehrer so tun, als wäre jedes Kind so was wie ein Genie.«
»Ja.«
»Besonders den Eltern gegenüber.«
»Ja«, stimmte Ulf zu. »Besonders dann.«
»Vielleicht ist es so am besten«, sinnierte Anna. »Wenn wir nur lange genug so tun, als ob, glauben wir am Ende, was wir glauben sollen, und alle sind zufrieden.«
»Nirwana«, sagte Ulf. »Wir könnten Schweden in Nirwana umbenennen – offiziell.«
Erneut wechselten sie das Thema – nun sprachen sie über ein internes Memo, gegen das alle im Büro Sturm liefen –, und dann hatten sie den Rand des weitläufigen Markts erreicht. Anna stieg aus, um Ulf in eine enge Parklücke zu lotsen, und sie machten sich auf den Weg zu ihrem Treffen mit dem Streifenpolizisten, der die Messerstecherei als Erster untersucht hatte.
Er hieß Blomquist. Ulf und Anna hatten schon mit ihm zusammengearbeitet, und zwar bei einer Ermittlung zu gefälschtem Whisky, der ein, zwei Jahre zuvor flüchtig auf dem Markt aufgetaucht war. Blomquist wartete am Ende eines der Marktgänge auf sie. Er erkannte sie wieder und begrüßte sie herzlich.
»Ich erinnere mich an diese Whiskysache«, sagte er. »Die war ja schon komisch, aber das jetzt!« Er stieß einen Pfiff aus. »Das wird eine echt harte Nuss.«
Ulf zuckte die Achseln. »Deswegen sind wir ja hier, nehme ich an.«
Blomquist nickte. »Ach, ich weiß schon, ihr Leute habt den Ruf, dass ihr solche Sachen aufklärt, aber ich glaube, das hier wird euch auf die Probe stellen.«
Anna warf Ulf einen Blick zu. »Wir werden sehen«, sagte sie ganz geschäftsmäßig. »Erzählen Sie uns, was Sie wissen.«
Blomquist deutete auf einen Marktstand ein Stückchen weiter. »Sehen Sie den Stand da drüben? Den, wo der Mann der Frau da einen Schal zeigt?«
Ulf sah in die Richtung, in die Blomquist deutete. Ein stämmiger Mann in einer Lederjacke schloss gerade den Verkauf eines Schals an eine junge Frau in Jeans und leuchtend rotem Oberteil ab.
»Das ist bestimmt Kaschmir«, sagte Anna. »Ich kenne diese Leute.«
»Das ist der Bruder des Opfers«, sagte Blomquist. »Er kümmert sich ums Geschäft, solange sein Bruder im Krankenhaus ist. Wir können mit ihm reden, wenn Sie wollen. Dann sehen Sie, wo es passiert ist.«
»Wie lange wird dieser Mann im Krankenhaus bleiben?«, fragte Anna.
Blomquist winkte ab. »Nur ein, zwei Tage, glaube ich. Es ist keine schwere Verletzung, aber sie befindet sich offenbar an einer heiklen Stelle. In der Kniekehle. Anscheinend verlaufen da unten alle möglichen Stränge …«
Anna unterbrach ihn. »Stränge?«
»Ich glaube, Sie meinen Sehnen«, sagte Ulf. »Wir haben Sehnen in der Kniekehle.« Er zögerte. »Und ich glaube, vorne am Knie auch. Oder jedenfalls an den Seiten.«
»Ich spiele Tennis«, erklärte Blomquist. »Ich weiß alles darüber. Wenn man sich das Knie verdreht, weiß man alles darüber.« Er sah Ulf an. »Spielen Sie auch, Herr Varg?«
»Früher«, antwortete Ulf. »Ich war nie besonders gut, aber es hat mir Spaß gemacht.«
»Sport muss Spaß machen«, sagte Blomquist. »Und das Schöne am Tennis ist, es kann einem Spaß machen, auch wenn man nicht besonders gut ist.«
»Sofern der Gegner ungefähr gleich stark ist«, schränkte Ulf ein. »Wenn man gegen einen starken Aufschläger antritt und selbst nicht besonders gut ist, wird das Spiel ziemlich einseitig.«
»Das stimmt«, sagte Anna. »Aber sollten wir jetzt vielleicht mit diesem Mann sprechen? Wie heißt er übrigens?«
»Oscar Gustafsson«, erwiderte Blomquist. »Und sein Bruder, das Opfer, heißt Malte. Malte Gustafsson.«
»Ich war dabei«, sagte Oscar. »Gesehen habe ich es nicht, aber ich war hier und habe meinem Bruder geholfen. Ihm gehört der Stand, verstehen Sie – ich arbeite bei der Bahn, aber ich habe Schichtdienst, und in meiner Freizeit komme ich her und helfe Malte.«
Ulf sah sich um. Es war ruhig auf dem Markt, und es sah nicht so aus, als gäbe es viele Interessenten für die Schals und Pullover in der Auslage von Gustafssons Stand. Er befühlte einen der Schals. Oscar war ein untersetzter Mann mit kurz geschorenem Haar; kein Typ, den man ohne Weiteres mit Kaschmir in Verbindung brachte.
»Kaschmir?«, fragte Ulf.
Oscar zögerte. Dann sagte er: »Sozusagen. Es kommt darauf an, was man unter Kaschmir versteht.«
Anna sah ihn an. »Ich weiß, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber wenn ich Kaschmir sage, meine ich in der Regel Kaschmir.«
Ulf machte eine beschwichtigende Geste. »Deswegen sind wir nicht hier«, sagte er. »Erzählen Sie mir von Ihrem Bruder, Herr Gustafsson.«
Oscar wirkte erleichtert. »Er ist seit etwa zehn Jahren Markthändler. Vorher war er Mechaniker, wissen Sie – ein ziemlich guter sogar. Hauptsächlich hat er sich um Motorräder gekümmert. Harley-Davidsons. Dann hatte er genug davon, weil er ein Ekzem bekam und seine Haut allergisch auf Seife reagiert. Wenn die Hände bei der Arbeit jeden Tag voller Schmieröl sind und man keine Seife verträgt, ist das ein Problem.«
Blomquist nickte. »Eindeutig«, sagte er. »Ekzeme sind heikel. Und manche dieser Cremes, die sie einem geben, machen die Haut dünn, wissen Sie? Mit denen muss man vorsichtig sein.«
»Nur die stärkeren«, wandte Anna ein. »Wenn man die schwächeren Kortikosteroide benutzt, ist es besser.«
»Malte hatte Probleme mit alledem«, sagte Oscar. »Auch als er keine Motorräder mehr reparierte. Er benutzt jetzt einen Seifenersatz, aber er bekommt immer noch trockene Stellen auf der Haut.«
»Der Feuchtigkeitshaushalt«, sagte Anna. »Man muss auf den Feuchtigkeitshaushalt der Haut achten, besonders wenn es kalt ist. Als Markthändler ist man sicher viel im Freien.«
»Deshalb sollte er vorsichtig sein«, sagte Blomquist. »Kälte und Wind sind schlecht, wenn man trockene Haut hat.«
Ulf klopfte mit der Schuhspitze aufs Pflaster. »Aber Malte – erzählen Sie mir mehr über ihn.«
»Malte«, begann Oscar, »ist ein sehr sanfter Mann.«
Opfer, dachte Ulf, sind das oft.
»Er ist ein paar Jahre älter als ich«, fuhr Oscar fort. »Ich habe immer zu ihm aufgeblickt. Sie wissen sicher, wie das bei Brüdern ist: Man glaubt, der ältere Bruder kann alles. Man wäre gern er, schätze ich. Und mit Malte war das genauso, weil er so gut mit Maschinen umgehen konnte. Ich habe das auch probiert, aber ich bin nicht weit gekommen. Zur Bahn bin ich gegangen, weil ich auf eine Mechanikerlehre gehofft habe, aber dazu ist es nicht gekommen. Ich bin zur Schienenwartung gegangen, und das mache ich noch heute. Ist gar nicht so übel.«
Ulf nickte. »Viele von uns müssen sich mit etwas abfinden. Und dann stellen wir fest, dass das, womit wir uns abgefunden haben, genauso gut ist wie das, was wir eigentlich machen wollten.«
»Stimmt«, sagte Oscar. »Und so war das bei Malte auch, glaube ich. Wegen seiner Hautprobleme musste er sich damit abfinden, auf dem Markt zu stehen, und dann hat er gemerkt, dass es ihm gut gefällt. Er hat es nie bereut.«
Ulf dachte kurz nach. »Sie haben gesagt, Malte habe Harley-Davidsons repariert. Fährt er noch Motorrad?«
Oscar erwiderte, sein Bruder besitze noch zwei Harleys, eine davon ein Modell von 1965, die andere ein Mischmasch aus verschiedenen Ersatzteilen. »Er nennt die, die er selbst zusammengeschraubt hat, eine Davidson-Harley – weil er da einiges von hinten nach vorn eingebaut hat.«
Anna lachte. »Witzig.«
Oscar wirkte erfreut, dass der Witz seines Bruders gut ankam. »Manche Leute kapieren das nicht«, sagte er. »Jedenfalls ein paar von den Bikern nicht.«
»Ach«, warf Ulf ein. »Humor ist etwas Eigenartiges. Aber sagen Sie: Gehört er einem Motorradklub an? Einem Harley-Davidson-Klub oder so?«
»Sie meinen, einer Gang?«, fragte Oscar. Und dann erklärte er lächelnd, Malte gehöre zwar zu einer Bikertruppe, aber die sei eher untypisch. »Sie haben zwölf Mitglieder«, sagte er. »Zehn davon im Ruhestand – nur Malte, der der Jüngste ist, und einer der anderen sind unter fünfzig. Malte ist achtundvierzig, müssen Sie wissen.«
»Dann sind diese Biker also ziemlich zahm?«, fragte Anna.
»Ja«, erwiderte Oscar. »Ihre Ausfahrten sind sehr gemächlich. Diese großen Harleys können wie Sessel sein, wissen Sie? Man lehnt sich zurück und nimmt die Kurven ganz behutsam. Weit fahren sie auch nicht, diese Jungs – sie kommen gern früh nach Hause.
»Zurück zu ihren Alten«, witzelte Anna. »So nennen sie sie doch, oder?«
»Diese Jungs nennen sie ihre Frauen«, sagte Oscar. »Ich habe es Ihnen ja gesagt – sie sind sehr anständige Leute.«
»Also glauben Sie nicht, dass es etwas mit Streitigkeiten unter Bikern zu tun haben könnte?«, fragte Ulf. Natürlich wusste er, dass man eigentlich nicht mit Zeugen über Ermittlungshypothesen sprach, aber die Frage war ihm einfach herausgerutscht.
Oscar schürzte die Lippen. »Die? Keine Chance. Das ist ein Haufen Miezekatzen.«
»Der Schein kann trügen«, sagte Anna.
Oscar schüttelte vehement den Kopf. »So ist das überhaupt nicht«, sagte er. »Oscar hat sich immer sehr gut mit allen verstanden. Er hat ihnen bei ihren Motorrädern geholfen – jedenfalls wenn es etwas war, wobei er Handschuhe tragen konnte. Handschuhe schützen seine Haut. Er ist bei allen beliebt.«
»Also«, sagte Ulf, »wenn es keine Biker-Fehde war, was könnte es dann Ihrer Meinung nach gewesen sein? Man sticht doch nicht einfach so jemandem mit einem Messer in die Kniekehle. Gibt es jemanden, der einen Groll gegen ihn hegt?«
Wieder verneinte Oscar rigoros. »Hören Sie«, sagte er, »es gibt niemanden – und ich meine wirklich niemanden –, der Malte nicht ausstehen kann. Er ist der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Er würde nie …«
»Ein unzufriedener Kunde?«, warf Anna ein und deutete auf die Ware. »Ein Streit über die Qualität der Ware?«
Oscar sah sie verächtlich an. »Malte ist ehrlich«, sagte er. »Er betrügt nie. Und seine Preise sind auch fair.«
Ulf fragte nach Maltes Privatleben. War er verheiratet? War die Ehe glücklich?
»Malte hat mit achtundzwanzig geheiratet«, erwiderte Oscar. »Er und Mona haben vor Kurzem ihren zwanzigsten Hochzeitstag gefeiert. Sie ist Erzieherin. Die Ausbildung hat sie erst spät gemacht – erst vor zehn Jahren –, nachdem ihre eigenen Kinder ein bisschen größer waren. Sie kommt von einem Milchhof etwa vierzig Kilometer außerhalb von Malmö. Die machen da ihren eigenen Käse – es ist ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen.«
»Arbeitet Mona auf dem Hof mit?«, fragte Anna.
Oscar seufzte. »Eigentlich sollte sie. Sie waren zu zweit – sie und ihr Bruder. Der alte Herr führt den Laden noch, und Monas Bruder Edvin hilft ihm und übernimmt in letzter Zeit immer mehr. Mona würde selbst gern mehr Hand anlegen oder zumindest mitreden – schließlich ist es ein Familienbetrieb –, aber Edvin will sie offenbar nicht dabeihaben. Er hat den alten Mann auf seine Seite gezogen, und deshalb wird Mona nie gefragt. Vor Kurzem haben sie einen ganz neuen Melkstand gebaut – das Neueste vom Neuen –, und sie haben es ihr nicht mal gesagt. Kein Wort. Obwohl sie und ihr Bruder offiziell ebenbürtige Geschäftspartner sind – zusammen mit dem alten Herrn natürlich.«
»Wie denkt Malte darüber?«, fragte Ulf.
»Er war stinkwütend. Mona soll ihrem Bruder die Stirn bieten, hat er gesagt.«
Ulf und Anna wechselten einen Blick. »Also gibt es böses Blut zwischen Malte und seinem Schwager«, sagte er.
»Ja. Aber das ist nicht Maltes Schuld. Er hat es mit dem Anwalt der Familie besprochen. Hat sich beschwert, hat gesagt, wenn der Hof ein Unternehmen ist – und das ist er –, dann sollte er auch wie ein richtiges Unternehmen geführt werden, mit Versammlungen der Anteilseigner und ordentlichen Protokollen über die Entscheidungen – all das. Das hat Edvin nicht gefallen, kann ich Ihnen sagen. Er hat Malte gedroht …« Oscar unterbrach sich. »Ich meine, er hat ihm gesagt, er wäre derjenige, der die ganze Arbeit macht, also führt er den Hof auch so, wie es ihm gefällt.«
»Sie haben gesagt, er hat ihm gedroht«, hakte Anna nach. »Womit genau?«
Oscar blickte verdrießlich. »Edvin hat Malte nicht das Messer ins Knie gestoßen. Die Info gebe ich Ihnen gratis. Edvin war überhaupt nicht in der Nähe, als es passiert ist.«
»Woher wissen Sie das?«, fragte Ulf. »Auf dem Markt ist es manchmal ziemlich voll.«
Blomquist, der lange geschwiegen hatte, meldete sich zu Wort. »Zur Zeit des Vorfalls war es auf jeden Fall voll hier. Ich kam zehn Minuten später hier an, und da waren jede Menge Leute.«
»Vergessen Sie nicht, ich war auch hier«, gab Oscar zurück. »Wenn Edvin hier herumgehangen hätte, hätte ich ihn gesehen. Er war nicht hier. Und außerdem gibt es einen Grund, warum er nicht hier war. Einen guten Grund.«
Sie warteten auf seine Erklärung. Und als er sie ihnen gab, wirkte er ein wenig triumphierend. »Weil er in Kanada war. Irgendein Cousin in Winnipeg hat geheiratet, und sowohl Mona als auch Edvin waren eingeladen. Mona wollte nicht, aber Edvin und seine Frau sind hingeflogen. Sie sind Anfang letzter Woche abgereist und kommen erst nächsten Dienstag zurück. Malte hat mir das erzählt. Er hätte nichts dagegen gehabt, hinzufliegen, aber Mona sagt, sie kann Edvin nicht so lange ertragen. Sie entscheidet normalerweise, was die beiden tun.«
In Begleitung von Blomquist wurden sie von Oscar zum Ort des Geschehens geführt, hinter dem Stand, in einem kleinen Verschlag aus Zeltplane, einer Art Zeltanbau, der anscheinend als Büro diente. Es gab dort einen Schreibtisch, einen Campingstuhl und einen Stapel Kartons.
»Als ich Malte schreien hörte, lief ich zu ihm«, sagte Oscar. »Ich bediente gerade eine Kundin und dachte, er will irgendwas von mir, aber mir wurde schnell klar, dass etwas nicht in Ordnung war. Malte stand vornübergebeugt da drüben und hielt sich das Knie. Er hatte ziemlich starke Schmerzen.«
»Und war jemand bei ihm?«, fragte Ulf.
Oscar schüttelte den Kopf. »Keine Menschenseele. Und Malte sagte, er hätte niemanden gesehen.«
Ulf runzelte die Stirn. »Könnte jemand hier gewesen sein, der dann schnell wieder verschwunden ist?«
Oscar blickte ratlos. »Ich kapiere einfach nicht, wie man das schaffen kann.«
Ulf fragte, ob es außer der Öffnung in der Zeltplane, durch die sie hereingekommen waren, noch einen anderen Weg hinein und hinaus gebe. Den gebe es nicht, sagte Oscar, nur einen kleinen Schlitz an der Rückseite. »Ein kleines Kind käme da durch«, sagte er und deutete auf den Schlitz. »Aber kein Erwachsener.«
Ulf bückte sich und untersuchte den Schlitz. Er teilte die Zeltplane und stellte fest, dass an den Rückseiten der Stände ein Gang verlief. Durch diesen Gang hätte durchaus jemand kommen können, dachte er, wobei es viele Hindernisse gab: einen Benzinkanister, ein einsames Ersatzrad, ein paar umgekippte, verrottende Holzkisten.
Er drehte sich wieder zu Oscar um. »In welche Richtung sah Malte, als Sie hereinkamen?«, fragte er.
»Zu mir«, sagte Oscar.
»Weg vom Schlitz in der Zeltplane?«
»Ja, ich glaube schon.«
Ulf untersuchte den Schlitz genauer. »Hier ist Blut auf der Zeltplane«, sagte er leise. »Schaut.«
Blomquist spähte ihm über die Schulter. Anna bückte sich und sah von der Seite hin.
»Folgendes ist passiert«, sagte Ulf. »Jemand hat von draußen die Hand – mit einem Messer – hereingestreckt und es in das Erstbeste gerammt, an das er herankam. Das war die Kniekehle Ihres Bruders.«
»Deshalb hat er ihn nicht gesehen«, murmelte Oscar.
»Ich nehme es an«, sagte Ulf. »Anna, was denkst du?«
»Es ist eine plausible Hypothese«, erwiderte Anna. »Aber eine, die keine Fragen beantwortet. Jede Hypothese, die das Wort jemand verwendet, bringt uns der Lösung nicht näher.«
Ulf war anderer Meinung. »Sie beantwortet die Frage nach dem Wie. Die Frage nach dem Warum und dem Wer lässt sie offen, aber eine Antwort auf eine von drei Fragen ist doch besser als gar keine Antwort.«
»Marginal«, sagte Anna.
Dann ging sie ihren Brokkoli und ihre Eier kaufen, während Ulf und Blomquist, der sich ihren Ermittlungen offenbar eigenmächtig angeschlossen hatte, den schmalen Gang hinter dem Zelt nach Spuren absuchten, die etwas Licht in den Fall bringen könnten. Natürlich fanden sie nichts außer den Hinterlassenschaften des Stadtlebens: Fast-Food-Verpackungen aus Zellophan; ein leerer Kugelschreiber; eine zusammengeknüllte Einkaufsliste, von irgendeinem Passanten fallen gelassen: Kartoffeln, Vitamintabletten, Küchenpapier, Talkum; eine Eintrittskarte für ein Rockkonzert einige Monate zuvor – eine dänische Gruppe, von der sogar Ulf, der keine Rockmusik mochte, schon einmal gehört hatte.
»Nichts, was uns weiterbringt«, sagte Blomquist, als sie mit ihrer Suche fertig waren, und fügte hinzu: »Die Leute sind solche Dreckspatzen, oder?«
»Stimmt«, pflichtete Ulf ihm bei. Er stupste einen eingebeulten Karton an, den irgendein Händler hier im Regen verrotten ließ, und störte dabei einen Käfer auf, der fluchtartig sein durchnässtes Heim verließ und davonhuschte, um sich eine neue Bleibe zu suchen.
Kapitel drei
Der singende Baum
Als Ulf und Anna vom Markt zurückkehrten, gab es im Büro nicht viel zu tun. Carl war in ihrer Abwesenheit fleißig gewesen: Ein Routinebericht, zu dem sie eigentlich alle hätten beitragen müssen, war fertig, weil Carl seine Mittagspause geopfert hatte, um ihn zu Ende zu schreiben. Nun benötigte der Bericht nur noch Unterschriften, wonach Ulf Denkzeit, wie er es nannte, zur Verfügung hatte, eine Gelegenheit, sich die bisherigen Fakten der Ermittlung durch den Kopf gehen zu lassen. Etwas übersehen? Etwas, was die Umstände nahelegten, ihm aber noch nicht aufgegangen war? Das Offensichtliche, hatte Ulf einmal festgestellt, ist kaum jemals offensichtlich, bevor es sich mit der Zeit als solches erweist. Es war die Weisheit der Rückschau, die uns behaupten lässt, dass jeder hätte vorhersehen können, was schließlich passiert war – kein Standpunkt, den Ulf je vertreten hätte. »Normalerweise tappen wir im Dunkeln«, hatte er einmal zu Anna gesagt. »Wir alle – du, ich, Carl –, drei Leute, die im Dunkeln umhertasten und versuchen, aus dem Wald herauszufinden.«
»Und trotzdem haben wir eine ganz ordentliche Aufklärungsrate«, entgegnete sie. »Was beweist, dass manchmal Licht in dieses Dunkel dringt.«
»Ich glaube, das könnte auch Zufall sein«, sagte Ulf. »Manchmal stolpern wir über die Wahrheit. Wir glauben, wir finden sie, dabei findet sie uns.«