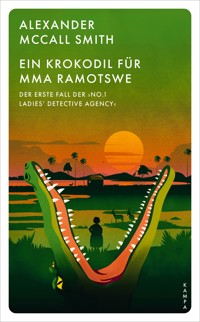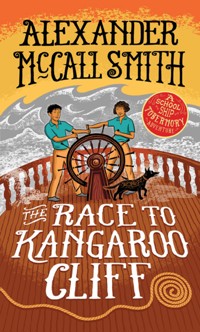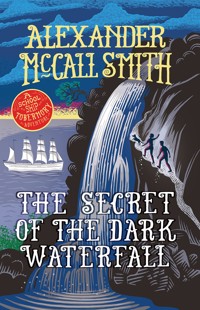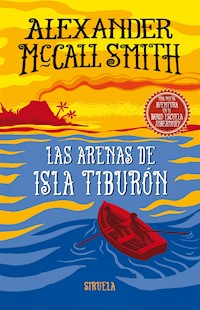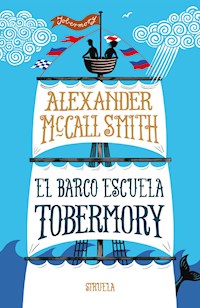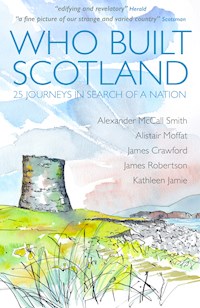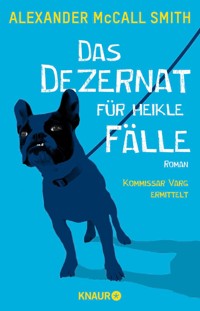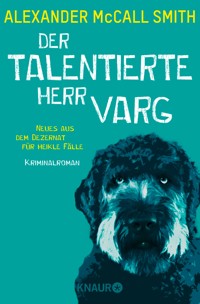
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ulf "Wolf" Varg
- Sprache: Deutsch
Gegen diesen Kommissar haben selbst die absurdesten Verbrechen keine Chance: Teil 2 der humorvollen Krimi-Reihe aus Schweden von Bestseller-Autor Alexander McCall Smith Kommissar Ulf Varg hat es nicht leicht bei seinen neuesten Ermittlungen: Neben der Depression seines ebenso treuen wie taubstummen Hundes Marten stört auch Kollege Bloomquist die Konzentration seines Chefs mit hochnotpeinlichen Gesundheitstipps. Dabei muss das »Dezernat für heikle Fälle« um Kommissar Varg nicht nur einen mysteriösen Fall von Erpressung lösen, in den Schwedens berühmtester Schriftsteller verwickelt scheint. Außerdem benötigt die hübsche Kollegin Anna Ulfs Hilfe, und dann ist da noch ein gewitzter Betrüger, der Hunde als Wölfe verkauft – warum auch nicht? Immerhin bringen die Tiere so deutlich mehr Geld ein! In Alexander McCall Smiths humorvoller Krimi-Reihe wird garantiert nicht gestorben – dafür bieten die absurden Fälle und das liebevoll-verschrobene Personal allen Fans von Cosy Crime jede Menge Anlass, herzlich zu lachen. Seinen ersten Fall löst Kommissar Ulf Varg aus Schweden im humorvollen Krimi »Das Dezernat für heikle Fälle«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alexander McCall Smith
Der talentierte Herr Varg
Neues aus dem Dezernat für heikle Fälle
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Alice Jakubeit
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Gegen diesen Kommissar haben selbst die absurdesten Verbrechen keine Chance.
Kommissar Ulf Varg hat es nicht leicht bei seinen neuesten Ermittlungen: Neben der Depression seines ebenso treuen wie taubstummen Hundes Marten stört auch Kollege Bloomquist die Konzentration seines Chefs mit hochnotpeinlichen Gesundheitstipps.
Dabei muss das »Dezernat für heikle Fälle« um Kommissar Varg nicht nur einen mysteriösen Fall von Erpressung lösen, in den Schwedens berühmtester Schriftsteller verwickelt scheint. Außerdem benötigt die hübsche Kollegin Anna Ulfs Hilfe, und dann ist da noch ein gewitzter Betrüger, der Hunde als Wölfe verkauft – warum auch nicht? Immerhin bringen die Tiere so deutlich mehr Geld ein!
In Alexander McCall Smiths humorvoller Krimi-Reihe wird garantiert nicht gestorben – dafür bieten die absurden Fälle und das liebevoll-verschrobene Personal allen Fans von Cosy Crime jede Menge Anlass, herzlich zu lachen.
Seinen ersten Fall löst Kommissar Ulf Varg aus Schweden im humorvollen Krimi »Das Dezernat für heikle Fälle«.
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel eins | Vergrößerte Poren
Kapitel zwei | Zur Verteidigung von Stereotypen
Kapitel drei | Mafia-Zement
Kapitel vier | Echtes Kunstleder
Kapitel fünf | Der schwedisch-russische Krieg
Kapitel sechs | Ein Buch für jeden Geschmack
Kapitel sieben | Blomquist beklagt sich
Kapitel acht | Hundepolitik
Kapitel neun | Knoblauch entfaltet seine Wirkung
Kapitel zehn | Esten, Bandwürmer, Tätowierungen
Kapitel elf | Ångest überall
Kapitel zwölf | Mit Wölfen verwandt
Kapitel dreizehn | Van Dog
Kapitel vierzehn | Der große skandinavische Biker-Krieg
Kapitel fünfzehn | Nicht ABBA
Dieses Buch ist für Lance und Pauline Butler
Kapitel eins
Vergrößerte Poren
Ulf Varg vom Dezernat für heikle Fälle fuhr mit seinem silbergrauen Saab durch eine Landschaft der kurzen Wege. Er war unterwegs zu einer eintägigen Psychotherapieveranstaltung in einem Wellnesscenter auf dem Land, und die Fahrt dorthin, dachte er bei sich, war Teil der Therapie. Vor ihm lag Südschweden, parzelliert in Bauernhöfe, die seit Generationen im Besitz derselben Familien waren. Hier und dort sprenkelten weiße Punkte das Grün, die Häuser der Leute, die dieses Land bearbeiteten. Es waren sesshafte Menschen mit langem Gedächtnis und ebenso lang gepflegten Eifersüchteleien; Menschen, deren metaphorischer Horizont dort endete, wo der Himmel auf das Land traf, was manchmal nur einen Steinwurf entfernt zu sein schien; Menschen, die nicht viel herumgekommen waren und auch nicht das Bedürfnis danach verspürten.
Er dachte über ihr Leben nach, das sich so sehr von seinem Leben in Malmö unterschied. Hier war nichts sonderlich dringend; niemand hatte Zielvorgaben zu erfüllen oder Berichte zu schreiben. Input und Output oder Kommunikationsziele waren hier sicher kein Thema. Diese Menschen arbeiteten meistens für sich, nicht für andere; sie wussten, was ihre Nachbarn zu so ziemlich jedem Thema zu sagen hatten, denn sie hatten es alles schon einmal gehört, wieder und wieder, und es war ihnen so vertraut wie das Wetter. Sie wussten auch genau, wer wen mochte oder nicht ausstehen konnte, wem nicht zu trauen war, wer was getan hatte, auch wenn es Jahre zurücklag, und was die Folgen gewesen waren. Hier Polizist zu sein war sicher einfach, dachte Ulf, da es keine nennenswerten Geheimnisse gab. Von Straftaten würde man erfahren, beinahe bevor sie verübt wurden, wobei es sicher nicht viele gab. Die Menschen hier waren gesetzestreu und angepasst und führten ein Leben, das in engen Bahnen vorschriftsmäßig bis ins Grab verlief – und sie wussten auch schon, wo das liegen würde: gleich neben den Gräbern ihrer Eltern und Großeltern.
Ulf öffnete das Autofenster und atmete tief ein: Die Landluft roch nach irgendwelchen Blüten – Ginster, dachte er, oder die blühenden Obstbäume in der Plantage an der Straße. Bäume waren nicht Ulfs Stärke, er konnte sich nie erinnern, welcher Obstbaum welcher war, wobei er glaubte, dass er sich im Moment in einem Apfelanbaugebiet befand – oder waren es Pfirsiche? Wie auch immer, sie blühten, ein bisschen später als gewöhnlich, hatte er gehört, weil der Frühling in Schweden dieses Jahr hatte auf sich warten lassen. Genau genommen ließ alles auf sich warten, auch in Ulfs Karriere. Man hatte ihm – inoffiziell – gesagt, er sei für eine Beförderung innerhalb des Malmöer Dezernats für heikle Fälle vorgesehen, doch seit Monaten war in dieser Sache nichts weiter geschehen.
Sich von der erwarteten Gehaltserhöhung eine neue Couchgarnitur zu kaufen, zumal eine mit weichem Florentiner Leder bezogene, war keine gute Idee gewesen. Sie war ruinös teuer gewesen, und als sein Gehalt einfach nicht erhöht wurde, war er gezwungen gewesen, Geld von seinem Sparkonto aufs Girokonto zu transferieren, um diese Ausgabe zu decken. Ulf war das sehr unangenehm, da er sich gelobt hatte, sein Sparkonto vor dem sechzigsten Geburtstag, bis zu dem es noch genau zwanzig Jahre waren, nicht anzutasten. Doch zwanzig Jahre erschienen ihm wie eine sehr lange Zeit, und er fragte sich, ob er dann überhaupt noch da sein würde.
Ulf neigte nicht zu melancholischen Betrachtungen über die Situation des Menschen. Man kann im Leben nicht alles auf sich nehmen; seine Aufgabe war es, Menschen vor anderen zu schützen, die ihnen in irgendeiner Weise schaden wollten – das Verbrechen zu bekämpfen, wenn auch einen eher abseitigen Teil des kriminellen Spektrums. Er konnte nicht alles tun, befand er, konnte nicht alle Probleme der Welt auf seine Schultern laden. Wer konnte das schon? Ulf war nicht etwa desinteressiert oder verantwortungslos, er war keiner dieser Bürger, die gedankenlos Plastiktüten verwendeten. Er achtete ebenso sehr wie jeder andere darauf, seinen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten – abgesehen von dem Saab natürlich, der mit fossilem Treibstoff statt Strom betrieben wurde. Wenn man den Saab jedoch aus der Gleichung herausnahm, konnte Ulf in Gesellschaft von Umweltschützern den Kopf hocherhoben tragen, auch neben seinem Kollegen Erik, der zwar ständig über Fischbestände schwatzte, gleichzeitig aber jedes Wochenende sein Bestes gab, die verbleibenden Fische zu fangen. Erik hielt sich viel zugute auf seine Gewohnheit, die Fische, die er fing, zurück ins Wasser zu werfen, doch Ulf hatte ihn darauf hingewiesen, dass diese Fische traumatisiert waren und möglicherweise nie mehr die alten sein würden. »Geangelt zu werden ist ein einschneidendes Erlebnis für einen Fisch«, hatte er zu Erik gesagt. »Selbst wenn du ihn zurückwirfst, wird er sich nie wieder sicher fühlen.«
Erik hatte seinen Einwand einfach abgetan, doch Ulf hatte ihm angemerkt, wie betroffen er war. Und das hatte er sofort bedauert, denn es war nur allzu leicht, jemanden wie Erik zu verunsichern. Es ist schwer genug, Erik zu sein, überlegte Ulf, auch ohne noch Kritik von Menschen wie mir ausgesetzt zu sein. Ulf war ein liebenswürdiger Mensch, und obwohl Eriks Gerede über Fische anstrengend war, würde er künftig darauf achten, es sich nicht anmerken zu lassen. Er würde ihm geduldig zuhören und vielleicht sogar noch etwas lernen – wobei Ulf das für eher unwahrscheinlich hielt.
Während er den Saab über die stille Landstraße lenkte, galten seine Gedanken weniger dem Umweltschutz und den langfristigen Aussichten der Menschheit, sondern hauptsächlich einer peinlichen Angelegenheit, die sich infolge eines seiner letzten Fälle ergeben hatte. Alltägliche Vergehen überließ das Dezernat für heikle Fälle in der Regel den uniformierten Kollegen von der lokalen Polizei. Von Zeit zu Zeit kam es jedoch dazu, dass ein ansonsten banaler Fall aufgrund irgendeines besonderen politischen oder gesellschaftlichen Aspekts bei ihnen landete. So auch der Fall einer durch einen lutherischen Geistlichen verübten leichten Körperverletzung: Der Pfarrer hatte seinem Opfer eines Samstagmorgens vor den Augen von mindestens fünfzehn Zeugen eine blutige Nase verpasst. Das an sich war schon ungewöhnlich genug, da lutherische Geistliche in der Kriminalstatistik nicht sonderlich weit oben rangierten. Doch was dieses Vergehen für das Dezernat für heikle Fälle qualifizierte, war nicht so sehr die Person des Täters, sondern die des Opfers. Die Nase, die zum Ziel besagter Körperverletzung geworden war, gehörte dem Anführer einer Gruppe reisender Roma.
»Geschützte Spezies«, hatte Ulfs Kollege Carl angemerkt.
»Tataren«, sinnierte Erik, wurde jedoch von ihrer Kollegin Anna, die die Grenzen des Zulässigen besser als jeder andere im Dezernat kannte und bei dieser altmodischen und herabsetzenden Bezeichnung die Augen verdrehte, scharf korrigiert.
»Das sind keine Tataren, Erik. Es sind Resande, eine reisende Minderheit.«
Ulf entschärfte die Situation. »Erik verweist nur auf die Unsensibilität anderer Menschen. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Haltung, die zu Vorfällen wie diesem führt.«
»Außer er hatte es verdient«, murmelte Erik.
Das ignorierte Ulf und betrachtete stattdessen die Fotos der fraglichen Nase, die der Akte beilagen. Sie waren in der Notaufnahme des Krankenhauses gemacht worden, als noch Blut aus dem linken Nasenloch rann. Abgesehen davon schien es eine ganz gewöhnliche Nase zu sein; allerdings fiel Ulf auf, dass die Poren auf den Nasenflügeln leicht vergrößert waren.
»Hier sind seltsame kleine Löcher«, sagte er, stand auf und reichte die Akte an Anna weiter, deren Schreibtisch – einer von vieren im Raum – seinem am nächsten stand. »Sieh dir die Haut dieses armen Mannes an.«
Anna betrachtete das Foto. »Vergrößerte Poren«, sagte sie. »Fettige Haut.«
Carl sah von dem Bericht auf, den er gerade schrieb. »Kann man dagegen irgendwas tun? Manchmal, wenn ich in den Spiegel sehe – ich meine, wenn ich mir meine Nase genau ansehe –, dann sehe ich kleine Pünktchen. Ich hatte mich schon gefragt, was das ist.«
Anna nickte. »Das Gleiche – und völlig normal. Man findet sie an Stellen, an denen die Haut von Natur aus fettig ist. Sie dienen als eine Art Abfluss.«
Carl wirkte interessiert. Er betastete die Haut um seine Nase. »Und kann man etwas dagegen tun?«
Anna gab Ulf die Akte zurück. »Wasch dir das Gesicht. Verwende einen Gesichtsreiniger. Und dann kannst du für besondere Gelegenheiten einen Eiswürfel daran halten. Dadurch zieht sich die Haut zusammen, und die Poren sehen kleiner aus.«
»Oh«, sagte Carl. »Eis?«
»Ja«, bestätigte Anna. »Aber das Wichtigste ist, die Haut sauber zu halten. Du trägst kein Make-up, nehme ich an …«
Carl lächelte. »Noch nicht.«
Anna verwies darauf, dass manche Männer es taten. »Heutzutage kann man alles tragen. Da ist dieser Mann im Café auf der anderen Straßenseite – ist dir der schon mal aufgefallen? Er trägt Rouge – ziemlich viel sogar. Der muss vorsichtig sein – wenn er das Make-up nicht gründlich entfernt, könnte es seine Poren verstopfen.«
»Warum macht er so was?«, fragte Carl. »Ich kann mir nicht vorstellen, mir das Gesicht mit Chemikalien zu verkleistern.«
»Weil er so gut wie möglich aussehen möchte«, erwiderte Anna. »Weißt du, die meisten Menschen sehen nicht so aus, wie sie aussehen möchten. Das ist ein bisschen traurig, schätze ich, aber so ist es.«
»Sehr merkwürdig«, sagte Ulf, dachte dabei aber eher an ihren Fall denn an Kosmetik.
Der Angriff auf den Rom hätte vielleicht zu einer raschen und unkomplizierten Verurteilung des Täters geführt, wenn es nicht so gewesen wäre, dass kein einziger der fünfzehn Augenzeugen zur Aussage bereit war. Vier von ihnen sagten, sie hätten gerade in die andere Richtung geblickt; fünf gaben an, ihre Augen seien zufällig geschlossen gewesen, als der Angriff erfolgte; einer behauptete tatsächlich, er habe geschlafen; und die übrigen erklärten, sie könnten sich nicht an den Vorfall erinnern und bezweifelten sehr, ob er überhaupt stattgefunden hatte. Damit blieben das Opfer und der Pfarrer. Für das Opfer war die Sache klar: Während er auf einem öffentlichen Platz seinen Angelegenheiten nachgegangen sei, sei ein Fremder im Gewand eines Geistlichen zu ihm gekommen und habe ihn auf die Nase geboxt. Und zwar nur, weil er ein Rom sei, sagte er.
»Wir sind daran gewöhnt, dass die Sesshaften uns so behandeln. Sie gönnen uns unsere Freiheit nicht.«
Der Pfarrer wiederum behauptete, plötzlich habe ein Wildfremder vor ihm gestanden und sich in eine unbegreifliche Schmährede so hineingesteigert, dass er sich die Nase an einem Laternenpfeiler gestoßen habe. Er selbst sei so besorgt über die Verletzung dieses Unglücklichen gewesen, dass er ihm sein eigenes Taschentuch angeboten habe, damit er sich das Blut abwischen konnte. Dieses Angebot sei auf das Unhöflichste verschmäht worden. Die Unterstellung, er habe diesen Mann angegriffen, sei abscheulich und offenkundig falsch.
»Manche Menschen sind schreckliche Lügner«, schloss der Pfarrer. »Gott segne sie, aber sie haben wirklich überhaupt kein Schamgefühl. Nicht, dass ich hier auf irgendeinem bestimmten Personenkreis herumhacken wollte, das verstehen Sie sicher.«
Ulf legte Opfer und Angreifer nahe, die ganze Sache durch eine gegenseitige Entschuldigung beizulegen.
»Wenn es unmöglich ist, festzustellen, was tatsächlich geschehen ist«, erklärte er, »dann ist es manchmal am besten, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen eines Konflikts – wie in diesem Fall –, aber wenn beide Seiten sich in der Lage sehen, die Sache beizulegen …«
Die Körpersprache des Opfers machte deutlich, dass dieser Vorschlag von ihm nicht gut aufgenommen wurde. Der Mann schwoll regelrecht an, in seinem Hals schien sich ein gefährlicher Druck aufzubauen, und seine Augen wurden schmal vor Wut.
»Die Nase eines Rom zählt also weniger als die anderer«, zischte er. »Wollen Sie das sagen?«
»Ich fälle hier kein Urteil über Ihre Nase«, sagte Ulf gelassen. »Und soweit es uns betrifft, sind alle Nasen gleich – das versichere ich Ihnen.«
»Das sagen Sie«, fuhr das Opfer ihn an. »Aber wenn es hart auf hart kommt, läuft es anders, oder?« Seine laute Stimme klang beleidigt. Er funkelte Ulf an, dann fuhr er fort: »Meine Nase ist so schwedisch wie Ihre.«
Ulf erwiderte seinen Blick. Aggression verärgerte ihn immer, und dieser Mann, dachte er, war unnötig aggressiv. Gleichzeitig war ihm bewusst, dass er es mit einem Angehörigen einer Minderheit zu tun hatte, die viele nicht mochten. Das ging sicher nicht spurlos an einem vorüber.
Daher erwiderte er versöhnlich: »Selbstverständlich. Das habe ich gar nicht in Abrede gestellt.«
»Aber Sie wollen ihn einfach so davonkommen lassen, oder? Berechtigte Körperverletzung? Ist es das?«
Das traf Ulf. »Vili…« Er brach ab.
Der Name des Beschwerdeführers wollte ihm nicht einfallen. Er stand in der Akte, doch die hatte er nicht zur Hand. Da ihm gerade Diskriminierung vorgeworfen wurde, war dieser Lapsus Memoriae besonders unglücklich. An den Namen des Pfarrers erinnerte er sich, doch nicht an den des anderen Mannes. »Vili…«
»Da!«, zischte das Opfer. »Sie machen sich nicht mal die Mühe, sich meinen Namen zu merken.«
Ulf schluckte schwer. »Tut mir leid.«
Jetzt fiel er ihm wieder ein, und er fragte sich, wie er ihn hatte vergessen können. Viligot Danior.
»Tut mir leid, Viligot. Ich habe viel um die Ohren. Von überall werden Probleme an mich herangetragen, und manchmal fällt es mir schwer, alles im Kopf zu behalten. Jedenfalls möchte ich Ihnen sagen, dass ich die Sache nicht auf sich beruhen lassen werde. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen, und bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass der Pfarrer zur Verantwortung gezogen wird.«
Viligot entspannte sich sichtlich. »Gut. Das ist sehr gut.«
»Und daher werde ich mich dafür aussprechen, dass er angeklagt wird. Dann muss der Richter entscheiden, wem er glaubt. Es wird Aussage gegen Aussage stehen. Hoffen wir einfach, dass das Gericht herausfindet, wer die Wahrheit sagt.«
»Das bin ich«, sagte Viligot hastig.
»Wenn Sie das sagen«, erwiderte Ulf, »dann will ich Ihnen glauben, solange man mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Schließlich kommt eine blutige Nase nicht aus dem Nichts.«
»Zumal es auf dem fraglichen Platz gar keine Laternenpfeiler gibt«, sagte Viligot.
Ulf dachte kurz nach. Dann lächelte er. »Ich denke, Sie haben mich gerade überzeugt.«
Als man dem Richter ein Foto des Tatorts vorlegte, war auch er überzeugt, sehr zum Ärger der Verteidigung. Wo, wurde der Angeklagte gefragt, ist der Laternenpfeiler, mit dem Viligot zusammengestoßen sein sollte? Damit stand die Verurteilung des Pfarrers fest. Er wurde mit einer Geldstrafe belegt und streng verwarnt.
»Ein Geistlicher hat eine besondere Pflicht zur Redlichkeit«, sagte der Richter. »Und Sie haben in diesem Punkt eklatant versagt.«
Ulf fand, der Gerechtigkeit sei Genüge getan. Viligot war grundlos angegriffen worden, weil er einem ungeliebten Teil der Gesellschaft angehörte. Von Pfarrern durfte man vielleicht mehr Toleranz als vom Durchschnittsbürger erwarten, aber vermutlich gab es unter ihnen auch solche, die vulgäre Vorurteile und Ressentiments hegten. Dennoch war es ein sonderbarer Fall, und Ulf war sich nicht völlig sicher, ob er wirklich bis zum Kern der Angelegenheit vorgedrungen war.
Das kam später – nicht einmal eine halbe Stunde nach Ende der Gerichtsverhandlung. Als Ulf den Gerichtssaal verließ, um sich in einem nahe gelegenen Café einen Cappuccino zu besorgen, kam einer der widerspenstigen Augenzeugen zu ihm, die nichts gesehen hatten: der Briefträger, der zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung vorbeigegangen war, doch in die andere Richtung gesehen hatte.
»Ulf Varg«, sagte der Briefträger, »ich hoffe, Sie sind zufrieden.«
Ulf sah den Mann warnend an. »Und was wollen Sie damit sagen?«
Doch der Briefträger ließ sich nicht einschüchtern. »Der Mann dahinten.« Er deutete mit dem Kopf verächtlich zum Gerichtsgebäude. »Dieser Danior …« Er spuckte den Namen regelrecht aus. »Wissen Sie etwas über ihn? Wissen Sie, was er tut?«
Ulf zuckte die Achseln. »Ich weiß, dass er ein Reisender, ein Rom ist, falls Sie das meinen. Aber diese Menschen haben die gleichen Rechte wie Sie und ich, ähm …«
»Johansson.«
»Nun, Johansson, das Gesetz unterscheidet da nicht.«
Johansson lächelte. »Ach, das weiß ich, Ulf. Das müssen Sie mir nicht sagen. Aber wissen Sie, was Viligot Danior getan hat? Wissen Sie, warum der Pfarrer getan hat, was er getan hat?«
Ulf musterte den Briefträger und dachte an die Sturheit der Zeugen – fünfzehn Personen. Fünfzehn! Da musste doch irgendjemand etwas gesehen haben.
»Ich dachte, Sie hätten nichts gesehen.«
»Das hat nichts damit zu tun, was ich gesehen oder nicht gesehen habe«, gab der Briefträger zurück. »Ich rede von dem, was Danior getrieben hat. Er und diese Söhne von ihm. Von denen gibt es drei. Üble Burschen, jeder Einzelne von ihnen. Von oben bis unten tätowiert.«
Ulf wartete.
»Sie stehlen Reifen«, erzählte der Briefträger. »Wir sind eine kleine Stadt da draußen, Ulf, und uns allen wurden Autoreifen gestohlen. Sie kamen bei uns in der Gegend an, und als Nächstes – Überraschung, Überraschung – verschwanden unsere Reifen. Sie montieren sie einfach ab – manchmal auch die gesamten Räder.«
»Danior macht das, sagen Sie?«
Der Briefträger nickte.
Ulf runzelte die Stirn. »Und die örtliche Polizei? Was sagt die dazu?«
Da musste der Briefträger lachen. »Denen hat man verboten, sie unter Druck zu setzen. Hat irgendwas mit der Sensibilität der Gemeinschaft zu tun. Die Polizei guckt einfach weg.«
Wie du auch, dachte Ulf. Und dennoch …
»Tja, Danior und seine Söhne haben dem Pfarrer die Räder gestohlen. Er hat einen Volvo – ein schönes Auto. Aber zwei seiner Räder wurden geklaut, dazu ein weiterer Reifen und der Reservereifen.«
Ulf seufzte. »Und woher weiß er, dass es Danior war?«
»Weil er einen von seinen Söhnen dabei gesehen hat. Er ist ihm noch hinterhergerannt, aber der Bursche ist in ein Auto gesprungen und hat sich aus dem Staub gemacht. Und als Danior ihm das nächste Mal in der Stadt über den Weg lief, hat er die Beherrschung verloren und ihm eine gelangt.« Der Briefträger hielt inne. »Das könnte jedem passieren. Sogar Ihnen, wissen Sie – nichts für ungut.«
Ulf schwieg. Er stellte sich vor, wie er sich fühlen würde, wenn jemand die Reifen seines Saab stehlen würde. Und dennoch war der Sinn eines Justizsystems, die Menschen davon abzuhalten, dass sie die Sache selbst in die Hand nahmen und über diejenigen, die ihnen unrecht getan hatten, herfielen. Genau darum ging es doch. Und dennoch …
Wieder seufzte er. Mit einem Mal war er so müde, als lasteten das gesamte Staatsgefüge und dessen Grundlagen auf ihm.
»Das tut mir leid«, sagte er. »Aber wir können nicht zulassen, dass jemand andere Menschen wegen etwas, was sie getan haben, angreift. Das geht einfach nicht.«
Der Briefträger sah zu Boden. »Manchmal frage ich mich, was aus diesem Land geworden ist.«
Ulf sah ihn an. »Das verstehe ich.«
»Ach ja?«
Ulf nickte. »Es ist nicht so einfach, wie Sie denken, Johansson. Wirklich nicht.«
Und dann war es sogar noch komplizierter geworden. Vor drei Tagen war Ulf abends nach Hause gekommen und hatte eine Nachricht von Agnes Högfors, seiner Nachbarin, gefunden. Ein großes Paket sei für ihn abgegeben worden, schrieb sie, und sie habe es angenommen. Es werde auf ihn warten, wenn er Martin abhole. Martin war Ulfs Hund, auf den Frau Högfors tagsüber aufpasste. Sie mochte ihn sehr gern und Martin sie ebenfalls.
Das Paket war unbeholfen in schlichtes braunes Papier eingeschlagen. Ulf nahm es mit in seine Wohnung, wo er einen silbernen Saab-Kühlergrill auswickelte, vom Alter und Stil her genau das, was er gesucht hatte. Sein eigener Kühlergrill war beschädigt und musste ausgetauscht werden, und hier war exakt das Ersatzteil, das er brauchte.
Es lag eine Nachricht bei. »Ulf Varg«, stand da. »Danke, dass Sie sich für mich eingesetzt haben. Sie sind ein ehrlicher Mann, Ulf, und ich dachte, das gefällt Ihnen vielleicht. Mir war aufgefallen, dass Ihr Auto einen neuen braucht. Mit Dank, Viligot.«
Es gab ein Prozedere für dergleichen, und Ulf wusste, dass er dieses Geschenk sofort zurückgeben sollte. Er wollte das auch tun und fuhr am folgenden Tag dorthin, wo er Viligot ursprünglich befragt hatte: zu einem Campingplatz außerhalb der Stadt, in der die Straftat begangen worden war. Doch von Viligot, seinen Söhnen oder sonst jemandem war nichts zu sehen.
»Die haben sich aus dem Staub gemacht, Gott sei Dank«, sagte eine Frau, als Ulf in der Stadt nachfragte. Dann fügte sie hinzu: »Die haben die meisten unserer Reifen geklaut – und noch andere Autoteile.«
Ulf spürte, wie er rot wurde. Der Saab-Kühlergrill war gestohlen – und jetzt lag er in seinem Auto auf dem Rücksitz, gut sichtbar für jeden, der vorbeiging und einen Blick durchs Fenster warf. Er dankte der Frau und fuhr nach Hause, stellte den Saab ab, nahm den Kühlergrill vom Rücksitz und brachte ihn wieder in seine Wohnung. Es war niemand zu sehen, doch er spürte, dass er durch mehr als ein Fenster beobachtet wurde. Als er den Blick hob, sah er eine Bewegung an einem der Nachbarfenster. Nun gab es mindestens einen Zeugen für seinen Umgang mit Diebesgut.
Er wusste, was er zu tun hatte. Im Handbuch für korrektes Polizeiverhalten stand ziemlich eindeutig, dass Geschenke von Personen, mit denen man beruflich Umgang hatte, an den Schenkenden zurückzugeben sind. Unter gewissen Umständen – wie beim Geschenk eines dankbaren Bürgers, der durch die Rückgabe gekränkt wäre – durfte man es behalten, doch nur mit offizieller Genehmigung aus dem Polizeipräsidium. Wenn ein Geschenk als gestohlen galt, musste es einem Vorgesetzten übergeben werden, zusammen mit einem Bericht über die Gründe für die Schlussfolgerung, dass es gestohlen war. Dies hatte innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach Erhalt des Geschenks zu geschehen. Ulf hatte auch vorgehabt, das zu tun, doch dann war es ihm entfallen.
Nun waren drei Tage vergangen, und es war zu spät dafür, es sei denn, er würde in seinem Bericht den Zeitpunkt des Erhalts fälschen. Und Ulf würde niemals absichtlich lügen, schon gar nicht in einem offiziellen Formular.
Kapitel zwei
Zur Verteidigung von Stereotypen
Von der Straße aus war das Schild mit der Aufschrift »Dein inneres Selbst: hier entlang« kaum zu sehen, doch Ulf erkannte sein Ziel von dem Foto in der Broschüre, die Dr. Svensson ihm gegeben hatte. Darin wurden die Aktivitäten des Zentrums dargestellt, auch die samstägliche Gruppenveranstaltung zum Thema »Löse deine Vergangenheit auf«, die Dr. Svensson ihm empfohlen hatte.
»Wir haben zweifelsohne Fortschritte gemacht«, hatte der Therapeut gesagt, »aber manchmal ist es hilfreich, eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen, und ›Löse deine Vergangenheit auf‹ wird von einem sehr guten Freund von mir geleitet, einem Deutschen, Hans Ebke. Er praktiziert jetzt in Stockholm, aber die Leute vom Max-Planck-Institut unten in Leipzig haben ihn sehr geschätzt. Wirklich sehr geschätzt.«
Ulf war sich nicht sicher, ob er tatsächlich nennenswerte Fortschritte gemacht hatte.
Diese Unsicherheit hinsichtlich des Nutzens der teuren Sitzungen beim Psychoanalytiker hätte Ulf vielleicht bewogen, die Therapie zu beenden, doch er empfand ein beinahe abergläubisches Widerstreben dagegen. Und es war zweifelsohne interessant, musste er zugeben, in die Tiefen des Unterbewusstseins einzutauchen – jedenfalls manchmal. Bei anderen Gelegenheiten hatte er den Eindruck, das Unterbewusstsein sei zu solcher Banalität fähig, dass man es vielleicht besser in Ruhe ließe, so wie man es auch mit anderem Plunder im Leben tat. Von diesen beunruhigenden Gedanken erzählte Ulf Dr. Svensson nichts; vielleicht würden sie zu gegebener Zeit auf der Psychoanalysecouch ans Licht gezerrt.
Ulfs Kollegin Anna hegte große Zweifel am Nutzen seiner Therapie. »Ehrlich, Ulf, ich weiß nicht, warum du das alles überhaupt machst. Du bist der ausgeglichenste, entschlossenste Mensch, den ich kenne. Und das schließt Jo und mich mit ein.«
Jo war Annas Ehemann, ein sanftmütiger und weitgehend unauffälliger Anästhesist. Dr. Svensson bezeichnete ihn als Ulfs Rivalen, doch soweit es Ulf betraf – jedenfalls soweit es sein Bewusstsein und sein Über-Ich betraf –, entbehrte diese Annahme jeder Grundlage, denn Ulf war zu dem Schluss gekommen, dass er wegen seiner Zuneigung zu Anna nie etwas unternehmen durfte. Sie war eine Kollegin und eine verheiratete Frau, und diese beiden Faktoren machten jede emotionale Verstrickung zwischen ihnen unmöglich. Wie könnte er auch nur in Erwägung ziehen, dachte er, irgendetwas zu tun, was Annas geregeltes Leben mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern, die beide vielversprechende Wettkampfschwimmerinnen waren, beeinträchtigte? Wie könnte er?
Doch nun deutete Anna hier implizit an, sie und ihr Mann seien weniger ausgeglichen und entschlossen als er. Ulf bezweifelte das: Sie hatten eine perfekte Zwei-Kind-Familie zustande gebracht; er dagegen war ein lediger Kriminalpolizist, der sich in Therapie befand und allein mit einem hörgeschädigten Hund lebte.
»Die Menschen wollen nicht, dass ihre Freunde erfolgreich sind«, hatte Dr. Svensson Ulf einmal erklärt. »Der Erfolg eines Freundes unterstreicht unsere eigenen Misserfolge. Wir wollen nicht, dass unsere Freunde mehr Geld haben als wir; und übrigens auch nicht mehr Freunde. Sehen Sie, Ulf, Neid ist tief in unserer Psyche verwurzelt.«
»Aber wenn dieser Neid so allgegenwärtig ist«, fragte Ulf, »bedeutet das dann, dass wir uns niemals über das Glück anderer freuen können?«
»Auf einer bestimmten Ebene können wir eine solche Freude empfinden«, erwiderte Dr. Svensson. »Aber sie wird immer oberflächlich bleiben. Tief im Inneren, im Innersten unseres Wesens, begrüßen wir es nicht, wenn andere Glück im Leben haben.«
Im Innersten unseres Wesens … Diese Formulierung brachte Ulf ins Grübeln. Von Zeit zu Zeit sprach Dr. Svensson von diesem Innersten unseres Wesens, erklärte jedoch nie genau, wo es seinen Sitz hatte. Allerdings bezweifelte Ulf nicht, dass es existierte. Immer wenn er es mit einem Fall von unerhörter menschlicher Grausamkeit zu tun bekam, wurde er sich des Innersten seines Wesens bewusst, denn dann krampfte sich sein Magen zusammen, und der Magen, stellte er sich vor, musste ganz in der Nähe des Innersten seines Wesens liegen, wenn er nicht sogar sein Sitz war.
Hatte das Innerste seines Wesens etwas mit seiner Haltung zu Annas Ehe zu tun? Falls er nicht wollte, dass sie in ihrer Ehe glücklich war, waren die Gründe dafür vielleicht schlicht und ergreifend Eigennutz und Berechnung, weil es für ihn selbst so am besten war. Oder war es womöglich blinder Neid – weil er selbst schon nach so kurzer Ehe wieder allein gewesen war? Ein Teil von ihm, erkannte er – sein Es –, würde ein Zerwürfnis zwischen Anna und Jo sehr begrüßen, denn dann hätte er freie Bahn und könnte sein unleugbares Begehren befriedigen, eine Affäre mit Anna zu beginnen. Das war typisch für das Es – dem Es ging es immer um animalische Befriedigung, den Sexualtrieb, Hunger, es wollte sich das Begehrte nehmen und es verzehren.
Wie viel stärker, dachte Ulf, war die Position derer, die sich den Begierden des Es verweigerten; die in ihrer Erhabenheit über dem Fleischlichen schwebten. Selbstverständlich war das illusorisch. Auch der Asket, der Heilige, der, der Verzicht übte, sie alle hatten in der Regel ihre schmutzigen Geheimnisse, ihre verborgenen Begierden, ihre Fehltritte. Das Es ließ sich nicht einfach beiseiteschieben; es verlangte Aufmerksamkeit und bekam sie normalerweise auch.
Vielleicht konnte Hans Ebke ein wenig Licht in diese Angelegenheit bringen, dachte Ulf, während er über die lange Auffahrt zum Wholeness Centre fuhr. Allerdings hatte Dr. Svensson ihn vorgewarnt, dass der Tag Gruppenarbeit beinhalte, und Ulf wusste nicht recht, ob er einer ganzen Schar fremder Menschen von seinen Gefühlen für Anna erzählen wollte. Nicht einmal Dr. Svensson, der der Schweigepflicht unterlag, wusste davon, und Menschen, die keiner solchen Pflicht unterlagen, wollte Ulf gewiss nicht davon erzählen.
Falls also das Thema Neid zur Sprache käme, was ja gut möglich war, konnte er wohl kaum zugeben, dass er davon geplagt wurde, denn dann würden die anderen Teilnehmer die naheliegende Frage stellen: Worauf bist du neidisch? Darauf konnte er wohl schlecht antworten: »Ich bin neidisch, wenn ich an meine attraktive Kollegin denke, die zwei Kinder und einen Mann hat, der ständig Leute einschlafen lässt.«
Der arme Jo mit seinen Gasen und Masken und so weiter und seiner schrecklich ernsthaften Art, die manche einschläfernd nennen mochten; bei diesem Gedanken verspürte Ulf eine gewisse Traurigkeit.
Er stellte den Saab auf dem kleinen Parkplatz neben dem Gebäude ab. Andere waren vor ihm eingetroffen, denn es standen sechs Fahrzeuge da. Ulf musterte sie, und sein kriminalistischer Verstand beschäftigte sich bereits mit der Frage, welchen der Wagen Dr. Ebke fuhr und welche den Teilnehmern gehören mochten. Dies setzte natürlich voraus, dass Dr. Ebke schon eingetroffen war – aber daran bestand kein Zweifel. Dr. Ebke war ja Deutscher, und bisher hatte Ulf noch nie einen unpünktlichen Deutschen kennengelernt. Er selbst kam zu spät – etwa eine Viertelstunde nach der Uhrzeit, die im Brief aus der Verwaltung des Wholeness Centre angegeben war. Dr. Ebke war also garantiert schon hier. Damit blieben fünf Autos, und dem besagten Brief zufolge gab es außer ihm noch vier weitere Teilnehmer. Einer der Wagen musste folglich der Person gehören, die in der Verwaltung arbeitete und Ulf seine Anmeldebestätigung geschickt hatte. In einer Anlage zum Brief waren die Namen der Teilnehmer aufgelistet, versehen mit den kurzen biografischen Angaben, um die sie alle gebeten worden waren. Man hatte sie darauf hingewiesen, dass diese Angaben allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt würden, und ihnen geraten, nichts preiszugeben, was die anderen nicht erfahren sollten. Man durfte aber ein Pseudonym verwenden, sollte jemand sich damit wohler fühlen, und als Ulf sich die Teilnehmerliste durchlas, sah er, dass drei der anderen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hatten.
Die biografischen Angaben hatte Ulf mit Interesse gelesen. Es waren zwei Frauen und zwei Männer. Die erste Frau auf der Liste hieß Henrietta. Ein Sternchen neben dem Namen wies darauf hin, dass das ein Pseudonym war.
»Ich bin Wolleinkäuferin«, hatte Henrietta angegeben. »Ich bin unverheiratet und kaufe Wolle für Textilunternehmen. Manchmal reise ich nach Australien. Ich mag Wandteppiche, Handarbeit und tanze gern Salsa.« Dann folgte ein kurzer Absatz zu ihren Gründen für die Psychotherapie. »Ich habe das Gefühl, dass ich mir das schuldig bin«, hatte sie geschrieben.
Ulf wandte sich dem zweiten Eintrag zu. Er stammte von Ebba, die wie Ulf selbst kein Pseudonym verwendete, aber ihren Nachnamen nicht angegeben hatte. »Ich heiße Ebba«, hatte sie geschrieben, »und arbeite in einer Kreativagentur. Ich schreibe Werbetexte und entwickele manchmal auch Marketingideen – wenn mir etwas einfällt! Mein Problem ist meine Unschlüssigkeit, aber ich arbeite daran. An einer Gruppentherapie nehme ich zum ersten Mal teil, und ich freue mich wirklich darauf. Oder doch nicht?«
Ulf lächelte.
Als Nächste kamen Olaf, der gestand, er sei einige Jahre lang wegen »beunruhigender Impulse« in Behandlung gewesen, und schließlich Peter, ein Pilot. Er litt unter einer milden Zwangsneurose, die er zu überwinden hoffte, bevor er eine Fortbildung begann, die ihn befähigen würde, eine neue Generation von Jets zu fliegen. Würde die Vorflugkontrolle Peter jemals zufriedenstellen, oder würde er sie endlos wiederholen müssen, bis der Tower ihn schließlich fragte, ob er noch zu starten beabsichtige?
Ulf betrachtete die parkenden Autos. Es war kein neues Modell darunter, und mit einer Ausnahme waren alle Wagen bodenständig und schlicht. Das eine Auto, das herausstach, war ein Porsche – und der hatte eindeutig schon bessere Zeiten gesehen. Ulf kam zu dem Schluss, dass er vermutlich Peter gehörte; ein Porsche passte weder zum ästhetischen Empfinden einer Wolleinkäuferin und Textilkennerin, noch war das ein Auto für einen entscheidungsschwachen Menschen. Ebba fuhr sicher den langsamsten Wagen, dachte Ulf, denn so blieb ihr genügend Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie links oder rechts abbiegen sollte – eine solche Bedenkzeit gewährte ein Porsche einem nicht. Das bedeutete, dass der kleine untermotorisierte Fiat, der früher unter dem liebevollen Spitznamen Bambino bekannt gewesen war, Ebba gehören musste.
Neben dem Porsche gab es ein weiteres deutsches Auto, einen Mercedes-Benz, und Ulf kam zu dem Schluss, dass er Dr. Ebke gehörte. Unter Druck gesetzt, würde er einräumen, dass man das denkfaul finden konnte, da seine Annahme auf Stereotypen beruhte, doch er hatte das schon so oft erlebt, und sollte man etwa das Ergebnis empirischer Beobachtung auf dem Altar der Unvoreingenommenheit opfern? Deutsche mochten deutsche Autos. So war es nun einmal. Und sie setzten ihrerseits empirische Beobachtung ein, um etwas zu rechtfertigen, was in den Augen anderer nichts als oberflächliche, nationalistische Bevorzugung sein mochte. Deutsche Autos waren gut, damit konnte man nichts falsch machen. Die Deutschen wussten das und wählten ihre Autos dementsprechend aus.
Somit müsste der Mittelklasse-Mercedes-Benz, der vom Eingang aus auf dem zweiten Parkplatz stand, Dr. Ebkes sein, während der Wagen, der direkt neben dem Eingang stand, der Verwaltungsangestellten gehörte, die natürlich als Erste eingetroffen war, um das Gebäude aufzuschließen. Damit blieben zwei Autos, von denen eines hinten dunkel getönte Scheiben hatte. Dieser Wagen gehörte jemandem, der etwas zu verbergen hatte, und wurde folglich von Olaf gefahren, der beunruhigende Impulse hatte. Die Scham konnte einem die Wahl des Autos anscheinend ebenso diktieren wie der Stolz. Das letzte Fahrzeug konnte nunmehr Henrietta zugeschrieben werden. Es war ein spanisches Modell, ein Seat … Salsa-Tanz, dachte Ulf, was sein Urteil bestätigte.
Er fand die übrigen Teilnehmer im Sitzungsraum bei einem Kaffee um Dr. Ebke versammelt.
»Ein Kaffee vorab«, sagte Dr. Ebke und schüttelte Ulf die Hand. »Ich dachte, wir lernen uns vor unserer ersten Sitzung schon mal ein bisschen kennen.« Er hielt inne. »Ihre biografischen Angaben waren übrigens sehr knapp. Das ist natürlich in Ordnung, aber finden Sie nicht auch, dass sie ziemlich knapp waren?«
»Man will sich ja nicht aufdrängen«, entgegnete Ulf.
»Nein, natürlich nicht«, sagte Dr. Ebke hastig. »Aber Sie haben uns nicht gesagt, was Sie machen.«
»Ist das denn notwendig?«, fragte Ulf.
Dr. Ebke trank einen Schluck Kaffee und sah Ulf durchdringend an. »Unsere Arbeit definiert uns, meinen Sie nicht?«
Ulf zuckte die Achseln. »Wenn wir uns unsere Arbeit aussuchen, ja. Aber viele Menschen machen etwas, was sie sich nicht ausgesucht haben, meinen Sie nicht? Viele Menschen rutschen in ihren Beruf, weil … nun, durch Zufall oder sogar durch ein Erbe, nicht wahr? Bei Bauern ist das so, glaube ich. Bauern sind Bauern, weil ihre Eltern auch Bauern waren.«
Dr. Ebke lachte. »Ich sehe schon, bei Ihnen muss ich auf Zack sein. Aber sagen Sie, was machen Sie denn nun?«
Ulf antwortete nicht sofort. An Dr. Ebkes Verhalten war etwas, was ihn reizte. Und welches Recht hatte er auf Informationen, die Ulf vielleicht nicht mitteilen wollte?
»Ich bin Ingenieur.« Er hatte keine Ahnung, warum er das gesagt hatte, es sei denn, um seine Privatsphäre zu schützen. Das war natürlich kindisch von ihm, aber nun, da es gesagt war, konnte er sich ja schlecht berichtigen.
Doch das war gar nicht nötig. »Ingenieur?«, wiederholte Dr. Ebke. »Wie eigenartig. Ich dachte, Sie wären Kriminalpolizist.«
Ulf starrte den Therapeuten an. »Und warum haben Sie dann überhaupt gefragt? Wenn Sie es bereits wussten, warum haben Sie mich danach gefragt?«
Diese direkte Frage schien Dr. Ebke aus dem Konzept zu bringen. Unvermittelt sah er ostentativ auf die Uhr.
»Du meine Güte. Schon so spät. Wir sollten anfangen.« Er stand auf. »Später haben wir noch genug Zeit, um uns zu unterhalten, Ulf.«
Ulf beobachtete, wie Dr. Ebke die Teilnehmer zusammenrief. Am Fenster stand eine Gruppe von Sesseln zu einem Kreis angeordnet. Dorthin setzten sie sich und wurden einander von Dr. Ebke förmlich vorgestellt.
»Ulf wird uns gewiss später mehr über sich erzählen«, sagte Dr. Ebke, als er zu Ulf kam. Dabei warf der Therapeut ihm einen Seitenblick zu, und Ulf sah weg. Er hatte beschlossen, Dr. Ebke nicht zu mögen, doch aus Respekt für Dr. Svensson würde er bis zum Ende durchhalten. Es war ein vergeudeter Samstag, dachte er, aber was andererseits hätte er sonst getan? Da gab es wirklich nicht viel – vielleicht ein längerer Spaziergang mit Martin oder ein Besuch bei seiner Cousine, die gerade ihr zweites Kind bekommen hatte und es ihm gern zeigen würde, weil sie es nach ihm benannt hatte.
»Ulf ist ein so schöner Name«, hatte die Cousine gesagt. »Sowohl Otto als auch ich fanden ihn perfekt.«
Er würde ein Geschenk für den kleinen Ulf aussuchen müssen. Was schenkte man einem Baby? Etwas aus Silber, dachte er, mit einer Inschrift: »Für Ulf von Ulf«, mit Datum. Wohlgemerkt, Silber war teuer – und er hatte gerade erst diese teure Sitzgarnitur gekauft. Also würde der kleine Ulf vielleicht eher etwas aus Zinn bekommen – ein Baby merkte so etwas schließlich nicht. Auch die Kosten der Gravur konnte man senken, wenn man »Für U von U« oder sogar nur »U« nahm.
Olaf sagte: »Ich würde Ihnen gern etwas erzählen, worüber ich noch nie gesprochen habe – mit niemandem.«
Dr. Ebke nickte ermutigend. »Nun, Olaf, deswegen sind wir ja hier. Der Sinn einer Gruppentherapie ist es, die Bürde mit anderen zu teilen. So nennen wir das: die Bürde mit anderen teilen.«
Henrietta sagte: »Ja. Ja. Ich habe schon immer geglaubt, dass eine Bürde leichter wird, wenn man sie mit anderen teilt. Wirklich. Jedenfalls nach meiner Erfahrung.«
Das schien Dr. Ebke zu freuen. »Henrietta hat ganz recht, wissen Sie. Alles wird leichter, wenn andere Menschen einem tragen helfen. Das gilt für alles – ein Paket, einen Rucksack … alles.«
Ulf runzelte die Stirn. Wie sollte denn ein Rucksack von mehr als einer Person getragen werden? Es war doch der Witz am Rucksack, dass man ihn sich auf den Rücken schnallte. So waren Rucksäcke nun einmal konstruiert. Kaum vorstellbar, dass unter die Riemen eines Rucksacks zwei Personen passten. Sie müssten mit dem Rücken zueinander stehen, die Arme irgendwie durch die Riemen gezwängt, und der Rucksack würde zwischen ihnen hängen.
Olaf fuhr fort: »Ich weiß, ich sollte das, was ich zu sagen habe, schnell sagen – ich meine, jetzt, nicht später.«
Henrietta beugte sich vor. »Ja, Olaf. Ich möchte es hören. Ich möchte es wirklich hören.«
Besorgt sah Olaf sie an. »Warum denn? Warum bist du so darauf erpicht?«
Henrietta sah ihn gekränkt an. »Weil wir dir helfen wollen«, erklärte sie. »Deshalb sind wir doch hier – um dir bei diesen unangemessenen Impulsen zu helfen.«
Olaf wandte sich an Dr. Ebke. »Unangemessen? Wer hat denn was von unangemessen gesagt?«
Obwohl die Frage an Dr. Ebke gerichtet war, antwortete Henrietta. »Du selbst, Olaf. Du hast uns in deiner Kurzbiografie davon erzählt.«
»Das stimmt nicht«, widersprach Olaf. »Ich habe ›beunruhigend‹ geschrieben. ›Beunruhigende Gedanken‹, das habe ich geschrieben.«
»Nein, hast du nicht«, mischte Peter sich ein. »Schau, hier steht es.« Er zog den Brief der Institutsverwaltung aus der Tasche und faltete ihn auseinander. »Doch, da steht ›beunruhigende Impulse‹. Siehst du? Impulse, nicht Gedanken.«
Dr. Ebke hob die Hand. »Ich denke, wir sollten nicht in diesem vorwurfsvollen Ton miteinander reden, keiner von uns. Wichtig ist das, was Olaf hier sagt – in unserer Gegenwart.«
»Ich würde gern wissen, was der Unterschied zwischen einem Impuls und einem Gedanken ist«, warf Peter ein. »Gibt es einen, was meinen Sie?«
»Eigentlich geht es doch um …«, setzte Olaf an.
Aber Peter fiel ihm ins Wort. »Ich habe Dr. Ebke gefragt, nicht dich.«
Olaf wirkte verletzt. »Du brauchst nicht in diesem Ton mit mir zu reden. Es geht doch hier um meine Gedanken.«
»Deine Impulse«, berichtigte Henrietta.
Ulf beobachtete die Szene. Sein Blick ruhte auf Olaf, und er fragte sich, ob er ihm schon einmal begegnet war – beruflich. Das wäre heikel, dachte er, wenn einer dieser Menschen von einer kriminellen Handlung erzählte. Musste er dann aktiv werden? Musste er dann seinen Dienstausweis zücken und sagen: »Genug Gruppentherapie – du bist verhaftet«?
Er bemühte sich, Olaf nicht zu auffällig anzustarren, doch je länger er ihn musterte, desto mehr verstärkte sich sein Verdacht, dass es in diesem Gespräch eher um Impulse denn um Gedanken gehen würde – und dass es möglicherweise kein einfaches Gespräch sein würde.
Doch da stand Olaf auf. »Ich gehe, Dr. Ebke. Tut mir leid, aber ich breche das ab.«
»Du bist gerade impulsiv«, sagte Peter und lachte. Dies trug ihm einen tadelnden Blick von Dr. Ebke ein.
»Es besteht keine Veranlassung, sich darüber lustig zu machen«, sagte der Therapeut. »Und wir dürfen einander nicht auslachen. Das ist sehr, sehr ernst.«
Ulf versuchte, sich das Lachen zu verkneifen. Er zog sein Taschentuch hervor und putzte sich die Nase. Das half.