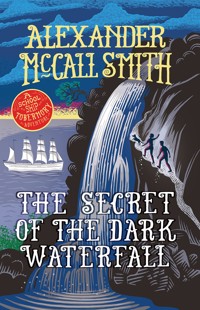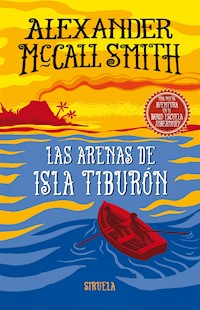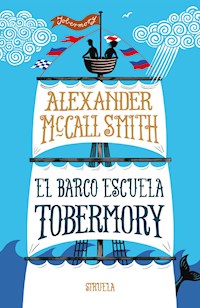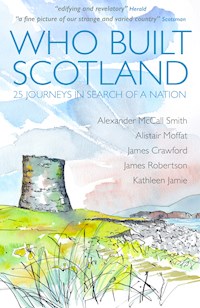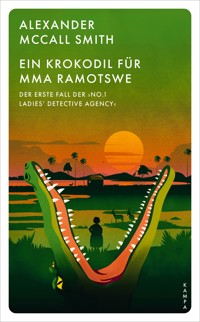
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mma Ramotswe hat ein großes Herz und einen ebensolchen Körperumfang. Und sie ist mindestens so einzigartig wie ihr Beruf: In Afrika, am Rande der Kalahari, betreibt sie die einzige Detektivagentur Botswanas. Wenn sie nicht gerade unter einem Akazien baum sitzt oder ihr Mann Schützlinge aus dem Pflegeheim zu Hause anschleppt, spürt sie verschwundenen Kindern oder vermissten Ehemännern nach – bis sie auf der Suche nach einem Kind selbst in Gefahr gerät. Diese Detektivin beherrscht keine Kampfsportart und trägt keine Waffe bei sich;Mma Ramotswe löst ihre Fälle mit ihrer großen Lebenserfahrung und Menschenkenntnis – und manchmal mit einem Blick in ihr Handbuch für private Ermittlungen. Dabei erweist sie sich als sympathische Führerin durch die Landschaft und den Alltag ihres Landes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander McCall Smith
Ein Krokodil für Mma Ramotswe
Der erste Fall der ›No. 1 Ladies’ Detective Agency‹
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Gerda Bean
Kampa
Dieses Buch ist für
Anne Gordon-Gillies
in Schottland
und für
Joe und Mimi McKnight
in Dallas, Texas.
1
Mma Ramotswe betrieb in Afrika eine Privatdetektei, am Fuß des Kgale Hill. Das Inventar bestand aus: einem kleinen weißen Lieferwagen, zwei Schreibtischen, zwei Stühlen, einem Telefon und einer alten Schreibmaschine. Dann gab es einen Teekessel, in der Mma Ramotswe – die einzige Privatdetektivin in Botswana – Rotbuschtee zubereitete. Und drei Tassen – eine für sie selbst, eine für ihre Sekretärin und eine für ihre Kundschaft. Was brauchte eine Privatdetektei mehr? Privatdetekteien leben von menschlicher Intuition und Intelligenz, Eigenschaften, über die Mma Ramotswe reichlich verfügte. Natürlich tauchten diese Eigenschaften auf keiner Inventarliste auf.
Da war auch noch der Blick, der ebenfalls auf keiner Inventarliste auftauchen konnte. Wie könnte eine solche Liste auch nur halbwegs anschaulich beschreiben, was man sah, wenn man aus Mma Ramotswes Tür hinausschaute? Ganz vorne, eine Akazie, der Dornenbaum, der die weiten Flächen der Kalahari bevölkert. Seine weißen Dornen sind eine einzige Warnung, gemildert von dem zarten olivgrauen Laub. In seinen Zweigen kann man am Spätnachmittag oder in der kühlen Frische des frühen Morgens einen Go-Away-Vogel sehen – oder besser gesagt, hören. Und hinter der Akazie, auf der anderen Seite der staubigen Straße, teilweise verborgen unter einem Baldachin aus Baumkronen und hohem Buschwerk, die Dächer der Stadt. Schließlich am Horizont, im blauen Hitzeflimmern, die Berge wie phantastische, überwachsene Termitenhügel.
Alle nannten sie Mma Ramotswe, obwohl die Leute, wenn sie besonders höflich sein wollten, sie auch mit Mme. Mma Ramotswe anreden konnten. So gehört es sich für eine Persönlichkeit von Format, aber sie hatte nie darauf bestanden. Daher hieß es immer Mma Ramotswe anstatt Precious Ramotswe, ein Name, den nur sehr wenige benutzten.
Sie war eine gute Detektivin und eine gute Frau. Eine gute Frau in einem guten Land, könnte man sagen. Sie liebte ihr Land, Botswana, als einen Ort des Friedens, und sie liebte Afrika, trotz all seiner Plagen. Ich schäme mich nicht, als afrikanische Patriotin betrachtet zu werden, sagte Mma Ramotswe. Ich liebe alle von Gott geschaffenen Menschen, aber ich liebe ganz besonders die Menschen, die hier leben. Sie sind mein Volk, meine Brüder und Schwestern. Es ist meine Pflicht, ihnen zu helfen, die Probleme und Rätsel in ihrem Leben zu lösen. Dazu und zu nichts anderem fühle ich mich berufen.
In stillen Momenten, wenn es nichts Dringendes zu erledigen gab und wenn jedermann von der Hitze schläfrig war, setzte sie sich unter die Akazie. Es war ein staubiger Sitzplatz, und gelegentlich erschienen dort ein paar Hühner und pickten um ihre Füße herum, aber es war ein Platz, der einen dazu brachte nachzudenken. Hier war es, wo Mma Ramotswe sich einige von den Dingen durch den Kopf gehen ließ, die im alltäglichen Einerlei sehr leicht übersehen oder beiseitegeschoben werden.
Alles, so dachte Mma Ramotswe, war irgendwann etwas anderes gewesen. Hier bin ich, die einzige Privatdetektivin in ganz Botswana, und sitze vor meiner eigenen Privatdetektei. Aber es ist nur wenige Jahre her, da gab es noch keine Privatdetektei, und davor gab es hier noch nicht einmal irgendwelche Gebäude, hier standen nur Akazien, und ein Stück entfernt war das Flussbett und dahinter die Kalahari, und alles ganz nahe.
Damals gab es noch nicht einmal ein Botswana, nur das Protektorat Betschwanaland, und davor war das Ganze Khamas Land, und da waren nur Löwen, deren Mähnen im trockenen Wind flatterten. Aber sieh es dir jetzt mal an: eine Privatdetektei, hier in Gaborone, und ich, die dicke Detektivin, sitze draußen davor und denke darüber nach, dass alles, was heute etwas ist, schon morgen etwas ganz anderes sein kann.
Mma Ramotswe gründete die No. 1 Ladies’ Detective Agency mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Rinder ihres Vaters. Er hatte eine große Herde besessen und außer seiner Tochter Precious keine anderen Kinder gehabt. So ging jedes einzelne Tier, alle hundertachtzig Stück, an sie, inklusive der weißen Brahmabullen, deren Großeltern er selbst gezüchtet hatte. Die Rinder wurden vom Viehgehege zurück nach Mochudi getrieben, wo sie im ewigen Staub unter den wachsamen Augen der ständig schwatzenden Hirtenjungen warteten, bis der Viehhändler erschien.
Die Tiere erzielten einen guten Preis, da es in jenem Jahr starke Regenfälle gegeben hatte und das Gras üppig und saftig gewesen war. Wäre es das Jahr vorher gewesen, als große Teile des südlichen Afrikas von einer Dürre heimgesucht worden waren, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Damals hatten die Leute gezögert. Sie hatten ihr Vieh behalten wollen, da man ohne Vieh praktisch nackt war. Andere, die verzweifelter waren, hatten schon verkauft, weil der Regen ein ums andere Jahr ausgeblieben war, und sie hatten mitansehen müssen, wie das Vieh immer mehr abmagerte. Mma Ramotswe freute sich, dass die Krankheit ihres Vaters ihn davon abgehalten hatte, irgendeine Entscheidung zu treffen, da der Preis jetzt in die Höhe gegangen war und all jene, die durchgehalten hatten, reich belohnt wurden.
»Ich möchte, dass du dein eigenes Geschäft hast«, sagte er auf seinem Totenbett zu ihr. »Du kriegst für das Vieh jetzt einen guten Preis. Verkauf die Tiere und kauf ein Geschäft. Eine Metzgerei. Oder einen Getränkeladen. Was du willst.«
Sie ergriff die Hand ihres Vaters und blickte in die Augen des Mannes, den sie mehr liebte als jeden anderen, ihren Daddy, ihren weisen Daddy, dessen Lungen voll waren mit dem Staub aus den Minen und der eisern gespart hatte, um ihr zu einem schönen Leben zu verhelfen.
Sie hatte Tränen in den Augen, und ihre Kehle war wie zugeschnürt, aber sie brachte dann doch heraus: »Ich gründe eine Privatdetektei. Unten in Gaborone. Es wird die beste in ganz Botswana sein. Die No. 1 Detective Agency.«
Für einen kurzen Moment weiteten sich die Augen ihres Vaters, und es schien, als wollte er etwas sagen.
»Aber … aber …«
Doch er starb, ehe er weiterreden konnte, und Mma Ramotswe warf sich auf ihn und weinte um all die Würde und Liebe und all das Leiden, das mit ihm gestorben war.
Sie hatte ein Schild in hellen Farben malen lassen, das dann an der Lobatse Road, am Stadtrand, aufgestellt wurde und auf das kleine Haus hinwies, das sie gekauft hatte:
DIENO. 1LADIES’DETECTIVEAGENCYFÜRALLEVERTRAULICHENANGELEGENHEITENUNDERMITTLUNGEN. PROMPTEERLEDIGUNGUNDABSOLUTEDISKRETIONGARANTIERT.
Die Eröffnung war von erheblichem öffentlichem Interesse gewesen. Radio Botswana brachte ein Interview, in dem sie höchst unhöflich dazu gedrängt wurde, ihre Qualifikationen offenzulegen; die Botswana News brachten einen wesentlich befriedigenderen Artikel, der auf die Tatsache verwies, dass sie die einzige Privatdetektivin des Landes war. Dieser Artikel wurde ausgeschnitten, kopiert und gut sichtbar an einem kleinen Brett neben dem Eingang der Detektei befestigt.
Nach einem langsamen Anfang stellte Mma Ramotswe mit Überraschung fest, dass ihre Dienste äußerst begehrt waren. Sie wurde über verschollene Ehemänner befragt, über die Kreditwürdigkeit potenzieller Geschäftspartner und über Mitarbeiter, die im Verdacht standen, Betrügereien begangen zu haben. In beinahe jedem Fall konnte sie ihrem Kunden zumindest einige Auskünfte geben. War dies nicht der Fall, verzichtete sie auf ihr Honorar, was bedeutete, dass praktisch niemand, der sie zurate zog, unzufrieden war. Die Menschen in Botswana redeten gern, stellte sie fest, und die reine Erwähnung der Tatsache, dass sie Privatdetektivin war, löste einen wahren Wortschwall über alle möglichen Themen aus. Es schmeichelte offensichtlich den Leuten, von einer Privatdetektivin angesprochen zu werden, das lockerte ihre Zungen. Auch Happy Bapetsi, eine ihrer ersten Kundinnen, hatte keine Scheu, mit ihr zu reden. Die arme Happy! Ihren Daddy verloren zu haben und ihn dann zu finden und wieder zu verlieren …
»Ich hatte mal ein glückliches Leben«, sagte Happy Bapetsi. »Ein sehr glückliches Leben. Dann passierte diese Sache, und jetzt kann ich das nicht mehr behaupten.«
Mma Ramotswe beobachtete ihre Kundin, während sie den angebotenen Rotbuschtee schlürfte. Alles, was man über einen Menschen wissen wollte, stand in seinem Gesicht geschrieben. Nicht, dass sie meinte, die Kopfform zähle – auch wenn es noch viele gab, die an diesem Glauben festhielten –, es ging eher darum, die Linien und den Ausdruck genauestens zu studieren. Und die Augen natürlich; sie waren sehr wichtig. Die Augen erlaubten es einem, tief in das Innere eines Menschen zu blicken, seinen Kern zu durchdringen. Deshalb trugen Leute, die etwas zu verbergen hatten, auch drinnen Sonnenbrillen. Sie musste man sehr genau beobachten.
Nun, diese Happy Bapetsi war intelligent. Das war gleich zu sehen. Sie hatte außerdem wenig Sorgen – das war daran zu erkennen, dass sich, außer ein paar Lachfältchen natürlich, keine Falten in ihrem Gesicht zeigten. Also Probleme mit Männern, dachte Mma Ramotswe. Irgendein Mann ist aufgetaucht und hat ihr alles verdorben, ihr Glück mit seinem schlechten Benehmen zerstört.
»Lassen Sie mich erst einmal von mir erzählen«, sagte Happy Bapetsi. »Ich komme aus Maun, wissen Sie, oben am Okavango. Meine Mutter hatte einen kleinen Laden, und ich lebte mit ihr auf der Rückseite des Hauses. Wir hatten viele Hühner und waren sehr glücklich.
Meine Mutter sagte, dass mein Daddy sie vor langer Zeit, als ich noch ein kleines Baby war, verlassen hätte. Er sei zum Arbeiten nach Bulawayo gegangen und nie zurückgekehrt. Jemand hatte uns geschrieben – ein anderer Motswana, der dort lebte –, er glaube, mein Daddy sei tot. Er war sich aber nicht sicher. Er sagte, er hätte eines Tages jemand im Mpilo-Hospital besucht, und als er den Korridor entlangging, sah er, wie sie einen auf einem Krankenhausbett hinausrollten, und der Tote auf dem Bett hätte meinem Daddy erstaunlich ähnlich gesehen. Sicher war er sich aber nicht.
Wir dachten nun, dass er wahrscheinlich gestorben war, aber meiner Mutter machte es nicht allzu viel aus, weil sie ihn nie sonderlich gemocht hatte. Und ich konnte mich natürlich gar nicht an ihn erinnern. Deshalb war es mir ziemlich egal.
Ich ging in Maun in eine Schule, die von katholischen Missionaren geleitet wurde. Einer entdeckte, dass ich gut rechnen konnte, und verbrachte viel Zeit mit mir, um mir weiterzuhelfen. Er sagte, er hätte noch nie ein Mädchen gesehen, das so gut zählen kann.
Es war wirklich seltsam. Ich konnte eine Gruppe von Zahlen sehen und sie mir einfach merken. Dann stellte ich fest, dass ich die Zahlen, ohne darüber nachzudenken, im Kopf addiert hatte. Es war ganz leicht – ich musste überhaupt nicht üben.
Bei den Prüfungen schnitt ich sehr gut ab, und ich ging schließlich nach Gaborone und lernte Buchhalterin. Wieder war es sehr einfach für mich. Ich konnte ein ganzes Blatt mit Zahlen anschauen und verstand alles sofort. Am nächsten Tag konnte ich mich an jede Zahl genau erinnern und alle aufschreiben, wenn es sein musste.
Ich fand Arbeit bei der Bank und bekam eine Beförderung nach der anderen. Jetzt bin ich die erste Hilfsbuchhalterin, und ich glaube nicht, dass ich noch weiterkommen kann, weil alle Männer Angst haben, dass sie neben mir dumm aussehen. Aber es macht mir nichts aus. Ich werde sehr gut bezahlt und bin um drei Uhr nachmittags mit der Arbeit fertig, manchmal sogar früher. Danach gehe ich einkaufen. Ich habe ein schönes Haus mit vier Zimmern und bin sehr glücklich. Das alles mit achtunddreißig erreicht zu haben ist gut genug, finde ich.«
Mma Ramotswe lächelte. »Das ist alles sehr interessant. Sie haben recht, Sie sind tüchtig gewesen.«
»Ich habe viel Glück«, sagte Happy Bapetsi. »Aber dann ist diese Sache passiert. Mein Daddy tauchte bei mir auf.«
Mma Ramotswe hielt die Luft an. Das hatte sie nicht erwartet. Sie hatte gedacht, das Problem hätte mit einem Freund zu tun. Väter waren eine ganz andere Sache.
»Er klopfte einfach an die Tür«, sagte Happy Bapetsi. »Es war ein Samstagnachmittag, und ich ruhte mich auf meinem Bett aus, als ich ihn klopfen hörte. Ich stand auf, ging zur Tür, und da stand dieser Mann von ungefähr sechzig, stand da mit dem Hut in der Hand. Er sagte, er wäre mein Daddy und dass er lange in Bulawayo gelebt hätte, jetzt aber wieder in Botswana, und dass er gekommen sei, um mich zu sehen.
Sie verstehen sicher, wie erschrocken ich war. Ich musste mich setzen, sonst wäre ich bestimmt in Ohnmacht gefallen. Die ganze Zeit über redete er. Er nannte mir den Namen meiner Mutter, und er sagte, es täte ihm leid, dass er sich nicht früher gemeldet hätte. Dann fragte er, ob er in einem der überzähligen Zimmer schlafen könne, da er nicht wisse, wo er sonst hingehen solle.
Ich sagte, natürlich könne er das. In gewisser Weise war ich aufgeregt, meinen Daddy zu sehen, und ich dachte, es wäre gut, all die verlorenen Jahre nachholen zu können und ihn bei mir zu haben, besonders da meine arme Mutter gestorben war. Also machte ich ihm in einem der Räume ein Bett und kochte ihm eine große Mahlzeit aus Steak und Kartoffeln, die er schnell vertilgte. Dann verlangte er nach mehr.
Das war vor ungefähr drei Monaten. Seitdem lebt er in dem Zimmer, und ich habe eine Menge Arbeit mit ihm. Ich mache ihm Frühstück, koche ihm sein Mittagessen, das ich für ihn in der Küche lasse, und abends ist dann sein Abendessen fällig. Ich kaufe ihm eine Flasche Bier pro Tag und habe ihm auch neue Sachen zum Anziehen und ein gutes Paar Schuhe gekauft. Er dagegen sitzt nur auf seinem Stuhl vor der Haustür und sagt mir, was ich als Nächstes für ihn tun soll.«
»Viele Männer sind so«, warf Mma Ramotswe ein.
Happy Bapetsi nickte. »Dieser ganz besonders. Seit er angekommen ist, hat er nicht einen einzigen Kochtopf abgewaschen, und ich bin es leid geworden, mich für ihn abzustrampeln. Außerdem gibt er viel Geld für Vitaminpillen und Biltongue aus.
Ich würde mich damit abfinden, wissen Sie, wenn da nicht noch etwas wäre: Ich glaube nicht, dass er mein richtiger Daddy ist. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass dieser Mann ein Betrüger ist und dass er von meinem richtigen Daddy vor seinem Tod noch etwas über unsere Familie erfahren hat und mir jetzt was vormacht. Ich glaube, das ist ein Mann, der sich nach einem Altersheim umgesehen hat und sich freut, dass er ein gutes gefunden hat.«
Mma Ramotswe ertappte sich dabei, dass sie Happy Bapetsi mit aufrichtiger Verwunderung anstarrte. Sie sagte zweifellos die Wahrheit. Was sie in Erstaunen versetzte, war die Frechheit, die schiere, unverhohlene Frechheit der Männer. Wie konnte dieser Mensch es wagen, diese hilfsbereite, freundliche Person so auszunutzen! Was für eine Schikane, was für ein Betrug! Es war Diebstahl, regelrechter Diebstahl!
»Können Sie mir helfen?«, fragte Happy Bapetsi. »Können Sie herausfinden, ob dieser Mann wirklich mein Daddy ist? Wenn ja, will ich eine pflichtbewusste Tochter sein und mich damit abfinden. Wenn er es nicht ist, möchte ich, dass er woandershin geht.«
Mma Ramotswe zögerte nicht. »Ich werde es rausfinden«, sagte sie. »Es kann ein oder zwei Tage dauern, aber ich finde es raus!« Natürlich war dies leichter gesagt als getan. Es gab heute zwar Bluttests, aber sie bezweifelte sehr, dass der Mann damit einverstanden wäre. Nein, ihr müsste etwas Raffinierteres einfallen, etwas, das hieb- und stichfest nachwies, ob er der Daddy war oder nicht. Sie unterbrach ihren Gedankenflug. Ja! Es war etwas Biblisches an dieser Geschichte. Was, dachte sie, hätte Salomon gemacht?
Mma Ramotswe holte die Schwesternuniform von ihrer Freundin ab. Sie war ein bisschen eng, vor allem um die Arme herum, da Schwester Gogwe zwar großzügig proportioniert, aber doch ein klein wenig schlanker als Mma Ramotswe war. Aber als sie dann in der Uniform steckte und die Uhr der Krankenschwester an ihrer Brust befestigt hatte, war sie das vollkommene Abbild einer Pflegerin vom Princess Marina Hospital. Es war eine gute Tarnung, fand sie und notierte sich in Gedanken, sie auch in Zukunft wieder einmal zu benutzen.
Während sie mit ihrem winzigen weißen Lieferwagen zu Happy Bapetsi fuhr, dachte sie darüber nach, wie die afrikanische Tradition, alle Verwandten zu unterstützen, die Menschen schwer belasten konnte. Sie wusste von einem Mann, einem Polizeiwachtmeister, der einen Onkel, zwei Tanten und eine Cousine zweiten Grades unterstützte. Wenn man die alte Setswana-Moral hochhielt, konnte man keinen Verwandten wegschicken, und das hatte viel Gutes für sich. Aber es bedeutete auch, dass Scharlatane und Schmarotzer es hier viel leichter hatten als anderswo. Solche Leute waren es, dachte sie, die das System ruinierten. Sie sind es, die den alten Gebräuchen einen schlechten Namen geben.
Als sie sich dem Hause näherte, trat sie aufs Gaspedal. Dies war schließlich ein Akt der Barmherzigkeit, und wenn der Daddy auf seinem Stuhl vor dem Eingang saß, müsste er sie in einer Staubwolke heranbrausen sehen. Der Daddy war natürlich da und genoss die Morgensonne, und als er den winzigen weißen Lieferwagen vor dem Tor einschwenken sah, setzte er sich gerade auf. Mma Ramotswe stellte den Motor ab, sprang aus dem Auto und lief zum Haus.
»Dumela Rra, guten Tag, mein Herr«, grüßte sie ihn hastig. »Sind Sie Happy Bapetsis Daddy?«
Der Daddy erhob sich. »Ja«, sagte er stolz. »Ich bin der Daddy.«
Mma Ramotswe japste, als versuchte sie, wieder zu Atem zu kommen.
»Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es einen Unfall gegeben hat. Happy wurde überfahren. Sie liegt im Krankenhaus, und es geht ihr sehr schlecht. Gerade eben wird sie operiert.«
Der Daddy heulte auf. »Aiee! Meine Tochter! Mein kleines Baby Happy!«
Ein guter Schauspieler, dachte Mma Ramotswe, es sei denn … Nein, sie vertraute lieber Happy Bapetsis Instinkt. Ein Mädchen würde seinen eigenen Daddy wiedererkennen, auch wenn es ihn seit seiner Babyzeit nicht mehr gesehen hat.
»Ja«, fuhr sie fort. »Es ist sehr traurig. Sie ist sehr krank, sehr krank. Und sie brauchen eine Menge Blut, um all das Blut, das sie verloren hat, zu ersetzen.«
Der Daddy runzelte die Stirn. »Sie müssen ihr das Blut geben. Eine Menge Blut. Ich kann es bezahlen.«
»Es geht nicht um Geld«, sagte Mma Ramotswe. »Blut kostet nichts. Wir haben nicht die richtige Sorte. Wir brauchen welches von ihrer Familie, und Sie sind der Einzige, den sie hat. Wir müssen Sie um Blut bitten.«
Der Daddy setzte sich schwerfällig.
»Ich bin ein alter Mann«, sagte er.
Mma Ramotswe spürte, dass es funktionieren würde. Ja, dieser Mann war ein Schwindler.
»Deshalb fragen wir Sie ja«, sagte sie. »Weil sie so viel Blut braucht, müssen sie ungefähr die Hälfte von Ihrem Blut nehmen. Und das ist sehr gefährlich für Sie. Sie könnten sogar sterben.«
Der Mund des Daddys klappte auf.
»Sterben?«
»Ja«, sagte Mma Ramotswe. »Aber Sie sind schließlich ihr Vater, und wir wissen, dass Sie das für Ihre Tochter tun werden. Kommen Sie also schnell mit, bevor es zu spät ist. Doktor Moghile wartet schon.«
Der Daddy öffnete wieder den Mund und machte ihn zu.
»Los, kommen Sie«, sagte Mma Ramotswe und packte ihn am Handgelenk. »Ich helfe Ihnen zum Wagen.«
Der Daddy stand auf und versuchte sich dann wieder zu setzen. Mma Ramotswe zerrte an ihm.
»Nein«, sagte er. »Ich will nicht.«
»Sie müssen«, sagte Mma Ramotswe. »Nun kommen Sie schon!«
Der Daddy schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er leise. »Das werde ich nicht. Wissen Sie, ich bin nicht wirklich ihr Daddy. Es ist eine Verwechslung.«
Mma Ramotswe ließ sein Handgelenk los. Dann baute sie sich mit verschränkten Armen vor ihm auf und sagte ihm ins Gesicht: »Sie sind also nicht der Daddy! Ich verstehe! Ich verstehe! Wieso sitzen Sie dann auf diesem Stuhl und essen ihr Essen? Haben Sie schon mal was vom Strafgesetzbuch von Botswana gehört und was es über Leute wie Sie sagt? Ja?«
Der Daddy blickte zu Boden und schüttelte den Kopf.
»Na schön«, sagte Mma Ramotswe. »Gehen Sie ins Haus und holen Sie Ihre Sachen. Ich gebe Ihnen fünf Minuten. Dann fahre ich Sie zur Busstation, und Sie steigen in einen Bus. Wo sind Sie wirklich zu Hause?«
»Lobatse«, sagte der Daddy. »Aber es gefällt mir da unten nicht.«
»Gut«, sagte Mma Ramotswe. »Wenn Sie anfangen, etwas Richtiges zu tun, statt nur auf einem Stuhl zu sitzen, gefällt es Ihnen vielleicht besser. Da unten gibt’s viele Melonen, die man anbauen kann. Wie wäre es damit?«
Der Daddy sah todunglücklich aus.
»Rein!«, befahl sie. »Noch vier Minuten!«
Als Happy Bapetsi nach Hause kam, war der Daddy fort und sein Zimmer leer. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel von Mma Ramotswe. Als sie ihn las, kehrte ihr Lächeln zurück.
»Er war doch nicht Ihr Daddy. Ich habe es auf die beste Art herausgefunden: Er hat es mir selbst gesagt. Vielleicht finden Sie eines Tages den richtigen Daddy. Vielleicht nicht. Aber inzwischen können Sie wieder glücklich sein.«
2
Wir vergessen nichts, dachte Mma Ramotswe. Unsere Köpfe mögen klein sein, aber sie sind so voller Erinnerungen, wie der Himmel manchmal voll herumschwärmender Bienen ist, voll von Tausenden und Abertausenden von Erinnerungen, von Gerüchen, von kleinen Dingen, die uns passiert sind und die unerwartet zurückkehren, um uns ins Gedächtnis zurückzurufen, wer wir sind. Und wer bin ich? Ich bin Precious Ramotswe, Staatsangehörige von Botswana, Tochter von Obed Ramotswe, der starb, weil er Bergmann war und nicht mehr atmen konnte. Sein Leben ist nicht überliefert. Wer schreibt schon über das Leben der einfachen Leute?
Ich bin Obed Ramotswe und wurde 1930 in der Nähe von Mahalapye geboren. Mahalapye liegt auf halber Strecke zwischen Gaborone und Francistown, an der Straße, die immer und immer weiterzugehen scheint. Damals war es natürlich nur eine staubige, unbefestigte Straße, und die Eisenbahnlinie war viel wichtiger. Die Strecke führte von Bulawayo hinunter, bei Plumtree nach Botswana hinein und verlief dann in südlicher Richtung am Rande des Landes auf der anderen Seite bis nach Mafikeng.
Als Junge schaute ich oft den Zügen zu, wenn sie aufs Nebengleis fuhren. Sie stießen große Dampfwolken aus, und wir wetteten miteinander, wer sich am dichtesten an sie heranzuschleichen traute. Die Heizer brüllten, und der Stationsvorsteher pfiff, aber sie schafften es nie, uns loszuwerden. Wir versteckten uns hinter Pflanzen und Kisten und sprangen hervor, um vor den geschlossenen Fenstern der Züge um Münzen zu betteln. Wir sahen Weiße, die wie Gespenster aus den Fenstern guckten, und manchmal warfen sie uns einen ihrer rhodesischen Pennys zu – große Kupfermünzen mit einem Loch in der Mitte – oder, wenn wir Glück hatten, eine winzige Silbermünze, die wir Tickey nannten und die für eine kleine Büchse Sirup reichte.
Mahalapye war ein weitläufiges Dorf mit Hütten aus braunen, von der Sonne getrockneten Schlammziegeln und ein paar Blechdachhäusern. Diese gehörten der Regierung oder der Eisenbahngesellschaft und schienen für uns fernen, unerreichbaren Luxus zu repräsentieren. Es gab auch eine Schule, die von einem alten anglikanischen Priester und einer Weißen geleitet wurde, ihr Gesicht schwer mitgenommen von der Sonne. Sie sprachen beide Setswana, was ungewöhnlich war, aber sie unterrichteten uns auf Englisch und bestanden unter Androhung von Prügel darauf, dass wir unsere eigene Sprache draußen auf dem Schulhof ließen – in der Schule durften wir nur Englisch sprechen.
Auf der anderen Straßenseite begann die Ebene, die sich bis zur Kalahari erstreckte. Es war eine Landschaft ohne herausragende Merkmale mit niedrigen Dornenbäumen übersät, auf deren Zweigen Nashornvögel und die häufig hin und her flatternden Molopes, Vögel mit lang herabhängenden Schwanzfedern, hockten. Es war eine Welt, die keine Begrenzung zu haben schien, und das war es wohl auch, was Afrika damals so besonders machte. Es war unendlich. Ein Mann konnte ewig weitergehen oder -reiten und nirgendwo ankommen.
Jetzt bin ich sechzig, und ich glaube, Gott will nicht, dass ich noch lange lebe. Vielleicht habe ich noch ein paar Jahre vor mir, aber ich zweifle daran. Ich bin zu Dr. Moffat ins holländisch-reformierte Krankenhaus gegangen, der meine Brust abhörte. Er wusste sofort, dass ich Bergmann gewesen war, und er schüttelte den Kopf und meinte, die Minen könnten einem Mann auf viele verschiedene Arten schaden. Während er sprach, fiel mir ein Lied ein, das die Bergleute von Sotho sangen. »Die Minen fressen Männer. Auch wenn du sie schon lange verlassen hast, können die Minen dich immer noch fressen.« Wir wussten alle, dass es stimmte. Man konnte von herabstürzendem Gestein erschlagen oder Jahre später getötet werden, wenn die Arbeit unter Tage nur noch eine Erinnerung war oder vielleicht ein böser Traum, der einen nachts heimsuchte. Die Minen fordern ihren Tribut, wie jetzt auch bei mir. So überraschte mich nicht, was Dr. Moffat sagte.
Manche Leute können solche Nachrichten nicht ertragen. Sie denken, sie müssten ewig leben, und heulen und jammern, wenn sie merken, dass ihre Zeit gekommen ist. So geht es mir nicht, und ich weine nicht über die Nachricht, die mir der Doktor gab. Das Einzige, was mich traurig macht, ist, dass ich Afrika verlasse, wenn ich sterbe. Ich liebe Afrika. Afrika ist meine Mutter und mein Vater. Wenn ich tot bin, werde ich den Geruch von Afrika vermissen, denn man sagt, dass es dort, wo man hingeht – wo immer das auch sein mag –, keinen Geruch und keinen Geschmack gibt.
Ich sage nicht, dass ich ein tapferer Mann bin. Das bin ich nicht. Aber die Nachricht, die ich bekommen habe, scheint mir wirklich nichts auszumachen. Ich kann auf meine sechzig Jahre zurückblicken und an alles denken, was ich gesehen habe, und daran, dass ich mit nichts begonnen habe und jetzt fast zweihundert Rinder besitze. Und ich habe eine gute Tochter, eine treue Tochter, die sich um mich kümmert und mir Tee macht, während ich in der Sonne sitze und auf die Berge in der Ferne schaue. Wenn man die Berge von Weitem sieht, sind sie blau wie alles weit Entfernte in diesem Land. Hier sind wir weit vom Meer entfernt – Angola und Namibia liegen zwischen uns und der Küste. Und trotzdem haben wir diesen großen, leeren, blauen Ozean über uns und um uns herum. Kein Matrose könnte einsamer sein als ein Mann, der in der Mitte unseres Landes steht, umgeben von meilenweitem Blau.
Ich habe das Meer nie gesehen, obwohl mich einmal ein Mann, mit dem ich im Bergwerk arbeitete, zu sich ins Zululand einlud. Er erzählte, dass es dort grüne Berge gebe, die sich bis zum Indischen Ozean erstrecken, und dass er nur aus seiner Tür schauen muss, um Schiffe in der Ferne zu sehen. Er sagte, dass die Frauen in seinem Dorf das beste Bier im ganzen Land brauen und dass ein Mann dort viele Jahre in der Sonne sitzen kann und nichts weiter zu tun braucht, als Kinder zu machen und Maisbier zu trinken. Er sagte, dass er mir eine Frau verschaffen könnte und dass die Leute vielleicht darüber hinwegsehen würden, dass ich kein Zulu bin – falls ich bereit wäre, dem Vater genug für das Mädchen zu zahlen.
Weshalb sollte ich aber ins Zululand gehen wollen? Warum sollte ich jemals etwas anderes wollen, als in Botswana zu leben und ein Tswana-Mädchen zu heiraten? Ich sagte ihm, Zululand klinge gut, aber jeder Mensch hat eine Landkarte seiner Heimat im Herzen, und das Herz erlaubt nie, diese Landkarte zu vergessen. Ich sagte ihm, dass wir zwar die grünen Berge, die es bei ihm gibt, in Botswana nicht haben, auch kein Meer, aber wir haben die Kalahari und Land, das sich weiter erstreckt, als man sich überhaupt vorstellen kann. Ich sagte ihm, dass ein Mann, der an einem trockenen Ort geboren wird, zwar von Regen träumt, aber nicht zu viel davon will und dass ihm die Sonne, die ständig auf ihn niederbrennt, nichts ausmacht. So bin ich nie mit ihm ins Zululand gegangen, und ich habe das Meer nie gesehen, niemals. Aber das hat mich nicht unglücklich gemacht. Nicht ein einziges Mal.
Nun sitze ich also hier, dem Ende nah, und denke an alles, was mit mir geschehen ist. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Gott denke und mir überlege, wie es sein wird zu sterben. Ich habe keine Angst davor, weil Schmerzen mir nichts ausmachen und die Schmerzen, die ich spüre, ganz erträglich sind. Sie haben mir Pillen gegeben, große weiße, und mir gesagt, ich solle sie nehmen, wenn die Schmerzen in meiner Brust zu stark werden. Aber diese Pillen machen mich müde, und ich bin lieber wach. Also denke ich an Gott und frage mich, was er wohl sagen wird, wenn ich vor ihm stehe. Manche Leute stellen sich Gott als weißen Mann vor, ein Gedanke, den die Missionare den Menschen anscheinend vor vielen Jahren in die Köpfe gesetzt haben. Ich glaube nicht, dass das so ist, weil es zwischen weißen und schwarzen Männern keinen Unterschied gibt. Wir sind alle gleich. Wir sind nur Menschen. Und Gott war sowieso schon hier, bevor die Missionare kamen. Nur nannten wir ihn damals anders, und er lebte nicht drüben bei den Juden, er lebte hier in Afrika, in den Felsen, im Himmel, an Orten, wo er gerne lebte.
Es gibt eine Geschichte in Botswana über zwei Kinder, Bruder und Schwester, die von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen werden und feststellen, dass der Himmel voll schöner weißer Rinder ist. So stelle ich ihn mir auch gerne vor, und ich hoffe, dass es stimmt. Ich hoffe, dass ich mich, wenn ich sterbe, an einem Ort wiederfinde, wo es solche Rinder gibt, die einen süßen Atem haben und rings um mich stehen. Wenn das auf mich wartet, gehe ich gerne morgen schon oder sogar jetzt in diesem Augenblick. Ich will mich aber noch von Precious verabschieden und beim Gehen die Hand meiner Tochter halten. Das wäre ein glücklicher Abschied.
Ich liebe unser Land und bin stolz darauf, ein Motswana zu sein. Kein anderes Land in Afrika kann den Kopf so hoch oben tragen wie wir. Wir haben keine politischen Gefangenen und nie welche gehabt. Wir haben eine Demokratie. Wir waren vorsichtig: Die Bank von Botswana ist voller Geld von unseren Diamanten. Wir schulden niemandem etwas.
Aber früher ging es uns schlecht. Bevor wir unser Land aufbauten, mussten wir zum Arbeiten nach Südafrika gehen. Wir arbeiteten unter Tage wie die Leute aus Lesotho und Mosambik und Malawi und all diesen Ländern. Die Minen schluckten unsere Männer und ließen die Alten und die Kinder zurück. Wir gruben nach Gold und Diamanten und machten die Weißen reich. Sie bauten ihre großen Häuser mit ihren Mauern und ihren Autos. Und wir gruben tief unter ihnen und holten das Gestein hoch, auf dem sich ihr ganzer Reichtum gründete.
Ich ging ins Bergwerk, als ich achtzehn war. Damals waren wir das Protektorat Betschwanaland, und die Briten regierten unser Land, um uns vor den Buren zu schützen (das behaupteten sie jedenfalls). Unten in Mafikeng, hinter der Grenze zu Südafrika, gab es einen Kommissar. Der kam manchmal die Straße hochgefahren und sprach mit den Häuptlingen. Er sagte dann: »Macht dies, macht das.« Und die Häuptlinge gehorchten ihm, sie wussten, dass er sie sonst absetzen würde. Einige waren jedoch schlau. Wenn die Briten sagten: »Macht dies«, antworteten sie: »Ja, ja, Sir, das werden wir tun«, und machten hinter dem Rücken des Kommissars etwas ganz anderes oder spielten ihm was vor. Viele Jahre lang geschah also gar nichts. Es war ein gutes Regierungssystem, weil die meisten Leute wollen, dass sich nichts verändert. Das ist heute das Problem mit den Regierungen: Sie wollen ständig etwas tun. Sie sind dauernd damit beschäftigt sich auszudenken, was sie als Nächstes machen können. Die Leute mögen das aber nicht – sie wollen in Ruhe gelassen werden und sich um ihr Vieh kümmern.
Wir hatten inzwischen Mahalapye verlassen und waren nach Mochudi gezogen, wo die Angehörigen meiner Mutter lebten. Ich mochte Mochudi und wäre gern dortgeblieben, aber mein Vater sagte, ich solle in den Minen arbeiten, weil sein Land nicht mich und eine Frau ernähren könne. Wir hatten nicht viele Rinder und bauten gerade genug Feldfrüchte an, um uns das Jahr über am Leben zu halten. Als dann der Lastwagen über die Grenze kam, um Männer anzuwerben, meldete ich mich, und sie stellten mich auf eine Waage, hörten meine Brust ab und ließen mich zehn Minuten lang eine Leiter rauf- und runterklettern. Dann sagte ein Mann, aus mir würde ein guter Bergmann werden, und ich musste meinen Namen auf einen Zettel schreiben. Sie wollten den Namen meines Häuptlings wissen und fragten mich, ob ich jemals Ärger mit der Polizei gehabt hätte. Das war alles.
Am nächsten Tag fuhr ich auf dem Lastwagen davon. Ich hatte einen großen Koffer, den mein Vater im indischen Laden für mich gekauft hatte. Ich besaß nur ein Paar Schuhe, aber ich hatte ein Hemd und ein paar Hosen zum Wechseln. Außer etwas Biltongue, das meine Mutter für mich gemacht hatte, war das alles, was ich mitnahm. Ich lud meinen Koffer auf den Lastwagen. Alle Familien, die zum Abschied gekommen waren, fingen zu singen an. Die Frauen weinten, und wir auf dem Lastwagen winkten. Junge Männer wollen nicht weinen und nicht traurig aussehen, aber ich wusste, dass die Herzen in uns allen kalt waren.
Es dauerte zwölf Stunden, bis wir Johannesburg erreichten – die Straßen waren damals noch sehr holprig. Wenn der Lastwagen zu schnell fuhr, konnte eine Achse brechen. Wir fuhren durch das westliche Transvaal, durch die Hitze, im Wagen wie Vieh zusammengepfercht. Einmal in der Stunde hielt der Fahrer an, kam nach hinten und teilte Feldflaschen aus, die in jedem Ort, durch den wir fuhren, neu gefüllt wurden. Man hielt die Feldflaschen immer nur wenige Sekunden in der Hand, und in dieser kurzen Zeit versuchte man so viel Wasser zu trinken, wie man konnte. Männer, die schon zum zweiten oder dritten Mal unterschrieben hatten, kannten sich aus und hatten selbst Flaschen mit Wasser dabei, die sie mit einem teilten, wenn man verzweifelt war. Wir waren alle zusammen Botswana, und keiner sah zu, wenn ein Landsmann litt.
Die älteren Männer kümmerten sich um die jüngeren. Sie sagten ihnen, dass sie jetzt, wo sie sich für das Bergwerk verpflichtet hätten, keine kleinen Jungs mehr wären. Sie sagten, dass wir in Johannesburg Dinge sehen würden, die wir uns nie hätten vorstellen können, und dass unser Leben, wenn wir schwach oder dumm wären oder nicht hart genug arbeiteten, von jetzt an nur noch aus Leid bestünde. Sie erzählten uns, dass wir Grausamkeit und Bosheit sehen würden, dass wir aber, wenn wir uns an andere Botswana hielten und täten, was die älteren Männer uns sagten, überleben könnten. Ich dachte, sie übertrieben. Ich erinnerte mich, dass die älteren Jungen uns von der Initiationsschule erzählt hatten, zu der wir alle gehen mussten, und wie sie uns davor gewarnt hatten. Sie wollten uns Angst machen. Die Wirklichkeit war dann ganz anders. Aber diese Männer sagten trotzdem die reine Wahrheit. Was vor uns lag, war genau so, wie sie es prophezeit hatten, sogar schlimmer.
In Johannesburg bildeten sie uns zwei Wochen lang aus. Wir waren alle recht fit und stark, aber niemand konnte in die Minen geschickt werden, bevor er nicht noch stärker gemacht worden war. Deshalb führten sie uns zu einem Gebäude, das sie mit Dampf aufgeheizt hatten, und dann ließen sie uns vier Stunden am Tag auf Bänke hinauf- und herunterspringen. Für einige Männer war das zu viel. Sie brachen zusammen und mussten wieder auf die Füße gestellt werden. Aber ich überstand es irgendwie und kam in die nächste Runde des Trainings. Sie erklärten uns, wie wir hinuntergebracht würden und wie die Arbeit wäre, die sie von uns erwarteten. Sie sprachen von Sicherheit und wie der Felsen brechen und uns zerquetschen könnte, wenn wir unvorsichtig wären. Sie trugen einen Mann ohne Beine herein und legten ihn auf einen Tisch, und wir mussten uns anhören, was er uns von seinem Unfall erzählte.
Sie brachten uns Funagalo bei, die Sprache, in der unter Tage Befehle erteilt werden. Es ist eine merkwürdige Sprache. Die Zulus lachen immer, wenn sie Funagalo hören, weil so viele Zulu-Wörter drin sind, aber Zulu ist es nicht. Es ist eine Sprache, mit der man Leute gut herumkommandieren kann. Es gibt viele Wörter für schieben, nehmen, stoßen, tragen und laden und keine für Liebe, Glück oder das Zwitschern der Vögel am Morgen.