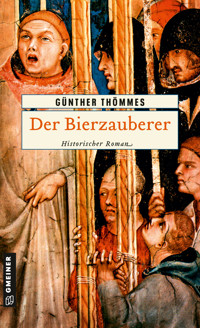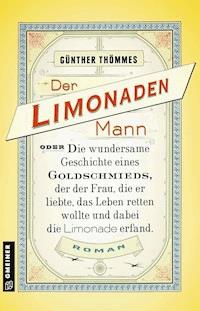Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Bierzauberer-Saga
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1800. Im rasch wachsenden München boomt das Biergeschäft. Brauherr Gabriel Sedlmayr schaut bewundernd nach England, wo die Industrialisierung auch beim Bier Einzug gehalten hat. Über eine Freundschaft mit dem Besitzer der größten Brauerei Londons versucht er den Fortschritt nach München zu bringen. Doch durch ein tragisches Unglück werden aus den Freunden Feinde. Nun geht es nur noch darum, sich gegenseitig zu schaden. Mit Industriespionage und politischen Intrigen wollen die Bayern die Engländer mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Aber der wahre Bierkrieg beginnt erst noch…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günther Thömmes
Das Duell der Bierzauberer – Aufstieg der Bierbarone
Historischer Roman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
So braut Deutschland, Lieblingsplätze (2016), Der Papstkäufer (2012), Malz und Totschlag (Hg. 2011), Der Fluch des Bierzauberers (2010), Das Erbe des Bierzauberers (2009), Der Bierzauberer (2008)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_View_from_the_East-End_of_the_Brewery_Chiswell_Street.jpg; Klappenabbildung aus: ›Die Spaten-Brauerei‹ von Wolfgang Behringer
ISBN 978-3-8392-5280-2
Vorbemerkung
Dies ist ein Roman. Das bedeutet, dass Handlung und Figuren frei erfunden sind. Der aufmerksame Leser wird jedoch bemerken, dass einige Figuren dieses Romans recht eng an tatsächliche Personen der Zeitgeschichte angelehnt sind. In einem Roman ist es allerdings möglich, bestimmte biografische oder familiäre Details dieser Figuren aus dramaturgischen Gründen zu verändern und an die Handlung des Romans anzupassen. Von dieser Möglichkeit habe ich hier Gebrauch gemacht. Daher sind Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen und Ereignissen zwar zufällig, aber durchaus beabsichtigt.
1985 – Erinnern Sie sich noch: Eine sensationelle Entdeckung
Die Art, wie ich zu dem Bierzauberer-Buch kam, war eigentlich einerseits zu banal für ein solches Fundstück, andererseits, wo sollte man ein wirklich antikes Buch über Bier finden, wenn nicht im Umfeld seiner Produktion? Im Rahmen meiner Ausbildung zum Brauer und Mälzer verbrachte ich im Sommer des Jahres 1985 einige Wochen in einer Mälzerei in Andernach am Rhein. Die Mälzerei war in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden und stellte ein Konglomerat aus alten Gebäuden dar, die nach und nach errichtet worden waren, sodass sie sich über die Jahrzehnte in ein regelrechtes Labyrinth verwandelt hatten. Ich hatte mir schon ein abgelegenes Treppenhaus mit einigen Seitentüren ausgesucht, in dem ich mich einmal etwas genauer umsehen wollte. Umso größer war meine Enttäuschung, als ich alle Türen verschlossen fand. Ich wollte gerade zurück zu den Silos gehen, um meine Sachen zu packen und ins Wochenende zu fahren, als ich noch eine kleine Seitentür erblickte. Ich ging hin, sie war nicht verschlossen! Die Tür klemmte ein wenig, mit einem kräftigen Stoß konnte ich sie öffnen. Schnell ging ich hinein und machte die Tür hinter mir zu. Es war stockdunkel, und die Luft roch abgestanden und leicht modrig. Nach einer Weile hatte ich einen Lichtschalter gefunden. Ich stand in einem kleinen Raum, der wohl einmal als Büro gedient haben mochte. Ein kleiner alter Schreibtisch aus dunklem Holz, dazu ein passender Stuhl, alles voller Staub und Spinnweben. Ein Kalender an der Wand deutete mir an, dass dieses Büro zuletzt im Jahr 1928 benutzt worden war. Ich konnte meine Neugierde kaum zurückhalten! Besonders faszinierte mich von Anfang an das dritte Möbelstück im Raum, ein kleiner hölzerner Bücherschrank mit einer Glastür. Der Schlüssel steckte, und ich sah eine Reihe Bücher, fast genauso verstaubt, aber ansonsten in gutem Zustand. Ich nahm einen Stapel heraus und legte ihn auf den Tisch. Die ersten waren Rechnungsbücher von der Buchhaltung der Mälzerei aus früheren Jahren. Getreideeinkauf, Betriebskosten, Personal, alles war hier verzeichnet. Als ich den ersten Stapel zurück in den Schrank legte, fiel mir ein Buch ins Auge, welches aus der Reihe herausragte, in Material und Größe war es nicht wie die anderen. Ein schwerer Ledereinband, der wirklich alt aussah. Ein großes, umständliches Format, wie ein altertümliches Rezeptbuch. Auf dem Ledereinband prangte ein großer Stern. Ein Stern, wie ich ihn ansonsten als »Davidstern« kannte. Ich überflog das Buch oberflächlich. Es war ein handschriftliches Manuskript, geschrieben in einem, wie ich fand, beinahe unmöglich zu entziffernden sehr altmodischen Deutsch, aber einige wenige Passagen waren mit etwas Anstrengung durchaus lesbar. Bestimmt das älteste Buch, das ich jemals in der Hand gehalten hatte. Während ich durch das Buch blätterte, fielen einige einzelne Blätter heraus. Helleres Papier, in einer anderen Qualität, Papier neueren Datums. Ich hob sie auf, legte sie auf die Seite und schlug das Buch vorne auf. So begann die Geschichte des »Bierzauberers«. Was aber war mit den anderen, vereinzelten Blättern, die aus dem Buch heraus gefallen waren? Es waren Briefe, teilweise wahrhaftige Vermächtnisse anderer Brauer. Brauer, die alle dieses Buch für eine Weile besessen hatten. Berühmter Braumeister, so wie Gabriel Sedlmayr, und nicht ganz so berühmter. Ich machte mich an die Arbeit, auch deren Leben neu zu entdecken.
Dies ist die Geschichte von einem von ihnen …
Karte
Quelle: Stadtarchiv Lüneburg
Gedicht
»Kings and heroes here were guests,
In stately hall at solemn feasts;
But now no dais, nor halls remain,
Nor fretted window’s gorgeous pane.
No fragment of a roof remains
To echo back their wassail strains.«
(Sir W. Scott, »Kenilworth«)
1. Kapitel
London, ein Märztag im Jahr 1610
»Und, habt Ihr Euch entschieden?«
Der mittelgroß gewachsene, eher unscheinbare Mann stand in der Mitte eines von Tribünen umsäumten Ovals von etwa dreißig Metern Durchmesser und musste seine Frage fast hinausschreien.
Der angesprochene in etwa gleichaltrige Mann mit einer Glatze und einem gut getrimmten grauen Vollbart, stand nämlich ein gutes Stück entfernt, auf der zweiten von insgesamt drei Etagen, und ließ den Blick über das ganze Gebäude schweifen, während er in seinen Händen zwei große Walnüsse knackte und genüsslich verspeiste.
Hier, am Südufer der Themse in Bankside, am Rande der Hauptstadt, konnte man sich noch amüsieren. Hier war das Zentrum des Theaters, es gab nicht nur dieses hier, das er gerade besichtigte, sondern auch »The Swan«, »The Rose«, »The Fortune« und »The Hope«.
Was der Bärtige sah, ließ ihn zufrieden lächeln. Ein achteckiges Fachwerkgebäude mit drei Stockwerken, der Innenhof für den Pöbel, diese billigen Plätze natürlich nicht überdacht. Im Gegensatz zur Bühne, die in den Innenraum hinein ragte und die Schauspieler bisweilen gefährlich nahe ans Publikum heranbrachte. Gefährlich ganz besonders bei Stücken, die die Volksseele kochen ließen. So wie es der unten im Oval stehende Mann, der ihm seinen Anteil am Theater verkaufen wollte, immer wieder geschafft hatte. Zuletzt mit diesem »Othello«, der das Publikum vor Begeisterung zur Raserei trieb. Zu seinem Leidwesen aber auch Stücke wie »Titus Andronicus«, auf das Shakespeare nicht stolz war; das er im Nachhinein für dumm und brutal hielt, und das doch seit fünfzehn Jahren ununterbrochen gespielt wurde.
»Sagt mir nur eines«, rief er nach unten. William Shakespeare legte die Hände an die Ohren, um ihn besser verstehen zu können. »Ihr seid mir immer noch eine Antwort schuldig, warum Ihr Euren Anteil am Globe-Theater verkaufen wollt.« Die korrekte Antwort wären in etwa die Gedanken gewesen, die ihm gerade durch den Kopf gingen. Shakespeare ging unter die Tribüne zur grob gezimmerten, aber sehr stabilen Holztreppe. Ein paar Augenblicke später stand er seinem Geschäftspartner Henry Evans gegenüber. Einem kleinen gedrungenen Mann in weiten Pluderhosen und mit verschlagenem Blick. Unredlichkeit ausstrahlend. Aber sie kannten sich seit vielen Jahren, er wusste ihn zu nehmen.
»Ich habe genug Theater gehabt in meinem Leben und bin ein alter Mann. Meine Heimat ist Stratford-upon-Avon, dort will ich meinen Lebensabend verbringen.«
Evans schüttelte den Kopf. »Ihr seid erst knapp über vierzig Jahre alt, wenn ich richtig schätze. Da bin sogar ich älter als Ihr. Ihr könntet mit dem Geld guter Teilhaber einer Brauerei hier in der Nachbarschaft werden. Das würde Euch ein Auskommen sichern.« Er legte dem anderen die Hand auf die Schulter. »Ich verstehe Euch einfach nicht.«
Erneut ging dem Dichter der unheimliche Erfolg von »Titus Andronicus« durch den Kopf. Das wollte er nicht mehr.
»Bei Euch ist das Globe-Theater in guten Händen. Dann habt Ihr neben dem Blackfriars-Theater noch eine weitere Spielstätte. Und Arm und Reich können Euch ihr Geld geben.«
Langsam wurde er ungeduldig. Wochenlang hatte Evans ihn hingehalten. Versprechungen gemacht. Gezögert. Versprochen. Nun wollte er die Sache zum Abschluss bringen.
»Seid Ihr bereit, meinen Preis zu zahlen?«
Er wollte weg von hier.
Weg von diesem Theater mit seinem gefährlichen Gedränge, den übel riechenden Menschen in ihren ungewaschenen Kleidern, mit ihren faulen schwarzen Zähnen und nach Knoblauch stinkend. Die ungeniert auf den Boden pissten, die Akteure mit Flaschen, Nüssen und faulem Obst bewarfen.
Weg von diesem ekelhaften, profitgierigen Impresario, der regelmäßig kleine Jungen entführte, wie in einem Gefängnis unter Verschluss hielt und das Ganze nur zum Zweck, dass die Jungen für ihn Theater spielen lernten.
Weg aus der Stadt und ihren Elendsquartieren hier am Rand, in der der Pöbel regierte und ein Theaterstück nicht nach seiner Qualität beurteilte, sondern danach, wie viel Aufruhr man damit stiften konnte.
Weg von London, wo unter den eng gedrängten 200.000 Menschen regelmäßig die Pest ausbrach und daher bisweilen eine ganze Saison kein Theater gespielt werden konnte.
Weg von einer Gesellschaft, in der ein blutrünstiges Spektakel wie »Bear Biting«, bei dem ein angeketteter Bär gegen Hunde und menschliche Gegner kämpfen musste, mehr Zuschauer anlocken konnte als ein Drama wie »Romeo und Julia«.
Weg von einer Obrigkeit, die für seine Kunst so wenig übrig hatte, dass hohe Schauspielkunst niedriger eingeschätzt wurde als die Arbeit eines Schuhmachers oder Bierbrauers.
Evans zögerte erneut. Dann dachte er an die Einnahmen von dreitausend Menschen, die ihm ein volles Globe-Theater an einem einzigen Abend einbrachten, so nickte er schließlich.
»In Ordnung.«
William Shakespeare nestelte an seinem dunkelgrünen Wams mit dem großen weißen Kragen, zückte den Kaufvertrag, den er zusammengerollt in der Hand gehalten hatte, und legte ihn auf die Brüstung der Tribüne. Beide Männer unterzeichneten, dann wechselte ein dicker Beutel Münzen den Besitzer im Gegenzug für einen Anteil von zwölfeinhalb Prozent am erfolgreichsten Theater Londons.
»Und denkt an Eure Versprechen: kein Streit mit den anderen Teilhabern. Und meine Schauspieler dürfen unter Euch weiter spielen. Ich wünsche Euch viel Erfolg. Gehabt Euch wohl!«
Mit diesem Satz verabschiedete sich der größte Dramatiker der Weltliteratur vom Käufer seiner Anteile am Globe-Theater und stiefelte vorsichtig, die tiefen Wasserpfützen meidend, zu einer wartenden Kutsche. Nachdem er eingestiegen war, fuhren sie rumpelnd durch den matschigen Ausgang davon. Ein letztes Mal winkte er den grell geschminkten Damen des benachbarten Hurenhauses zu. Das war’s. In zweieinhalb Tagen würde er daheim sein. In »New Place«, so hieß das schöne Haus, das er vor einigen Jahren als Alterssitz vorsorglich gekauft hatte.
So kehrte er dem Globe den Rücken zu.
Elf Jahre lang hatte er dort Triumphe gefeiert. Mit seinen Stücken. Als Schauspieler und Impresario.
Und Geld verdient.
Viel Geld.
So viel Geld, dass er sich keine Sorgen mehr machen musste.
Sorgen machte er sich indes um die Zukunft seiner Zunft. Er weinte dem Globe deswegen auch keine Träne nach. Das Theater war tot. Kein Zweifel. Zumindest die Art von Theater, wie er es immer gemacht hatte. Alles, was jetzt Theater genannt wurde, war ein billiger Abklatsch ohne Niveau. Schauspiel ohne Wert.
»Wenn ein Krug Bier mehr wert ist als ein gutes Stück im Theater, dann ist das Ende der Menschheit nicht mehr fern«, murmelte er schläfrig, während die Kutsche schaukelnd und ächzend den Weg nach Stratford-upon-Avon einschlug. »Bier statt Theater, werden die Menschen das wirklich so haben wollen in der Zukunft?« Er wusste zuerst nicht, ob er sich ärgern oder freuen sollte. Beschloss dann aber, da er seinen Preis durchgesetzt hatte, das Ganze als Erfolg zu verbuchen.
Er merkte, wie eine ungeheure Last von ihm abfiel. Und wie er Durst bekam. Durst auf Bier. Auf ein kräftiges, dunkles, süßes Gebräu. »Aber andererseits, so eine Kanne Bier – das ist doch ein Königstrank«, sagte er zu sich selbst. Er befahl dem Kutscher, beim nächsten Gasthaus einen Halt einzulegen. Mit diesem Gedanken schlief er ein, bis die Kutsche vor dem »Coach & Horses« anhielt.
Das Globe-Theater lief noch einige Jahre erfolgreich weiter.
1613 wurde während einer Aufführung von Shakespeares Stück »Heinrich VIII.« eine Kanone abgefeuert, die das strohgedeckte Dach in Brand setzte. Das Feuer vernichtete das Theater komplett. Es wurde allerdings gleich wieder aufgebaut, diesmal mit Ziegeldach.
Wenig später eröffnete der »Citizen and Clothworker of London« James Monger direkt neben dem Theater ein Brauhaus. Er pachtete das Land, welches später das »Noell’s Estate« genannt wurde, und vererbte die Brauerei vor seinem Tod an seinen Patensohn gleichen Namens.
Keine drei Jahrzehnte später: Während der Dreißigjährige Krieg den ganzen Kontinent ins Elend stürzte, tobte in England ein Bürgerkrieg. Die Puritaner wurden dabei endgültig zur dominanten Religionsbewegung und sorgten dafür, dass alle Theater und sonstigen Vergnügungsstätten in England geschlossen wurden.
Das Globe-Theater stand leer.
1644 wurde es abgerissen.
Die Ruinen wurden zugeschüttet.
Zeit verging.
London wuchs. Die Brauerei neben dem ehemaligen Globe Theater ebenso.
Und auch der Bierdurst der Menschen.
Nur William Shakespeares Globe-Theater wurde ganz einfach vergessen.
2. Kapitel
Zweihundert Jahre später.
»Der Hofer Andreas ist tot!« Lautstark und unaufhaltsam bahnte sich die vier Tage alte Nachricht eine Gasse durch das winterliche München im Februar 1810. Der Tiroler Freiheitsheld weilte nicht mehr unter den Lebenden, zur großen Genugtuung der zahlreichen bayerischen Nationalisten. Verurteilt und erschossen vom Kriegsgericht der Franzosen im italienischen Mantua. Zuvor verraten und für 1.500 Gulden an Napoleons Truppen verkauft vom »Judas von Tirol«, dem Bauern Franz Raffl.
Während sich die Münchner in heftigen Diskussionen darüber ergingen, ob der Rebell aus Tirol ein gerechtes oder doch eher ein unwürdiges Ende gefunden habe, wanderte der ehemals königliche Hofbraumeister Gabriel Sedlmayr, seit drei Jahren stolzer Besitzer des Oberspatenbräu, unruhig in seiner Wohnung auf und ab. Der 38-jährige, kräftige, leicht korpulent wirkende Mann mit den ständig roten Backen und hellbraunen Haaren trug seinen besten schwarzen Gehrock und wartete auf seine sechs Jahre jüngere Gattin Maria Franziska.
»Weib, wie lange muss ich mich noch gedulden?« Die kräftige, schnarrende Stimme hallte unwirsch durch die Räumlichkeiten, die sich in einem Seitenflügel neben der Brauerei befanden.
Immer musste sie ihn warten lassen. Seit Jahren trieb sie dieses Spiel und ihn langsam in den Wahnsinn. Damit und mit ihrer häufig sehr spitzen Zunge. Die sie, das stand für Sedlmayr außer Frage, von ihrer Mutter geerbt hatte. Die jedoch zum Glück so weit weg wohnte, dass sie sich nur zwei Mal im Jahr begegneten. Andererseits liebte er seine Maria Franziska über alles und war ihr treu ergeben. Ohne sie wäre sein Leben als Brauherr des »Oberspatenbräus« nicht denkbar gewesen.
Seine Gedanken schweiften ab in die Zeit vor nicht einmal drei Jahren, als es um Biegen und Brechen um den Kauf der Brauerei und um seine berufliche Existenz gegangen war.
Mitte September hatte Sedlmayr damals um das Braulehen angesucht. Innerhalb weniger Tage musste er sich vorstellen und seine Eignung zum Münchner Brauherrn durch Taufschein und Lehrbrief unter Beweis stellen. Dann war erbittert um den Kaufpreis gefeilscht worden.
»30.500 Gulden sind eine Menge Geld.«
Das war in dieser Zeit das zentrale Thema aller Diskussionen zwischen den Eheleuten gewesen, wobei Maria Franziska zudem noch hochschwanger gewesen war. Dennoch, die Zeit drängte. Michaeli, und damit der Beginn der Brausaison zum 29. September, rückte bedrohlich schnell näher.
Schließlich hatte sich das Ehepaar Sedlmayr einen Ruck gegeben, über beide Ohren verschuldet und am 26. September das Oberspatenbräu mit »Behausung samt Bräustatt nebst allen Braurequisiten, zwei Pferden und zwei Wagen, Schöff und Geschirr, Vorräten, Zimmereinrichtungen und anderem Besitz« erworben. So lautete denn auch der Grundbucheintrag vom Juni des folgenden Jahres. Der Braulehensbrief war schon gleich nach dem Kauf erteilt worden, am 7. Oktober. Da war der erste Sohn der Sedlmayrs, Franz Maria, bereits acht Tage alt gewesen. Und die erste Saison war somit gerettet worden!
Sogar der führende Brauer Münchens, Herr Josef Pschorr vom Hackerbräu, hatte Sedlmayrs Aufnahme ins Münchner Brauerhandwerk zu Beginn des folgenden Jahres unterschrieben; wenn auch erst nach anfänglichem Zögern.
Und das gesamte Bier der ersten Saison war nicht nur ausverkauft gewesen, es hatte nur bis in den Juli hinein gereicht, wie bei den erfolgreichen alteingesessenen Brauern der Stadt.
Stolz war er gewesen über diesen Erfolg. Stolz, die Familientradition des Bierbrauens wieder fortführen zu können. Nachdem seinem Vater damals in Maisach bei Fürstenfeld von den Fürstenfelder Klosterherren seine Hypothek gekündigt worden war und er mit seiner Brauerei und seiner Familie in Not und Schulden geraten war. Ganz ohne eigenes Verschulden, nur durch den Ruf, ein freisinniger Mann zu sein. Das hatte damals schon ausgereicht, um den Ort verlassen zu müssen. Es gab also doch einen Fortschritt in der Menschheit. Schulden aber gab es immer noch. Denn auch die 700 Gulden, die zu dieser wie auch zur Bürgeraufnahme benötigt worden waren, waren geliehen gewesen. Die hohen Schulden waren zur Belastungsprobe für die Ehe geworden, und öfter als beiden lieb war, hieben sie seither verbal aufeinander ein. Auch die regelmäßigen, zwangsweisen Einquartierungen von Soldaten gingen ins Geld. Bis zu vierzehn Mann waren vor einigen Wochen bei ihnen untergekommen und hatten ihnen die Haare vom Kopf gefressen. Bei äußerst bescheidener Entschädigung, die Maria Franziska erbost nachbessern wollte, Gabriel aber um des lieben Friedens willen zähneknirschend akzeptierte.
Vollends in Streit mit Maria Franziska war er geraten, als diese den Ausgaben für Reitzeug, Säbel, Pistolen, den protzigen Hut mit Federbusch, die glänzenden Stiefel mit den glitzernden Sporen und den neuen Uniformrock auf die Spur gekommen war.
»Geht es dem Herrn jetzt schon so gut, dass er paradieren möchte?«, war sie spöttisch und höhnisch auf ihn losgegangen. Auf seine beinah schüchterne Entgegnung, dass er nun zur Bürgermiliz gehöre und diese solch eine Ausrüstung eben vorschriebe, war sie keifend und schimpfend aus dem Zimmer gestürmt.
»All unsere Freunde und Gönner, die uns das viele Geld geliehen haben, werden sich wundern, warum der feine Herr sich aufputzt, bevor er seine Schulden zurück bezahlt!«
Ein Geräusch ließ ihn aufschrecken und in die Wirklichkeit zurück kehren. Gabriels Ärger war im Nu verflogen. Maria Franziska sah einfach zauberhaft aus. Angetan mit ihrem feinsten dunkelblauen Kleid, hochgeschlossen nach englischer Mode und daher ohne Reifröcke, nur mit einigen Hüftpolstern, das Ganze verziert mit einigen Spitzen und Seidenapplikationen, kam sie ihm lächelnd entgegen. Sogar ihre Frisur war britisch. Lange ausgekämmte Papilloten, die gepudert und zu einem Knoten hochgebunden worden waren, wobei nur einige wenige Strähnen in den Nacken fallen durften.
Maria Franziska liebte alles, was aus England kam. Zum Teil aus Trotz gegen die vom ungeliebten Napoleon gegen England verhängte Kontinentalsperre, zum Teil aus rein nützlichen Erwägungen.
»Diese Mode ist so viel praktischer als all das, was aus Frankreich gezeigt wird. Zum Glück verstehen sich unsere Schneider mittlerweile auch darauf.«
Obwohl sie damit gegen den Strom schwamm, sprach sie mit ihrer Vorliebe für England ihrem Gemahl aus der Seele. Auch der schaute häufig neiderfüllt und voller Neugier über den Kanal, wenn auch aus anderen Gründen. Die Insel, oder besser gesagt gewisse Entwicklungen dort waren denn auch der Anlass ihres heutigen Ausgehens.
Die Sedlmayrs wollten zu einem Vortrag des Gewerbehilfsvereins. Diese von der Obrigkeit anfangs misstrauisch beäugte Organisation hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Münchner Gewerbetreibenden mit internationalen Neuigkeiten vertraut zu machen. Die Politiker hatten mittlerweile das unpolitische Wirken des Vereins akzeptiert, es wurden sogar bereits erste Gespräche geführt, um den Verein nach dem Vorbild anderer Städte in einen ganz offiziellen »Polytechnischen Verein« zu wandeln. Und um polytechnische Neuerungen ging es auch an diesem Abend. Der berühmte Physikprofessor Dr. Johann Baptist Hermann war angekündigt mit einem Referat »Über neue und nützliche Erkenntnisse aus England aus den Bereichen des Dampfantriebs, der Kälte und sonstiger Temperaturen und ihre Überprüfung auf ihre Nützlichkeit für das bayerische Gewerbe«.
Kontinentalsperre hin oder her, Ideen waren zum Glück grenzenlos. Und ausnahmsweise waren sogar Frauen zum Vortrag zugelassen, das wollte sich Maria Franziska natürlich nicht entgehen lassen. Forsch klemmte sie ihren Arm unter den des Gatten.
»Lass uns aufbrechen.«
»Die Kutsche wartet bereits.«
Es wären zwar nur wenige Minuten zu gehen, aber die verdreckten Straßen wie auch das Renommee eines Brauereibesitzers verlangten nach einer Kutsche.
Vorsichtig gingen sie die enge Stiege zur Straße hinunter. Seit ihrem Einzug schimpfte Gabriel über die enge Treppenflucht und versprach eine baldige Erweiterung. Draußen vor dem Haus in der Neuhauser Gasse war es nass und kalt. Schneematsch hatte sich mit dem üblichen Straßendreck und zahlreichen Pferdeäpfeln zu einer widerlichen Melange zusammengetan. Die Kutsche stand gleich vor der Tür. Der Kutscher machte zuerst keine Anstalten, vom Bock zu steigen und mit Hand anzulegen, bis ihn ein derber Befehl Sedlmayrs zur Ordnung rief. Hastig nahm er eine zu diesem Zweck mitgeführte bereits ziemlich durchweichte Strohmatte in die Hand und legte sie vor Maria Franziska auf den Boden. Die balancierte gekonnt an der Hand ihres Mannes, ohne den Kutscher eines Blickes zu würdigen, bis zur ersten der beiden Stufen, dann verschwand sie in der Kutsche. Sedlmayr folgte. Die Fahrt war denkbar kurz. Bei ihrer Ankunft drängte sich bereits eine erwartungsfrohe Menschenmenge vor dem »Wilhelminum«, dem ehemaligen Jesuitenkolleg, ebenfalls in der Neuhauser Gasse. Dieses fungierte mittlerweile als Bauschule der Akademie der Bildenden Künste, und dort wurden, mangels anderer passender Örtlichkeiten, gelegentlich Vorträge abgehalten. Die Sedlmayrs machten ein wenig mit beim notwendigen Geplauder übers Wetter und die Politik, bevor sie dann ihre Plätze im vorderen Bereich einnahmen. Der Saal war brechend voll. Nicht nur alle Sitzplätze waren belegt, auch in den Gängen standen die neugierigen Zuhörer dicht gedrängt. Der Präsident des Gewerbehilfsvereins, ein kleines dickliches Männlein namens Dr. Müller, kündigte mit dem Charme eines Zirkusdirektors den berühmten Professor an. Sedlmayr grinste, sah es doch zuerst eher nach einem Wettstreit aus, welcher der beiden Männer vorne auf dem Podium den imposanteren Backenbart vorweisen konnte. Der Professor ließ sich aber nicht lange aufhalten, schickte seinen Gastgeber mit einer herrischen Geste von der Bühne und begann mit seinem lange erwarteten Vortrag.
Drei Stunden später war die Welt für Gabriel Sedlmayr nicht mehr dieselbe wie vorher. Was er und die anderen Zuhörer an diesem Abend vernommen hatten, war über das Verständnis der meisten weit hinausgegangen. Bei Sedlmayr indes hatte es einen Denkprozess in Gang gesetzt, der für den Rest seines Lebens andauern sollte.
Gedankenverloren, tagträumend zog ihn Maria Franziska zur Kutsche. Zu Hause angekommen, ging der immer noch schweigende Braumeister an seinen Schreibtisch, machte sich einige Notizen und ging zu Bett.
Er träumte gut und viel in dieser Nacht.
Er träumte von einer Revolution, aber einer unblutigen.
Von einer Revolution des Bierhandwerks, wie es sie in seiner vieltausendjährigen Geschichte noch nicht gegeben hatte.
Denn was halfen alle Reformen des Ministers Montgelas? Zollfreiheit und Abbau der Handelsschranken, das war schön und gut. Er nahm den einen und gab den anderen. Aber bis zu einer Neuordnung der Brauerzunft war es noch ein weiter, weiter Weg. Auch die neue Malzaufschlagsordnung würde da wenig ändern. Solange es so viele Gesetze gab, alles so bürokratisch gehandhabt wurde und seine Brauerkollegen vom Phlegma beherrscht wurden, würde nichts weitergehen.
Daher wusste er gleich: Diese Revolution würde länger dauern als sein Menschendasein. Wenn er Erfolg haben wollte, würde er in Zukunft in anderen Dimensionen denken müssen – in denen einer ganzen Dynastie!
3. Kapitel
Robert Barclay ließ seinen Sekretär eintreten, während er am Fenster stand und sein Blick über die Themse ging. Hier am Südufer, in Bankside, befand man sich mitten in London. Einer der größten Städte der Welt – mittlerweile über eine Million Menschen, konnte man das glauben? Aber auch einer der dreckigsten und gefährlichsten.
Der Sekretär, ein klein gewachsener, schlanker Mann mit viel Brillantine in den Haaren, ging aus seiner ständig geduckt aussehenden Stellung in die Vertikale. Drückte den Rücken durch und stand stramm. »Sie wünschen, Sir?«
Barclay drehte sich um, ging auf seinen Adlatus zu. Er überragte ihn fast um einen Kopf. Er strich gedankenverloren durch seinen Vollbart und murmelte:
»Was, lieber Chester, sollen wir mit ihm machen?«
»Bitte um Entschuldigung. Mit wem, Sir, sollen wir was machen?«
»Mit diesem Bayern. Penetranter Mensch.«
Ein Licht der Erkenntnis durchzuckte das Gesicht des Sekretärs. »Ach, Sie meinen diesen Münchner Brauer?«
Schroffer als beabsichtigt erwiderte Barclay:
»Kennen Sie sonst noch einen Menschen aus dieser rückständigen Provinz?«
Chester schüttelte den Kopf. »Um Himmels willen, nein!«
Zerstreut ging Barclay zu seinem monumentalen Schreibtisch aus massivem Eichenholz, wühlte einige Sekunden in diversen Papieren herum und nahm einen Brief in die Hand.
Ein Brief, offensichtlich von einem Dolmetscher geschrieben. Er glaubte im Leben nicht, dass ein Hinterwäldler aus München der englischen Sprache mächtig war.
»So etwas habe ich noch nicht erlebt! Diese Impertinenz! Ein wildfremder Mensch möchte mich kennenlernen. Und besuchen! Und alles nur, um von mir zu lernen. Keine Manieren haben diese Bayern.«
Chester wagte sich aus der Deckung:
»Aber die Gastfreundschaft gebietet es …«
Barclay drehte sich schnell auf dem Absatz um. »Natürlich, das ist ja das Problem. Denn wenn ich den Brief richtig interpretiere, erwartet er mehr als rein diplomatische Gastfreundschaft. Und ich fürchte, wenn wir ihm geben, was er möchte, werden wir ihn nicht mehr los werden.«
»Das steht zu befürchten.«
»Also, ich möchte, dass Sie ihm wie folgt antworten: Er ist hier willkommen. Auch dazu, einen Blick hinter die Kulissen unserer ehrwürdigen Brauerei ›Barclay Perkins‹ zu werfen. Aber nur eine Woche lang. Dann muss ich verreisen, gleich wohin.«
»Wie Sie wünschen, Sir.«
»Und noch eines.« Chester war schon Richtung Tür unterwegs und drehte sich nochmals um.
»Wir warten mit der Einladung, bis die Übergabe des Throns von König George III. an seinen Sohn erfolgt ist.«
Chester nickte verständnisvoll, Barclay schüttelte den Kopf und murmelte: »Verdammter Regency Act«, bevor er ergänzte: »… und wir wissen, dass unser alter König mit seiner Geisteskrankheit gut untergebracht ist und keinen Anlass zu Skandalen gibt. Ich möchte nicht, dass wir uns vor diesem Hinterwäldler blamieren.«
Gabriel Sedlmayr konnte sein Glück kaum fassen. Hektisch wedelte er mit der Depesche in der Hand, während er suchend durchs Haus lief.
»Franzi, die Engländer haben geantwortet!«
Das war ja schneller gegangen als erwartet. Und sie hatten ihm auch die gewünschte Einladung ausgesprochen.
Seine Frau kam die Treppe herunter, an der Hand Franz Maria, ihren fast vier Jahre alten Sohn.
Gabriel Sedlmayr ignorierte für einen Moment, dass sein Sohn weinte, lief den beiden entgegen und umarmte seine Gattin. Die schaute alles andere als fröhlich drein.
»Musst du wirklich nach London reisen? Und gleich für so lange?«
»Es wird nicht für lange sein. Du wirst sehen, ich bin bald zurück. Und unser Leben wird sich ändern.«
»Woher weißt du eigentlich, dass ich unser Leben geändert haben möchte?«, fragte sie schnippisch zurück.
Sedlmayr nahm nun das Weinen seines Sohnes wahr, hob ihn auf den Arm und drückte ihn zärtlich. Streichelte seinen Kropf und die geröteten geweiteten Augen und fragte:
»Was ist los? Hat er wieder Schmerzen?«
»Ja, ich weiß manchmal nicht, wie ich weiter machen soll. Es gibt Tage, da ist alles fast normal, aber so wie heute …« Sie ließ den Satz unvollendet. Sedlmayr konnte mitfühlen. Ihr Sohn war mit einem Kropf und Glupschaugen auf die Welt gekommen. Nichts Ungewöhnliches in diesen Tagen, aber es gab immer noch keine richtige wirksame Behandlung. Derzeit probierten sie alles aus, was die Ärzte und Apotheker empfahlen. Mit durchwachsenem Erfolg.
Sedlmayr kam zurück zum ursprünglichen Thema: »Wie du sicher weißt, sind die Reiseregeln bei merkantilistischen Reisen seit dem Pariser Vertrag gelockert worden. Es sollte kein Problem sein, mir die Papiere für eine Reise nach London zu beschaffen. Dann bleibe ich höchstens vier Wochen dort, werde also in etwa drei Monaten bereits zurück sein.«
Franziska Maria Sedlmayr gab auf.
»Bist du sicher, dass deine Brauerei eine derart lange Abwesenheit von dir bereits verträgt?«
Gabriel Sedlmayr nickte zustimmend.
»Sicher. Kastulus ist ein hervorragender Brauer, der alle Facetten des Handwerks beherrscht.«
Frau Sedlmayr war immer noch nicht überzeugt.
»Schau her, Franzi«, bemühte er sich weiter, »ob das Bier gut wird oder weniger gut, steht derzeit nicht in meiner Macht. Vor drei Jahren hatten wir ein äußerst gutes Bier, im Jahr danach wieder nicht. Beim Sommerbier verhält es sich genauso.«
»Aber was, um Himmels willen, versprichst du dir von einem Besuch in London? Du verstehst dich doch aufs Bierbrauen wie kein Zweiter.«
»Viel, eigentlich alles. Wie du vielleicht weißt, ist diese Brauerei, die ich besuchen möchte, die größte Brauerei auf der ganzen Welt. Ich möchte sehen, wie solch eine moderne große Brauerei aussieht. Wie man dort den Prozess des Biermachens steuert, kontrolliert und bemisst. Wie man gutes Porterbier macht. Und vielleicht erfahre ich, wie man Biere herstellt, die so gut haltbar sind, dass wir unser Sommersudverbot endlich aufheben können. Unter Umständen finde ich sogar noch die richtige Medizin für unseren kleinen Franz Maria. England ist uns ja in vielen Dingen voraus. Und wenn ich all das weiß, was hier in München sonst noch niemand weiß, dann werde ich der beste Brauer Münchens werden. Und eines Tages vielleicht der größte auch. So einfach ist das.«
Den Sommer über gab es trotz Braupause noch einiges zu erledigen. Die Brauerei wuchs schnell, der Platz wurde knapp. Ein alter rückwärtiger Stall wurde umgebaut zum dringend benötigten Fasslager, im Sudhaus musste die Befeuerung erneuert werden. Hierbei spielte Sedlmayr mit dem Gedanken, anstelle von Holz die Pfannen mit Torf zu befeuern. Außerdem plante er gerne mit eigenen Erfindungen und Verbesserungen; und so wurde die Sudpfanne im Sommer mit einer von ihm selbst konstruierten Hebevorrichtung über einen Seilzug ausgestattet. Als dann schließlich noch die neuen Kühlschiffe, die er bei Tiroler Zimmerleuten bestellt hatte, pünktlich eingetroffen und installiert waren, da glaubte er, in Ruhe abreisen zu können.
Auf nach London!
4. Kapitel
Ende Oktober standen sie sich dann erstmals gegenüber.
Gabriel Sedlmayr hatte noch das Ende der Festlichkeiten abgewartet, die nach der vorjährigen Hochzeit zwischen Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese nun alljährlich Anfang Oktober auf dem Sendlinger Berg stattfinden sollten. Ein einträgliches Geschäft auch für die Brauereien, aber gleich nach dem letzten Pferderennen auf dem Feld, das zukünftig »Theresienwiese« heißen sollte, hatte er sich in die Kutsche gesetzt und war mit einigen großen Koffern Richtung England aufgebrochen.
Während Napoleon das französische Heer in Russland in die Katastrophe schickte, fuhr er fast zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Zuerst nach Mannheim, dann weiter mit dem Schiff rheinabwärts bis Köln. In Köln war er erneut auf eine Kutsche umgestiegen und über Antwerpen nach Ostende gefahren. Er hatte es so eilig gehabt, dass er gar nicht, wie es opportun gewesen wäre, sich noch diverse Brauereien im Rheinland oder in Belgien angeschaut hatte. Dennoch hatte er gelassen alle Schikanen an den diversen Zollstationen ertragen. Hatte elend lange Wartezeiten ausgehalten, sein Gepäck durchwühlen und seine Papiere von unhöflichen Beamten zerfleddern lassen, die überall Verschwörung und Spionage witterten. Aber sein Gewissen war rein. Er wollte nur nach London.
In Ostende bestieg er einen Frachtsegler. Nun war er wirklich aufgeregt. Als Erster seiner Familie verließ er den Kontinent. Wenn das sein Vater noch erleben dürfte! Sein Vater, der ihm Vorbild und Abschreckung zugleich gewesen war. Vorbild darin, sich nicht unterkriegen zu lassen. Abschreckung aber auch, wie tief man sinken kann, wenn das Glück einen verlässt.
Er erinnerte sich daran, wie sie damals, er selbst als ganz kleiner Bub, aus Maisach fortgegangen waren, verjagt regelrecht. Ihr einziges Möbelstück war ein altes Oberbett gewesen. Auf dem hatte die kranke Großmutter gelegen, darunter eine Schubkarre, die vom Vater Richtung München geschoben worden war, Mutter und Kinder waren hintendrein gelaufen. Und erst in München, dann später in Ellingen im Fränkischen, neu begonnen hatten.
Und nun segelte er Richtung England! Mehr als vier Wochen war er unterwegs gewesen, das Herz pochend vor Aufregung und Vorfreude. Als das Segelschiff in die schwierig zu kreuzende Themsemündung einfuhr, konnte er zuerst die Rauchwolken der zahllosen Kamine Londons sehen, kurz darauf einen ersten Teil dieses unüberschaubaren Häusermeers. Weit über eine Million Menschen lebten hier, während München nicht einmal 100.000 Köpfe zählte. Ein Moloch, aber ein sehr verlockender. Wie würde man ihn dort empfangen? Würde man sein Englisch verstehen? Ein Englisch, das er sich mühsam mithilfe eines Freundes beigebracht hatte. Und umgekehrt, wie käme er mit der englischen Sprache zurecht? Ohne die wäre sein Besuch sinnlos. Nur mit den Augen alleine würde er nicht genug verstehen.
Kurz nach Mittag fuhr Sedlmayrs Kutsche rumpelnd und knirschend in der Londoner City am Aldermanbury Square vor. Graue Wolken bedeckten den Himmel, London roch wie eine Räucherkammer. Es regnete in Strömen, als der Münchner Brauherr ausstieg und erst einmal bis zu den Knöcheln im Morast versank. Schimpfend setzte er vorsichtig einen Fuß vor den anderen, bis er tropfnass unter dem mächtigen Vordach der London Brewer’s Hall stand. Der Kutscher warf ihm seine beiden Koffer mehr nach, als dass er sie hinstellte, und machte sich eilends davon.
Nun wandte er seine Augen auf das imposante säulengesäumte Portal des Gebäudes, das wie ein fürstliches Gerichtsgebäude aussah, und doch nur den Wohlstand der Londoner Brauer repräsentierte.
Fette Goldbuchstaben, in weißen Marmor eingekerbt, verkündeten: »In God is all our Trust«, für Sedlmayr nach der anstrengenden Reise eine irgendwie beruhigende Nachricht.
Barclay hatte die Brewer’s Hall als ersten Treffpunkt vorgeschlagen. Nicht ohne Hintergedanken. Zum einen konnte Sedlmayr dort Quartier nehmen – es gab ein paar Zimmer für Brauherren, die zu Besuch in London weilten, womit Sedlmayr leicht zu überzeugen gewesen war.
Zum anderen konnte er den Bayern, sollte dieser über Gebühr lästig oder unsympathisch sein, charmant und unkompliziert an einen anderen Brauer weiterreichen.
Dies schien jedoch nicht notwendig zu sein. Knapp eine Stunde später erschien Sedlmayr im Salon mit gesäuberten Schuhen und frischem Gehrock. Neugierig musterte er den vornehm ausgestatteten Raum, die dunklen Holztäfelungen, die edel gepolsterten Möbel und goutierte die völlige Abwesenheit von jeglichem Staub oder Spinnweben. Die schweren Teppiche schienen jeden Laut zu verschlucken. Der Sekretär der Assoziation führte ihn zu einer Nische mit drei Sesseln, nicht weit vom anheimelnd knisternden Kaminfeuer entfernt.
Die kleine Peinlichkeit, als er den Sekretär Chester, in der Annahme, er sei Robert Barclay, devot mit »Mr. Barclay, I presume«, ansprach, sorgte gleich für etwas Heiterkeit. Das Eis brach schnell und tatsächlich, Barclay mochte den bayerischen Brauer vom ersten Moment an. Auch Sedlmayr fand den gut zwanzig Jahre älteren Engländer sofort überaus sympathisch.
In knappen Worten, aber betont höflich, hieß Barclay seinen Gast vom Kontinent willkommen, fragte nach der Befindlichkeit nach der langen Anreise und ob die Unterkunft hier im Hause zu seiner Zufriedenheit sei. Sedlmayr verstand das meiste, nickte und bejahte.
Barclay fragte nach einer Erfrischung. »Would you prefer tea or Whisky?«
Sedlmayr hatte beides noch niemals getrunken, also folgte er seinem Gastgeber und nahm einen Whisky. Er hustete nach dem ersten Schluck, scharf und torfig war das schottische Gebräu, und er wusste wieder einmal mehr, warum er lieber Bier trank.
Barclay ließ sich noch ein wenig über die alte, seit dem Mittelalter bestehende Tradition der London Brewer’s Guild aus, vergaß auch nicht, den großen Brand von 1666 zu erwähnen, bei dem die alte Brewer’s Hall zerstört worden war, bevor die drei Herren dann zum Dinner geleitet wurden.
Von da an setzte sich jeden Morgen, nach einem ausgiebigen Frühstück im kleinen Salon der Brewer’s Hall, Sedlmayrs Kutsche in Bewegung. Vorbei an der London Wall, der alten römischen Stadtmauer, umfuhr die Kutsche die City, passierte Bishopsgate und die London Bridge, um am Themse-Ufer entlang zur Brauerei Barclay Perkins zu gelangen. Die Brauerei befand sich an der Bankside Road und hatte ihren Haupteingang an der Park Street.