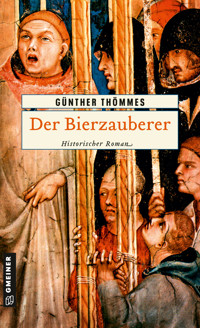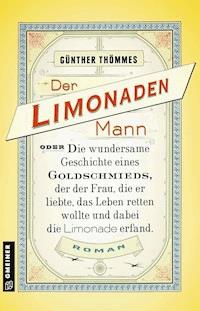Titel
Günther Thömmes
Der Fluch des Bierzauberers
Historischer Roman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2010
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/Korrekturen: Daniela Hönig / Sven Lang, Katja Ernst
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Der König trinkt« von David Teniers d.J. / visipix.com
ISBN 978-3-8392-3510-2
Widmung
Dieser Roman ist allen Brauern
gewidmet, die auch in schlechten Zeiten
mit Leib und Seele
Bier gebraut haben,
heute brauen und
zukünftig brauen werden.
Der Dreißigjährige Krieg war eine Kette von Ereignissen, die in der europäischen Geschichte ohne Beispiel war und bis heute ist. Dieser Krieg, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz allgemein der ›Große Krieg‹ genannt, forderte auf deutschem Boden mehr Opfer als alle Kriege zuvor und danach. In manchen Regionen starben bis zu sechzig Prozent der Bevölkerung. Dies war umso dramatischer, als diesem Krieg von 1555 bis 1618 die längste Periode in der deutschen Geschichte vorausgegangen war, die man als ›Friedenszeit‹ beschreiben könnte. Leider hatten sich in dieser Zeit Spannungen aufgebaut und Bündnisse gebildet, die nur darauf warteten, sich im Krieg zu entfesseln. Die verheerende Kombination aus Krieg, unfassbarer Brutalität, Seuchen und Hungersnöten, verbunden mit fehlender Staatsgewalt und im ganzen Lande marodierenden Söldnerheeren sorgte dafür, dass mehr als nur eine Generation von diesem Krieg traumatisiert wurde, und diese Katastrophe, trotz vieler anderer fehlender Glücksmomente, bis heute mehr als alle anderen im kollektiven deutschen Gedächtnis hängen geblieben ist. Auch in die Historie des Bieres ist das 17. Jahrhundert als dunkle, um nicht zu sagen rabenschwarze Periode eingegangen. Mit dem Krieg wurden, durch die Zerstörung der Getreidefelder und Hopfengärten, den Bauern ebenso die Lebensgrundlagen entzogen wie den Brauern. Doch selbst in den finstersten Zeiten gab es immer Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen wollten. Von diesen Menschen handelt dieser Roman.
G.T., im Herbst 2009
Keine Szene für Kleist
Homburg: Die Steuer ist, mein Fürst, zu hoch.
Kurfürst: Wenn Ihr, Herr Landgraf, nur ein einzig Mal mit Eurer gottverfluchten Brauerei in Weferlingen und der Steuer mit ins Zelt zu treten – Euch noch unterfängt – (Der Kurfürst ächzt vor Gicht)
Homburg: Ich wüsste nur zu gern, mein Fürst, wie die Canaille heißt, die gegen mich bei Euch hier. Lebt wohl. (Er humpelt hinaus)
(Aus: Herbert Rosendorfer: Der Prinz von Homburg)
Der Fluch
Ein letztes Mal erhob der alte Braumeister zitternd seinen einfachen, geschnitzten Krückstock und deutete anklagend auf den sehr viel jüngeren Regenten, der blass, aber gefasst auf seinem Thron saß. Nachdem so die leidenschaftliche, hasserfüllte Rede des Alten offensichtlich beendet war, herrschte plötzlich Schweigen im Thronsaal des Cöllner Schlosses.
Fassungsloses Schweigen.
Der alte hünenhafte Mann wusste mit Bestimmtheit, dass er soeben, hier und jetzt, sein Todesurteil unterzeichnet hatte.
Sein Dienstherr, der Prinz, stand neben ihm, hielt den Knauf seines silbernen Stocks so fest umklammert, dass die Adern auf der Hand hervortraten und kratzte sich mit dessen Ende verlegen am Stumpf des nicht mehr vorhandenen rechten Beines. Sein sonst so forsches, souveränes Auftreten war dahin. Er konnte nur noch hoffen, dass er nicht mit in den Strudel der Vergeltung hineingezogen werden würde, der diesem Eklat unweigerlich folgen musste.
Die Höflinge, die der skandalösen Tirade beigewohnt hatten, duckten sich, als hätten sie Angst, gleich vom Orkan einer Wutrede ihres Regenten hinweggefegt zu werden.
Die Soldaten der Leibgarde musterten sich gegenseitig, so als würden sie bereits untereinander abmachen, wer von ihnen dem Erschießungskommando zugeteilt werden würde.
Nur der Sohn des alten Mannes, der Jüngste in der kleinen Gruppe, die vor dem Thron stand, schaute mit Besorgnis zu seinem Vater hinüber. Sein Herz bebte und er hoffte inständig, der Regent möge Gnade walten lassen und seine Familie nicht zerstören.
Der Fürst erhob sich von seinem Thron. Einige Anwesende räusperten sich aus Verlegenheit. Mit herrischer Geste gebot der Fürst zu schweigen.
Dann öffnete er den Mund und begann, den Saal mit seiner Stimme zu füllen, lautstark, wohlüberlegt und mit ausdrucksstarken Gesten; es war eine Rede, von der alle ahnten, dass sie ein grausames Ende für den alten Mann einleiten würde.
Und hätte eine gnädige Vorsehung dies nicht verhindert, wäre es auch genau so gekommen …
Erster Teil:
Cord und Magdalena im Großen Krieg – 1631 bis 1652
1.
Ein kalter Regen, in den sich noch letzte Reste von Schnee mischten, fiel auf Magdeburg nieder und sorgte dafür, dass die Menschen in den Häusern blieben. Der Brauherr Cord Heinrich Knoll stand in seiner Braustube und verfluchte einmal mehr sein Schicksal, in dieses Jahrhundert hineingeboren worden zu sein.
Seit vier Generationen schon hatte seine Familie das Brauhaus in der Magdeburger Krockentorgasse betrieben, genau zwischen dem Stadttor und der Kirche St. Jakob gelegen, aber nie war es so schwer gewesen wie in dieser Zeit. Sieben Mäuler – sich eingeschlossen – hatte er zu stopfen mit dem, was sein Brauhaus eintrug.
Denn neben dem reinen Kampf ums Überleben hatte er obendrein seine Berufsehre, den Ehrgeiz, stets und immer das beste Bier der Stadt zu brauen. Obwohl beide Herausforderungen im Laufe der letzten Monate immer schwieriger zu meistern geworden waren, litt im Moment seine Ehre als Brauer am stärksten unter der Situation. Arm waren sie ja nicht, die Knolls. Viele gute Jahre hatten der Familie Knoll ermöglicht, einen soliden Wohlstand aufzubauen. Die Galerie aus Ölgemälden seiner Vorfahren, die repräsentativ in ihrer guten Stube hing, bestätigte dies anschaulich. Etwas finster dreinblickende Männer waren sie alle gewesen, die alten Brauer der Familie Knoll. Aber tatkräftig und zupackend allemal. Nur, was half einem das Geld und eine erfolgreiche Vergangenheit, wenn es nichts oder zu wenig zu beißen gab?
Seit der Große Krieg, wie die später Dreißigjähriger Krieg genannte Schlächterei im Volksmund hieß, auch seine Heimatstadt, die alte Hansestadt Magdeburg, erreicht hatte, war es mit der Qualität des Bieres immer mehr bergab gegangen. Nicht dass so viel weniger getrunken wurde. Beileibe nicht, die Keller leerten sich weiterhin recht schnell. Das lag jedoch leider nicht daran, dass Knolls sowieso schon preisgünstiges Broyhan-Bier, ein süß-säuerliches und leicht weinig schmeckendes Bier, so beliebt war. Vielmehr war die Ursache, dass die wirklich guten Biere – die Garley aus dem gleich im Norden liegenden Gardelegen, das Bitterbier aus dem genauso nahen, nur südöstlich von Magdeburg gelegenen Zerbst oder das berühmteste von allen, das Duckstein aus dem westlich gelegenen Königslutter – nicht mehr oder nur noch unter großen Schwierigkeiten in die Stadt hineinfanden.
Sogar der Wettinische Keuterling, ein mittelprächtiges Gebräu aus dem Herzogtum Magdeburg, wurde, wenn es denn angeboten wurde, lieber getrunken als Knolls beinahe hopfenloses, süß-saures Broyhan-Bier, dessen Rezept er dem erfolgreichen Original aus Hannover nachempfunden hatte. Allein das Wasser der Elbe eignete sich nicht für den Broyhan. Da die Stadt auf Fels gegründet war, gab es keine Brunnen, sodass sie sich mit dem häufig verdreckten Flusswasser begnügen mussten.
Knoll hatte in Hannover das Bierbrauen gelernt, bei den Nachkommen des legendären Braumeisters Cord Broyhan. Sein eigener Vater hatte ihn mit dem Vornamen des berühmten Vorbilds versehen und taufen lassen. Auch er war erfolgreich in dessen Fußstapfen getreten, hatte das Bierbrauen am Ort der Entdeckung dieses beliebten Bieres gelernt, hatte alle Lehrbücher über die Bierbrauerei studiert, die es überhaupt gab, und schließlich das Brauhaus seines Vaters übernommen.
Jahrelang hatte er geglaubt, er könne nichts anderes brauen als Broyhan. Und jahrelang hatte sein Magdeburger Brauhaus sich auch erfolgreich mit der auswärtigen Konkurrenz arrangiert, was beileibe nicht leicht gefallen war, da Magdeburg doch geradezu umzingelt war von berühmten Brauereien.
Das waren noch Zeiten gewesen, als in der überaus fruchtbaren Magdeburger Börde noch genug von dem berühmten Börde-Brauweizen wuchs! Jedes Frühjahr und jeden Herbst wurden große Mengen davon an die gut zahlenden Brauer nach Königslutter und Gardelegen geliefert. Aber auch für die einheimischen Brauer blieb genug übrig, um gutes Bier herstellen zu können. Im Gegengeschäft für den Weizen hatte so manches Fass Duckstein-Bier auf rumpelnden Karren das Magdeburger Stadttor passiert. Diese Köstlichkeit aus Königslutter wurde den Wirten fast aus den Händen gerissen. Ja, wenn er so ein Brauwasser hätte! Das wäre herrlich …
Die Stadt Gardelegen hatte sich auf andere Weise für die Weizenlieferungen revanchiert. Neben Garley-Bier wurde ebenso der nicht minder berühmte Hopfen exportiert. Auch Knoll hatte jahrelang von der Möglichkeit profitiert, günstig erstklassigen Gardelegener Hopfen zu bekommen, auch wenn der schwach gehopfte Broyhan nur wenig davon benötigte.
Das Zerbster Bier hatte immer ohne gegenseitigen Handel den Weg in die Stadt gefunden. Magdeburg hatte das Stapelrecht für diesen Abschnitt der Elbe, und so musste jedes Fass Zerbster Bitterbier hier verschifft – und natürlich verzollt werden. Der Zoll war meist in Naturalien entrichtet worden.
Alle Brauer waren zufrieden gewesen, die Biertrinker der Hansestadt rühmten die Vielfalt der Biere, die hier im Angebot waren. Auch der Magdeburger Broyhan war erheblich besser gewesen als heutzutage. Sogar der Ratsherr Otto von Gericke, einer der bekanntesten Bürger der Stadt, ein Mann, auf dessen militärischem Geschick nun die Hoffnungen vieler Magdeburger ruhten, war regelmäßig und gern zu Gast in Cords Brauhaus gewesen.
Zu dieser Zeit war besonders ganz Mitteldeutschland durch die, wie eine biblische Heuschreckenplage, über alles herfallenden Söldnerheere bedroht. Sie plünderten, brandschatzten und fraßen ganze Landstriche leer. Aufgrund dieser Verwüstungen, gab es seit zwei Jahren kaum noch Gerste oder Weizen. Und das Wenige von Qualität wurde zum Brotbacken benötigt. Die Brauer bekamen lediglich den Ausputz, das Hühnerfutter. Andere Getreidesorten waren ebenso unerschwinglich geworden. Ein Scheffel Roggen, der 1620 noch zwei Reichstaler gekostet hatte, war mittlerweile nicht mehr unter zwölf Talern zu haben. Diese Taler waren zwar keine reinen Silbertaler mehr, sondern mit Kupfer gestreckt, aber immer noch genauso teuer.
Der Hopfen war aus dem Magdeburger Broyhan komplett verschwunden. Und seitdem bekannt geworden war, dass der verhasste Generalissimus des papistischen Habsburgerkaisers, Albrecht von Wallenstein, dem Wein abgeschworen hatte und am liebsten das Weizenbier aus seiner eigenen Brauerei trank, wurde Knoll regelmäßig das Opfer von Schimpfkanonaden seiner Kunden. ›Braut endlich mal ein Bier, das zu uns Protestanten passt. Bier mit Weizen drin ist was für Katholiken!‹
›Wenn es dem Wallenstein schmeckt, wie könnte es uns dann munden?‹
Knoll hatte nur eine Antwort parat: ›Wenn der Krieg so weiter geht, dann gibt es bald gar kein Bier mehr, auch keines mehr, über das ihr euch beschweren könnt.‹
Wieder einmal hatten zu viele der Machthabenden, ganz besonders aber die Kaiser Matthias und Ferdinand aus dem Geschlecht der Habsburger, die alte Diplomatenweisheit ignoriert: ›Krieg ist leicht anzufangen, die Mitte aber schwer und mühsam und der Ausgang ungewiss.‹
Dieser Krieg befand sich genau in der Mitte, in der schweren und mühsamen Mitte. Und zwischendrin nun die ›Burg der Mägde‹, die eine Jungfrau im Wappen führte. Sie war nämlich erheblich unter Druck geraten. Als ›Unser Herrgotts Kanzlei‹, als ›Heilige Wehrstadt des Protestantismus‹ war Magdeburg die erklärte Hochburg des Widerstandes gegen die vom Kaiser in Wien angeordnete Rekatholisierung und hatte so in der Vergangenheit bereits des Öfteren unter der Reichsacht gestanden. Dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 war eine ungewohnt lange Zeit ohne größeres Kriegstreiben gefolgt. Über fünfzig Jahre lang konnten sich die Bauern wie auch Handel und Handwerk an den Früchten ihrer Arbeit freuen. Magdeburg wurde reich. Durch die gleichzeitige Verbreitung der Reformation sowie dem Erstarken der Gegenreformation war der Friede anfänglich nur ins Wanken geraten und schließlich 1618 vom Kaiser und den Böhmischen Ständen gänzlich beendet worden. Seither herrschte Krieg, der von den Herzögen Wallenstein und Maximilian I. von Bayern zuerst einmal nach Böhmen und in die Kurpfalz getragen worden war.
Erst fünf Jahre später – der Krieg war längst überall in Deutschland angekommen – stellte der Rat von Magdeburg fest, dass es wohl unmöglich sein würde, sich in Zukunft aus dem Krieg herauszuhalten und begann aufzurüsten. Eine Kriegsanleihe war erhoben worden, dieser Kriegszehnte war von allen Bürgern zu entrichten; er hätte ursprünglich sogar verzinst werden sollen. Es dauerte jedoch noch einmal sechs Jahre, bis die wirtschaftliche Not so sichtbar war, dass der alte Rat abgesetzt wurde. 1630 gab es erste Unterstützung von schwedischen Soldaten, aber seither war Magdeburg ein protestantischer Dorn im katholischen Auge des Kaisers. Vor allem, weil die Stadt mit der Zeit der einzige echte Verbündete des Schwedenkönigs geworden war.
Der kaiserliche General Tilly, der nach Wallensteins Entlassung aus des Kaisers Diensten die Führung der Armeen der Katholischen Liga übernommen hatte, hatte sich die Eroberung Magdeburgs, die er, teils zynisch, teils religiös-fanatisch, ›die Verheiratung der Magdeburger Jungfrau mit dem katholischen Kaiser‹ nannte, als oberstes Kriegsziel gesetzt.
Seit Anfang März 1631 lagerten Tillys Truppen vor Magdeburg, hatten Schanzen gebaut, Laufgräben ausgehoben und ihre eigene Stadt vor der Stadt errichtet. Dennoch war den Bürgern innerhalb der Stadtmauern die meiste Zeit nicht bange gewesen. Denn der schwedische König Gustav Adolf, der unbesiegbare ›Löwe aus Mitternacht‹, war mit Verstärkung unterwegs. Er würde General Tilly auf seine gierigen Pfoten klopfen und wieder vertreiben. Zur Befestigung der Wehranlagen hatten die Bürger sogar Steine aus den Mauern des Bischofspalastes herausgebrochen, sodass dieser langsam zerfiel. Der Bischof residierte längst in Halle.
Cord Heinrich Knoll, der keine Ahnung hatte, wie falsch er mit seiner Hoffnung auf schwedische Verstärkung lag und der nicht wusste, dass sein Schicksal eigentlich schon besiegelt war, kämpfte mit anderen, banaleren Problemen: Im Moment versuchte er noch mit Resten eines ziemlich dünn geratenen Malzes einen letzten Sud eines ebenso dünnen Broyhans zu brauen, bevor der anbrechende Sommer der Brausaison ein Ende setzen würde. Es war ein ungewöhnlich kaltes, trockenes Frühjahr gewesen, bis vor einigen Tagen der Regen eingesetzt hatte. Nur aufgrund des kühlen Wetters konnte im Mai noch gebraut werden. Normalerweise war damit Ende April Schluss, auch wenn es in Magdeburg nicht gesetzlich geregelt war wie in Bayern, mit dem Namenstag des Heiligen Georg, dem 23. April, aufzuhören. Er trieb seinen Brauerburschen an, das Feuer ordentlich zu schüren. Dass es sich dabei um seinen eigenen Sohn handelte, spielte keine Rolle. »Los, Gisbert, blas’ schon anständig rein in die Glut, auf dass wir eine gute Hitze haben!« Der achtjährige Junge, mit einer langen, gegerbten Lederhose und einem verdreckten Leinenhemd gekleidet, schwitzte und pumpte an dem großen Blasebalg, als ginge es um sein Leben. Eigentlich war Knoll froh, dass ihm von den neun Kindern, die seine Frau Lisbeth zur Welt gebracht hatte, wenigstens fünf geblieben waren. Gisbert, den Ältesten, hatte er sogar schon zur Brauerei angelernt. Die drei Mädchen waren meist bei der Mutter in der Stube, wobei sie auf den Kleinsten, den zweijährigen Ulrich, achtgaben.
Das Geschäft war so schlecht geworden, dass er schon vor der letzten Saison seine beiden Brauerburschen fortgeschickt hatte. Nun waren nur noch er und Gisbert im Brauhaus tätig. Cord Heinrich Knoll war in der Mitte des ersten Jahrzehnts im neuen Jahrhundert geboren worden und somit siebenundzwanzig Jahre alt. Baumlang und hünenhaft stand er da, mit Händen groß wie Bratpfannen, selbst der bei Bierbrauern obligatorische Bierbauch fehlte, den hatten harte Arbeit und karge Kost dahinschmelzen lassen wie das köstliche Schmalz, das – in besseren, früheren Tagen – in der großen, eisernen Pfanne auf dem Herd ausgelassen wurde. Schulterlanges, schwarzes Haar verdeckte bisweilen die Sicht auf die braunen, treu blickenden Hundeaugen, wie seine Lisbeth sie nannte. Ein mächtiger Bart komplettierte die imposante Erscheinung des Magdeburger Brauherrn. Er nahm die Eimer mit dem Malzschrot, als wögen sie nichts und wuchtete sie gekonnt ins Maischgefäß. Dann füllte er mit heißem Wasser aus dem Kessel auf, unter dem Gisbert eine Höllenglut entfacht hatte. »Gut so, weiter so, mein Junge!«, feuerte Knoll seinen Sohn an, der alle Anlagen hatte, ein Hüne wie sein Vater zu werden. Er brauchte das Feuer später zum Kochen der Bierwürze, da sollte es zwischendurch nicht ausgehen.
»Ich gehe derweil zum Eiskeller nach dem Rechten schauen«, rief er seinem Sohn zu und verschwand durch eine Öffnung in der Wand in einen kleinen Stollen, hinein in die Dunkelheit. Gisbert starrte in die Feuerglut.
Dieser Sud, den die beiden Knolls gerade ansetzten, sollte der letzte gewesen sein. Nicht nur der Saison, sondern in der Geschichte von Knolls Magdeburger Brauhaus.
Für alle Zeiten! Man schrieb den 18. Mai 1631.
Übermorgen würde sich die Stadt ergeben müssen.
General Tilly rüstete zum Sturm auf Magdeburg …
2.
Magdalena Bacherl war eine Soldatenfrau. Seit fast sechs Jahren, seit sie einander in der Nähe von Schweinfurt gefunden hatten, folgte sie ihrem Mann, dem Söldner Johannes, im Heerestross quer durch Deutschland. Sie wusch ihrem Mann die Wäsche, pflegte seine Wunden, gebar die gemeinsamen Kinder, die sie auch allesamt gleich wieder beerdigt hatte, und half beim Ausplündern der Toten nach der Schlacht sowie bei den Beutezügen, wenn sie eine Stadt erobert hatten. Gemeinsam mit anderen Soldatenfrauen reinigte sie die Scheißplätze der Soldaten; alles war besser, als allein irgendwo unterwegs zu verrecken.
Das Leben im Soldatenlager war grausam, hart und ohne eine enorme Robustheit und den unbeirrbaren Glauben, dass das ganze Leben nur eine Prüfung des einen, des ewigen Gottes sei, nicht zu ertragen. Magdalena hatte beides. Sie war, als Ehefrau eines erfahrenen Söldners, relativ gut beschützt, selbst in einem Tross voll ewig lüsterner Soldaten. An eine wie sie Hand anzulegen, hätte den sicheren Tod bedeutet. Zu wichtig waren allen Soldaten ihre mit dem Tross ziehenden Familien. Ihre jeweils eigene, kleine Welt. Das war alles, was sie hatten. Es war wenig genug, aber zumindest gehörte es ihnen!
Sie war einst ein hübsches junges Ding gewesen, mit grünen Augen, langen, hellbraunen Haaren und kleinen, festen Brüsten, mit Träumen dazu, wie sie jedes Mädchen hatte: einen guten Ehemann haben, einige Kinder kriegen und den Hof der Eltern bewirtschaften.
All dies war in Rauch aufgegangen, als eine Gruppe ausgemusterter, halb verkrüppelter, ehemaliger Landsknechte, hungrig wie ein Rudel Wölfe, den väterlichen Hof in der Nähe von Frankfurt überfallen hatte. Erst wurde alles leer gefressen, dann die Eltern gefoltert. Obwohl bei ihnen nichts zu holen war, wurden die Mutter sowie der Vater grausam getötet und der Hof in Brand gesteckt. Nie würde sie die Schreie vergessen, den Rauch, den Gestank, auch wenn ihr alles mittlerweile wie die Erinnerung einer anderen Person aus einem früheren Leben vorkam. Sie und ihre Geschwister hatten sich danach in alle Winde zerstreut, sie rechnete auch nicht damit, jemals einen Bruder oder eine Schwester wiederzusehen. Sie hatte sich dann, wie viele Heimatlose und Entwurzelte, einem der vorbeiziehenden Heere angeschlossen. Zuerst hatte sie Handlangerdienste, Räum- und Wascharbeiten verrichtet und versucht, sich ihrer Haut zu erwehren, so gut es ging. Bis sie Johannes aufgefallen war. Der war ein fescher, tapferer Söldner, er hatte sie zu sich genommen und bald geheiratet. Vier Kinder hatte sie ihm bereits geboren. Zwei Mädchen, zwei Jungen. Keines hatte das erste halbe Jahr überlebt. Zu anstrengend war das Leben im Heerestross, zu unsauber und voller Krankheiten für Neugeborene. Über fünf Jahre lang waren sie, vom Frühjahr bis zum Herbst, nun bereits von Schlacht zu Schlacht gezogen und nur mit viel Glück am Leben geblieben. Jetzt lagerten sie seit über zwei Monaten vor Magdeburg und hofften, dass die reiche Stadt bald gestürmt werden würde. Und das alles nur, weil die Magdeburger sich, rätselhafterweise, geweigert hatten, den geforderten Tribut von lächerlichen einhundertfünfzigtausend Talern zu zahlen.
Vergebens hatten die Menschen auf der anderen Seite, innerhalb des Belagerungsrings, bislang auf das Eintreffen des schwedischen Heeres gehofft. Den etwa fünfunddreißigtausend Menschen, die sich hinter den Stadtmauern versammelt hatten, wurden die Vorräte knapp. Jetzt war es langsam vorbei, die Stadt würde sich entweder ergeben müssen oder eine letzte Schlacht um ihr Überleben ausfechten. Ein Sieg über Magdeburg, das würde der Höhepunkt im Soldatenleben eines jeden Mannes sein, der hier in General Tillys Heer stand. Der andere Anführer des Heeres, der Reitergeneral Pappenheim, der als der eigentliche Antreiber des Angriffs galt, hatte die Magdeburger Bürger schon vorab einmal für vogelfrei erklärt. Da galt es, reichlich Beute zu machen. Vielleicht so viel sogar, dass man aufhören konnte mit dem Sengen, Morden und Plündern. So oder ähnlich hörten sich auf jeden Fall die großspurigen Reden an, die Abend für Abend im katholischen Lager geführt wurden.
Früh am Morgen des 20. Mai loderte die aufgehende Sonne bereits über der dem Untergang geweihten Stadt. Der Regen hatte aufgehört. Das Blau des Horizonts wurde nur hier und da von kleinen, weißen Flaumwölkchen getrübt. Die Heeresführung trommelte alle Soldaten für das Gebet zusammen. Feldherr Johann t’Serclaes Graf von Tilly war bereits Anfang Siebzig – doppelt so alt wie sein Pendant Pappenheim –, von mittlerer Statur und sturem, fanatischem Charakter. Unter seinen buschigen, grauen Augenbrauen erblickte man, trotz des Alters, feurige Augen, die seine scharfen Gesichtszüge unterstrichen. Seine hagere Erscheinung zeugte von Bescheidenheit und Disziplin – nicht umsonst trug er den Spitznamen ›Der Mönch‹ –, und er erwartete die gleichen Eigenschaften von seiner Truppe. Im Normalfall …
Der Herzog aus Brabant und Gottfried Heinrich zu Pappenheim hatten beide ihre prächtigsten Kriegsgewänder angelegt.
Tilly trug einen schwarzen, ledernen Kürass mit einer dicken, mehrfach gefalteten, leinenen Halskrause, darüber einen silbern schimmernden Harnisch. Sein Victor-Emanuel-Bart, nach Musketier-Art, war gezwirbelt und gewichst worden wie nie zuvor. Seine polierten Stiefel glänzten. Sogar sein Pferd war geschmückt, denn schließlich war Tilly ja, seiner eigenen Einschätzung zufolge, auf dem Weg zu einer Hochzeitsfeier.
Pappenheim trug eine silberne Rüstung und einen Lederkoller, darüber jedoch nur einen kleineren, den spanischen Kragen, der Golilla genannt wurde. Auch er hatte einen Musketier-Bart, allerdings nicht gezwirbelt, sondern auf Oberlippe und Kinn mächtig aufgekämmt, sodass sein Gesicht voller und männlicher wirkte.
Siegessicher sahen sie beide aus, als sie die Hände ergriffen, zum Himmel hoben und zum Allmächtigen Gott und der Jungfrau Maria flehten, für Kaiser, Papst und Vaterland! Und während die Generäle mit ihren Offizieren, aber auch mit den Soldatenfrauen wie Magdalena, inbrünstig darum beteten, ihrem Gott, dem Gott der Katholiken, die Jungfrau Magdeburg zu Füßen legen zu können, glänzten die Augen der gemeinen Soldaten aufgrund der bevorstehenden Beute. Es waren ungarische, kroatische, polnische, italienische, spanische, französische und deutsche Söldner. Der Krieg war längst kein deutscher Krieg mehr, sondern ein europäischer.
Die reiche Hansestadt bestand aus drei Teilen, die jeweils durch tiefe, künstlich angelegte Wasserkanäle sowie eigene Stadtmauern voneinander getrennt waren: Die Südenburg, die Altstadt und die nördlich gelegene Neustadt. Die Neustadt war im Krieg unmöglich zu halten und daher schon längst geräumt; leer und teils abgebrannt, gab es dort nichts, was noch von Wert für Tilly gewesen wäre. Die Südenburg war klein und von wenig Interesse. So konzentrierte sich alles auf die drei nördlicher gelegenen Stadttore der großen, wohlhabenden Altstadt. Zwei weitere südlichere Tore, das Südenburger-Tor, direkt beim Dom gelegen, sowie das Ulrichstor wurden noch sicher gehalten; also waren die Lukasklause, das Krockentor sowie die Hohe Pforte im Norden als Angriffsziele ausgemacht worden.
Elbseitig gab es nur ein Tor. Die beiden Schanzen auf der anderen Uferseite, die Krockow’sche und die Zollschanze, waren bereits seit längerem unter der Kontrolle der katholischen Armee, und die schmalen Brücken, an denen sich hinter den Schanzen das Holzmarschtor, die Zugbrücke und das eigentliche Elbestadttor befanden, waren teilweise zerstört worden. Bewacht wurden sie nur, damit niemand auf diesem Weg aus der Stadt fliehen konnte.
Johannes hatte beschlossen, dass sie beide durch das Krockentor in die Stadt einfallen wollten, welches Tilly, zusammen mit der Hohen Pforte, seiner Truppe zugeteilt hatte. Pappenheims Soldaten hingegen würden hauptsächlich durch die Lukasklause hineinstürmen. »Beim Krockentor, da sind gleich zwei Kirchen, St. Augustin und St. Jakob, und jede Menge reiche Bürgerhäuser mit fetten Pfeffersäcken gleich drum herum«, frohlockte er vorab.
Die Stadttore waren bald gestürmt und die reiche Hansestadt lag vor ihnen wie auf dem Silbertablett. Als Magdalena dann mit den johlenden Soldaten, etwa sechsundzwanzigtausend an der Zahl, in die gefallene Schönheit eindrang, spürte sie gleich, dass heute irgendetwas anders war. Des Öfteren hatten sich die Truppen bereits über Ortschaften und Städte hergemacht, die es gewagt hatten, dem Kaiser und der Katholischen Liga zu trotzen. Aber noch nie war die Stimmung so aufgeladen gewesen wie heute. Gewalt, Zorn, Übermut, Siegestaumel und Lüsternheit lagen in der Luft, dies allerdings vielfach verstärkt durch Unmengen an Wein und Bier, die Tilly seinen Truppen für die Siegesfeier bereitgestellt hatte. Magdalena hatte ein äußerst ungutes Gefühl, eine dumpfe Vorahnung, dass heute noch mehr Gräueltaten passieren würden als sonst. Sie wollte nur schnell hinein in die Stadt, zusammenraffen, was halbwegs von Wert erschien, und wieder hinaus. Natürlich wusste sie, dass es immer Landsknechte gab, die Frauen schändeten und Bürger quälten, um deren Geldverstecke zu erfahren. Aber meist in einem Rahmen, bei dem die Feldherren beide Augen zudrückten. Heute, das spürte sie bereits am frühen Morgen, würde alles anders ablaufen.
So ließ sie sich gleich zu Beginn nach hinten fallen, während ihr Mann Johannes an vorderster Front losstürmte. Er, der mittlerweile einer der dienstältesten der gemeinen Soldaten war, hatte so viel erlebt, dass ihn andere Männer seines Zuges bereits für ›gefroren‹, also für unverwundbar, hielten. Tatsächlich trug Johannes in seinen Taschen diverse Utensilien, die ihm als Talisman dienten und ihm diese Unversehrtheit garantieren sollten. Ein Stück Bocksbart, ein Wolfsauge und eine Gemskugel sollten dazu auf jeden Fall ausreichen.
Magdalena wartete am Stadttor, dessen in die Stadtmauer integrierter Geschützturm wie auch das vorgesetzte Hornwerk gleich zu Beginn des Sturms aufgegeben worden waren, um in dem entstandenen Gedränge weiterzukommen. Sie vernahm bereits die ersten Schreckensschreie der einsetzenden fürchterlichen Gemetzel und sah, wie die ersten blutigen Leiber über die Stadtmauer hinunter in den Kanal stürzten. Als sie nach dreißig endlos scheinenden Minuten innerhalb der Stadtmauern angekommen war, glaubte sie sich in der Hölle wieder. Blut floss in Bächen die Straßen hinunter und färbte das Pflaster tiefrot.
Anfangs trafen die Eroberer noch auf erbitterten Widerstand der Bürger Magdeburgs. Siedendes Wasser ergoss sich aus den Fenstern in die engen Gassen, auf die Köpfe der vor Schmerz aufschreienden Söldner. Aus dem Hinterhalt der Kellerfenster jagten Pistolenkugeln in die Beine und Bäuche der Eindringlinge. Der Widerstand war jedoch bald im Keim erstickt. Magdalena, die bislang geglaubt hatte, alle entsetzlichen Fantasien der Soldaten seit Jahren zur Genüge zu kennen, wurde bereits in den ersten Stunden eines grausamen Besseren belehrt. Vor einem Brauhaus, nur einige Häuser vom Krockentor entfernt, standen zwei große Fässer mit Bier, die oben eingeschlagen worden waren. Aus einem hatten zwei Landsknechte sich die Krüge gefüllt und tranken, als gäbe es kein Morgen mehr. In dem zweiten steckte kopfüber eine Frau, die gerade von einem Soldaten geschändet wurde. Sie strampelte vergeblich mit den Beinen, die Hände zuckten im Todeskampf, während der Soldat, der seinen Rock hochgebunden hatte, damit er mit einer Hand den Haarschopf des Mädchens ergreifen und ihren Kopf im Bier untertauchen konnte, immer wieder mit den Lenden zustieß, bis er erleichtert aufgrunzte und von seinem Opfer abließ. Die beiden anderen Soldaten standen lachend daneben, und machten sich sogleich nacheinander über die bereits Tote her. Voller Abscheu passierte Magdalena die albtraumhafte Szene, indes, es wurde nicht besser. Überall Entsetzen, Mord, Vergewaltigung und Totschlag. Tillys Soldaten nutzten den Freibrief zur Plünderung, den ihnen ihr General zugesagt hatte, weidlich aus.
Während der metallische Geruch von frisch vergossenem Blut durch die Luft waberte, wurden die Bürger aus ihren Häusern getrieben, auf Böcke gebunden und so lange mit Messern und mit brennenden Pechfackeln gefoltert, bis sie auch ihre letzten Geldverstecke preisgaben. Alle Frauen, egal ob blutjung oder steinalt, derer die Soldaten habhaft werden konnten, wurden vergewaltigt und geschändet, viele bis zum Tod. Und sogar vor den Toten kannte der Furor vieler Soldaten keine Gnade.
Die Soldaten machten auch vor kleinen Kindern und Säuglingen nicht halt. Sie hielten sie in den Armen und ermordeten sie auf grausamste Art und Weise, durchtrennten ihre Körper mit ihren Schwertern oder schlugen einfach ihre Köpfe gegen Hauswände oder Treppenstufen bis sie tot waren.
Mittlerweile war an verschiedenen Stellen Feuer ausgebrochen, was die Dramatik der höllischen Kulisse noch steigerte. Aus dem Pulverhof war das Explodieren der dort gelagerten Munition zu hören. Leichen trieben die Kanäle hinunter in die Elbe und stauten sich am Pfeiler der Holzmarschbrücke und der Zugbrücke. Der große Fluss begann sich rot zu färben.
Magdalena hatte in einem bereits leeren und geplünderten Haus eine schöne, massive, silberne Gürtelschnalle gefunden, die von den ersten einfallenden Plünderern entweder übersehen oder verloren worden war und sie sofort in ihrem Leintuch verstaut. Mittlerweile hatte sie sich bis zur Kirche St. Ulrich im Zentrum der Altstadt vorgearbeitet. Eine prallvolle Geldkatze war dort hinzugekommen, die Johannes ihr zugeworfen hatte. Er zog gerade sein Schwert aus dem blutigen Bauch eines wohlbeleibten, gut gekleideten, aber nun mausetoten Bürgers. »Der braucht sein Geld nimmer!«, schrie er dabei lauthals. Trotz des Infernos um ihn herum wirkte er geradezu fröhlich. Die Frauen von Tillys Soldaten waren mit farbigen Tüchern gekennzeichnet, damit sie nicht aus Versehen geschändet oder gemordet wurden. Viele von ihnen arbeiteten Hand in Hand mit ihren Männern wie eine eingespielte Bande.
So auch Johannes und Magdalena. Wenn er mit seiner Frau beim Plündern war, gab es nur selten Missverständnisse, eher eine traumwandlerische Zusammenarbeit. Aber heute war offensichtlich, dass Johannes mehr wollte. Seine Augen hatten einen blutrünstigen Ausdruck, den Magdalena so noch niemals bei ihm gesehen hatte. Sie hatte genug und wollte nur raus aus der Stadt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie sich erst wieder im Lager träfen. So winkte sie ihm zu, drehte sich um und machte sich auf den Weg Richtung Stadttor. Daher sah sie nicht, wie Johannes nur eine Minute später den Nimbus der ›Gefrorenheit‹ verlor. Eine verirrte Musketenkugel riss ihm das halbe Gesicht weg und kurz darauf wurde er selbst zum Opfer von Leichenfledderern aus dem eigenen Lager.
Auf ihrem Weg hinaus aus dieser Apokalypse ging sie erneut durch das Krockentor. Dabei passierte sie wieder das Brauhaus. Die zwei Fässer standen immer noch davor. Aber nun staken aus beiden die nackten Beine zweier bedauernswerter Magdeburger Mädchen wie Mahnmale heraus. Lediglich ein in Bier ertränktes Opfer hatte den Soldaten nicht genügt. Magdalena hatte Mitleid mit den beiden, ging zu ihnen hin und zog die außen an den Fässern herunterhängenden Röcke zumindest so weit hinauf, um wenigstens die Blöße zwischen den Beinen zu bedecken. »Hoffentlich wird mir einst ein gnädigerer Tod zuteil«, murmelte sie dabei und schickte gleich noch ein Stoßgebet zum Himmel.
Das Tor zum Brauhaus stand halb offen, so ging sie hinein. Tillys Mannen waren bereits, gleich zu Beginn, hier gewesen und hatten alles Inventar zerschlagen, soweit es nicht von Wert war. Das Feuer näherte sich unaufhaltsam, es war nur noch zwei Häuser entfernt. Eigentlich sollte sie sich schnell davonmachen, als sie ein Geräusch vernahm.
Neugierig ging sie in die nächste Kammer, die sich zu einem saalartigen Raum ausweitete, offensichtlich das Brauhaus. Da erblickte sie einen Mann – ein baumlanger Kerl, der einen Jungen und ein kleines Kind bei sich hatte. Rauch waberte bereits durch die offenen Fenster. Der Junge hustete.
Wie konnten die Plünderer diese drei Menschen übersehen haben?, fragte sie sich.
Der große, kräftige Mann hantierte an einer Holzplatte, die in die Wand eingelassen war. Als er im Nebel eine Gestalt wahrnahm, drehte er sich um und kam drohend auf sie zu. Sie bekam es mit der Angst zu tun. Doch Knoll erkannte, dass dort eine Frau stand, ließ ab und schaute sie mit seinen großen, braunen Augen vertrauensvoll an. Dann legte er seinen Zeigefinger auf die Lippen und bedeutete ihr somit, zu schweigen.
Der Junge, die Augen voller Furcht, winkte ihr trotzdem zu und rief leise: »Komm mit uns. Wir bringen dich in Sicherheit.« Er deutete auf einen Korb zu seinen Füßen, in dem sich Brot und andere Lebensmittel befanden. Heftig riss der Mann die Schulter des Jungen herum und sah ihn schweigend und voller Wut an. Der Junge schwieg sofort. Hinter der Holzplatte öffnete sich ein schmaler Gang, ein paar Stufen konnte sie sehen, bevor alles im Dunkeln verschwand.
Magdalena zögerte. Was ging da vor? Sie trat näher, sodass sie den Mann genau sehen konnte. Normalerweise wäre sie jetzt hinausgegangen und hätte sich auf der Straße Hilfe gesucht, um zu plündern.
Dann sah sie, wie der Mann den kleinen Jungen liebevoll auf seinen Arm nahm und den anderen, älteren Jungen mit dem Korb in der einen, einer brennenden Kerze in der anderen Hand, als Ersten in den Stollen schickte. Sie dachte an ihre eigenen verstorbenen Kinder, die sie niemals so im Arm halten konnte. In diesem Moment beschloss sie, dieser Familie die Flucht zu ermöglichen. Sie wiederholte die Geste des Schweigens und rieb mit der anderen Hand Daumen und Zeigefinger aneinander.
Der Mann nickte und warf ihr eine silberne Brosche zu, die er aus seinem Beutel genommen hatte. Anschließend griff er eine brennende Fackel aus der Wandhalterung und verschwand die Stiegen hinunter in den Schacht.
Der kleine Junge, der in eine Decke eingewickelt war, wimmerte vor Angst.
Magdalena verließ das Brauhaus, durchquerte das Stadttor und erreichte bald darauf das Lager, in dem bereits ein schwunghafter Handel mit den erbeuteten Preziosen in Gang war.
3.
Cord Knoll trieb sich und Gisbert an, während er versuchte, den verängstigten Ulrich zu beruhigen. Einige Hundert Fuß lang war der schmale, in den Fels hineingetriebene Stollen, der das Brauhaus mit dem Eiskeller verband. Der von innen verriegelte Eingang befand sich in einem kleinen Wald außerhalb der Stadtmauern. Kaum jemand wusste davon, denn der Eingang lag verdeckt und war, durch die Kriegsereignisse der letzten Monate, lange nicht mehr geöffnet worden. Dieses Frühjahr würden sie kein Eis mehr brauchen …
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!