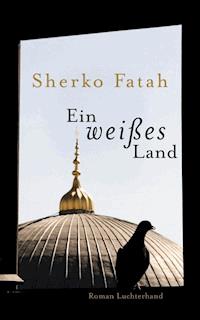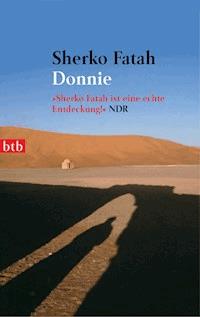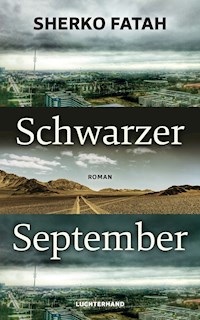3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kerim, von Beruf Koch, macht sich aus dem irakischen Grenzland auf die beschwerliche und gefährliche Reise nach Europa. Er war unter Gotteskrieger geraten und mit ihnen durch das Land gezogen, bevor er sich entschied, vor ihrem Weg der Gewalt zu fliehen. Kerim versucht, in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, und findet in dem fremden Land seine erste Liebe. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht abschütteln. Seine Heimat fängt ihn wieder ein, als die Gotteskrieger ihn in Deutschland aufspüren und für seine Flucht bestrafen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sherko Fatah
Das dunkle SchiffRoman
btb
BUCH: Das Buch erzählt die Geschichte des jungen Kerim, von Beruf Koch, der sich aus dem irakischen Grenzland auf die beschwerliche und gefährliche Reise nach Europa macht. Von früh an der Idee verfallen, sich zu verwandeln, hat er noch andere Gründe für seine Flucht, war er doch unter die Gotteskrieger geraten und mit ihnen durch das Land gezogen, bevor er sich von ihrem Weg der Gewalt lossagte. Kerim, bemüht, in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, kann, obwohl er in dem fremden Land auch Zuwendung und sogar seine erste Liebe findet, die Vergangenheit nicht abschütteln, vielmehr scheint diese sich fortwährend auf ihn zuzubewegen. In diesem Roman geht es nicht um den Islam, sondern um den Extremismus, der viele Erscheinungsformen haben kann, um seine Verführungsmacht und die Folgen. Extremismus entsteht nicht in einem Kopf, sondern unter realen Lebensbedingungen. So ist Kerims Geschichte die eines kleinen, konkreten Lebens inmitten großer Umwälzungen, und sein spirituelles wie auch seine realen Abenteuer sind nicht so außergewöhnlich, wie sie aus europäischer Sicht scheinen mögen.
AUTOR: Sherko Fatah wurde 1964 in Ost-Berlin als Sohn eines irakischen Kurden und einer Deutschen geboren. Er wuchs in der DDR auf und siedelte 1975 mit seiner Familie über Wien nach West-Berlin über. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte. Für seinen ersten Roman »Im Grenzland« wurde er mit dem aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. »Das dunkle Schiff« war auf der Shortlist für Deutschen Buchpreis 2008.
Sherko Fatah bei btb: Im Grenzland. Roman
Die Arbeit an diesem Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds Darmstadt gefördert.
1. Auflage
Genehmigte Taschenbuchausgabe Januar 2010,
btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Copyright © 2008 Jung und Jung, Salzburg und Wien Umschlaggestaltung: semper smile München
Umschlagfoto: Hrant Arakelyan / Jung und Jung Verlag
KR · Herstellung: SK
eISBN: 978-3-641-18730-9
www.btb-verlag.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Es war ein Sommertag, heiß, aber doch so windig, dass man es nicht wirklich spürte. Wolkenschatten eilten dunkel über die Ebenen und Hänge, als schwebten Luftschiffe durch den tiefblauen Himmel. Vielleicht war es der schönste Tag seines Lebens, nicht des leichten Lichtes und des sanften Windes wegen, nein, an diesem späten, saumselig vergehenden Tag verspürte er ein erstes Mal die tiefe Ruhe, welche die Schönheit gewährt, und erfuhr zugleich ihre Vergeblichkeit.
Um diese Jahreszeit zogen die alten Frauen hinaus, um Heilkräuter zu sammeln. Sie wussten, wann sie für welches Gewächs an einen bestimmten Ort zu gehen hatten. Weit mussten sie nicht hinaufsteigen, nur auf die Hügel. Dort sah er sie, eine kleine Kolonne, die wie so oft schon den nie ganz überwucherten Pfaden folgte. Sie sprachen und lachten laut, hier draußen waren sie endlich ganz unter sich, für ein paar Stunden fern von Räumen und Regeln. Hätten sie umhergeschaut, auch ihnen wäre die Unberührbarkeit der wilden Gräser, der Dolden und der warmen Steine aufgefallen. Doch sie schwenkten ihre Körbe, und ihre farbenfrohen Gewänder wehten im Wind, sie waren zu sehr miteinander beschäftigt. Fast beneidete er sie darum, so selbstvergessen hineingestellt zu sein in den Tag, der wie ein riesiges, geöffnetes Fenster um sie stand. Er lief ihnen nach, als sie hinter den Hügeln verschwanden, nur einfach, um sie weiterhin zu sehen, winzig, doch nicht verloren, und blieb auf dem Hügel stehen. Er fühlte nicht mehr die Abgeschiedenheit hier draußen, nicht mehr die raue Einöde, er sah die Landschaft wie eine geöffnete Hand. Er atmete schwer. Ich bin noch ein Kind, dachte er kurz, meine Lungen sind nicht weit genug für diesen Tag. Und selbst wenn sie es wären, so ahnte er, dann könnte ich doch niemals weit genug in ihn hineingehen.
Die Frauen hatten sich in der Ferne verteilt und mit dem Sammeln der Kräuter begonnen. Wie ein schwaches Echo, von den Felsen mehr verschluckt als zurückgeworfen, erhob sich das Geräusch. Es war ein Helikopter, angestrahlt vom späten Licht, das selbst seine Tarnfarbe fröhlich erscheinen ließ. Er beschirmte seine Augen mit der Hand und blickte hinauf. Er sah den Haupt- und den Heckrotor und vernahm das anschwellende Donnern. Doch nichts, auch nicht diese Maschine war fähig, den tiefen Frieden über den Hügeln zu stören. Der Helikopter flog vorüber, kam zurück und zog einen weiten Kreis über ihm. An der offenen Seitenluke kauerten zwei Soldaten, einer winkte ihm zu. Alles konnte geschehen an diesem Tag, und so winkte er ohne Furcht zurück. Der Helikopter zog seine Bahn und sank unwirklich langsam zur Erde nieder. Im Geheimen hatte er den Kinderwunsch verspürt, und nun wurde er wahr; er landete, weit entfernt zwar, aber er landete. Vielleicht nehmen sie mich mit, war sein nächster Gedanke, vielleicht kann ich mit ihnen fliegen.
Er lief los, winkend und rufend, scharfkantige Steine und spitze Distelsträucher waren in seinem Weg, doch nichts ließ ihn stolpern, und nichts stach ihn. Weit vor ihm wurde der Helikopter eingehüllt von aufgewirbeltem Sand, trockene Halme segelten durch die Luft. Es ist zu weit, ich schaffe es nicht, dachte er, als er die beiden Soldaten herausspringen und geduckt zu den Frauen hinüberlaufen sah. Diese hatten ihre Körbe abgestellt, die Hände in die Hüften gestützt oder an die Stirn gelegt und blickten den Männern entgegen. Er sah, wie die Soldaten sie zum Helikopter trieben, sah es undeutlich durch den Staub, und da blieb er stehen. Ich schaffe es nicht, dachte er noch einmal bedauernd, doch tröstete ihn, dass es überhaupt geschehen war, das ganz und gar Außergewöhnliche. Er stand und sah sie abheben, ruckartig erst, dann unaufhaltsam, wie in den Himmel gezogen, bis sie die Staubwolke unter sich ließen. Ganz leicht legte sich der Helikopter auf die Seite und flog erneut seine weite Kurve, schraubte sich allmählich höher und höher, bis er befreit im Himmel dahinschwamm. Er blickte ihnen nach und winkte wieder. Und tatsächlich kam die Maschine erneut heran, das Donnern wurde laut und lauter, bis er sich die Ohren zuhielt. Den Kopf im Nacken sah er die Frauen. Da fielen sie, eine nach der anderen stürzte aus der Luke, mit gebreiteten Armen glänzten sie auf im Licht, und wie um sie aufzuhalten, riss an ihren Gewändern der Wind.
Erster Teil
1.
Kerim erinnerte sich an das immer gleiche Ritual. Seine Mutter rief ihn und seine Brüder zusammen. Gemeinsam holten sie eine alte, vom Waschen zerschlissene Wolldecke hervor und breiteten sie auf dem Boden aus. Manchmal taten es auch Zeitungsbögen. Sie stellten die Töpfe und Schalen in die Mitte und setzten sich wie um ein Lagerfeuer auf den Boden. Es gab Löffel, aber da sie meist unter sich waren, wurde mit den Händen gegessen. Jeder nahm, so viel er wollte, und griff ohne zu zögern in die Töpfe.
Manchmal, in schwachen Augenblicken, kam es Kerim vor, als wäre die Erinnerung an diese Art des Essens alles, was ihm von seiner Familie geblieben war. Denn wenn er daran zurückdachte, standen sie alle, deutlich wie sonst nie, vor seinen Augen: Seine Mutter, die immer dabei war, doch die er kaum je essen sah. An ihre Hände erinnerte er sich und an die zarten Unterarme, die hervorsahen, weil sie die Ärmel zurückgezogen hatte. Imat, den älteren seiner Brüder, sah er vor sich, schmal und blass, wie er den Reis in winzigen Portionen nahm und selbst die Okraschoten nach Größe aussuchte, bevor er sie sich zaghaft, als wären seine Lippen wund, in den Mund schob. Ali dagegen kam schon mehr nach ihm, Kerim, und seinem Vater. Immer hungrig und nah bei seiner Mutter, griff er aus der Deckung zu. Er aß gern und für sein Alter recht viel. Schließlich tauchte auch sein Vater vor Kerims innerem Auge auf, müde meist nach den langen Arbeitstagen. Der schwere, vorgewölbte Bauch ließ ihn zusammengesackt erscheinen, wenn er am Boden saß. Kerim erinnerte sich an die Ringe unter seinen Augen, die im Flimmern des Fernsehlichtes deutlich hervortraten. Halb zum Bildschirm blickend, der über ihren Köpfen hing, halb seiner Familie zugewandt, stets recht schweigsam, ohne dabei stumpf zu wirken, so begegnete ihm Kerim in seinen Erinnerungen.
Sein Vater betrieb ein kleines Restaurant, fast schon außerhalb ihrer Stadt gelegen. Es war nicht mehr als eine Hütte, vollgestellt mit hölzernen Bänken und Stühlen, das Dach hatte an einer Stelle ein großes Loch, behelfsweise mit einer Matte bedeckt. Im Laufe der Zeit war diese Matte verwittert und ließ, vor allem in den frühen Abendstunden, Strahlen eines, wie Kerim es empfand, lieblichen Lichtes in die Hütte fallen. Aber niemand außer ihm bemerkte das.
Die meisten der Gäste waren Durchreisende, die auf ihrem Weg durch den gebirgigen Norden des Landes eine Rast einlegten. Das Gasthaus lag ganz in der Nähe einer der großen Überlandstraßen, auf denen man das gesamte Land durchfahren konnte. Kerim erinnerte sich an den gelblichbraunen Raum, an das Stimmengewirr und an die Rauchschwaden über den Köpfen der Gäste. In der Nähe der Matte füllte der Rauch die einfallenden Lichtstrahlen, als wären sie gläserne Gefäße. Kerims Mutter war sehr unzufrieden darüber, dass das Loch im Dach nie fachmännisch ausgebessert wurde. Doch ihr Mann fand dazu keine Zeit. Sein Leben wurde bestimmt vom Zubereiten des Essens. Solange Kerim ihn kannte, war das Essen das einzige, was ihn ernsthaft beschäftigte.
Bevor er zur Schule aufbrach, musste Kerim bereits arbeiten. Er hatte die kleine Küche vorzubereiten, die sich in einem Anbau der Hütte befand. Der Tag begann um vier Uhr morgens, denn um diese Stunde fanden sich die Taxifahrer ein. Sie waren immer unterwegs und zahlten im Gasthaus Sonderpreise, dafür übernahmen sie ab und an Lieferungen für Kerims Vater. Um diese frühe Morgenstunde gab es nur Brühe oder Innereien am Spieß. Das war so üblich; später am Tag hatten die Gäste die Wahl zwischen Huhn oder Hammel und der dazugehörigen Brühe. Dazu gab es immer Reis, der in einem riesigen schwarzen Kessel in Unmengen gekocht wurde. Das regelmäßige Umrühren und schließlich das Ausleeren und Wiederbefüllen überließ sein Vater gänzlich Kerim, später auch die Sorge um die Gasflaschen, die ein schweigsamer Mann regelmäßig auf einem Holzkarren vorbeibrachte. Das war ein wenig teurer als sie selbst im Laden abzuholen, doch dafür schloss er sie gleich an und überprüfte die Dichtung mit einem Streichholz. Kerim kannte diesen Mann sein ganzes Leben lang, ohne je mehr als ein paar Sätze mit ihm gesprochen zu haben.
So weit er zurückdenken konnte, stand das Essen im Zentrum seines Lebens. Er hatte eine Abneigung gegen dieses wiederkehrende Ritual und gegen die viele Arbeit, die es verursachte. Manchmal beobachtete er seinen Vater nur einfach, wie er, vornübergebeugt und schnaufend von der Hitze in der engen Küche, rasend schnell die vielen Teller vorbereitete, die Kerims Mutter eine halbe Stunde später wieder einsammeln würde. Und bereits als Kind verspürte Kerim die Gewissheit, diese Arbeit niemals selbst tun zu wollen.
Hinter der Hütte gab es einen fensterlosen Schuppen mit Blechdach, in dem nach Bedarf auch geschlachtet wurde. Kerim betrat diesen dunklen Raum nur selten, denn die stickige Hitze und der Geruch waren ihm unerträglich. In der Mitte lagen in Haufen abgetrennte Schafsköpfe, jeder einzelne mit offenen, glasigen Augen und heraushängender Zunge. Ein paar Jungen aus ärmeren Familien der Nachbarschaft verdingten sich bei Kerims Vater und arbeiteten in dem Schuppen. Sie reinigten die Köpfe und trennten die Zungen heraus. Einmal, nur um ihn damit vertraut zu machen, hatte ihm sein Vater die Sache erklärt: Die Zungen mussten durch die weiche Stelle im Unterkiefer herausgeschnitten werden, durch das Maul wäre es zu mühselig. Die Jungen hockten in ihren schmutzigen Hosen und Hemden inmitten des Blutgeruchs am Boden und warfen die langen Zungen neben sich in Blechschalen. Sie blickten neugierig zu Kerim auf, doch sagten kein Wort. Das Sonnenlicht fiel nur in einem weiten Streifen von der Tür über den dunklen Boden, und es schien, als würde es die Fliegenschwärme mit sich tragen.
Eine solche Arbeit war, nach Meinung seines Vaters, nichts für Kerim, seinen ältesten Sohn. Das Kochen brachte er ihm nebenher bei, für die Handreichungen in der Küche musste er zur Verfügung stehen. Dennoch ging Kerim regelmäßig zur Schule. Sein Vater hatte sogar einen Gehilfen, der ihn, wenn Kerim fort war, mit einem alten Pritschenwagen zum Einkauf der Vorräte in den Basar begleitete.
Es schien, als gäbe es nichts, was seine Eltern nicht getan hätten, um ihm eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Aus diesem Grund sah es sein Vater nicht gern, wenn Kerim in den Schuppen ging, um den Jungen zuzusehen. Vielleicht fürchtete er, es könnte etwas von der bedrückenden, sprachlosen Tätigkeit in jenem Dämmer auf seinen Sohn überspringen und ihn verderben. Kerim wuchs in dem Gefühl auf, wenn schon nicht zu Großem, so doch Besserem bestimmt zu sein.
Sehr früh schon begann er, dick zu werden. Anfangs fiel es nicht weiter auf, es gab in der Nachbarschaft mehrere füllige Kinder. Doch sie hielten nicht Schritt mit Kerim. Als er sieben Jahre alt war, war er das dickste Kind weit und breit. Seine Mutter ermahnte ihn oftmals, nicht an die Essensreste zu gehen. Sie schickte ihn schließlich sogar aus dem Haus, damit er sich mehr bewegte. Doch sie tat all das heimlich, bemüht, nicht die Aufmerksamkeit ihres Mannes zu erregen. Denn Kerims Vater hatte den Leibesumfang von drei Männern, und nichts daran störte ihn. Er war nicht groß, der Anlage nach von eher schmaler Gestalt mit feinen Hand- und Fußgelenken. Doch das Essen hatte ihn völlig verwandelt.
Kerims Mutter kannte ihren Mann bereits, als er mehr als fünfzig Kilo weniger wog. Manchmal flocht sie die Erinnerung daran ein in die abendlichen Gespräche. Sie verweilte gern bei diesem Thema. Ihr Gesicht hellte sich auf, ihre mandelförmigen Augen verengten sich, sie wirkte vergnügt. Wenn sich Kerim später daran erinnerte, war ihm klar, was er damals nicht wissen konnte: Dies war die einzige kleine Respektlosigkeit, die seiner Mutter gestattet war – und sie kostete sie aus, so sehr sie nur konnte. Sein Vater kauerte derweil, friedlich lächelnd, auf der mit Kissen gepolsterten Bank und atmete wie immer schwer.
»Er war dünn wie ein Kind, als ich ihn das erste Mal sah«, sagte sie. »Mager wie unsere Ziege, ihr wisst schon, die kleine graue ...«
Kerim und seine Brüder lauschten ihr aufmerksam, auch wenn sie das alles schon oft gehört hatten. Denn für sie war es eine Möglichkeit, ihren Vater anders zu sehen, als sie ihn kannten. Jedenfalls konnten sie es versuchen. Verstohlen blickten sie zu dem schnaufenden Mann hinüber, darauf bedacht, dass er es nicht bemerkte. Doch es war fast unmöglich, in ihm denjenigen wiederzuerkennen, den sie beschrieb.
»Ich musste ihn zwingen zu essen«, berichtete sie. »Er war bestimmt am Verhungern. Was ich ihm auch kochte, er nagte nur daran. Wie eine Maus. Ich musste die Stellen suchen, von denen er genommen hatte.«
Kerim kannte seinen Vater als Mann, der wenig Worte machte. Selbst wenn es um die Küche ging, gab er nur Anweisungen und erklärte das Nötigste. Doch er erinnerte sich auch an ein Gefühl der Sicherheit in seiner Nähe. Wenn sie mittags durch die Gassen der Stadt gingen, warf er neben ihm einen gewaltigen Schatten auf die Mauern. Sein Vater hielt ihn fest an der Hand, und so konnte Kerim diesem Schatten und seiner Verlängerung auch dann nicht enfliehen, wenn er kurz zurückblieb und sich ziehen ließ.
Kerim hätte nicht zu sagen gewusst, ob sein Vater – und überhaupt seine Familie – in der Nachbarschaft beliebt war. Geachtet sicher, dafür sorgte der Gasthausbetrieb. Doch auf der Straße begegneten die Leute ihm immer mit höflicher Distanz.
Vielleicht hatte das zu tun mit seiner Herkunft aus einer alevitischen Familie. Wenig erfuhr Kerim darüber, da sein Vater nur spärliche Erinnerungen daran zu haben schien. Sie hatten im türkischen Tunceli gelebt; schon das Wort klang aus märchenhafter Ferne herüber.
»Das Dorf lag hoch in den Bergen«, erzählte sein Vater. »Wie ein Schwalbennest, so dass man von unten keinen Pfad erkennen konnte, der hinaufführt. Das war sehr wichtig, denn auf diese Weise war es für die normalen Muslime schwierig, dort hinzukommen. Auch die Chaldäer lebten so, alle, die anders waren. Aber wir hatten die Staatsmacht zu fürchten. Einmal kam ein Polizist in unser Dorf und schaute sich um. Die Leute zeigten ihm die Häuser und den Versammlungsraum, wo alle, Männer und Frauen beteten und tanzten. Als er mit der Besichtigung fertig war, sagte er zum Dorfältesten: ›Ihr habt keine Moschee.‹ Der Alte antwortete: ›Wir haben unser Gebetshaus.‹ – ›Ihr braucht eine Moschee, laßt uns eine bauen‹, sagte der Polizist. Der Dorfälteste überlegte, denn es handelte sich offensichtlich um ein Angebot. Dann sagte er: ›Was wir brauchen, ist eine Schule für unsere Kinder, wir brauchen Bücher und Lehrer.‹ Da schüttelte der Polizist den Kopf: ›Erst müßt ihr eine Moschee bauen und vielleicht, irgendwann bekommt ihr eine Schule dazu.‹«
Solche Geschichten erzählte sein Vater selten. Auch das, was er selbst als Kind gelernt hatte, übermittelte er seinen Söhnen nur indirekt: Es war das Gefühl, nirgends wirklich dazuzugehören. In seiner Kindheit beneidete Kerim seine Mitschüler um ihre religiösen Rituale. Seine Eltern erwarteten anderes von ihm, da sie selbst kaum einmal beteten. Das war nichts Außergewöhnliches; es gab viele Familien, in denen nur zu Festtagen gebetet wurde. Und doch schien der Glaube für sie selbstverständlich oder zumindest nah zu sein. Was aber Kerim sah, war eine gewisse Verstellung: Um das Gasthaus nicht in Misskredit zu bringen, paßte sich sein Vater den muslimischen Regeln an, wo es nötig war. Manchmal ging er sogar in die Moschee. Sein wichtigstes Zugeständnis war der Kauf eines lebendigen Schafes zum Opferfest. Bei der Schlachtung hielt er sich sorgfältig an alle Regeln: Er legte das Tier mit dem Kopf in Richtung Mekka, sprach ein Gebet und ließ es gründlich ausbluten, bevor er den größeren Teil des Fleisches an die Armen der Umgebung verteilte, die sich jedes Jahr im Hof des Gasthauses versammelten und darauf warteten. Einige waren die Eltern jener Jungen, die in seinem Schuppen arbeiteten.
Viel später erst begriff Kerim, wieviel Geschick sein Vater darauf verwandte, niemanden merken zu lassen, was er in seinem Herzen wirklich war: ein Mann ohne Glauben. Die unauffälligen Namen für alle seine Kinder, sein Verhalten den Nachbarn gegenüber, es war Anpassung. Er lebte für seine Familie und sein Geschäft, alles Höhere war ihm fremd. Als Kerim mit etwa sechs Jahren in einer Ecke neben der Küche zu beten begann, ganz so, wie er es bei anderen gesehen hatte, tat er es, ohne zu wissen, was man dabei sagt und wie oft man sich zu verneigen hat. Sein Vater kam nach ihm sehen und beendete das Ganze wie ein dummes Kinderspiel, weil er ihn in der Küche brauchte.
Kerim entsann sich genau, dass auch an diesem Tag ein Opfertier im Hof bereitstand. Diesmal war es eine dunkelbraune Kuh. Er beobachtete das Tier eine Stunde lang von der kleinen Treppe aus, die auf den rückseitigen Hof führte. Sie stand angeleint an einem Holzpfahl, suchte nach vereinzelten, trockenen Grasbüscheln und bewegte sich dabei ganz allmählich in einem weiten Kreis. Da sich das Seil um den Pfahl wickelte, wurde ihr Radius immer kleiner. Aber sie bemerkte das nicht, auch wenn sie mit dem Kopf ruckte und das Seil dabei straffte. Ihr Weg führte weiter um den Pfahl. Schließlich schnürte sie sich einen Hinterlauf ein. Doch sie brachte es nicht fertig, sich rückwärts zu bewegen. Und so stand sie, ein Bein in die Höhe gezogen, schief an dem Holzpfahl und starrte vor sich hin. Ganz kurz muhte sie auf, doch verstummte gleich wieder und senkte ihren schweren Kopf, so als wollte sie weitergrasen. Den Boden konnte sie aber nicht mehr erreichen.
Kerim rührte sich nicht. Gegen das schiefe Geländer gelehnt, blickte er stumm auf das Tier hinab. Er amüsierte sich nicht bei dem grotesken Anblick, den es, so eingeschnürt, während der nächsten halben Stunde bot. Der Gedanke an diese Begebenheit ließ ihn nicht los. Er hatte darauf gewartet, dass sie, halb zufällig, halb durch die Schmerzen, in die entgegengesetzte Richtung wechseln würde. Lange und ohne Mitgefühl hatte er darauf gewartet. Aber die Kuh tat es nicht. Nur einmal schien sie der Lösung ihres Problems nahe: Fliegen hatten sich an den Rändern ihrer Augen festgesetzt, und sie schüttelte ihren großen Kopf, um sie loszuwerden. Dabei lockerte sich das Seil etwas. Ihre Flanke bekam Spielraum, und hätte sie jetzt nur einen einzigen Schritt rückwärts, über das schlaff herabhängende Seil hinweg getan, so hätte sie sich wieder frei bewegen, sogar umwenden können. Statt dessen aber verharrte sie kurz und nutzte ihre kleine Freiheit, um wiederum vorwärts zu drängen. Diesmal fesselte sie sich endgültig.
2.
Einmal fuhren sie in die kurdischen Berge hinauf zu einem entlegenen Aussichtspunkt. Es war ein feuchter Tag im Winter. Nebel stand zwischen den Berghängen, und je weiter sie der ansteigenden Serpentine folgten, umso dichter wurde er. Kerim schaute konzentriert aus dem Seitenfenster, aber er konnte den Nebel nicht durchdringen. Nur ganz selten, fleckenweise, zeichneten sich Flächen aus Fels darin ab, und Kerim erschien es, als tauchte er in einen hellen Strom.
Wenn er daran zurückdachte, erfüllte ihn ein tiefes Glücksgefühl. Es muss die Zeit gewesen sein, in der er die Dinge um sich neu zu sehen begann. Kerim hatte eine sehr klare Erinnerung an dieses innere Erlebnis, weitaus klarer als etwa an so manchen seiner Verwandten. Am Anfang, so dachte er, waren alle Dinge nur um ihn herumgestellt. Sie waren Hindernisse oder erschienen ihm schön, sie schmerzten oder schmeckten gut. Immer aber verschwanden sie, wie sie aufgetaucht waren, scheinbar ohne Spuren zu hinterlassen. Alle Dinge waren auf eine gewisse Weise leicht. Und plötzlich veränderten sie sich. Es war, als wären ihnen von unsichtbarer Hand weiche Schatten gegeben worden. Das allein genügte, die Welt, die Landschaft um ihn begehbar werden zu lassen. Und es gab immer einen Hügel hinter dem Hügel, einen Pfad, der jenen einen, dem Kerim gerade folgte, irgendwo an einer unerwarteten Stelle kreuzte und ihn an einen noch unbekannten Ort locken wollte.
Als Kerim die Nebel an den Bergflanken entlanggleiten sah, wartete er darauf, dass dieser helle Schleier sich hob und ihm, hier und dort, die Umrisse steinerner Tiere und Ungeheuer oder auch verzerrte Gesichter im Fels zeigte.
Es war zu jener Zeit eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen er mit seinem Vater allein unterwegs war. Da die Familie ohnehin so gut wie nie verreiste, denn die Arbeit im Gasthaus hatte immer Vorrang, war dieser Ausflug in die Berge etwas Besonderes.
Früh waren sie aufgebrochen, gerade hatte der Muezzin zum Morgengebet gerufen. Sein Vater saß müde und wortkarg am Steuer, andauernd gähnte er. Die Straße führte immerzu aufwärts, und sie fuhren sehr langsam wegen der schlechten Sicht. Das steigerte Kerims Spannung so, dass er auf dem Sitz wippte, bis sein Vater ihm Einhalt gebieten musste. Der Nebel strömte an den Wagenfenstern entlang.
Nach Stunden schließlich tauchten sie daraus auf und erreichten eine abgeflachte Bergkuppe. Hier gab es einen Parkplatz und ein hölzernes Haus, das verlassen aussah. Als er ausstieg, bemerkte Kerim, wie kalt es geworden war. Die Feuchtigkeit kroch ihm sofort in die Kleidung und ließ ihn zittern.
Sein Vater ging ihm voraus, und sein Gang, seine Haltung wirkten auf Kerim so feierlich, als würde ihm in den nächsten Augenblicken ein Geheimnis offenbart. Doch hinter der Tür, die sein Vater geöffnet hielt, bis er eingetreten war, befand sich nur ein Gasthaus, kleiner als das ihre. Kerim überschritt zögernd die Schwelle und blickte um sich in dem von langen Schatten durchzogenen Raum. Der steinerne Boden, die schief stehenden Tische und Holzbänke, alles war versunken im grauen, durch schmutzige Fenster hereinfallenden Morgenlicht. Es roch wie bei ihnen zu Hause nach Fett und Rauch, ein süßlicher, scharfer Geruch, der für Kerim immer mit dem frühen Morgen verbunden sein würde, der Stunde, bevor die ersten Gäste kamen.
Hier auf dem Berg aber war es nun schon Vormittag, und niemand kam zum Essen. Sein Vater schritt zielstrebig durch den Raum und klopfte an eine winzige Holztür, die einen Verschlag zu verbergen schien. Das muss die Küche sein, dachte Kerim. Die Tür wurde aufgestoßen, sie war leicht wie aus Pappe. Ein kleingewachsener Mann trat heraus. Selbst er noch musste sich bücken, um sich den blanken Schädel nicht am Türrahmen zu stoßen. Kerim wich unwillkürlich zurück, denn er erwartete, ein häßliches oder auch nur erschreckendes Gesicht zu sehen, als der Mann den Kopf hob. Doch gleich darauf strahlten ihn freundliche Augen an, und der Mann kratzte sich lächelnd die unrasierte Wange.
»Kerim, das ist Anatol«, sagte sein Vater. »Er ist ein alter Freund von mir. Sag ihm guten Tag.«
Kerim gehorchte und ließ den Mann auch danach nicht aus den Augen. Dieser bemerkte es und zwinkerte ihm zu, während er sich mit seinem Vater unterhielt. Doch all seine Freundlichkeit konnte den Jungen nicht beruhigen. Kerim starrte ihn an, wartete darauf, dass er die Maske fallen ließ.
»Warum beobachtest du mich?«, fragte Anatol irgendwann und ließ eine unangenehme Pause entstehen.
Kerim wusste nichts zu antworten, aber er schämte sich augenblicklich. Dieses Gefühl glich einem Fieberschauer. Hilflos blickte er zu seinem Vater, der das Schweigen schließlich brach.
»Er ist ein bisschen ängstlich«, sagte er, ohne den Blick von seinem Sohn zu wenden. »Ich weiß nicht, warum. Geht auch kaum einmal auf die Straße in letzter Zeit. Sitzt nur in seiner Ecke und glotzt die Gäste an.«
Kerim fühlte sich plötzlich gekränkt und schüttelte heftig den Kopf. »Ich habe keine Angst«, stieß er hervor und blickte dabei zu Boden.
Anatol streckte seinen langen, dünnen Arm aus und legte Kerim die Hand auf den Kopf. Der Junge fuhr zusammen, doch er schüttelte die Hand nicht ab. Er wusste nicht, was ihn an diesem Mann störte, und das verunsicherte ihn noch mehr. So schwieg er einfach und hielt still. Lange lag die Hand auf seinem Kopf, bis sie ihm schließlich das Haar verwuschelte und sich hob.
»Aber vielleicht hast du Hunger«, sagte Anatol.
Wieder entstand eine Pause. Kerim nickte, nur um ihn zufriedenzustellen.
»Na, dagegen kann ich etwas tun. Ich habe etwas Schönes für euch.« Anatol erhob sich und fügte hinzu: »Etwas Seltenes für besondere Gäste. Ich habe alles schon vorbereitet.« Dann entfernte er sich rasch und verschwand hinter der kleinen Holztür.
Anatol kochte, und er ließ sich Zeit dabei. Der Geruch von Fett und Zwiebeln drang in den Raum. Kerim war noch immer verunsichert und still. Der leere Raum, in dem sie saßen, war ihm unheimlich, doch zugleich machte er ihn neugierig.
»Was tut der Mann?«, fragte er.
»Er kocht für uns«, sagte sein Vater, »und das ist eine große Ehre, denn er ist ein sehr guter Koch.«
Wenn Kerim daran zurückdachte, meinte er, erwartet haben zu müssen, dass auch dieser Ausflug mit seinem Vater dem Essen gewidmet sein würde. Doch so war es nicht. Damals hatte er nichts erwartet.
»Warum tut er das?«, fragte er seinen Vater.
»Ich habe ihn darum gebeten. Damit du etwas lernst.« Er hatte andeutungsweise den Zeigefinger erhoben. »Nur du. Deine Brüder sind noch zu jung dazu.«
»Darf ich herumgehen?«
Sein Vater nickte, und Kerim machte sich daran, den Raum zu erkunden. Doch er fand nichts, was ihn interessierte. Die Dinge um ihn lagen wie leere Schalen umher. Er erinnerte sich, deshalb eine halbe Drehung vollführt und einmal tief geseufzt zu haben. Er trat an eines der Fenster. Der Himmel war noch immer grau, der alte Toyota seines Vaters stand verloren auf dem Platz vor dem Haus. Eine braune Katze saß darunter, regungslos, mit aufgerissenen Augen. In der Ferne war noch der Nebel zu erkennen, der das Tal füllte. Im Sommer musste es schön sein an diesem Aussichtspunkt. Jetzt aber dünstete alles Kälte und Verlassenheit aus.
»Warum sind keine anderen Leute da?«, fragte Kerim, ohne sich umzuwenden.
»Damit uns niemand stört«, antwortete sein Vater. »Anatol hat Urlaub. Deshalb hat er ein Schild an die Tür gehängt.«
Kerim betrachtete den dunklen Fels, der sich neben dem Haus erhob. Feucht glänzte das Gestein, und an einigen Stellen schien sogar Wasser herabzulaufen. Ein Wagen kam die Straße herauf. Vier Leute saßen darin. Das Auto näherte sich dem Restaurant, hielt, und der Fahrer streckte den Kopf zum Seitenfenster hinaus. Er blickte zum Eingang, hob kurz eine Hand und wendete dann.
»Die Leute kommen von weit her, um bei ihm zu essen«, sagte sein Vater, während sich das Motorengeräusch entfernte. »Anatol ist berühmt.«
Nach einer halben Stunde tauchte der Koch wieder auf.
»Das Fleisch ist noch nicht so weit«, sagte er entschuldigend. Missmutig blickte er sich im Raum um. »Es ist kalt, nicht wahr?«
»Nicht besonders«, sagte Kerims Vater. »Frierst du?«
Kerim schüttelte tapfer den Kopf.
Schließlich brachte Anatol das Essen. Er musste schnell gearbeitet haben, um dieses Mahl zuzubereiten. Der Duft von Reis, gekochtem Fleisch, grünen und weißen Bohnen erfüllte den Raum und erwärmte ihn spürbar. Kerims Vater bot seine Hilfe nicht an, und er schickte auch seinen Sohn nicht in die Küche, um wenigstens die Teller zu holen. Anatol machte alles allein. Es war wohl genau so verabredet.
Mit einer feierlichen Armbewegung wies der Koch über den gedeckten Tisch, als zauberte er das Essen in diesem Moment herbei. Kerims Vater dankte ihm mehrmals.
»Iss langsam«, wies er seinen Sohn an.
Kerim hatte inzwischen tatsächlich Hunger und musste sich zügeln, um nicht zu essen wie sonst, hastig und beinahe ohne zu kauen. Er konzentrierte sich und genoss das Essen dadurch wirklich. Doch zugleich war er voller Anspannung, weil er auf etwas wartete. Dieses Essen, so gut es auch schmeckte, war nichts Außergewöhnliches. Es gab nur eines, was ihm auffiel: das gekochte Lamm war außergewöhnlich schmackhaft.
Dennoch schüttelte er den Kopf, als sein Vater ihn danach fragte, nachdem er seine Hand ergriffen hatte.
»Iss von dem Fleisch«, sagte sein Vater ruhig und beobachtete Kerims Bewegungen, schaute ihm beim Kauen zu. »Iss noch einmal davon.« Er nickte sachte, aber bestimmt.
Unter den aufmerksamen Blicken der beiden Männer kaute Kerim den nächsten Bissen gründlich durch, wagte aber nichts zu sagen.
»Dieses Lamm«, sagte Anatol, »war noch nicht geboren.«
Kerim kaute mechanisch weiter, ohne recht zu verstehen.
»Es war noch im Mutterleib.«
»Daher«, ergänzte sein Vater, »ist es so zart. Nimm mehr davon.«
Kerim kaute noch immer, doch er konnte unter den Augen der anderen nichts mehr schmecken. Das Fleisch schien in seinem Mund zu schmelzen und gleich darauf zu verschwinden.
Sein Vater gab ihm ein Zeichen innezuhalten. Was er ihm dann sagte, erinnerte Kerim kaum noch. Es hatte anfangs mit dem Essen zu tun. Schließlich aber weitete es sich zu einer Art Predigt aus. Es ging um Jugend und Reinheit. Der Grund dafür, dass dieses Lamm so gut schmecke, sei, dass es noch wenig Zeit in sich aufgenommen habe, sagte er. Es sei seinem Ursprung, seiner Schöpfung noch sehr nahe. Dann wandte er sich seinem Sohn ganz zu. Nach einer Pause fügte er an:
»Alles, was lebt, bleibt immer seinem Ursprung, nämlich Gott, dem Allmächtigen, verbunden. Je weiter es sich von diesem Ursprung entfernt, umso schwächer und hässlicher wird es. Es verliert seine Jugend, die Kraft des Ursprungs, und muss schließlich sterben und zu Staub zerfallen.«
Noch immer fragte sich Kerim nach dem Sinn dieser mystischen Ansprache und verspürte die Enttäuschung darüber, nie etwas gefunden zu haben, was er daraus lernen konnte.
Damals saß er bewegungslos am Tisch und starrte auf den Teller mit den Resten des Lammfleisches. Was er bereits gegessen hatte, lag ihm nun schwer im Magen mit all der Bedeutung, die es bekommen hatte. Er verspürte erstmals einen Widerwillen gegen das Essen überhaupt, der ihn nie wieder verlassen sollte. Zudem, so meinte er zumindest in der Rückschau, war er von jenem Moment an ein Gefangener der Zeit. Wenn er innehielt und darauf achtete, konnte er fühlen, wie er selbst sich von seinem Ursprung entfernte und schwächer wurde, und er empfand wie eine leise Warnung, was Anatol sagte, eher beiläufig und um die lastende Stille zu beenden:
»Gott lässt dich nicht allzu weit gehen, bevor er dich zurückholt.«
Kerim erfuhr nie, warum, doch eines Tages nahm ihn sein Vater mit nach Nadschaf, dem wichtigsten Wallfahrtsort der Schiiten. Wenn er auch keine Glaubensregeln befolgte, so hatte er doch ein besonderes Verhältnis zur Vergangenheit, sofern sie ihn und seine Familie betrat. Es zeigte sich sowohl in den Geschichten, die er gelegentlich erzählte, als auch in jenem zweiten Ausflug, den er mit seinem ältesten Sohn unternahm. Jedenfalls erklärte sich Kerim den Grund dafür später damit, dass die Aleviten immerhin eine Abspaltung der schiitischen Glaubensrichtung darstellten und sein Vater ihn darauf hinweisen wollte. Was Kerim dann aber sah, hatte überhaupt nichts zu tun mit dem, was er kannte, es war eine völlig fremde Glaubenswelt.
Nach langer Fahrt erhob sich die Stadt flimmernd aus der gelblichen Lehmwüste. Haine von hohen Dattelpalmen säumten den Stadtrand, dazwischen weit ausgedehnte Friedhofsfelder, unzählige Grabsteine von verschiedener Form steckten wie vielfarbige Glasscherben in der Erde. Je näher sie kamen, desto mehr ähnelten sie den Trümmern einer riesigen, geborstenen Vase. Die Gassen der Stadt lagen schutzlos in der glühenden Sonne. Sein Vater hielt vor einem alten Haus, dessen Holzbalken unter dem Dach hervorragten und schneeweiß waren von Staub und Licht. Ein Stück hatten sie noch zu gehen bis zum goldenen Eingang der Moschee. Kerim erinnerte sich an den weiten Hof aus großen, rechteckigen Steinfliesen, die so heiß waren, dass er es beim Gehen im Gesicht spürte. Er sah Frauen mit schwarz verhüllten Gesichtern, und sein Blick wurde sofort gefangen von der riesigen goldenen Kuppel und den Minaretten. Es wimmelte von weißbärtigen Männern mit Gebetsmützen. Ohne Schuhe kamen sie aus dem großen Eingang, Kerim erinnerte sich an ihre weißen und blauen Socken.
»Tu alles, was ich tue«, sagte sein Vater zu ihm. Und wie immer zeigte er Geschick bei der Anpassung. Er zog die Schultern hoch, senkte den Kopf ein wenig und verwandelte sich so umstandslos in einen der vielen Gläubigen.
Gleich hinter dem Eingang begann das Dämmerlicht. Ein Greis nahm ihre Schuhe entgegen, sie gingen auf dem spiegelblanken, kühlen Boden weiter. Kuppeln und massige Pfeiler, behängt mit gläsernen Tropfen, in denen sich das Licht der Kerzen tausendfach spiegelte. Stimmen und Laute drangen aus dem Raum mit dem Grabmal Alis. Am Eingang zu diesem Hauptraum küsste sein Vater den Türpfosten, Kerim tat es ihm nach. Im Inneren herrschte Gedränge, entgegen dem Uhrzeigersinn schritten die Pilger um das Grab: ein dunkler Holzkasten, geschützt durch ein schweres silbernes Gitter. Sie wurden vorwärts geschoben und gestoßen, immer auf den Schrein zu. Sie waren noch Meter davon entfernt, als sein Vater schon die Hand ausstreckte, um es gleich im ersten Moment berühren zu können, und auch Kerim hob den Arm. Der Druck der Menge nahm zu, Frauen krallten ihre Hände in die metallenen Maschen, wurden gegen sie gepresst und sprachen dabei unaufhörlich. Ein alter Mann mit verrutschter Gebetsmütze wurde rückwärts daran vorbeigeschoben. Als kümmerte es ihn nicht, dass er falschherum stand, fuhr seine Hand über das Metallgeflecht. In seinen Augen standen Tränen. Kerim sah auf die schwielige Hand und ahnte etwas davon, wieviel Trauer, wieviel Leidenschaft der Imam Ali über Generationen ausgelöst hatte durch seinen Märtyrertod.
Die meisten Pilger versuchten das Gitter zu küssen, doch durch das Geschiebe glitten ihre geschürzten Lippen an den Maschen vorbei. Plötzlich rutschte der Mann vor ihnen zur Seite, Kerim wurde vorangeschoben, und sein Mund fiel wie von selbst auf das von den vielen Berührungen warme Metall. Kerim blickte zur Seite und sah die Finger der Menschen sich in die Gittermaschen hineindrängen, sah ihre Nasen zur Seite gedrückt, wenn sie es mit dem Gesicht berührten. Und dort, wohin alle drängten, stand der dunkle Schrein mit dem Geruch nach altem Holz. Kerim versuchte mehr von ihm zu sehen, blickte durch immer neue Maschen, als wäre irgendwann eine größere dabei. Unablässig wurden sie weitergedrängt und waren schon auf der anderen Seite, als sie sich aus dem Strom der Menschen lösten. Kerim betrachtete die alten Männer, die, ihre Köpfe schüttelnd, am Boden saßen, auf den verschränkten Beinen das heilige Buch, das er von seinen wenigen Koranstunden her kannte. Doch dort hatte er, wenn überhaupt, nur die arabischen Schriftzeichen, mehr aber noch den Klang der heiligen Worte kennengelernt. Nie aber war ihm eine solche Inbrunst begegnet, nie solche Menschen mit diesem Glauben voller Dringlichkeit.
Er folgte seinem Vater durch die gläsernen Gewölbe zurück, sie bekamen ihre Schuhe wieder und traten hinaus in das heiße Mittagslicht. Wann immer er daran zurückdachte, erschien ihm diese Moschee wie das Gefäß für ein unerhörtes Ereignis, lang vergangen und sich wiederholend, traurig und erhebend zugleich.
3.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!