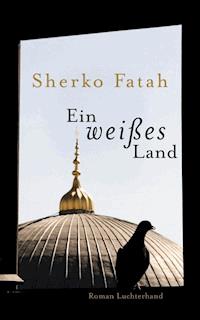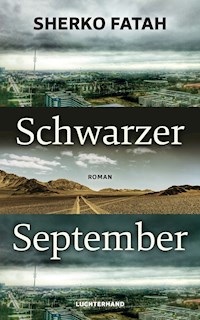
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Schwarzer September“ ist ein Roman über den Terrorismus der Siebziger Jahre. Rebellische Idealisten wie Theresa, Alexander und Jakob reisen in den Nahen Osten, um sich ausbilden zu lassen. Ihre Familien bleiben mit Legenden in der Bundesrepublik zurück. Menschen aus dem Nahen Osten wiederum wechseln in die Bundesrepublik, um Aktionen vorzubereiten. Sie alle verbindet eines: Werkzeuge zu sein in einem Zusammenhang, den sie nicht überschauen. Kraftwellen einer Gewalt, die uns bis heute beschäftigt, auch wenn sich der Terrorismus inzwischen von einer mit revolutionärem Elan ausgeübten Gewalt zum Ausdruck einer extrem politisierten Religiosität gewandelt hat.
Sherko Fatah ist einer der klügsten Beobachter und Deuter der Vorgänge im Nahen Osten. Seine faktenreichen und doch atmosphärisch dicht erzählten Romane sind ihrer Zeit auch dann voraus, wenn sie den Blick in die Vergangenheit richten. Sie spüren den abenteuerlichen Wegen der handelnden Figuren aus unterschiedlichen Kulturen inmitten der Konflikte im Nahen Osten nach und beschreiben die Auswirkungen dieser Konflikte, die wie Druckwellen auch das heutige Westeuropa erreichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
»Schwarzer September« ist ein Roman über den Terrorismus der Siebzigerjahre. Rebellische Idealisten wie Theresa, Alexander und Jakob reisen in den Nahen Osten, um sich ausbilden zu lassen. Ihre Familien bleiben mit Legenden in der Bundesrepublik zurück. Menschen aus dem Nahen Osten wiederum wechseln in die Bundesrepublik, um Aktionen vorzubereiten. Sie alle verbindet eines: Werkzeuge zu sein in einem Zusammenhang, den sie nicht überschauen. Kraftwellen einer Gewalt, die uns bis heute beschäftigt, auch wenn sich der Terrorismus inzwischen von einer mit revolutionärem Elan ausgeübten Gewalt zum Ausdruck einer extrem politisierten Religiosität gewandelt hat. Sherko Fatah ist einer der klügsten Beobachter und Deuter der Vorgänge im Nahen Osten. Seine faktenreichen und doch atmosphärisch dicht erzählten Romane sind ihrer Zeit auch dann voraus, wenn sie den Blick in die Vergangenheit richten. Sie spüren den abenteuerlichen Wegen der handelnden Figuren aus unterschiedlichen Kulturen inmitten der Konflikte im Nahen Osten nach und beschreiben die Auswirkungen dieser Konflikte, die wie Druckwellen auch das heutige Westeuropa erreichen.
Der Autor
Sherko Fatah wurde 1964 in Ost-Berlin als Sohn eines irakischen Kurden und einer Deutschen geboren. Er wuchs in der DDR auf und siedelte 1975 mit seiner Familie über Wien nach West-Berlin über. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte. Für sein erzählerisches Werk hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, zuletzt den Großen Kunstpreis Berlin der Akademie der Künste und den Adelbert-von-Chamisso-Preis 2015, außerdem den aspekte-Literaturpreis für den Roman »Im Grenzland«. Er wurde mehrfach für den Preis der Leipziger Buchmesse (2008 mit »Das dunkle Schiff«, 2012 mit »Ein weißes Land«) nominiert und mit »Das dunkle Schiff« auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2008 gewählt.
Sherko Fatah
Schwarzer September
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 Luchterhand Literaturverlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign, München
Covermotiv: Getty Images / Harald Boback / EyeEm (oben und unten); Getty Images / Xuanyu Han (Mitte)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-16216-0V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag/
twitter.com/luchterhandlit
Der Autor dankt dem Deutschen Literaturfonds Darmstadt für die Unterstützung der Arbeit an diesem Roman.
Auch wenn die hier geschilderten Ereignisse auf vielerlei historische Begebenheiten Bezug nehmen, so handelt es sich bei diesem Werk doch um einen Roman. Sämtliche Figuren, seien sie auch zeitgeschichtlich verbürgt, sind hier Teil einer mehr oder weniger fiktiven Geschichte und damit ihrerseits mehr oder weniger fiktiv.
»Besonders sind Jünglinge diese neuen Ritter, die sich durch den Weltlauf, der sich statt ihrer Ideale realisiert, durchschlagen müssen und es nun für ein Unglück halten, daß es überhaupt Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat, Gesetze, Berufsgeschäfte usf. gibt, weil diese substantiellen Lebensbeziehungen sich mit ihren Schranken grausam den Idealen und dem unendlichen Rechte des Herzens entgegensetzen. Nun gilt es, ein Loch in diese Ordnung der Dinge hineinzustoßen, die Welt zu verändern, zu verbessern oder ihr zum Trotz sich wenigstens einen Himmel auf Erden herauszuschneiden (…). Diese Kämpfe nun aber sind in der modernen Welt nichts Weiteres als die Lehrjahre, die Erziehung des Individuums an der vorhandenen Wirklichkeit, und erhalten dadurch ihren wahren Sinn.«
G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik
Erster Teil
Ende November 1971 schritt der jordanische Premierminister gemessen auf den Eingang des Sheraton Hotels in Kairo zu. Er befand sich in Begleitung seiner Leibwächter. Der Himmel über der Stadt war verhangen, mattes Sonnenlicht fiel auf die Steine, und ein leichter Wind ließ die trockenen Blätter der Straßensträucher rascheln. Vom nahen Nil her vernahm der Premierminister das Motorengeknatter der kleinen Boote, Stimmen und das Hupen von Autos wurden herangeweht.
Der Premierminister war ein stattlicher Mann von gut fünfzig Jahren. Ein ereignisreiches und oft genug gefährliches Leben lag hinter ihm, diente er doch während des Zweiten Weltkrieges in der britischen Armee, danach auf der Seite der Araber gegen die Israelis. Jetzt, angekommen bei den Mächtigen der Welt, kannte er bereits viele wichtige und sich wichtig nehmende Spieler, konnte sich einen engen Vertrauten seines haschemitischen Königs nennen und einen, in dessen Händen nicht selten die Entscheidung über Leben und Tod lag. Gerade kam er von einem Treffen der Arabischen Liga hier in Kairo.
Harte Monate lagen hinter ihm, eine Zeit, in der er seine Entscheidungen oft genug nicht nur zu fällen, sondern auch gegen heftige Kritik zu verteidigen hatte. Die PLO aus Jordanien zu vertreiben, so wie im Vorjahr geschehen, war das eine, dies vor den versammelten Heuchlern der Arabischen Liga zu rechtfertigen, von denen kein einziger einen Finger gerührt hatte, etwas anderes.
Der Premierminister blieb kurz stehen, wandte sich um und genoss den Anblick des großen alten Stroms, an dessen Ufern sich die staubgrauen Gebäude türmten, ohne ihm etwas von seiner Bedeutung zu nehmen. Wie der Nil müsste man sein, dachte er, schüttelte aber gleich den Kopf und lächelte über sich, der gerade im Begriff war, auch noch ein Dichter zu werden.
Auch wenn manche das anders sahen, er hatte keine Freude an dem Blutbad in den Slums von Amman gehabt. Die Palästinenser aus Jordanien zu vertreiben war für den Staat eine Frage des Überlebens gewesen. Die vielen Beobachter aus der Ferne hinter ihren Teleobjektiven und Fernsehkameras konnten das nicht verstehen. Diese bewaffnete und immerfort wachsende Volksgruppe stellte die Mehrheit und hätte, auch wenn dies nur das Ziel ihrer extremistischen Politiker war, letztendlich den jordanischen Staat zerstört. Er hatte zu allen Mitteln gegriffen, Napalm, Panzer, Geheimpolizei. Man nährt nicht freiwillig ein Geschwür, so dachte er noch immer.
Wieder schaute er auf den träge dahinströmenden Fluss. Er verspürte keine Reue, nur das seltsame Gefühl, all das, die niedrigen Sessel im Foyer, die langen Teppiche auf dem Marmorboden, das milchige Sonnenlicht und der sandfarbene Fluss wären weit von ihm entfernt, als erinnerte er sich daran mit dem Abstand von Jahren, obwohl es in diesem Augenblick in seiner Nähe war.
Seine Leibwächter waren mit ihm stehen geblieben und blickten verstohlen zu ihm, wenn sie glaubten, er bemerkte es nicht. Der Premierminister dachte an seine Frau, die im Hotel speiste und auf ihn wartete. Langsam ging er weiter. Es waren nur noch wenige Meter bis zum Eingang, und er freute sich auf eine nachmittägliche Ruhestunde. Die gläsernen Türen waren von einer feinen Staubschicht bedeckt, die das Sonnenlicht verschluckte. Die Säulen am Eingang strahlten kaum Hitze ab, und als seine Leibwächter ihm die Türen öffneten, glitt der Blick des Premierministers über die Ecken des Foyers, zurück zur Rezeption und nieder zum spiegelglatten Marmorboden, auf dem die Teppichläufer zu schweben schienen.
Als hätte er etwas vergessen, hielt er inne, die Leibwächter bereits drei Schritte vor sich. Wie unter einem Zwang wollte er sich noch einmal dem Nil zuwenden, Abschied nehmen vielleicht oder ihn sich einprägen. Doch hatte er sich noch nicht halb umgewandt, als vier junge Männer aus dem Nichts dieses stillen, späten Nachmittags auftauchten. Einer stand direkt hinter ihm auf der Treppe, öffnete die Glastür und richtete die Pistole auf ihn, drei andere stürmten aus dem Foyer heran und drängten die Leibwächter ab.
Blitzschnell griff der Premierminister nach der Waffe in seinem Schulterholster, doch das Revers des Sakkos war im Weg, seine Hand erreichte den nur Zentimeter entfernten Verschluss nicht mehr, und die vielen Kugeln, die er kaum hörte und spürte, warfen ihn zu Boden, wo sich sein Inneres auszubreiten und jedes Geräusch von außen zu verschlucken schien. Er wollte sich auf den Rücken drehen, doch ob es ihm gelang, nahm er nicht mehr wahr.
Nach den Schüssen herrschte kurz Stille, die Szenerie war erstarrt, niemand rührte sich, nicht die Gäste im Foyer oder die hinter die Tresen geduckten Hotelangestellten und nicht einmal die Leibwächter des Premierministers. Die vier Männer standen um den Toten herum, einer von ihnen kniff die Augen zusammen, um sie an das Dämmerlicht im Innenraum zu gewöhnen. Als wäre der Schrecken auch in sie gefahren, bewegten sie sich zunächst nicht, hielten nur die Pistolen wie zur Ablieferung vor sich. Einer der Leibwächter, ein Beduine, begann leise zu klagen, er drehte die Handflächen nach oben und legte den Kopf in den Nacken. Er beschimpfte die jungen Männer, von denen er wusste, wessen Handlanger sie waren, und verstummte erst, als er einen der Attentäter sich der Leiche nähern sah. Der Mann hatte die Pistole in den Hosenbund gesteckt und stellte sich neben den Premierminister. Er blickte in die Runde und musterte die Leibwächter, die sich noch immer nicht rührten, starrte auf den Toten hinab und ging schließlich auf die Knie. Der Beduine glaubte seinen Augen nicht zu trauen: Auf allen vieren bewegte sich dieser Mann voran, senkte in der Nähe des Leichnams den Kopf zum Boden und leckte das in langen Rinnsalen aus ihm hervorsickernde Blut vom Marmorboden. Er tat das mehrmals, sodass jeder es sehen konnte, und als er sich endlich erhob, war sein Mund rot wie der eines schlecht geschminkten Clowns. Er wischte sich nicht über die Lippen, sondern sprach zu den Anwesenden, monoton, ohne Leidenschaft. Er war wohl zufrieden.
Wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dachte Victor, dann handelte es sich um eine Show. Dieser Mord muss ihnen so unglaublich wichtig gewesen sein, dass sie bei der Ausführung zu Hochform aufliefen. Sie vergaßen weder den Namen der verantwortlichen Unterorganisation zu nennen noch den Premierminister des eigenhändigen Mordes an einem ihrer Mitglieder zu bezichtigen. Und das alles mit dessen Blut an den Lippen.
Victor warf sich in seinen Bürosessel zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Er mochte das schmale, bis zum Boden reichende Fenster in seinem Büro, durch das er seinen Blick über die Straße schweifen lassen konnte, immer wieder erstaunt darüber, wie wenig er sich an diesen Massen vorübergehender Passanten, den langsam fahrenden Autos, den Eselskarren und Lastenträgern sattsehen konnte. Das wäre meine Stadt, dachte er, so voller Leben und verschiedener Menschen von überallher, die richtige Größe und nah am Meer.
Gleich darauf fiel ihm Amos ein, und der Gedanke an ihn warf einen Schatten auf alles, was er sah. Das ärgerte ihn. Er hatte diesen neuen Star der Agentur, der vor ein paar Monaten aus dem Jemen angereist war, ignorieren wollen, hatte sich selbst Gleichgültigkeit vorgespielt. Aber er war in aller Munde. Seine neuen Methoden, von denen Victor wie auch manch anderer seiner Kollegen nichts hielt, kamen gut an bei einigen Oberen. Wir sind dabei, einen schier endlosen Scheißkrieg in Südostasien nun endlich zu verlieren, dachte Victor, da sind moderne, weiche Methoden, Verständnis, Kungelei und Anschmiegsamkeit genau das, was die Agentur braucht.
Amos war ein ausgemachter Experte für den arabischen Raum, sprach sehr gut Arabisch, war immerfort bemüht, es noch zu verbessern und schien mit jedem, den er hier auf der Straße oder im Café traf, vertraut. Er war unbürokratisch bis zur Schlampigkeit. Jemand müsste ihn daran erinnern, was wir hier eigentlich tun, hatte Heller einmal bemerkt und Victor konnte ihm darin nur zustimmen. Aber noch schien diese neue Herangehensweise an ein altes Problem niemanden zu stören. Amos umwehte der Hauch des Abenteuers, und wäre er nicht ein so vorbildlicher Familienmensch gewesen, Vater von fünf, bald sechs Kindern, ein Kirchgänger und Basketballspieler, dann hätte man ihn wahrscheinlich noch für einen amerikanischen Lawrence von Arabien gehalten. So aber war er für viele nur der gute Amerikaner, auf den alle hier gewartet hatten, einer, von dem die Einheimischen hofften, dass er sie verstand.
Alles schön und gut, sagte sich Victor, aber sind wir wirklich hier, um jemanden zu verstehen? Wir horchen die Leute aus und kaufen sie, wenn wir sie brauchen können, danach fertigen wir darüber Berichte an. Ihm war bewusst, dass er sich vor allem deshalb so an der Anwesenheit des Neuen störte, weil sie seine Methoden, seine in Jahren trainierte Herangehensweise, ja, sein gesamtes Denken infrage stellte.
Seit einem halben Jahr war Heller sein einziger Trost, der erfolglose Heller, stets übergangen und doch schon länger im Mittleren Osten unterwegs als dieser Amos denken konnte. Heller sah alle Seiten, konnte ihm, Victor, erklären, welche Möglichkeiten jemand wie Amos der Agentur hier in Beirut eröffnete, einfach durch seine Fähigkeit, Freundschaften zu schließen zu Leuten, die jedem Amerikaner in der Stadt misstrauten. Und Heller sah die Gefahr, die in dieser Art, einen gefährlichen Job zu machen, bestand. »Das kann schiefgehen, ohne dass jemand es bemerkt«, hatte er einmal gesagt. »Freundschaften sind in dieser Gegend Bündnisse.« An diese Worte hatte Victor oft denken müssen; vorgetragen wie eine sachliche Feststellung hallten sie als Warnung nach.
Victor erhob sich und trat vor das Fenster. Als kleiner Falloffizier hätten ihm die Spiele der Großen eigentlich gleichgültig sein können, er hatte keinen Einfluss darauf und war froh darüber. Nach allem, was man hörte, gingen Amos’ Berichte über einen nur kurzen Umweg direkt bis ins Außenministerium. Es war nicht vermessen zu glauben, dass Kissinger selbst sie las.
Einer alten Gewohnheit folgend, schnürte sich Victor, während er vor dem Fenster stand, den Gürtel enger. Immer wenn er sich morgens die Hosen anzog, wählte er für den Gürtel das vorletzte Loch, um im Laufe des Tages festzustellen, dass er dünner war als er glaubte. Und jedes Mal grinste er bei dem Gedanken an den Tick, der sich hinter diesem Verhalten verbergen mochte.
Jedenfalls landeten seine Berichte nicht auf dem Tisch des Außenministers. Was er tat, war im Grunde Routinearbeit, allerdings an einem besonderen Ort. Sein bester Kontakt in diesem Jahr war Massud, ein Polizist, bodenständig und fast unarabisch in seiner Direktheit. Dieser Mann war ein Glücksgriff gewesen, denn er kannte Gott und die Welt. Das Wichtigste aber: Er war, anders als die vielen lockeren Kontakte unseres neuen Genies, eingeschrieben, das heißt, er arbeitete für die Agentur und war damit in einem nicht zu unterschätzenden Maß auch kontrollierbar.
Das war es, worauf Heller immer wieder hinwies: Kontrolle, auch wenn sie verdeckt ist, bedeutet Macht. Und unter ihrem Schirm lässt sich sogar so etwas wie Vertrauen aufbauen. Alles andere waren in Hellers Augen Experimente von literarisch gebildeten Collegeboys, Abenteuer des Geistes ohne Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß – aber nicht ohne Risiko. Denn wer kontrollierte jemanden, der an einem Tag seine Zustimmung zur Zusammenarbeit gab, am nächsten allerdings seine Meinung änderte? Die Lohnliste, das heißt das faktische Wissen beider Seiten von der Verpflichtung für die Agentur, erlaubte Kontrolle.
»Die Informationen, die wir beschaffen, entscheiden möglicherweise über Leben und Tod«, hatte Heller gesagt. »Wir sollten sie nicht der Qualität des Wetters, der guten Laune unseres Gegenübers verdanken. Amos mag ein Genie sein, und vielleicht ist sein bedeutendster Kontakt so sensationell wie alle glauben, aber der Idealismus, der darin steckt zu glauben, man könnte Freundschaft zur Basis einer Zusammenarbeit machen, ist beängstigend. Du weißt, wir haben den künftigen starken Mann der Christen. Aber ist Bashir Gemayel deshalb unser Freund?«
Victor ging zum Schreibtisch zurück und begann mit seinem Bericht über die letzte Zusammenkunft mit Massud. Dem war ein junger Kerl namens Ziad ins Netz gegangen, Treibgut vom Lande, einer von diesen vielen Jugendlichen, die nichts zu verlieren hatten. Dieser Ziad war frei und würde, gut geführt, nützlich sein können. Es war ein kurzer Bericht, und Victor lehnte sich zufrieden zurück, bis der Gedanke an Amos ihn wieder nervös machte.
Wie schon oft zuvor hatte er damals in der Bar des Fleurs darüber nachgedacht, was ihn zur indirekten Zusammenarbeit mit den Amerikanern getrieben hatte. Ausgerechnet die verhasstesten Ausländer waren auch die am meisten umworbenen. Das galt für die ganze Region. Ziad führte das Teeglas an die Lippen und nickte bei jedem Schluck. Er wusste, dass ihn dies nicht entlastete. In den Augen mancher war und blieb er ein Verräter.
Sein Blick schweifte über die leeren Tische des Nachtclubs, der jetzt, am frühen Abend, entzaubert wirkte wie ein hell erleuchteter Kinosaal. Die Tischplatten waren fleckig und voller Krümel, Zigarettenkippen lagen am Boden, und am Tresen lehnte ein Reisigbesen.
Ziad staunte gerade noch über die Schäbigkeit dieses allgemein als Ausländertreffpunkt geltenden Etablissements, da zog ein Schatten hinter einem der dunklen Fenster seine Aufmerksamkeit auf sich. Wie immer in solchen Situationen machte sich Ziad klein, atmete aus und ließ die Schultern hängen. Seiner privaten Mythologie zufolge ließ ihn dies ein wenig mehr verschmelzen mit dem jeweiligen Hintergrund, vor dem er saß oder stand. Unauffälligkeit war wichtig in einer Stadt voller Verschwörer und Bombenleger, zumal, wenn man für die Amerikaner arbeitete. Ziad lächelte. Arbeiten, das hörte sich weitaus bedeutender an, als es war. Tote Briefkästen leeren, Leute ausspionieren, Botengänge machen. Nichts davon war aufregend, aber alles gefährlich.
Der Schatten im Fenster bewegte sich erneut. Diesmal glaubte Ziad, ruckartige Bewegungen wahrgenommen zu haben, er stellte sich vor, jemand suchte etwas in seiner Manteltasche. Gleich darauf war der Schatten wieder verschwunden, das Fenster leer, als hätte es nie eine Bewegung darin gegeben. Er blickte sich noch einmal im Raum um. Das tat er häufig, bevor er eine Entscheidung traf. Es zwang ihn, sich ganz auf die Situation zu konzentrieren, lenkte ihn auch, zum Guten oder zum Schlechten, vom Bevorstehenden ab.
Hinter dem langen schwarzen Tresen mit den aufwendig verzierten Zapfhähnen und vor der schimmernden Wand aus zumeist französischen Schnapsflaschen wischte ein junger Mann den Fußboden. Er war so dünn, dass sein Hemd tatsächlich leer wirkte. Leicht nach vorn gebeugt, fielen ihm pechschwarze Haarsträhnen ins Gesicht, wahrscheinlich war er ein Asiate. Auf der anderen Seite, weiter hinten im Raum, lungerten drei junge Männer auf Polstersesseln herum. Die Nische lag im Halbdunkel, an der Wand darüber war der gemalte, wohlgeformte nackte Körper einer Frau gerade noch zu erkennen.
Ziad beobachtete die drei ein paar Sekunden lang. Sie saßen mit dem Rücken zu ihm und wirkten unbeteiligt und nur miteinander beschäftigt. Er hielt sie für Botenjungen oder Lieferanten, die dort auf ihren nächsten Auftrag warteten.
Noch einmal ging er alles durch. Am frühen Abend hatte das Telefon geklingelt, lange und durchdringend, bis er endlich abgehoben und Massuds vertraute Stimme gehört hatte. Er schickte ihn ins Fleurs, um dort jemanden zu treffen. Es sei nicht ganz sicher, ob es klappen würde, aber den Versuch wert, sagte Massud. Solcherlei nebulöse Aufträge waren nicht selten, und jedes Mal ärgerte er sich sehr darüber, denn sie reduzierten ihn auf die Bedeutung jener Botenjungen dort drüben, mit denen man ähnlich umsprang. Jetzt aber ließ er sich nicht dazu hinreißen, innerlich darüber zu fluchen, dass man über ihn und seine Zeit nach Belieben verfügen konnte. Vielmehr rekapitulierte er innerhalb der nächsten Sekunden, was er über Massud wusste. Er hegte keinen wirklichen Verdacht, es war eher ein Was-wäre-wenn-Spiel, eine kurze Selbstvergewisserung.
Er lehnte sich zurück und starrte in das kalte Licht der Neonröhren, die über der Bar befestigt waren. Er betrachtete die großen Lampenschirme aus Ziegenleder in der Mitte der Raumdecke und dachte an das verführerische rötliche Dämmerlicht, das sie entstehen ließen, wenn sich gegen neun Uhr abends der Saal mit Gästen zu füllen begann. Jetzt war das alles weit entfernt, weder das glänzende Metall der Zapfhähne noch die vielen übereinanderstehenden Flaschen, noch nicht einmal der süßliche, scharfe Geruch im Raum konnten der sachlichen Vorabendstimmung etwas anhaben.
Kaum wiederzuerkennen war die Bühne. Der dicke Teppich, der sie bedeckte, war fleckig und grau. Nur mit Mühe konnte Ziad sich vorstellen, wie die Herrin der Hunde dort spät am Abend ihre Nummer aufführte. Halb nackt, in rotes Licht getaucht, streckte sie die Brüste vor und schwenkte die Hüften. Vor allem aber stolzierte sie barfuß umher, und allein schon, wie sie die Füße aufsetzte, sich umwandte und, vom Licht geblendet, herrisch sich umblickte, elektrisierte die anwesenden Männer. Das jedenfalls bildete Ziad sich ein.
Für ihn war sie die europäische Traumfrau, hell und hochgewachsen, Hure und Beute in einem, Herrin und unerreichbares Traumgebilde im anderen Moment, ganz wie sie es wollte. Der Anblick der jetzt schmutzigen Bühne ernüchterte Ziad. Kurz machte er sich bewusst, wie billig diese Inszenierung aus ein paar Bühnenstrahlern und lauter Musik war – und wie wirkungsvoll. Gleich darauf hatte er wieder die Tänzerin vor sich, ihre beweglichen Hüften, die wohlgeformten Schultern und den tiefrot geschminkten Mund.
Beim Gedanken an sie wurde ihm heiß, und, wie immer in solchen Momenten, verachtete er sich für diese jugendliche Geilheit, diese überbordende Leidenschaft, die so stark werden konnte, dass sie ihm den Atem nahm. Er dachte an die Europäer und Amerikaner, an Touristen und Leute, die er aus der Ferne von der Agentur her kannte, an diese Männer in Jeans und Freizeithemden oder auch in Leinenanzügen. Im Vergleich zu ihm waren das rational denkende Erwachsene, sie waren planvoll und zuverlässig, jedenfalls gaben sie das vor. Allem, was sie taten, schien Überlegung vorausgegangen zu sein, und ihre dauernde höfliche Distanz konnte hier leicht als Kälte und Berechnung missdeutet werden. Ihnen gegenüber kam sich Ziad vor wie ein Tier, ungezügelt und unberechenbar. Der Gedanke, dass diese Westler ihre Lüsternheit nur besser verbargen, tröstete ihn nicht, denn im Verbergen lag ja ihre Stärke. Etwas stimmt mit uns nicht, dachte er, wir sind zu heißblütig. Dachte er an die Tänzerin, an ihre leicht emporgereckten Zehen, wenn sie zu Beginn ihrer Nummer die spitzen Pantoffeln von ihren Füßen warf, dann wurde ihm der Mund trocken. Er wollte sich vor ihr niederwerfen und sie im gleichen Moment beherrschen, unter und über ihr sein. Diese Vorstellung aber erzeugte in seinem Geist eine Dissonanz, die ihn sich seufzend die Stirn wischen ließ. Vielleicht stimmt auch nur etwas mit mir nicht, dachte er und zwang sich zur Konzentration.
Er war, das wusste Ziad, auch hier, gerade hier in Gefahr. Selbst wenn er Massud nicht ernsthaft unterstellte, etwas gegen ihn im Schilde zu führen, so konnte doch immer noch etwas schiefgegangen sein. Wie hatte er es formuliert: »Tu mir den Gefallen, mein Freund, es ist keine große Sache. Bleib einfach, wo du bist, bis er kommt. – Ich muss heute noch viele Informationen auswerten. Du verstehst, alles wichtig, eilig – wie die Oberen eben sind.« Es war das Übliche, erst die Zumutung, dann der Trost durch Vertraulichkeit.
Ziad sah auf die Uhr. Er war jetzt seit einer halben Stunde hier und niemand schien ihn bemerkt zu haben. Der Raum war offen und betretbar wie eine Bahnhofshalle, und zu Ziads Verwunderung hatte sich niemand gerührt, nachdem er sich an einen der Tische gesetzt hatte.
Hinter ihm knarrte eine Tür, dort, wo zwischen zwei überlebensgroßen Porzellanhunden ein dunkler Gang zu den Toiletten führte. Er lehnte sich vor und stützte die Ellenbogen auf den Tisch. Momente später stand tatsächlich ein hochgewachsener Mann bei ihm. Ziad sah ihn aus dem Augenwinkel und rührte sich nicht.
»In den Bergen hat es gestern geregnet«, sagte der Mann auf Englisch.
»Am Schwarzen Horn oder im Schuf?«, sagte Ziad leise.
Der Mann schwieg unangenehm lange und kramte einen Briefumschlag aus seiner Manteltasche hervor. Unbeholfen setzte er sich schließlich Ziad gegenüber, legte die flache Hand auf den Umschlag und schob ihn über die Tischplatte zu ihm.
Ziad schmunzelte.
»Ich muss es einfach fragen«, sagte er, als würde er zu sich selbst sprechen, »warum ausgerechnet hier?«
»Der einzige Ort, den ich in Beirut kenne.« Der Mann blickte sich andeutungsweise um. » Sorry«, fügte er noch an.
Er erhob sich, zupfte den Mantel zurecht und ging. Ziad blickte ihm nach, beobachtete, wie er in den gewaltigen Windfang und von dort ins Licht der Straße trat. Er spürte den Umschlag unter seiner Hand und fragte sich, ob dieser Mann, der aussah, als käme er aus dem Süden des Landes und möglicherweise ein Schiit war, tatsächlich die ganze Zeit über in der Toilette auf ihn gewartet hatte. In solchen Momenten sah er alles, was er tat, von außen. Doch die Lächerlichkeit des Spiels konnte ihn nicht amüsieren, sie erschreckte ihn. War das auf den höheren Etagen der Agentur möglicherweise anders, gab es dort einen Grad von Professionalität, der Szenen wie diese nicht zuließ? Wer weiß, dachte er, vielleicht ist auch das eine Illusion.
Er wartete noch fünf Minuten, fing einen stumpfen, missmutigen Blick des Asiaten auf, der nichts als Überdruss zum Ausdruck brachte. Dann prüfte er kurz den Stapel Banknoten im Umschlag und erhob sich. Kurz vor dem Windfang blickte er noch einmal zu den drei Männern und bemerkte, dass es vier waren. Einer saß so tief im Schatten, dass er dunkelblau wirkte. Ziad öffnete die Tür, trat hinaus und atmete tief ein. Er spielte mit dem Umschlag in seiner Tasche herum, war erleichtert und bog auf den Boulevard ein.
Einige Meter weiter blieb er stehen. Er hatte sich gegen den Gedanken gewehrt, vielleicht einfach nur aus Trägheit. Jetzt aber, im frischen Abendwind, umbraust vom Vorabendverkehr, stand das dunkelblaue Gesicht des Mannes im Schatten klar vor ihm. Wenn das ein Zufall war, dachte Ziad, dann einer von jenen, die einen nicht mehr an Zufälle glauben lassen. Er machte kehrt und ging zum Fleurs zurück.
Vor dem Eingang bewunderte er wieder einmal den für diese Region untypischen Schaukasten. Wo vor einem Kino Aushangfotos befestigt gewesen wären, gab es hier nur einen kleinen, schwach beleuchteten, karmesinroten Vorhang. Ganz unten teilte er sich, und in dem dunklen Spalt stand ein Paar weißer Damenschuhe, hochhackig, spitz und mit Riemenverschluss, winzig wie das Zubehör für eine Puppe. Zwischen den Schuhen, ebenso klein, lag der Kopf eines abgewetzten Stoffhundes, niedlich und bedrohlich zugleich. Das war alles, kein Schild, kein Schriftzug, nur dieses Arrangement, das für Ziad fremdartig und verrucht war, der Eingang in eine Lasterhöhle.
Er griff nach der eisernen Klinke und drückte sie nieder. Der Eingang war noch immer offen und unbewacht. Im letzten Moment überlegte er es sich anders, schloss die Tür wieder und drehte sich um. Er eilte an den Straßenrand und wartete auf eine Lücke im Verkehr. Angestrengt blickte er sich um und machte schließlich drei Blocks weiter eine Telefonzelle aus. Er überquerte die Straße, ging schnell und erreichte das Telefon, bevor ein anderer es in Beschlag nehmen konnte. Erleichtert atmete er aus, fingerte die Münzen aus seiner Hosentasche hervor und rief Massud an.
Es dauerte lange, doch schließlich hob sein Kontaktmann ab. Wieder schnaufte Ziad erleichtert.
»Was ist los, mein Freund? Hat alles geklappt?«
»Ja, er hat mir etwas gegeben.«
»Gut, gut«, sagte Massud nach einer kurzen Pause. »Du bringst es mir, wenn ich es sage. – Was willst du?«
»Der Schwarze ist hier. Weißt du etwas darüber?«
Zu Ziads Beruhigung entstand diesmal keine Pause.
»Nein. Bist du sicher? Wo hast du ihn gesehen?«
»Im Fleurs.«
»Was denkst du, Bruder, was denkst du nur?«
»Ich weiß nicht, was ich denken soll. Sag du es mir.«
»Denk nicht, sondern geh dort weg. Sollte er es wirklich sein, dann hat es nichts mit dir zu tun. Kümmere dich nicht darum.«
»Du weißt es jetzt.«
»Ja. Geh einfach weg.«
Massud legte auf, Ziad hielt den schweren Hörer noch einen Moment lang in der Hand, bevor er einhängte. Was hast du anderes erwartet, sagte er sich und wusste, dass ihm seine Redseligkeit am Telefon wieder einmal Ärger einbringen würde. Er hatte zu viele Worte gemacht, unnötige Worte.
Mild und salzig wehte der Wind vom Meer heran, und noch durch die kleinen fleckigen Scheiben der Telefonzelle war das auf den hellen Hausmauern spielende Licht der Laternen und Autoscheinwerfer Anzeichen für einen schönen Frühsommerabend, der vor der Stadt lag.
Ziad schüttelte den Kopf, um aus seinen Träumereien zu erwachen, wandte sich um und wich zurück. Vor ihm stand der Mann aus dem Fleurs, jener, über den er gerade gesprochen hatte, nur durch die Tür der Telefonzelle von ihm getrennt.
Raissa hielt den Wagen, einen recht neuen Ford Taunus, nicht unmittelbar vor dem Haus an, sondern ein paar hundert Meter weiter. Das tat sie immer, weil ihr Mann Massud es ihr eingeschärft hatte. Aus Sicherheitsgründen, hatte er gesagt, und sie befolgte seine Anweisungen, immerhin arbeitete er auch für die Fremden. Doch sie tat es immer widerwilliger, seit sich ihr Mann, natürlich nur beruflich, mit den europäischen Huren aus dem Fleurs beschäftigte. Niemand, schon gar nicht ein Mann, konnte ihr erklären, welchen Sinn es haben sollte, sich in diesen Kreisen herumzutreiben.
Ihre beiden Jungen schliefen auf dem Rücksitz. Sie stellte den Motor ab, wandte sich um und weckte sie sanft. Wieder einmal konnte sie ihren Ärger nur mühsam unterdrücken, lächelte aber tapfer, als die Jungen sich die Augen rieben und in jammerndem Tonfall nach ihrem Vater zu fragen begannen.
»Gleich sind wir zu Hause«, sagte Raissa, »steigt aus und seid leise.«
Draußen nahm sie jeden an einer Hand, griff fest zu, damit sie es spürten, und ging auf das Haus zu.
Hinter einem Baum trat ein Mann hervor und stellte sich ihnen in den Weg. Er war groß und dunkel, wahrscheinlich ein Nordafrikaner. Raissa packte die Hände ihrer Jungen so fest, dass die beiden wieder zu jammern begannen. Sofort blickte sie sich hilfesuchend um, doch die Straße war leer, ausgerechnet in diesem Moment waren keine herumstreunenden Jugendlichen, kein Straßenhändler und nicht einmal ein Auto zu sehen.
»Ruhig. Bleib stehen«, sagte der Mann vor ihr.
Seine Stimme klang sanft, sein Arabisch fremd. Er streckte die Hand vor, trat nah an Raissa heran, berührte den Kopf von Khaled zuerst, danach den von Mohammed, tat einen unbeholfenen Schritt zurück und sagte:
»Deine Jungen werden heranwachsen.«
»Was willst du?«, sagte Raissa aufgebracht.
»Deine Jungen werden heranwachsen«, wiederholte der Mann langsam und eindringlich. »Wenn du dort entlang gehst.«
Er nickte bei den letzten Worten.
Raissa blickte in das versteinerte Gesicht, in seine dunklen Augen und auf seinen schmallippigen Mund. Sie sah ihr beleuchtetes Haus. Oben, aus Massuds Arbeitszimmer, drang Lampenschein. Im nächsten Moment füllten sich ihre Augen mit Tränen, die Jungen rissen an ihren Händen, Raissa senkte den Kopf, wandte sich um und zog sie die Straße entlang in die entgegengesetzte Richtung.
Zu oft stand sich Massud im Weg. Seit seiner Zeit an der Amerikanischen Schule von Beirut war ihm das klar. Er war kein Hitzkopf wie dieser von ihm angeworbene Ziad, der oft Mühe hatte, sich zu kontrollieren, er war auch nicht wie einer dieser anderen Herumtreiber allzu rasch bereit, einen neuen Arbeitgeber, also Zahlmeister, zu suchen. Diese Jungen hatten in den seltensten Fällen mehr als einen unbestimmten Kindertraum von Amerika.
Aber auch er wusste um seine Probleme mit sich selbst, etwa seinen Mangel an Aufmerksamkeit. Immer wieder ließ er sich einlullen von der Gastfreundschaft, sei es bei Muslimen, Maroniten oder den lebensfrohen syrischen Christen, allesamt Leute, denen man nicht trauen sollte, sobald man ihr Haus verließ. Die Einzigen, auf die hier Verlass war, waren Ausländer, Amerikaner, Franzosen, Briten, Deutsche, allerdings nur, solange sie einen brauchten. Danach war man wieder in Gottes Hand.
Massud warf drei Stück Zucker in sein Teeglas und rührte hastig um. Nachdenklich blickte er zum Fenster hinaus. Das Haus stand an einer Hügelflanke, daher hatte er einen schönen Blick auf Gemmayzeh, eine Nachbarschaft der Mittelklasse, geschaffen für Leute wie ihn, Händler und Regierungsbeamte, Aufsteiger, die auf der Hälfte des Weges stehen geblieben waren.
Der Tee munterte ihn auf. Wahrscheinlich hat dieser kleine Idiot Gespenster gesehen, sagte er sich. Die Bäume bewegten sich im Wind, gaben Laternen- und Fensterlichter frei und verdeckten sie wieder. Was aber, dieser Gedanke nagte an ihm, wenn der Schwarze wirklich in der Stadt war? Warum sollte ihm Ziad dies auf eine so unprofessionelle Weise am Telefon mitteilen, wenn er nicht außer sich gewesen wäre? Doch es ergab keinen Sinn. Der Libyer konnte von dieser kleinen Geldübergabe im Fleurs nichts gewusst haben, sie war zu unbedeutend.
Massud kam zu dem Schluss, dass es sich um einen Zufall handeln musste, wenn auch einen seltsamen. »Aber warum im Fleurs?«, murmelte er vor sich hin und rieb sich die tiefe Falte zwischen seinen Augen. Er überlegte, ob er jemanden von der Agentur kontaktieren sollte. Aber die Furcht vor Victors Missbilligung, vor seinen abschätzigen Kommentaren, welche er nie persönlich von ihm hörte, immer aber zugetragen bekam, hielt ihn kurz davon ab. Schließlich tat er es doch und erreichte den Amerikaner sogar. Dessen gleichmütige Stimme beruhigte ihn. Sie hielten das Gespräch kurz.
Unten waren Geräusche vernehmbar, Raissa kam nach Hause, seine Königin, die er noch mehr liebte, seit sie ihm die beiden Jungen geschenkt hatte. Sie waren sein ganzer Stolz, selbst wenn er sie Tage nicht sah, hatte er sie immer bei sich, als wären sie mit seinem Körper verwachsen. Er trank den Tee aus und stand auf.
Die Jungen waren auf der Treppe zu hören, doch anstatt zur Tür zu gehen, wandte sich Massud um und schaute noch einmal zum Fenster hinaus. Hinter dem nächsten Hügel, zum Meer hin, schienen die letzten, kaum noch erkennbaren Reste des Himmelsblaus von der Dunkelheit verschlungen zu werden. Der Lärm der Straßenhändler, Autohupen und von irgendwoher auch Musik drangen zu ihm herauf.
Beirut könnte ein Paradies sein, dachte er, wenn es nicht so viele fremde Mächte gäbe, die ausgerechnet den Libanon zu ihrem Operationsgebiet gemacht hatten. Es muss daran liegen, dachte er weiter, dass dieser Ort von so verschiedenen Religionen, politischen Parteien und Clans beansprucht wurde. So hatte er sich zu einem Magneten entwickelt, der nun auch weltweit die unterschiedlichsten Gestalten anzog. Welch ein Ort, sagte er sich, so voller Hass und dabei so friedlich, kein Tourist würde es je bemerken. Zumindest war das jetzt noch so.
Wieder rieb sich Massud seine Stirnfalte. Wenn sich all die Befürchtungen bewahrheiteten, die es seit dem Anschlag in München gab, dann waren dies vielleicht die letzten friedlichen Sommerabende für eine lange Zeit. Hätte er geahnt, dass sich die Dinge so entwickeln würden, dann hätte er sich vor zehn Jahren nicht anwerben lassen. Dieser Victor mochte sein Handwerk verstehen, doch offen war er nie, auch nicht jenen gegenüber, die er in Gefahr brachte. Amerikaner, dachte er, sind immer einem anderen, weit entfernten Herrn verpflichtet, nie sind sie wirklich hier. Sie arbeiten, als hätten sie einen Mikrofonstöpsel im Ohr, mit dem sie in ständigem Kontakt mit Übersee stünden. Die Franzosen, korrupte Selbstdarsteller allesamt, verlogene, vorgeblich diplomatische Kolonialisten. Sie kamen hierher, nahmen sich ein schönes Haus in den Bergen und während ihre Frauen nichts anderes zu tun hatten, als sich den nächstbesten Araber ins Bett zu ziehen, ließen ihre Männer nichts unversucht, die einflussreichsten Leute vor Ort zu bestechen.
Am ehesten Verlass war noch auf die Deutschen, die jetzt vermehrt auftauchten. Bei Allah, dachte Massud, wie konnte ein Volk, das noch vor ein paar Jahrzehnten die ganze Welt in einen jahrelangen Krieg gestürzt hatte, während seiner Olympischen Spiele bei acht Palästinensern so versagen. Nicht einmal ihre Gewehre hatten funktioniert. Was war nur mit diesen Leuten los, dachte er, wie desorganisiert mussten sie sein? Eine Handvoll Palästinenser tanzte ihnen vor den Augen der Welt auf der Nase herum, man munkelte sogar, sie hätten sich an einem der israelischen Athleten sexuell vergangen. Die Gedemütigten sind oft besonders einfallsreich, wenn es darum geht, andere zu entehren, und gerade die Israelis müssten wissen, dass dies zur Wahrheit gehört. Bei Allah, dachte Massud wieder, Bauern waren das, gewalttätig, primitiv, aber in der Lage, den einmal gefassten Plan auf Biegen und Brechen auszuführen. An Entschlossenheit, dachte er, mangelte es ihnen nicht, wenn auch an vielem anderen.
Er öffnete die Tür, war kurz verwundert, nichts mehr von den Jungen zu hören. Wo waren ihre Stimmen, ihr Gelächter, das Gepolter auf der Treppe? Im Foyer unten brannte das Licht, das wunderbare Medaillon des Keshan-Teppichs schien sich ein paar Zentimeter vom Boden zu heben, so überdeutlich wurde es angestrahlt. Massud machte abrupt kehrt und ging ins Arbeitszimmer zurück, steuerte auf den Schreibtisch zu und öffnete die Schublade. Manchmal, es ist selten, aber es kommt vor, versagen alle unsere Schutzmechanismen. Massud hörte die Worte Victors, als stünde er im Raum, sie erfüllten seinen Kopf, als er die Mauser entsicherte.
»Es gibt Mitarbeiter, die das im Laufe ihrer Karriere nie erlebt haben, und es gibt welche, die gleich mehrmals in eine solche Situation geraten sind. Für diesen besonderen Augenblick gilt: Selbstschutz. Alle Vorschriften, alle Maßregeln sind vergessen, es gibt kein Netz, das euch auffängt. Wir nennen das einen ernsten Zwischenfall, aber ihr müsst wissen, dies ist der Moment, in dem ihr allein seid.«
Massud wollte den Gedanken nicht zulassen, zu geruhsam war dieser Abend, an dem außer dem Anruf von Ziad nichts geschehen war. Ein schöner, ein erholsamer Abend mit ein, zwei Stunden für ihn selbst. Wie wohl ihm das Nachdenken getan hatte, wie gerne er hier gesessen hatte mit seinem Tee, an diesem schönen Fenster, in seinem Haus. Er, hier, mitten im Leben, wie gut ihm das getan hatte. In der Fensterscheibe sah er die gespiegelte Zimmertür sich öffnen. Er war fest entschlossen gewesen zu schießen, doch die Pistole hing nur schwer an seinem Arm, als ihn die Schüsse in Salven trafen, das Fenster vor ihm zersprang und eine ungeheure, tonlose Dunkelheit hereinstürzte.
Ziad. Erste Sitzung
Das Ausbildungslager bedeutete Verlorenheit. Er war ständig hungrig und fürchtete das Gebrüll der Ausbilder. Ziad hatte ein körperliches Training erwartet, vielleicht Übungen mit Waffen. Doch er erlebte Gehirnwäsche: ständig mussten sie ganze Sätze nachsprechen, mussten über den Sinn wichtiger Aussagen von wichtigen Männern referieren, abgehetzt, bedeckt von Wüstenstaub. Immerfort, bei jeder sich bietenden Gelegenheit wurden sie getestet, wurde ihr Denken in eine bestimmte Richtung gelenkt, sodass jeder der Anwärter unwillkürlich all seine Konzentration darauf verwandte, den nächsten Test zu bestehen. Sei es aus Furcht vor den Ausbildern oder doch eher vor den möglichen Strafen, jeder von ihnen gab sein Bestes, bis sie wie Automaten auf neue Schikanen reagierten.
Das Schreiben war eine der Aufgaben, die sie alle zwei oder drei Wochen erfüllen mussten. Dabei ging es nicht um Schulbildung. Jeder sollte einfach nur sein Leben erzählen, so gut er es erinnerte. Alles, was die Ausbilder von ihnen verlangten, war absolute Ehrlichkeit, und Ziad ahnte damals bereits, dass es hier um rückhaltlose Preisgabe ging, welche die Anwärter noch verwundbarer machen sollte.
Ziad starrte auf das Blatt, betrachtete die Schatten, die darauf zu wandern schienen. Er nahm den Stift, den sie ihm hingelegt hatten, seine Fingerkuppen waren so feucht, dass er fürchtete, er könnte ihn zum Schreiben nicht halten. Trotz der Schmerzen und der Furcht zu versagen, wollte er ehrlich sein. Widerwillig gestand er es sich ein: Ihre brutalen Methoden bewirkten etwas. Es war, als gebe es in all dem Schmerz und der Verzweiflung, in die er versunken war, einen glühenden, reinen Kern. Er hatte in seiner Situation einfach keinen Grund mehr zu lügen und zu täuschen und glaubte bald tatsächlich daran, seiner Qual nur durch die Wahrheit ein Ende bereiten zu können.
Also begann er zu schreiben, langsam und unbeholfen, und der Stift drohte ihm aus den Fingern zu gleiten. Ziad blickte kurz um sich, doch konnte er außerhalb des Lampenscheins kaum etwas erkennen. Er wusste nicht, ob jemand hinter ihm im Raum war oder ob sie ihn für die Lebensbeichte einfach allein gelassen hatten. Schließlich war er kein Gefangener, sondern ein Aspirant auf die Mitgliedschaft, also zukünftig einer von ihnen.
Allmählich lockerte sich sein Handgelenk, und sein Atem beruhigte sich. Er schrieb, begann mit seiner Ankunft in Marseille, wo er nach einer schrecklichen, von Seekrankheit bestimmten Überfahrt ankam. Er schrieb nicht, wie er seinem Vater das Geld für die Überfahrt gestohlen hatte, wie er in einem unbeobachteten Moment ins Schlafzimmer geschlichen war, die Schubfächer durchsucht und alles mitgenommen hatte, was er dort fand. Diese Tat war seine ewige Schmach, über die er schweigen wollte bis zum Grab. Er war zum Dieb an seiner eigenen Familie geworden, weil er an den Wänden seiner französischen Schule die großen Fotos französischer Landschaften und Städte gesehen hatte. So verheißungsvoll erschien ihm dieses gar nicht so ferne Land, dass er eines Tages aus seinem Dorf dorthin floh und dafür sogar seine Familie und seine Ehre als Sohn zurückließ.
Er schrieb, wie er, mit zitternden Knien und der Bewusstlosigkeit nahe, in einem der Hotels am Alten Hafen Unterschlupf fand. Sehr deutlich erinnerte er sich noch daran, wie er auf den dunklen Eingang zuwankte, in dem nichts als die Glut einer Zigarette aufleuchtete, wie er, an den Türrahmen gelehnt, auf einen Unsichtbaren einredete, bis dieser ihm seinen Rauch entgegenblies, als er sagte: »Complet«.
Ziad taumelte weiter, und es schien ihm, als hätte er ein Dutzend solcher Türen und noch mehr Rezeptionen im Dämmerlicht gesehen, bevor er endlich ein Hotel mit einem freien Zimmer fand. Dort, im dritten Stock, auf einem knarzenden Drahtbett mit durchgelegener Matratze, schwand das Fieber seiner Seekrankheit allmählich, kam sein Kreislauf zur Ruhe. Die Übelkeit ließ nach und wich einer tiefen Erschöpfung. Er schlief lange bei offenem Fenster, der Lärm von Stimmen und Autos, das Geschrei von Kindern und Musik aus einem Radio weckten ihn. Er richtete sich im Bett auf, legte die Hand an die Stirn und verspürte Erleichterung. Er war wieder gesund.
Ziad sollte sein bisheriges Leben aufschreiben, und die Furcht ließ ihn auch Jahreszahlen, Ereignisse, die für ihn wichtig gewesen waren, Menschen und Orte sich vergegenwärtigen, ja zusammenraffen. Doch immer, wenn er auf das Papier starrte, lösten sich die harten Fakten auf in den Erinnerungen an seine traurige europäische Odyssee.
Traurig war sie vor allem, weil er beinahe mittellos war. Das gestohlene Geld reichte kaum für die erste Woche. Danach war er eigentlich unaufhörlich unterwegs, dachte sehnsüchtig an die ersten Frühstücke im Straßencafé vor dem Hotel zurück, wenn er in einem Hauseingang, einem Park oder auf der Festungsinsel vor dem Alten Hafen übernachtete. Er durchstreifte diese seltsame Stadt, die, je weiter der Abend voranschritt, an vielen Orten immer arabischer, an anderen immer afrikanischer wurde.
Er war auf der Suche nach Arbeit. Nachdem er auf verschiedenen Baustellen kein Glück hatte, versuchte er es mit den arabischen Restaurants. Vielleicht lag es an seiner ungepflegten Erscheinung, die Restaurantbesitzer zögerten sogar, ihn als Tellerwäscher einzustellen. Und wenn sie doch dazu bereit waren, wollten sie ihm so gut wie nichts bezahlen. So kam es, dass er wochenlang im Freien schlief. Ich bin beinahe jedem begegnet auf dieser Reise, dachte Ziad, der es ausnutzen konnte, dass ich allein und mittellos war. Er seufzte und schrieb diesen Satz auf den Zettel, um ihn sogleich wieder durchzustreichen.
In Marseille gab es wie in Beirut Jugendbanden, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Anders als in Beirut aber waren sie hier schwerer zu erkennen, sie streunten herum oder kauerten in Hauseingängen, harmlos plaudernd, bis sie einen bemerkten. Mehrmals musste Ziad vor ihnen davonlaufen und immer, wenn er außer Atem und in Sicherheit war, fragte er sich, was sie eigentlich von ihm, der nichts besaß, wollten. Er vermutete, sie nutzten einfach nur die Gelegenheit zur Jagd, es ging um nichts, und das war im Grunde deprimierender als die Tatsache, dass man diese Eckensteher nicht einmal in Europa loswerden konnte.
Nachts an der Mole auf der Festungsinsel beobachtete er die Schwulen bei ihren Treffen. Es dauerte nicht lange, bis ihn ein in seinen Augen älterer Mann ansprach, Typ Professor oder Lehrer mit Brille, ungepflegtem Bart und einem auffälligen Halstuch. Der Mann wich nicht von seiner Seite, sprach unaufhörlich auf ihn ein, hakte sich bei ihm unter und drängte ihn von dem schmalen Sandweg in Richtung der Oleanderbüsche. Das Meer war unruhig an diesem Abend, recht heftig brachen sich die Wellen in der weiten Bucht. Die Gier schien den Mann mit der Brille völlig zu beherrschen, seine knorrigen Finger krallten sich unterhalb der Rippen in Ziads Körper, und während er auf ihn einsprach, bespuckte ihn der Mann, da ihm der Mund tatsächlich wässrig geworden war. Ziads Schlag gegen sein Kinn gelang ihm aus Versehen so präzise, dass der Mann zu Boden ging, in die Büsche fiel und sich nicht mehr regte. Schuldbewusst blickte er um sich, doch niemand von den Spaziergängern und den Paaren in der Nähe der Türme schien etwas gehört zu haben. Er starrte auf sein Opfer nieder, von dem nur der Hintern und die Beine zu sehen waren, erkannte die Umrisse der Brieftasche in der Gesäßtasche und griff ohne zu zögern zu. Genau in diesem Moment erwachte der Mann. Er tastete mit beiden Händen nach der Brille, die ihm von der Nase gefallen war. Ziad hockte sich über ihn und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, bis er sich nicht mehr rührte. Er genoss jeden Schlag, fühlte sich befreit dabei, nur das Blut ekelte ihn. Er erhob sich rasch und blickte schnaufend über die Büsche hinweg um sich. So war er inmitten von Meeresrauschen und Oleanderduft erneut zum Dieb geworden, ein Straßenräuber wie jene, die ihn zum Spaß jagten.
Noch im Davongehen zählte er das Geld und war zufrieden. Wieder suchte er sich ein Hotelzimmer in der Nähe des Hafens und wiederholte sein kleines Glück der Ankunft in Europa, inklusive Baguette und Milchcafé am Morgen.
War es das, was sie wissen wollten? Ziad hob den Kopf und beobachtete den Tanz der Mücken und Motten an der nackten Neonleuchte. Das feine Summen dieser Lampe machte ihn wahnsinnig, er steckte sich das Ende des Stifts in den Mund und rieb sich die Hände. Dann schrieb er:
Ich heiße … wurde dann und dann geboren, meine Eltern waren … mein Vater … meine Mutter … Es las sich sehr förmlich, und als er darüber nachdachte, mit welchem bedeutenden Tag in seinem Leben er beginnen sollte, fiel ihm der 6. September 1970 ein, er war gerade fünfzehn Jahre alt und saß in seinem Dorf am Radio. Die Flugzeugentführungen, das wird ihnen gefallen, dachte Ziad. An jenem Tag gab es gleich mehrere zugleich, eine Schweizer Maschine war dabei und eine britische. Und zu seinem großen Erstaunen war eine Frau beteiligt. Sie hieß Leila Chaled und wurde später weithin berühmt.
Damals aber fragte Ziad seinen Vater, wie es sein könne, dass eine Frau solche Dinge tat. Seine Schwestern waren noch nicht geboren, und alle Frauen, die Ziad bis dahin kennengelernt hatte, seine Mutter, Madame Perot, seine strenge Lehrerin in der französischen Schule, und die Mädchen im Dorf waren völlig anders als diese Leila. Zu seiner Überraschung wurde sein Vater wütend, entriss ihm das Kofferradio, packte ihn im Nacken und zog ihn hinaus auf die Dorfstraße. Ziad erinnerte sich noch gut an die Schmerzen, die er noch Tage nach diesem Griff an seinem Hals verspürte. Sein Vater war ein starker Mann, der seit Jahren auf Straßenbaustellen arbeitete. »Schau dich um«, sagte er zu seinem Sohn. »Hier müssen wir leben, weil wir Flüchtlinge sind, gottesfürchtig oder nicht, wir sind Flüchtlinge. Als du noch ein kleines Kind warst, sind wir in dieses Land gekommen, weil wir mussten. Vorher hat man uns alles genommen. Deine französische Madame in der Schule und vielleicht noch einige reiche Christenfrauen in Beirut können es sich leisten, seltsame Dinge zu tun. Wenn eine von uns sich dazu entscheidet, dann aus Not. Es ist nur ein Zeichen unserer Verzweiflung, dass die jungen Frauen unseres Volkes zum Gewehr greifen und Soldaten werden. Die ganze Welt ist gegen uns oder sie hat uns vergessen. Merk dir das: Für uns können die Gesetze dieser Welt nicht gelten, denn diese Gesetze sind gegen uns gerichtet. Ich bin froh, dass diese Frau in dem Flugzeug nicht meine Tochter ist, aber ich bewundere sie und würde ihr die Füße küssen, wenn ich könnte. Wahrscheinlich kommt sie auch aus einem Ort wie diesem, daran kannst du erkennen, wie manchmal aus etwas Kleinem, ganz Verlorenem, etwas wirklich Großes wird, das die Welt nicht mehr übersehen kann.«
Ziad erinnerte sich gut an den Anblick, den das Dorf an diesem Nachmittag bot. Es sah aus wie der abgelegenste Ort der Erde, bereit, im Boden zu versinken, sobald jemand nur fest genug mit dem Fuß auftrat. Madame Perot aber, die mit ihrer Strenge in den Jungen seiner Klasse eine Begierde danach auslöste, von ihr mit dem Stock oder der bloßen Hand bestraft zu werden, diese europäische Frau stand für ihn gleichberechtigt neben jener bewaffneten Heldin Leila.
Er schrieb und schrieb, bis er endlich auch erklärt hatte, wie es ihm gelang, in einem der arabischen Restaurants einen Job als Kellner zu finden. Wie er dem Mann, den er nur als Imad kannte, bei einem Abendessen begegnete. Er war mit einer Familie dort, die offensichtlich nicht seine eigene war, und verwickelte Ziad in ein kurzes Gespräch, fragte, woher er käme, was ihn nach Marseille geführt hätte und schickte ihn dann mit einer kurzen Handbewegung fort. Den ganzen Abend über ließ er Ziad nicht aus den Augen. Wenn dieser mit dem Tablett aus der Küche kam oder die Bestellzettel einsah – immer fing er den Blick Imads auf.
In dem Lokal gab es einen Flipperautomaten, an dem die Jugendlichen Lärm machten. Am späteren Abend, kurz vor Küchenschluss, stand Imad dort und winkte Ziad zu sich. Während er spielte, sprach er zu ihm, und Ziad hörte schweigend zu. Er konnte den Blick kaum lösen von der rothaarigen, mit einem feuerroten Slip bekleideten Frau, die ein Plastikgewehr hielt und der Aufschrift auf dem Display zufolge Barbarella hieß.
Imad sagte, sie würden sich zwar nicht kennen, aber er habe dennoch Vertrauen zu ihm. Ziad wunderte sich darüber, hielt es aber für angebracht, ein vertrauensseliges Gesicht zu machen. Imad zog einen zusammengefalteten Zettel aus der Tasche und gab ihn Ziad. Er sagte, ein paar Landsleute und andere träfen sich jeden Donnerstag im Café du Souk, in der Nähe des Bahnhofs Saint Charles. Er solle dorthin kommen, fügte Imad hinzu, beendete das Spiel und blickte Ziad eindringlich an. In dieser Stadt sei es nicht gut, zu lange allein zu sein, sagte er. Er legte ihm die Hand auf die Schulter und bekräftigte, er sei sich ziemlich sicher, Ziad könne ein paar Freunde gebrauchen.
Er wollte es auslassen, doch der Gedanke an jenen Abend, an dem er sich einfand, wohin Imad ihn bestellt hatte, ließ ihn nicht los. Vielleicht lag es an dem fensterlosen Raum, an seinem Hunger und diesem elenden Gefühl in der Magengrube, während eine Motte mit staubtrockenem Flattern gegen die heiße Lampe stieß; Ziad verlor sich in der Erinnerung an die schwere hölzerne Haustür, vor der er damals stand.
Die bürgerliche Pracht des großen Mietshauses war noch immer zu erkennen, obwohl sie an vielen Stellen bereits abblätterte. Als er den muffig riechenden Hausflur betrat, fühlte er sich, als würde er ein Gefäß betreten, das eine ihm völlig fremde Vergangenheit aufbewahrte. Es gab kaum noch zu erkennende Wandmalereien, verzierte Wandleisten und dunkel angelaufenen Stuck. Jede Treppenstufe, wahrscheinlich bis hoch in den fünften Stock, schien an der Stirnseite rechts und links von je einer winzigen Säule gestützt. Der alte Fahrstuhl, unsichtbar in seinem Gehäuse irgendwo oben im Aufzugschacht, beeindruckte ihn am meisten. Das dicke schwarze Aufzugseil hing fast bis zu ihm herab.
Ziad musste dieses Überbleibsel einer alten Zeit einfach ausprobieren. Er drückte den Knopf und erinnerte sich ganz genau an das Ächzen und Knarren, unter dem sich das müde Ungeheuer in Bewegung setzte, als der geheimnisvolle Impuls irgendwann oben ankam. Er stieg in die Kabine und schloss die Tür hinter sich. Ihn umgab das gedämpfte Licht einer Bar, und obwohl die Kabine so eng war, dass er kaum zu atmen wagte, fühlte er sich behütet, als Stockwerk für Stockwerk an ihm vorbei nach unten glitt.
Das änderte sich sofort, nachdem er die Wohnung betreten hatte. Es roch nach Rauch, er hörte viele Stimmen, und leichte Übermäntel hingen so dicht zu beiden Seiten des engen Flures, dass er sich hindurchzwängen musste. Der Mann, der ihn eingelassen hatte, schob ihn in ein weiträumiges Wohnzimmer. Ziad erinnerte sich an die vielen schwarz verhängten Fenster des prachtvollen Erkers und die gewaltige Sitzlandschaft davor, auf der mindestens acht Männer Platz genommen hatten, die alle Hemden und Jacketts trugen, als wären sie Geschäftsleute. Das schüchterte Ziad sofort ein, er fühlte sich fremd und schwach und wäre imstande gewesen, kehrtzumachen und aus der Wohnung zu fliehen, wenn ihn Imad nicht aus einer dunkleren Ecke des Zimmers zu sich gerufen hätte.
Schon beim ersten kurzen Blick in die Runde fiel Ziad auf, dass fast alle Anwesenden bewaffnet waren. Sie schienen die Schulterholster unter den offenen Jacketts zu präsentieren, während sie harmlos, das Weinglas in der Hand, parlierten. Imad stellte ihn einem fülligen Mann vor, der seine kurzen Arme vor der Brust verschränkt hielt und ihn durch seine Gelehrtenbrille mit goldenem Rand misstrauisch betrachtete. Nur andeutungsweise erzählte Imad dem anderen von Ziads Herkunft aus dem Libanon, was die Sache noch verschlimmerte. Der dicke Mann, der sich Abu Hamsa nannte, trat von einem Bein auf das andere und strich sich übers Kinn. Schließlich sagte er:
»Ihr Palästinenser seid zwar unsere Brüder, aber wie der übrigen Welt macht ihr auch uns Angst.«
Sein Lächeln dabei löste in Ziad Unbehagen aus.
Es blieb ihm an diesem Abend nicht viel mehr übrig, als Imads Anweisungen zu folgen. Er stand in der Ecke und betrachtete den Raum voller Menschen. Der Rauch wurde immer dichter, Ziad fing Diskussionsfetzen auf; das meiste davon drehte sich um Palästina und die politische Situation im Mittleren Osten. Zum Spaß verglich er eine uralte, verzierte Kommode mit dem marmornen Zimmerkamin in einer anderen Ecke, wollte ermitteln, ob das Kaminsims hier die gleiche Höhe hatte wie die geschnitzte kauernde Dame dort. Er wurde den ganzen Abend über nicht wieder angesprochen und hatte doch das Gefühl, nicht entlassen worden zu sein.
So sollte es für die nächsten Monate bleiben. Er führte die Botengänge aus, mit denen er beauftragt wurde, indem jemand im Restaurant aufkreuzte und ihm wortlos einen Zettel mit einer Adresse zuschob. Ziad holte irgendwo kleine Pakete oder Umschläge ab und brachte sie zu einer anderen Adresse. All das tat er in seiner Freizeit, nur um jemanden in dieser fremden Stadt zu kennen. Nach den ersten drei Gängen allerdings ließ sich auch Imad wieder sehen und steckte ihm ein Trinkgeld zu, das Ziads Lohn bei Weitem überstieg. Das war eine Hilfe und ein Beginn.
Mit Imad wurde das Leben für Ziad einfacher. Nicht nur wegen des Geldes, das er ihm gab, er nahm ihn auch mit auf Spaziergänge, immer gegen Abend, wenn Ziad noch vor seiner Schicht im Restaurant am einsamsten war.
Sie schlenderten durch den Markt von Noailles, folgten den engen Gassen südwärts bis zu den Ägyptern und Libanesen, die dort im Schatten ihrer Auslagen hockten oder auf Mauern und Steinen kauerten und ihre Wasserpfeifen rauchten. Ziad schien es, als starrten sie alle ihn an mit den Blicken Verirrter, die nicht heimkehren konnten. Er wollte das nicht verstehen, aber er sah sich selbst in ihren Gesichtern.
Manchmal setzten sie sich im Alten Hafen auf eine Bank und beobachteten das Treiben auf dem Fischmarkt. Frauen schnitten die großen Fischleiber der Länge nach auf, Gedärm flog durch die Luft und klatschte in die Eimer neben den Holztischen, an deren Kanten Perlenschnüre aus Blutstropfen hingen. Imad und Ziad saßen da und rauchten und sprachen manchmal für lange Zeit gar nicht miteinander. Imad aber wusste, wie viel Ziad diese Begegnungen bedeuteten.
Nach ein, zwei Wochen begann er, von seinen Plänen mit ihm zu erzählen. Ziad verstand zunächst nicht recht, worum es ging. Imad erzählte ihm, dass er zuerst nach Paris und danach nach Frankfurt in Deutschland reisen müsse. Es gehe um die Koordinierung von einigen Aktionen der Organisation, für die er arbeite. Ziad sah das Messer einer der Frauen im klaren Sonnenlicht so aufblitzen, dass es ihn blendete. Mit einem Hieb schnitt sie dem noch zappelnden Fisch den Kopf ab, schlitzte ihn auf und räumte seine Gedärme aus, noch bevor der Fischschwanz zur Ruhe gekommen war.