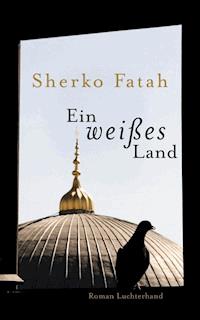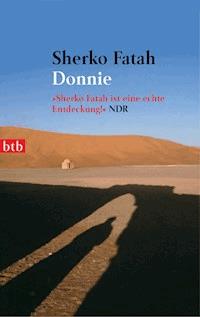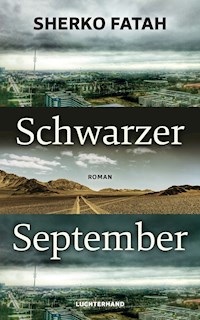7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein paar junge Männer töten an Heiligabend einen Schwan aus dem Stadtpark. Der Bummelstudent Michael hat sich mitziehen lassen zu diesem »Abenteuer«. Über den kurdischen Iraker Rahman, den Anführer beim Schwanenmord, lernt Michael dessen Landsmann Omar kennen, den alle nur »Onkelchen« nennen und der etwas Schlimmes erlebt haben muss. Michael ist fasziniert, und so lässt er sich auf ein weiteres Abenteuer ein: er fährt mit Rahman über den Balkan ins wilde Kurdistan. Und in Onkelchens schreckliche Vergangenheit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ein paar junge Männer töten an Heiligabend einen Schwan aus dem Stadtpark. Eine brutale Aktion und eine sinnlose, denn der Braten ist ungenießbar. Der Bummelstudent Michael hat sich mitziehen lassen zu diesem »Abenteuer«. Über den kurdischen Iraker Rahman, den Anführer beim Schwanenmord, lernt Michael dessen Landsleute Omar und Nina kennen. Omar, den alle nur »Onkelchen« nennen und der etwas Schlimmes erlebt haben muß, denn er spricht nicht mehr und kommuniziert nur noch über Nina. Michael ist fasziniert von Nina, und so läßt er sich auf ein weiteres Abenteuer ein: er fährt mit Rahman über den Balkan ins wilde Kurdistan. Und in Onkelchens schreckliche Vergangenheit …
SHERKO FATAH wurde 1964 in Ost-Berlin als Sohn eines irakischen Kurden und einer Deutschen geboren. Er wuchs in der DDR auf und siedelte 1975 mit seiner Familie über Wien nach West-Berlin über. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte. Für sein erzählerisches Werk hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, zuletzt erschien »Ein weißes Land« im Luchterhand Literaturverlag, sein vierter Roman.
Sherko FaTah Bei BTB Im Grenzland. Roman Das dunkle Schiff. Roman
Inhaltsverzeichnis
1. Auflage Genehmigte Taschenbuchausgabe Oktober 2012, btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München. Copyright © 2004 by Jung und Jung, Salzburg und Wien für die deutschsprachige Ausgabe Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: © plainpicture / Millenium MM Herstellung: BB
eISBN 978-3-641-18729-3
www.btb-verlag.deBesuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de.
www.randomhouse.de
I
Später fiel es Michael nicht leicht zu glauben, daß sie dazu wirklich imstande gewesen sind. Es muß an diesem Heiligabend gelegen haben, einem der letzten des Jahrhunderts, an der feierlichen Zurückgezogenheit um sie, welche die Straßen verlassen erscheinen ließ. Der Festtag isolierte die vier zusammengewürfelten Kameraden mehr als irgendein Alltag.
Der Abend war nicht übermäßig kalt. Eine dünne Schneedecke überzog die Straßen. Der bewölkte Himmel war hellgrau und stand dicht über den Häusern. Die mit Lampengirlanden geschmückten Fassaden hatten etwas Rohes, Steinernes zwischen den Lichtern und dem massigen Himmel.
Sie folgten Rahman, der, eine zusammengelegte Decke unter dem Arm, so schnell ging, als hätte er einen Termin. Wieder einmal wurde Michael das Gefühl nicht los, seinen Platz zugewiesen bekommen zu haben. Dimitri neben ihm hielt mit beiden Händen seinen knopflosen Lederparka zu und stapfte leicht gebeugt voran. Er dachte nie eingehender über das nach, was er tat. Und Thomas, hoch aufgerichtet, mit einem im Laternenlicht aufglänzenden Diadem aus Schneeflocken in der Mähne, war voller Erwartung, als würde er sich vorbereiten auf etwas, wovon nur er wußte. Das »Unbefestigte« der Lebenssituation, von dem Rahman irgendwann einmal gesprochen hatte, zeigte sich auch daran, daß sie an Heiligabend gezwungen waren, eine Ersatzfamilie zu gründen, eine frauenlose und etwas rüpelhafte Heimeligkeit des Beisammenseins herzustellen. Aber wie es mit den Ersatzfamilien eben ist: Jeder erkannte im anderen von Zeit zu Zeit die eigene Verlorenheit.
Sie gingen weit, und ihr regelmäßiges Schnaufen begleitete sie. Den unbeirrbaren Rahman immer vor Augen, bogen sie in menschenleere Seitenstraßen, passierten spärlich beleuchtete Kneipen, in denen sich ebenfalls kümmerliche Ersatzfamilien versammelt hatten. Schließlich erreichten sie den Park, in dem die Bäume düster zum Himmel aufragten, jeder einzelne um diese Jahreszeit ein Galgenbaum. Rahman ging bis dicht an das Ufer des halb zugefrorenen Sees und blieb endlich stehen. Er nahm die Hände aus den Taschen und rieb sie aneinander. Sie stellten sich neben ihm auf und blickten über die eisgraue Fläche.
»Was nun?« fragte Michael mit einem Blick auf die trostlose Umgebung.
»Wartet kurz«, erwiderte Rahman und starrte weiter konzentriert über den See.
Sekunden später fand er, was er suchte. Er setzte sich wieder in Bewegung.
Michael hatte keine Freude mehr an dieser Wanderung. »Kannst du nicht wenigstens andeuten, wohin du willst?« Er betrachtete die Decke, die Rahman trug. »Du willst aber kein Picknick veranstalten, oder?«
»Kommt mit. Wir sind gleich da.«
Sie gingen um den See, bis zu einem grauschwarzen Uferstreifen, an dem sich drei Schwäne versammelt hatten. Zwei kauerten an Land, einer patschte über das Eis, schon bevor er sie bemerkt haben konnte. Als sie diesmal stehenblieben, dämmerte ihnen, worum es ging, und Michael schüttelte gleich den Kopf. Rahman beachtete ihn nicht.
»Keine Enten«, sagte er mißmutig. »Wo sind die eigentlich, wenn man sie braucht?«
Niemand antwortete. Alle blickten mit Unbehagen auf die im grauen Abend matt leuchtenden Vögel.
Dimitri regte sich. Er wollte etwas sagen, und die drei übrigen waren so gespannt, daß sie unwillkürlich einen Halbkreis bildeten; drei Ohrenpaare, die sich um ihn gruppierten, verschafften ihm binnen einer Sekunde ein Auditorium. Er bewegte die Lippen.
»Was meinst du?« fragte Rahman aufmunternd.
»Das ist verboten«, stieß Dimitri hervor.
»Siehst du«, hakte Michael ein, »sogar er sagt das, und das sollte dich warnen.« Er wandte sich ab und machte Anstalten zurückzugehen.
»Ich dachte, du bist dabei«, rief Rahman.
»Nein, es ist Diebstahl.«
»Wieso?«
»An der Allgemeinheit.«
Rahman blickte wieder über den See. »Wer ist das denn«, brummte er.
»Es ist verboten«, kam es erneut von Dimitri, so überraschend, daß Michael innehielt.
Dimitri blickte zu Boden. »Wir könnten bestraft werden. Wenn wir ihn tragen, sieht man uns.«
Michael war bestürzt darüber, daß er bereits so weit dachte; die halbe Tat war schon begangen. Rahman bewegte sich in Richtung der Vögel.
»Dazu habe ich die Decke mit«, warf er den anderen hin.
Sie verharrten unschlüssig. Thomas hustete und sagte dann beinahe entschuldigend: »Es ist kalt. Bevor wir hier festfrieren, sollten wir ihm helfen.«
Ein allmählich sich verstärkender Sog erfaßte sie alle, einfach weil einer von ihnen geradewegs seinem Ziel zustrebte. Rahman pirschte bereits. Einen Arm hielt er nach hinten ausgestreckt. Vor dem grauen, von einem zarten rosigen Schleier überzogenen Himmel erschien er Michael nicht mehr wie ein Unbefestigter, sondern wie ein Besessener, der eigentlich nur hierher, in diesen Park zu dieser Zeit gehörte. Schon folgte ihm Dimitri unsicheren Schritts, und die Hand vor Rahmans Rücken machte ruheheischende Auf-und-ab-Bewegungen. Dimitri schlich weiter, indem er jeden seiner Schritte mit einem Kopfnicken begleitete, als würden sie dadurch unhörbar.
Etwas wie Jagdfieber lag in der Luft. Michael folgte Thomas schließlich. Dieser war ein Arbeitskollege Rahmans, allerdings drei Baustellen weiter beschäftigt. Schmal und sehnig, zeigte er zuweilen eine derartig bedenkenlose Entschlossenheit, daß Michael Rahman einmal unter vier Augen gefragt hatte, ob er glaube, eine Frau könne das ertragen. »Ach, weißt du«, sagte er darauf, »wenn der erst einmal eine findet, wird er ganz zahm, glaub mir.«
Vorsichtig schlossen sie zu Rahman auf, der nicht mehr weit von den Schwänen am Ufer entfernt war. Mit der Hand gab er den anderen Zeichen, sich zu verteilen. Thomas blieb auf Rahmans Höhe, Michael ging weiter oben entlang – und Dimitri blieb der See. Es schien kein Zufall, daß er es war, der sich auf die unsichere Eisfläche begeben mußte, was er mit der gleichen stoischen Ruhe tat wie alles andere auch.
Die Schwäne erhoben sich und tapsten unsicher herum, drehten sich, als suchten sie eine Position für den Abflug. Doch Rahman hatte vorgesorgt. Er holte ein Stück Brot aus der Hosentasche, zerbröselte es mit einer Hand und warf ihnen die Brocken zu. Das ließ Michael sich fragen, wann er seinen Mordplan eigentlich ausgeheckt hatte.
Gleich darauf brach Dimitri im Eis ein. Es knackte, und er sackte einen halben Meter tiefer, erst schief, dann gerade stehend. Er ruderte mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten, dann fiel er rückwärts mit dem Hintern auf das Eis, brach erneut ein und saß im Wasser. Zunächst waren die Schwäne, vom Brot angelockt, tatsächlich näher gekommen. Das Knacken aber war so laut, daß sie die Flucht ergriffen. In diesem Moment entfaltete Rahman mit einer einzigen geschickten Bewegung die Decke und warf sie über den Schwan, der ihm am nächsten war. Diesen Wurf mußte er geübt haben, dessen war sich Michael sicher: So elegant, wie er den ausgebreiteten Stoff flach durch die Luft schweben ließ, konnte das nur jemand, der sich auf sein Vorhaben gründlich vorbereitet hatte.
Die Decke legte sich über den Schwan, der noch heftiger fortzukommen versuchte, und mit drei großen Schritten war Rahman über ihm. Der Hals des Tieres war schon wieder frei, als er ihn packte und nach den anderen rief.
Es dauerte einige Sekunden, bis Thomas und Michael bei ihm waren. Dimitri hatte sich inzwischen erhoben und bewegte sich zum Ufer hin. Rahman lag quer über dem zappelnden Vogel. Ein großer weißer Flügel hatte sich unter ihm und der Decke hervorgeschoben.
»Leg dich mit drauf«, keuchte Rahman.
Aber Michael konnte es nicht. Er sah den Hals des Tieres und wie Rahman ihn umklammert hielt. Thomas drängte ihn zur Seite und ließ sich auf die Decke fallen. Rahman kam in eine günstigere Position und drehte dem Schwan den Hals um, mit der ungeheuren Sicherheit, die das Töten verleiht. Auch nach dem Knacken der Wirbel nahm das Zappeln kein Ende, und dieses helle und so leicht entfliehende Leben, das Rahman aus dem Vogelkörper drängte – es machte Michael schwach, als verschwände damit ein Teil von ihm.
Als der Schwan endlich still lag, war Dimitri bei ihnen angekommen. Er blickte auf Rahman und Thomas, auf die die Totenruhe überzugreifen schien, bis sie sich endlich aufrappelten. Schwer atmend, aber mit dem Gefühl, etwas geschafft zu haben, standen sie da.
Rahman rührte sich als erster, hockte sich nieder und begann, den Kadaver in die Decke zu wickeln.
»Mit dem Hals wird es schwierig beim Tragen«, sagte er. »Wir müssen ihn an den Körper legen und dafür sorgen, daß er da bleibt.«
»Brauchen wir den denn?« sagte Thomas. »Ich habe ein Messer. Dann wär er auch leichter.«
Michael war nun von der Komplizenschaft der beiden überzeugt.
»Nein, nein«, sagte Rahman und schüttelte den Kopf. »Er darf nicht bluten, das wäre zu auffällig. Hilf mal mit!«
Die beiden wickelten die Decke um das Tier, nachdem sie den Flügel und den Hals fest an den Körper gedrückt hatten.
Indem sie sich abwechselten, schleppten sie den Schwan bis zu Rahmans Wohnung im vierten Stock einer leidlich gepflegten Mietskaserne. Dimitri fror erbärmlich. Seine Zähne klapperten; doch die Decke war der Beute vorbehalten. Schon von weitem sahen sie die bunte Beleuchtung in vielen der Fenster. Sie trugen ihren Weihnachtsbraten durch ein stilles, ja festlich erstarrtes Haus.
Oben angekommen, legten sie das schwere Bündel mitten auf den Holzfußboden im Wohnzimmer. Rahman suchte als erstes Messer und alte Zeitungen zusammen.
»Schon mal ein Huhn gerupft?« fragte er vergnügt in die Runde.
Was ihm Michael damals übelnahm, war das Planmäßige dieser Aktion, zu der er sie alle benutzt hatte. Er warf ihm das vor, während Rahman immer größere Schneidwerkzeuge zusammensuchte, um den Schwan zu köpfen.
Michael sagte: »Du hast einfach Freude an Grausamkeiten, du brauchst so etwas.«
Als Rahman den Hals endlich abgetrennt hatte, legte er einen Holzblock unter den Körper, damit das Blut abwärts in eine Schüssel fließen konnte. Michael fügte an: »Das hättest du nicht tun müssen. Wir hätten ihn auch so rupfen können.«
Rahman sah ihn, kurz aufgebracht, an. »Mann, ich tue das, damit es mich mehr an ein Huhn als an einen Schwan erinnert.«
Sie standen um den großen, ausblutenden Körper, der plötzlich, zum letzten Mal, die Flügel von sich streckte; sie fielen seitlich hinab auf den Boden. Der Hals lag auf einer dicken Schicht Zeitungspapier wie ein ausgewickelter Aal.
Dimitri hatte noch immer seine nassen Hosen an. Er war ein Informatikstudent aus der Nachbarschaft, jünger als Michael, aber ebenso verbummelt. Eigentlich saß er ständig vor dem Computer, abends aber fand er sich öfter bei Rahman ein, immer wortkarg, doch aufmerksam.
Michaels Widerwillen gegen ihre gemeinsame Tat brauchte ein Ventil, und so fragte er ihn, ob er nicht etwas von Rahman anziehen wolle. Dimitri hob beschwichtigend die Hände, lächelte und stellte sich, wie um ihn zufriedenzustellen, an die Heizung. Im Zimmer roch es nach Blut.
Das Rupfen war eine elende, aber auch verbindende Arbeit für alle. Um sie zu erleichtern, holte Rahman seinen Wodka hervor und schenkte ihn in wiederverwendeten Senfgläsern aus.
Als der dicke Schwanenleib rosiggrau vor ihnen lag, waren sie betrunken. Sie wankten über einen Teppich aus Federn, in Thomas’ Haaren schienen auch jetzt noch weiße Flocken zu hängen, und Dimitri, der sich nach getaner Arbeit wieder an die Heizung gelehnt hatte, drohte einzuschlafen. Rahman begann mit den restlichen Tranchierarbeiten, er tat es ruhig und mit einem Ziel vor Augen. Er öffnete den Bauch.
»Achte auf die Galle!« rief Michael, nachdem das Gedärm herausgeholt war.
Rahman nickte und zog die Hand vorsichtig hervor. Leber und Herz brachte er zum Vorschein.
Thomas betrachtete den Magen und die übrigen Organe. »Phantastisch«, stieß er hervor, »schaut euch das an.«
Er hatte mit dem Finger etwas freigelegt, das aussah wie ein mit Froschlaich umwickelter Stab.
»Das ist ein Eierstock«, sagte Rahman.
Sie blickten andächtig auf das Gebilde, sogar Dimitri kam heran, um es zu sehen.
Federn flogen auf, als Rahman den Torso anzuheben versuchte. Er trat aus Versehen in das Gedärm, und zwei rote Sohlenabdrücke entstanden auf der weißen Fläche.
»Du, Haarmann, weißt du eigentlich, daß das ein ziemlich gigantischer Braten wird und daß dein Zimmer wie ein Schlachthaus aussieht?« fragte ihn Michael.
»Es ist Weihnachten«, raunzte er. »Wir haben noch eine Menge zu tun. Die Federschäfte, da oben vor allem. Hier, nimm das Messer. Nur auf einer Seite. Das Biest ist so groß, daß ich nur die Hälfte der Brust in den Ofen bekomme.«
Michael machte sich an die Arbeit. Irgendwann sagte Rahman: »Das genügt. Und jetzt die anderen. Du aber nicht, Dima.«
Michael half ihm. Sie trugen die Fleischteile zum Gasherd. Rahman entzündete eine Flamme.
Als sie das Fleisch darüber hielten, erklärte er: »Wir müssen die ganz kleinen Federn verbrennen.« Es erhob sich ein Geruch nach versengtem Haar. »Riechst du das?« sagte Rahman. »Dima darf bei solchen Sachen nicht mitmachen. Er würde Feuer fangen; für so etwas hat er einfach kein Talent.«
»Ja, ich sehe es vor mir, wie er, in Flammen stehend, noch das Zimmer erreicht – und auf der Leber ausrutscht.«
»Die Eier«, rief Thomas in die Küche, »werden nach unten hin größer. Und sie haben die Konsistenz von, na – weichen Kiwis.«
Aus reiner Neugier fragte Michael: »Warum hast du ihn nicht gleich in Stücke geschnitten, die du auch braten kannst?«
Rahman schüttelte den Kopf und überlegte kurz. »Ich habe genau vor mir, wie es geht«, sagte er dann, »und für jede andere Art, es zu machen, habe ich kein Bild.«
Alles weitere geschah, wie er es sich dachte. Sie holten die Keulen und hielten auch sie über das Feuer. Dann schnitt er einen Teil der Brust heraus.
Endlich war alles im Ofen, und sie gingen ins Zimmer zurück.
Thomas hatte seine Untersuchungen beendet, und Dimitri war an der Heizung eingeschlafen. Sie wollten aufräumen, doch Trägheit überwältigte sie.
Nach einer Weile entwickelte der Braten einen merkwürdig strengen Geruch, der sogar den Blutgestank im Zimmer durchdrang. Vor den Fenstern fiel sachte und feierlich der Schnee.
»Dieser Geruch«, sagte Thomas, »kommt daher, daß der Schwan ein wilder Vogel war. Also, er flog, und seine Drüsen funktionierten normal – nicht wie bei diesen geruchlosen Zuchtvögeln.«
Rahman und Michael saßen im Schneidersitz vor ihm und nickten. Der Wodka setzte ihnen zu. Nur Thomas schien er aufzumuntern. Er war in Erzähllaune, und wie schon öfter ging er dabei in die Vergangenheit zurück. Thomas war einer der wenigen Ostdeutschen, die Michael bisher kennengelernt hatte. In der neuen Ordnung fand er sich nicht zurecht, er war auf der Suche, und kam dabei immer wieder auf weit entfernte Geschehnisse zu sprechen. Auch seine Großeltern spielten hierbei eine wichtige Rolle: in deren Erzählungen lag für Thomas jetzt etwas Unanfechtbares, das keine politische Wende mehr in Frage stellen konnte.
»Das erinnert mich an eine Geschichte«, fuhr er fort, »die mir mein Großvater mütterlicherseits erzählt hat. Der war in Norwegen oder Finnland, ihr wißt schon, mit der Wehrmacht. Nun gut, besiegt und besetzt war schnell, und dann hieß es frieren. Es war Winter, und er und vier andere waren in einer Holzhütte auf dem platten Land untergebracht. Es herrschte unglaubliche Kälte, und die Jungs hatten kaum etwas Eßbares da. Eines Tages ging mein Opa vor die Tür und sah einen großen Raben auf dem Schnee. Er war so schwarz auf der weißen Fläche, daß sich mein Opa erschrak, wie er mir mehrmals erzählte. Er holte sein Gewehr und erschoß den Raben. Die übrigen kamen heran, und da sie hungrig waren, rupften sie den Raben und warfen ihn in einen Topf. Als er fertig war, kostete mein Opa ganz vorsichtig – und er hat noch nach Jahrzehnten geschwärmt: Alle waren der Meinung, sie hätten, wenn es auch wenig war, nie etwas Besseres gegessen.«
Sie nickten.
»Und?« fragte Michael.
»Sie blieben weiter in Norwegen oder Finnland und hatten weiter Hunger. Einige Zeit später sah ein anderer Soldat einen Raben in einem Baum. Er schoß ihn ab, und die Kameraden freuten sich auf das Essen. Nun, diesmal war das Fleisch völlig ungenießbar, zäh und bitter. Nicht einmal die Suppe konnte man trinken.«
Die anderen blickten ihn aus trüben Augen an.
»Na, ja«, sagte er, »so ein Rabe kann achtzig Jahre alt werden. Der erste war eben jung.«
»Oh Mann, was für eine Geschichte. Ich könnte heulen«, sagte Michael und war wirklich den Tränen nahe. »Stellt euch das vor: achtzig Jahre. Dieser Rabe war möglicherweise zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges aus dem Ei gekrochen. Um dann von der Wehrmacht erschossen zu werden. In Finnland.«
Thomas wurde unruhig. »Das hat jetzt mal nichts mit der Wehrmacht zu tun. Jeder, der Hunger hat, hätte den Raben erschossen.«
Rahman stieß Michael an. »Das Heulen kommt vom Schnaps«, sagte er aufmunternd.
Der strenge Geruch hatte sich noch verstärkt. Rahman stand auf und ging in die Küche, um den Braten zu beträufeln. Dimitri schnarchte leise. Michaels feuchter Blick schweifte über die Federn und den Schwanenhals.
»Das riecht nicht gut«, sagte er, als Rahman zurückkam. »Mir wird übel davon.«
»Ich sag dir was«, antwortete der. »Das war, wie Thomas gesagt hat, ein wilder Vogel. Keiner von diesen Zuchtviechern. So einer hat seinen eigenen Geruch. Ich habe mal eine junge Ente in einem Großmarkt gekauft. Ich wollte sie selbst großziehen und dem Sohn eines Freundes – er war damals noch klein – eine Freude machen. Und wißt ihr, was passiert ist?« Er wartete kurz, alle schüttelten die Köpfe. »Wir hatten so ein aufblasbares Planschbecken, und die Ente wollte unbedingt zum Wasser. Ich habe sie reingesetzt – und sie ist ersoffen. Die Ente ist ersoffen! Und der Junge hat geheult, sag ich euch.«
Als der Braten fertig war, mußten sie ein Fenster öffnen. Sie weckten Dimitri und setzten sich alle an den Küchentisch. Rahman hatte sogar eine Kerze gefunden und in die Mitte des Tisches gestellt. Kurz hellte sich die Stimmung auf, vielleicht weil die Küche im Vergleich zum Zimmer sauber wirkte.
»Guten Appetit«, sagte Rahman. »Ihr habt es euch verdient.«
Michael und Thomas nickten einvernehmlich und ließen doch noch jenen Augenblick vergehen, der es Dimitri erlaubte, als erster in seine Keule zu beißen und mit einem Seufzen den Mund ruckartig zurückzuziehen. Den drei anderen schwand alle hungrige Vorfreude beim Anblick des ziemlich großen, gelblichen Schneidezahns, der ganz oben in dem Fleischbuckel steckte. Sie hielten inne und schwiegen.
Dimitri saß zurückgelehnt im Stuhl. Seine Körperhaltung war ängstlich-verkrampft, sein Gesichtsausdruck aber neutral. Er hielt den Mund geschlossen und drückte mit dem Zeigefinger auf die Oberlippe, um die Lücke zu fühlen. Michael war sicher, daß er sich in diesem Moment bereits abgefunden hatte mit einem Leben ohne diesen Schneidezahn.
»Weißt du, Dima«, begann er, um ihm etwas Tröstendes zu sagen, »ich bewundere an dir dieses Hinnehmenkönnen …« Betrunken, wie er war, kam er über das Hauptwort nicht hinaus.
Dimitris blasse Augen wirkten verschreckt, als er ihn ansah.
»Trink einen Schluck«, sagte Rahman. »Das reinigt die Wunde.«
Dimitri hätte damals wohl alles getan, was man ihm sagte. Er nahm einen Schluck, heulte auf vor Schmerz und rannte ins Zimmer.
»Das reinigt«, wiederholte Rahman, aber der Zweifel stand ihm ins Gesicht geschrieben.
Sie folgten Dimitri wie auf ein geheimes Kommando. Er lag inmitten der Federn neben dem Schwanenhals und wimmerte. Sie hoben ihn auf, alle drei überwältigt vom Mitgefühl.
»Singen«, sagte Rahman, »singen hilft. Komm, Dima, wir singen jetzt.«
Sie fragten sich, welches Lied jeder von ihnen kannte. Es mußte ein Lied sein, das man nur einmal zu hören braucht, um es für immer zu behalten. Sie einigten sich auf »Katjuscha«. Rahman begann, die anderen fielen ein. Dima sang es auf russisch, Michael, leiser, auf deutsch.
Sie sangen alle Strophen sehr laut, bis sie das »Ruhe!«-Geschrei vom offenen Fenster her endlich hörten. Zu einem letzten Mal ließen sie sich dennoch hinreißen, verstummten schließlich und setzten sich auf den Boden.
Wenig später klopfte es heftig an die Wohnungstür. Blitzschnell war Rahman auf den Beinen und streckte, Ruhe gebietend, die Arme aus. Sie warteten. Aber es bummerte wieder, diesmal noch lauter.
Rahman reagierte, sammelte Fleischstücke und Schwanenhals ein und trug alles in die Toilette. Dann warf er den Eingeweidehaufen in die blutige Schüssel und wies Thomas an, damit in die Toilette zu gehen und dort zu bleiben. Michael und Rahman machten sich daran, die blutbesudelten Federn aufzusammeln und sie in einen Plastiksack zu stopfen. Beim dritten Klopfen war das erledigt.
Bevor er öffnete, tat Rahman etwas, das Michael von seiner Abgebrühtheit überzeugte: Er holte aus dem Schrank im Flur einen kleinen Plastiktannenbaum hervor und stellte ihn mitten in den weißen Federteppich.
Als die beiden Polizisten fragten, ob sie eintreten dürften, war Michael in der Küche, zog den Zahn aus der Schwanenkeule und behielt ihn in seiner Faust. Die Beamten hatten schon von der Tür aus die Federn im Zimmer sehen können. Nun traten sie näher und blickten sich um, während sie von der Beschwerde der Nachbarn berichteten.
»Na«, sagte der eine, »ihr habt’s euch nett gemacht, was? Richtig winterlich. Riecht nur nicht so gut bei euch.«
Es fiel den Sängern nicht schwer, sich besoffenfreundlich zu geben. Sogar Dima lächelte schief.
»Okay«, sagte der Polizist, »nur bitte nicht mehr so laut, sonst gibt’s hier im Haus Tumult.«
Als sie gegangen waren, atmete Rahman erleichtert aus und öffnete die Toilettentür. Thomas hatte sich, umgeben von Leichenteilen, in das Waschbecken übergeben. Er saß auf der Klobrille und blickte traurig.
»Ich finde auch das bewundernswert«, lallte Michael, machte eine Pause, aber niemand fragte nach, »daß du dich ohne ein Geräusch erbrechen kannst.«
Thomas nickte müde. »Viel war’s ja nicht.«
Dieser Weihnachtsabend endete für Michael am nächsten Tag in dessen leerer Wohnung, wo er sich auf den Fußboden legte, um seinen Körper auszustrecken und seine Ohren an die Stille zu gewöhnen. Der Katzenjammer zeigte bereits Wirkung.
Michael hatte Rahman nur wenige Monate vor dem Weihnachtsfest kennengelernt, aus einer Laune heraus. Dieser Umstand kam ihm später immer dann in den Sinn, wenn er über all die Abwege nachdachte, auf die ihn diese Begegnung führen sollte: Vielleicht war schon der Zufall ein Hinweis auf die Schwierigkeit ihrer Freundschaft, und wäre er nicht so »unbefestigt« gewesen in jener Zeit, dann hätte es sie nie gegeben.
Es war einer der letzten wirklich schönen Herbsttage, an dem er von der Bank kam; die Überweisung war in jenem Monat knapper ausgefallen. Wahrscheinlich, so dachte er, hatten seine Eltern im Fernsehen einen Bummelstudenten gesehen und fühlten sich dadurch veranlaßt, Erziehungsmaßnahmen zu ergreifen.
Er ging die Kastanienallee hinunter, stumpf und doch wachsam zwischen parkenden und fahrenden Autos, als ihm in einer Seitenstraße ein großer, uralter Bus auffiel. Es war eine Art Reisebus, so verdreckt, daß seine ursprüngliche Farbe nicht mehr auszumachen war. Die Seitenfenster waren blind, aus einem führte ein Stromkabel, spannte sich meterlang nach oben und verschwand in einem der Fenster des Mietshauses, vor dem der Bus stand. Die Sache interessierte ihn. Er umschlich den Bus wie etwas Gefährliches und war erstaunt, daß sich nichts darin rührte. Das Fahrzeug wirkte wie abgestellter Schrott, wäre da nicht das Kabel gewesen. Er versuchte, durch das längliche Fenster der hydraulischen Tür zu sehen, wischte ein Sichtloch in den Schmutz. Die Passagiersitze waren entfernt worden, stattdessen gab es Schlafpritschen, man hatte irgendwie sogar eine Geschirrspüle eingebaut. Michael sah ein paar Zipfel von geblümtem Bettzeug auf den Pritschen.
Er trat zurück. Auf der Straße mit Bäckerei und Zeitungsladen beachtete ihn niemand. Es war eigentlich nicht seine Art, jemanden, noch dazu in seiner Wohnung, aus einer Laune heraus zu behelligen. Dennoch ging Michael in das Haus, passierte den Zierpfosten mit der großen Holzkugel darauf, nahm die Treppen mit Schwung und klingelte an der Tür jener Vorderhauswohnung. Natürlich hatte er sich vorher überlegt, was er sagen würde, er nahm die Rolle eines Kontrolleurs ein. Auf diese Weise hatte er ein gewisses unausgesprochenes Recht auf seiner Seite. Es öffnete niemand, aber er beschloß, irgendwann wieder hinzugehen.
Er hatte ihn fast schon vergessen, aber nach einem Monat, wieder auf dem Weg zur Bank, fiel Michael der Bus ein. Er ging gleich nach dem Geldabholen in die Seitenstraße – und er war noch da. Unter den kahl gewordenen Bäumen, umweht vom kalten Wind, wirkte diese Behelfsunterkunft geradezu erbärmlich. Wieder schaute er hinein: Alles war unverändert; geblümte Bettwäsche und gespültes Geschirr im Tropfgitter. Noch immer war der Bus durch das Kabel mit der Wohnung im dritten Stock verbunden, und auch jetzt konnte es sich Michael nicht versagen hinaufzugehen.
Als er vor der Tür stand, hörte er das Knarren der Dielen von drinnen, das ausblieb, nachdem er geklingelt hatte. Er wartete, klingelte erneut, und nach einiger Zeit wurde die Tür geöffnet. Eine Frau mit langem, dunkelbraunen Haar, etwa dreißig, steckte den Kopf in den Türspalt, den die Kette gewährte.
Michael sagte betont freundlich »Guten Tag« und begann in sachlichem Tonfall über das Kabel zu sprechen, wobei er voraussetzte, daß sie dem Wortschwall nicht folgen konnte – sein Tonfall sollte sie verunsichern. Er redete und redete, darüber, daß die Sicherheit einer solchen Stromleitung nicht gewährleistet sei, daß er den Anschluß überprüfen müßte. Er häufte Fachausdrücke aneinander und beendete jeden Satz so, daß er verbindlich und auffordernd klang. Irgendwann begann sie zu nicken, lächelte auch. Aber sie verstand ihn nicht, und damit war der erste Teil seiner Rechnung aufgegangen.
Er legte also all seine Sicherheit in die Sätze, die er ihr vortrug, und mit der Zeit spürte sie wohl, daß die Reihe an ihr war. Sie mußte reagieren, Lächeln genügte nicht, denn dazu war Michaels Tonfall einfach zu amtlich. Erwartungsgemäß schob sie die Tür zu, löste die Kette und öffnete. Sie hatte zumindest so viel verstanden, daß sein Auftritt mit dem Kabel zu tun hatte, denn als er eintrat, ging sie zum Fenster, wo es, gequetscht unter dem verzogenen Rahmen, hereinführte.
Als er in der Wohnung stand, mußte Michael kurz über sein weiteres Vorgehen nachdenken. Er warf zunächst einen prüfenden Blick auf das Ganze. Es war allerdings nicht viel zu sehen: Das Kabel führte zu einer Mehrfachsteckdose.
Die Frau stand mitten im Wohnzimmer und wartete. Solange Michael sich über das Kabel beugte, schien sie hinter ihm erstarrt zu sein. Er öffnete das Fenster und blickte dem Kabel nach, durch die Zweige auf das Dach des Busses. Ein Schwall herbstlich feuchter Luft umfing ihn. Er wandte sich zu ihr und erkundigte sich nach den Leuten in dem Bus. Durch eine Geste verstand sie die Frage wahrscheinlich, aber sie konnte nicht antworten. Er versuchte es mit Englisch, auch das führte zu nichts.
Sie zuckte die Schultern, lächelte wieder hilflos und ging zu dem niedrigen Tisch vor der abgewetzten Sitzgarnitur. Dort kramte sie Zettel und Stift hervor und schrieb etwas. Sie übergab Michael das Papier. Er sah ein gezeichnetes Ziffernblatt darauf, die Zeiger standen auf acht Uhr.
Eine unbestimmte Angst trieb die Frau dazu, ihn für den Abend einzuladen, davon war er überzeugt. Wenn sie auch keinen sehr ängstlichen Eindruck machte, so konnte sein Auftritt doch im Grunde kaum eine andere Wirkung gehabt haben.
Michael kam also um 20 Uhr noch einmal und klingelte. Die Sache wurde spannend. Er hatte beschlossen, die Rolle des sachlichen Prüfers weiterzuspielen, und wenn ihm dort, wider Erwarten, ein Deutscher begegnen sollte, das Ganze mit einem unverbindlichen Satz zu beenden, vielleicht mit: »Ich wollte nur einmal nach dem Rechten sehen …« und: »Schließlich gibt es ja auch Sicherheitsfragen zu bedenken …«
Diesmal öffnete ihm ein ebenfalls vielleicht dreißigjähriger Mann mit schwarzen Bartstoppeln im Gesicht. Er machte einen angenehmen Eindruck; das Gesicht war markant geschnitten, die Augen klein und dunkel. Er ließ Michael gleich eintreten und streckte ihm die Hand hin. Die Frau tauchte kurz auf und deutete ein Winken an, dann verschwand sie im Nebenraum, aus dem Kinderweinen drang. So, einer Kleinfamilie gegenüber, fühlte er sich gleich viel unbehaglicher. Der Mann bot ihm Platz auf der Couch an, und erst in diesem Moment fragte sich Michael, was er hier eigentlich tat, denn sobald er saß, war klar, daß die Show ein Ende hatte. Er mußte sich mit diesem Mann unterhalten und hatte dabei gar kein Anliegen. Der Mann setzte sich in den Sessel und blickte Michael stumm an, kurz nur, dann wanderten seine Augen zum Fernseher, dessen Ton abgeschaltet war. Michael nahm sein Spiel wieder auf.
»Ich bin heute nachmittag schon einmal hier gewesen. Es geht um das Kabel, das da durch das Fenster zum Bus führt.« Er machte eine Pause, der Mann nickte, schwieg aber weiter. »Glauben Sie, daß dieser Stromanschluß sicher ist?«
ENDE DER LESEPROBE