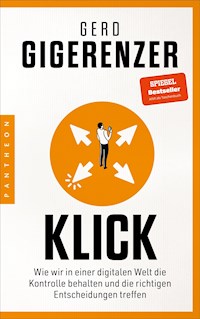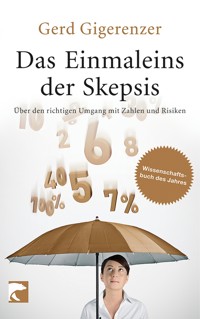
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das provokative Buch eines der renommiertesten deutschen Psychologen ermutigt zur Skepsis gegenüber vermeintlich absoluten Wahrheiten. »Mit seiner Studie über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken hat Gerd Gigerenzer geradezu ein Manual für die Risikogesellschaft vorgelegt, nach dessen Lektüre man statistischen Aussagen nicht einfach mit Misstrauen, sondern mit der richtigen Art von Nachfragen begegnen wird.« FAZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Für meine Mutter
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Michael Zillgitt
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Berlin Verlag erschienenen Buchausgabe1. Auflage 2014
ISBN 978-3-8270-7792-9Deutschsprachige Ausgabe:© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2014Covergestaltung: Rothfos & Gabler, HamburgCovermotiv: © photonica/Pedro LoboDatenkonvertierung: psb, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
INHALT
Dank
Teil I
Wage zu wissen!
1. Ungewissheit
2. Die Illusion der Gewissheit
3. Zahlenblindheit
4. Einsicht
Teil II
Ungewissheiten in der realen Welt verstehen
5. Brustkrebs-Screening
6. Der (un)mündige Patient
7. AIDS-Beratung
8. Männer, die ihre Frau schlagen
9. Sachverständige im Gerichtssaal
10. Der genetische Fingerabdruck
11. Gewalttätigkeiten
Teil III
Von Zahlenblindheit zur Einsicht
12. Wie man andere hinters Licht führt
13. Amüsante Aufgaben
14. Klares Denken
Glossar
Literaturverzeichnis
DANK
Wie auch Menschen haben Bücher ihre eigene Geschichte. Sie werden mit Liebe erdacht und mit Schweiß vollbracht. Meine Beschäftigung mit Ungewissheiten und Risiken wurde angeregt durch die historischen Abhandlungen von Ian Hacking und Lorraine Daston über Zufall, Rationalität und statistisches Denken. Aus den Arbeiten von David M. Eddy über medizinische Diagnose sowie von Lola L. Lopes über Entscheidungsfindung habe ich gelernt, wie diese Konzepte unsere heutige Welt beeinflussen. Mein Interesse daran, wie Ärzte und Juristen denken und wie man es ihnen erleichtern kann, Ungewissheiten besser zu verstehen, entstand durch die Zusammenarbeit mit Ulrich Hoffrage, meinem einstigen Schüler und heutigen Kollegen und Freund. Ihm danke ich herzlich mehr als zehn Jahre gemeinsamer Forschung, die Spaß gemacht hat. Diese Arbeit wurde fortgeführt von Ralph Hertwig, Stephan Krauss, Steffi Kurzenhäuser, Sam Lindsey, Laura Martignon und Peter Sedlmeier sowie anderen Forschern am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Von den vielen außerhalb meiner Arbeitsgruppe, die mein Denken über die in diesem Buch behandelten Aspekte formten, möchte ich besonders Jonathan J. Koehler und John Monahan danken.
Viele liebe Freunde und Kollegen haben die Vorstufen zu diesem Buch gelesen und zahlreiche Verbesserungsvorschläge gemacht, darunter Michael Birnbaum, Valerie M. Chase, Kurz Danziger, Norbert Donner-Banzhoff, George Daston, Robert M. Hamm, Ulrich Hoffrage, Max Hauck, Günther Jonitz, Gary Klein, Jonathan J. Koehler, Hans-Joachim Koubenec, Steffi Kurzenhäuser, Lola L. Lopes, John Monahan, Ingrid Mühlhauser, Marianne Müller-Brettel, R. D. Nelson, Mike Redmayne, Joan Richards, Paul Slovic, Oliver Vitouch, William Zangwill und Maria Zumbeel.
Besonderer Dank geht an Christine und Andy Thomson, ihres Zeichens Anwältin bzw. Psychiater. Ihnen verdanke ich einige der in diesem Buch vorgestellten Fallstudien.
Valerie M. Chase hat das gesamte Manuskript redigiert, und die erreichte Klarheit ist nicht zuletzt ihr Verdienst. Donna Alexander half mir in allen Phasen der Entstehung dieses Werkes, auch bei den zahlreichen Anmerkungen und Quellenhinweisen; ihr gebührt Dank für kritische und aufmunternde Unterstützung. Hannes Gerhardt und Erna Schiwietz lasen Korrekturen, Wiebke Möller trug Literatur zusammen, auch da, wo sie schwer zu beschaffen war, und Dagmar Fecht ermöglichte mir das Schreiben, indem sie mir organisatorisch den Rücken freihielt.
Lorraine Daston, meine geliebte Frau, war mir während der vier Jahre, die ich diesem Buch widmete, emotional und intellektuell eine Stütze, und meine wunderbare und hilfsbereite Tochter Thalia gab mir viele Hinweise, die zur besseren Lesbarkeit des Textes beitrugen.
Freunde und Kollegen sind natürlich wichtig, ebenso aber auch das Umfeld, in dem man wirkt. Ich hatte das große Glück, in den letzten Jahren von der anregenden Atmosphäre und von den Arbeitsmöglichkeiten der Max-Planck-Gesellschaft zu profitieren, der ich hiermit ebenfalls meinen Dank ausspreche.
I
WAGE ZU WISSEN!
… in dieser Welt ist nichts gewiss, außer dem Tod und den Steuern.
Benjamin Franklin
1. UNGEWISSHEIT
Susans Albtraum
Mitte der neunziger Jahre wurde im Rahmen einer medizinischen Routineuntersuchung bei Susan, einer 26-jährigen allein erziehenden Mutter, auch überprüft, ob bei ihr eine HIV-Infektion vorliegt. Sie nahm zwar illegale Drogen, spritzte sie aber nicht intravenös. Daher glaubte sie nicht, dass der »AIDS-Test« bei ihr positiv ausfallen könnte. Doch einige Wochen später wurde ihr genau dieses Ergebnis mitgeteilt – was damals fast einem Todesurteil gleichkam. Susan war schockiert und verzweifelt. Das Testergebnis sprach sich herum, und ihre Kollegen vermieden es aus Angst vor Ansteckung sogar, ihr Telefon anzufassen. Schließlich verlor sie ihre Arbeitsstelle. Bald darauf zog sie in ein Heim für HIV-Infizierte. Dort schlief Susan mit einem Mitbewohner – ohne Kondom, denn sie dachte sich: ›Wieso soll ich noch aufpassen, wenn ich doch schon infiziert bin?‹ Aus Sorge um die Gesundheit ihres inzwischen siebenjährigen Sohnes hörte Susan auf, ihn zu küssen, und überlegte auch, ob sie sein Essen beim Zubereiten überhaupt noch anfassen durfte. Die Distanz, die sie zu ihm aufbaute – im festen Glauben, ihn dadurch zu schützen –, belastete sie sehr. Einige Monate später bekam sie eine Bronchitis, und der sie behandelnde Arzt bestand darauf, den HIV-Test zu wiederholen. ›Was soll’s?‹, dachte sie sich.
Diesmal war das Ergebnis negativ, war sie also gar nicht infiziert? Daraufhin wurde Susans ursprüngliche Blutprobe noch einmal überprüft, und siehe da: Auch diesmal war das Resultat negativ. Was war geschehen? Als man beim ersten Mal die Daten in den Computer der Klinik im US-Bundesstaat Virginia eingegeben hatte, wurde offenbar das Ergebnis ihrer Blutprobe mit dem eines anderen Patienten verwechselt, der wirklich HIV-positiv war. Dieser gravierende Fehler stürzte nicht nur Susan grundlos in tiefe Verzweiflung, sondern wiegte den anderen Patienten in trügerischer Sicherheit.
Die Tatsache, dass ein HIV-Test ein falsch-positives Ergebnis haben kann, war für Susan völlig neu. Keiner der Verantwortlichen hatte sie je darüber informiert, dass den Labors, die an jeder Blutprobe zwei HIV-Tests durchführen (den ELISA- und den Western-Blot-Test), gelegentlich Fehler unterlaufen können. Stattdessen wurde ihr mehrfach gesagt, dass die Ergebnisse der HIV-Tests unumstößlich seien. Der erste Test könne zwar falsch-positiv ausfallen, aber weil in ihrem Fall der zweite, der »Bestätigungstest«, ebenfalls positiv gewesen sei, stehe die Diagnose absolut fest.
Als ihr Leidensweg schließlich endete, hatte Susan neun Monate lang unter dem Damoklesschwert einer niederschmetternden Diagnose gelebt, nur weil ihre Ärzte zu Unrecht glaubten, die HIV-Tests seien fehlerlos. Sie verklagte die Ärzte, weil diese ihr eine Illusion der Gewissheit gaben, unter der sie leiden musste. Schließlich wurde ihr eine großzügige Entschädigung zugesprochen, von der sie ein Haus kaufen konnte. Sie hörte zudem auf, Drogen zu nehmen, und wandte sich der Religion zu. Der Albtraum hatte ihr Leben völlig verändert.
Nebenwirkungen
Ein Psychiater, mit dem ich befreundet bin, verschreibt depressiven Patienten regelmäßig das Arzneimittel Prozac. Dieses hat, wie so viele Medikamente, gewisse Nebenwirkungen. Mein Freund informierte die betreffenden Patienten darüber, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 bis 50 Prozent sexuelle Probleme auftreten können, wie Impotenz und mangelnde Libido. Als sie das hörten, waren viele Patienten doch leicht beunruhigt. Sie stellten jedoch keine weiteren Fragen, was den Psychiater schon immer verwundert hatte. Nachdem er von dem Inhalt dieses Buches erfahren hatte, informierte er auf andere Weise über die Risiken. Nun sagte er den Patienten, dass bei drei bis fünf von zehn Menschen, die Prozac einnehmen, sexuelle Probleme auftreten. Mathematisch gesehen entsprechen diese Zahlen genau den Prozenten, die er zuvor mitgeteilt hatte, psychologisch aber wirken sie ganz anders. Die Patienten, denen er die Häufigkeiten der unerwünschten Nebenwirkungen anstatt der Prozente genannt hatte, waren viel weniger beunruhigt – und sie stellten Fragen, etwa die, was sie machen sollten, wenn sie zu ebenjenen drei bis fünf Patienten gehörten. Erst da wurde dem Psychiater klar, dass er nie nachgefragt hatte, was für die Patienten eine »Wahrscheinlichkeit von 30 bis 50 Prozent« bedeutete. Wie er schließlich herausfand, hatten viele von ihnen gedacht, in 30 bis 50 Prozent ihrer sexuellen Aktivitäten würden sich Störungen einstellen. Jahrelang hatte mein Freund einfach nicht bemerkt, dass das, was er eigentlich sagen wollte, nicht das war, was seine Patienten verstanden.
Das erste Mammogramm
Frauen über 40 empfiehlt der Gynäkologe normalerweise, jedes zweite Jahr eine Mammographie machen zu lassen. Denken Sie an eine Freundin, die keine Symptome hat, welche auf Brustkrebs hinweisen, und in deren Familie die Erkrankung noch nie aufgetreten ist. Auf den Rat ihres Arztes hin lässt Ihre Freundin also erstmals ein Mammogramm aufnehmen. Das Ergebnis ist positiv – es liegt also Verdacht auf einen sich entwickelnden Tumor vor. Sie bricht in Tränen aus, und Sie versuchen, sie zu trösten und zu beruhigen. Dabei überlegen Sie, was dieses positive Testergebnis eigentlich bedeutet. Hat Ihre Freundin ganz sicher Brustkrebs, oder beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür 99 Prozent, 95 Prozent, 90 Prozent oder vielleicht gar nur 50 Prozent, oder ist sie womöglich noch geringer?
Ich gebe Ihnen nun die Informationen, die Sie zum Beantworten dieser Frage brauchen. Allerdings tue ich dies auf zwei unterschiedliche Arten: zuerst in der Form von Wahrscheinlichkeiten, wie es in medizinischen Lehrbüchern üblich ist.[1] Machen Sie sich nichts daraus, wenn Sie gleich verwirrt sein werden – vielen, wenn nicht den meisten Leuten ergeht es nicht anders, und ebendas soll diese Demonstration deutlich machen. Danach gebe ich die gleichen Informationen nochmals, allerdings in einer Form, die Ihre Verwirrung in Einsicht verwandelt. Sind Sie bereit?
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau Anfang 40 Brustkrebs hat, beträgt ungefähr 1 Prozent. Wenn sie Brustkrebs hat, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Mammogramm positiv ist, bei 90 Prozent. Wenn sie keinen Brustkrebs hat, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit 9 Prozent, dass der Test dennoch positiv ausfällt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit also hat eine Frau, deren Mammogramm positiv ist, tatsächlich Brustkrebs?
Viele Leser werden keine Antwort sehen, sondern nur »Nebel«. Lassen Sie den Nebel einen Moment auf sich einwirken und fühlen Sie die Verwirrung. Viele, denen diese Frage gestellt wird, werden sagen, dass Ihre Freundin mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 90 Prozent Brustkrebs hat, denn ihr Mammogramm war ja positiv. Sie sind sich freilich nicht sicher, denn sie wissen nicht genau, welchen Schluss man aus den genannten Prozenten ziehen sollte. Nun gebe ich Ihnen noch einmal genau die gleichen Informationen, nur diesmal nicht in Form von Wahrscheinlichkeiten, sondern in Form natürlicher Häufigkeiten:
Stellen Sie sich 100 Frauen vor. Eine von ihnen hat Brustkrebs, und ihr Mammogramm wird wahrscheinlich positiv ausfallen. Von den übrigen 99 Frauen, die keinen Brustkrebs haben, werden 9 ebenfalls positiv getestet; also sind insgesamt 10 Mammogramme positiv. Wie viele von den insgesamt 10 positiv getesteten Frauen haben tatsächlich Brustkrebs?
Jetzt ist es leicht: Nur eine von den 10 Frauen mit positivem Mammogramm hat Brustkrebs. Also beträgt die Wahrscheinlichkeit, nach der eben gefragt wurde, nicht 90 Prozent und auch nicht 50 Prozent, sondern nur rund 10 Prozent! Jetzt hat sich der Nebel verzogen, und der Weg zur Lösung ist klar. Ein positives Mammogramm ist zweifellos keine gute Nachricht. Aber mit den natürlichen Häufigkeiten erkennt man ohne weiteres, dass die Mehrzahl der Frauen, bei denen der Test positiv ausfällt, gar keinen Brustkrebs hat.
Genetische Fingerabdrücke
Stellen Sie sich vor, Sie seien des Mordes angeklagt und stünden nun vor Gericht. Es gibt nur ein einziges Beweisstück gegen Sie – aber das hat es in sich: Ihr genetischer Fingerabdruck, das heißt Ihr DNA-Profil, stimmt mit dem einer Spur überein, die am Opfer gefunden wurde. Was bedeutet diese Übereinstimmung? Das Gericht beruft einen Sachverständigen, und dieser sagt Folgendes aus:
»Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Übereinstimmung zufällig zu Stande kam, liegt bei 1 zu 100.000.«
Sie sehen sich schon hinter Gittern. Jedoch – stellen wir uns vor, der Sachverständige drückt den gleichen Sachverhalt anders aus:
»Unter jeweils hunderttausend Menschen wird sich bei einem eine Übereinstimmung zeigen.«
Diese Formulierung legt uns nahe zu fragen, wie viele Menschen es wohl gibt, die als Mörder in Frage kämen. Wenn Sie in einer Großstadt mit einer Million erwachsenen Einwohnern leben, dürfte es demnach zehn Einwohner geben, deren DNA-Profil mit dem der Spur am Opfer übereinstimmt. Diese Tatsache allein würde Sie kaum ins Gefängnis bringen.
TECHNIK BRAUCHT PSYCHOLOGIE
Susans eingangs beschriebener Leidensweg veranschaulicht die Illusion der Gewissheit; bei der Prozac-Geschichte und dem DNA-Test geht es um die Kommunikation von Risiken; und das Mammogramm-Szenario handelt von Schlussfolgerungen aus Zahlen. Dieses Buch vermittelt das Einmaleins des »Klardenkens«, das einem dabei helfen kann, in derartigen Situationen die Unsicherheiten zu erkennen und sie in angemessener Form anderen mitzuteilen.
Eine ganz einfache Regel ist das, was ich »Franklins Gesetz« nenne: Nichts ist gewiss, außer dem Tod und den Steuern.[2] Hätten Susan und ihre Ärzte diese Regel in der Schule gelernt, dann hätten sie wohl gleich einen zweiten HIV-Test mit einer anderen Blutprobe verlangt, der Susan höchstwahrscheinlich den Albtraum erspart hätte, mit der Diagnose »HIV-positiv« leben zu müssen. Das soll aber nicht heißen, dass das Ergebnis eines zweiten Tests völlig sicher gewesen wäre. Da der Fehler in der Verwechslung von zwei Testergebnissen bestand, hätte ein zweiter Test das ziemlich sicher enthüllt, wie es später ja auch geschah. Wäre der Fehler aber auf Antikörper zurückzuführen gewesen, die HIV-Antikörper im Blut vortäuschen, dann hätte der zweite Test wohl den ersten bestätigt. Wie auch immer das Risiko eines Irrtums aussieht – es liegt in der Verantwortung der Ärzte, die Patienten darüber zu informieren, dass die Testergebnisse nicht völlig sicher sind. Leider ist Susans Fall keine Ausnahme. In diesem Buch werden uns Mediziner, Juristen und andere Experten begegnen, die der Öffentlichkeit fortgesetzt weismachen, HIV-Tests, genetische Fingerabdrücke und andere moderne Methoden seien »wasserdicht«, und damit basta.
Franklins Gesetz hilft uns, die Illusion der Gewissheit zu überwinden, denn es macht uns bewusst, dass wir sozusagen in einem Zwielicht der Ungewissheit leben. Es sagt uns aber nicht, wie wir einen Schritt weiterkommen und mit dem Risiko umgehen können. Ein solcher Schritt ist allerdings in der Prozac-Geschichte aufgezeigt, die eine Regel nahe legt, mit deren Hilfe die Menschen Risiken besser verstehen können: Wenn man über Risiken nachdenkt oder spricht, sollte man nicht Wahrscheinlichkeiten, sondern Häufigkeiten verwenden. Wie wir noch sehen werden, können Häufigkeiten die Information über Risiken aus mehreren Gründen erleichtern. Bei der Aussage des Psychiaters, dass »mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 bis 50 Prozent sexuelle Probleme auftreten können«, bleibt die Bezugsmenge unklar: Bezieht sich der Prozentsatz auf eine Menge von Menschen (nämlich Patienten, die Prozac einnehmen) oder auf eine Menge von Ereignissen (der sexuellen Aktivitäten einer bestimmten Person) oder auf irgendeine andere Menge? Für den Psychiater war es klar, dass sich die Aussage auf seine Patienten bezog, die Prozac einnehmen, während seine Patienten glaubten, sie beziehe sich auf ihre sexuellen Aktivitäten. Dagegen wird bei der Angabe von Häufigkeiten – beispielsweise: »drei von zehn Patienten« – die Bezugsmenge sofort klar, und die Gefahr von Missverständnissen ist deutlich geringer.
Mein Anliegen ist es, einfache und leicht verständliche Regeln des Klardenkens zu vermitteln, die uns allen dabei helfen können, uns in den unzähligen Ungewissheiten in unserer modernen, von der Technik dominierten Welt zurechtzufinden. Die beste Technik ist kaum etwas wert, wenn die Menschen nicht verstehen, was ihre Produkte und Ergebnisse wirklich bedeuten.
[1] Die Details werden in Kapitel 5 näher erläutert.
[2] Franklin (1987). In einem Brief vom November 1789 schrieb Benjamin Franklin einmal: »Unsere Verfassung ist inzwischen in Kraft; alles deutet darauf hin, dass sie Bestand haben wird; aber in dieser Welt ist nichts gewiss, außer dem Tod und den Steuern.« Es war der Vorabend der Französischen Revolution. Franklin, der am Entwurf der US-amerikanischen Verfassung beteiligt war, genoss in Frankreich einigen Ruhm, weil er die ungekünstelte Vornehmheit der Neuen Welt verkörperte. Sein Porträt zierte mancherlei Gegenstände, von der Schnupftabakdose bis zum Nachtgeschirr.
Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Immanuel Kant
2. DIE ILLUSION DER GEWISSHEIT
Gewissheit zu erlangen, ist offenbar ein grundlegendes Bestreben des menschlichen Geistes.[1] Unsere visuelle Wahrnehmung spiegelt diese Tendenz wider. Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, erzeugt unsere Wahrnehmung aus Ungewissheit automatisch Gewissheit. Das zeigen beispielhaft Täuschungen und Zweideutigkeiten im räumlichen Sehen. Beim so genannten Necker-Würfel (Abbildung 2.1) legen die zweidimensionalen Linien der Zeichnung nicht fest, ob eine Fläche des Würfels aus der Zeichenebene nach vorn oder nach hinten herausragt. Wenn Sie die Zeichnung betrachten, nehmen Sie aber keine Zweideutigkeit wahr: Sie sehen entweder den einen oder den anderen Würfel. Nach einigen Sekunden (oder wenn Sie die Zeichnung umdrehen) bemerken Sie plötzlich ein Umkippen der Gestalt – das bedeutet, Sie sehen nun den anderen Würfel, aber wiederum eindeutig.
Abbildung 2.1: Der Necker-Würfel. Wenn man die Abbildung fixiert oder sie umdreht, kann der räumliche Eindruck zwischen zwei Würfeln »umkippen«; der eine Würfel ragt aus der Zeichenebene nach vorn heraus, der andere nach hinten.
Bei Roger Shepards zwei Tischen (Abbildung 2.2) wird eine Täuschung über die räumliche Tiefe provoziert. Diese Abbildung zeigt, wie unsere Wahrnehmung aus recht unsicheren Hinweisen ein einziges, eindeutiges Bild erzeugt. Vermutlich halten Sie den linken Tisch für länglicher als den rechten. Tatsächlich haben beide Tischplatten aber nicht nur genau die gleiche Fläche, sondern auch dieselbe Form. Das können Sie überprüfen, indem Sie auf einem dünnen Blatt Papier einen der beiden Umrisse durchzeichnen und auf die andere Zeichnung legen. Ich zeigte diese beiden Tische einmal bei einem Vortrag vor Ärzten, die ich dazu bringen wollte, das Gefühl von Gewissheit (»oft falsch, aber niemals im Zweifel«) zu hinterfragen. Einer der Zuhörer bestritt rundheraus, dass die Flächen gleich seien. Ich fragte ihn, um wie viel er wetten wolle, und er bot 250 Euro. Am Ende meines Vortrags war er allerdings verschwunden.
Abbildung 2.2: Die gedrehten Tische. Die beiden Tischplatten sind in Größe und Form völlig gleich. Diese Täuschung wurde von Roger Shepard im Jahr 1990 gezeichnet (siehe Shepard, 1992). Mit freundlicher Genehmigung von W. H. Freeman and Company.
Was geht in unserem Gehirn beim Betrachten einer solchen Zeichnung vor sich? Wenn irgend möglich, konstruiert die menschliche Wahrnehmung aus unvollständigen Informationen – hier aus einer zweidimensionalen Zeichnung – unbewusst dreidimensionale Gegenstände. Betrachten wir noch einmal die Längskanten der beiden Tischplatten. Deren Abbildungen oder Projektionen auf der Netzhaut haben, wie wir ja nun wissen, die gleiche Länge. Die in der Perspektive der Zeichnungen enthaltenen Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass die längere Kante der linken Tischplatte sich nach hinten erstreckt, die der rechten Tischplatte aber nicht (für die kürzeren Kanten gilt das Umgekehrte). Unser Wahrnehmungssystem nimmt offensichtlich an, dass eine Linie, die sich in die Tiefe erstreckt, in der dreidimensionalen Wirklichkeit länger ist als eine gleich lange Linie, die sich nicht in die Tiefe erstreckt – und korrigiert das, was wir sehen, entsprechend. Und genau das führt dazu, dass der linke Tisch länglicher und schmaler erscheint.
Wir müssen aber bedenken, dass nicht unser Sinnesorgan, sondern unsere bewusste Erfahrung einer trügerischen Gewissheit zum Opfer fällt. Das Sinnesorgan nimmt unvollständige und zweideutige Informationen auf, die im Gehirn analysiert werden, und dieses »verkauft« unserem Bewusstsein seine wahrscheinlichste Vermutung als definitives Ergebnis. Schlussfolgerungen hinsichtlich räumlicher Tiefe, Länge und Ausrichtung werden von neuronalen Mechanismen sozusagen automatisch geliefert. Das bedeutet, dass auch die Einsicht in das Zustandekommen der Illusion diese praktisch nicht außer Kraft setzen kann. Schauen wir noch einmal auf die Zeichnung: Immer noch scheinen beide Tischplatten unterschiedliche Formen zu haben. Auch wenn man versteht, was geschieht, gibt das Unbewusste weiterhin die gleiche Wahrnehmung an den bewussten Verstand weiter. Hermann von Helmholtz, einer der bedeutendsten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, prägte den Begriff der »unbewussten Schlussfolgerung«, um auszudrücken, dass die Wahrnehmung sozusagen mit Folgerungen und Vermutungen arbeitet. Die Illusion der Gewissheit wird schon bei unseren elementarsten Erfahrungen mit der Wahrnehmung von Flächen und Formen offensichtlich. Die direkte Erfahrung ist jedoch nicht die einzige Art von Überzeugung, bei der Gewissheit »künstlich« erzeugt wird.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!